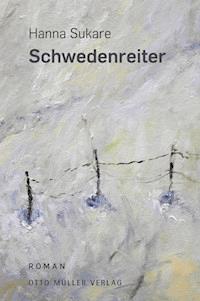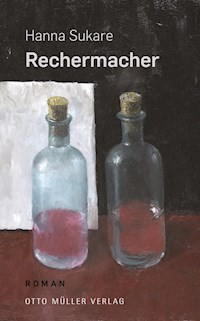
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Otto Müller Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
"Die Wahrheit ist eine Zumutung", heißt es am Ende dieses Romans, dessen Figuren mit ihren Wahrheiten hadern. Es gibt jene, die nichts wissen, und andere, die nicht sprechen wollen. Nelli wagt es irgendwann, an den Tabus ihrer Herkunftsfamilie zu rütteln, nachdem sich die Unkenntnis über ihre Ahnen "wie eine Schleppe aus Blei" auf ihr Leben gelegt hat. Verstörend und farbenreich zugleich sind die Geschichten, die Hanna Sukare rund um Nellis Großvater August Rechermacher webt. Weit ausholend umspannen sie viele Jahre europäischer Historie. August führt uns Anfang des 20. Jahrhunderts ins "Grasland" des Salzburger Flachgaus, später in die Kasernen des Bundesheeres und der Wehrmacht. Ist er als Soldat zum Täter geworden?, fragen sich Nelli und ihre Tochter. Sie leben und suchen in Heidelberg, England, Wien und immer wieder Salzburg, das als "Scharnier" die Erzählung zusammenhält. Mit der Familiengeschichte des Dragoners Rechermacher legt Hanna Sukare den dritten Band ihrer Trilogie der Suche vor. Erneut gelingt der Wiener Autorin eine poetische, kraftvolle Geschichte zwischen Fiktion und Fakten. "Rechermacher" ist ein Roman gegen den Krieg und für den Frieden, gegen das Vergessen und für die Zumutung des Erinnerns.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 263
Ähnliche
Hanna Sukare
RECHERMACHER
Hanna Sukare
RECHERMACHER
Roman
OTTO MÜLLER VERLAG
Die Drucklegung dieses Buches wurde gefördert durch die Kulturabteilungen von Stadt und Land Salzburg sowie Wien.
www.omvs.at
ISBN 978-3-7013-1296-6
eISBN 978-3-7013-6296-7
© 2022 OTTO MÜLLER VERLAG SALZBURG-WIEN
Alle Rechte vorbehalten.
Lektorat: Christine Rechberger
Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT
Druck und Bindung: Finidr s.r.o., Český Těšín
Umschlaggestaltung: Ursula Meyer
Coverbild: Hubert Dietrich:
Zwei Flaschen, Öl auf Holz, um 2003
Inhalt
Das Personal
Süßes Nichts
Im Grasland
Rote Punkte
Sag Semmerl
Schleppe Blei
Der Beistrich
Salz, ach
It’s just a shot away
Die Zumutung
Quellen
Dank an
Das Personal
August Rechermacher, Sohn aus der dritten Ehe des Viktualienhändlers, Vater des August Johann Schwaigerl
Genoveva Schwaigerl, genannt Vevi, Mutter des August Johann Schwaigerl
August Johann Schwaigerl, Sohn der Genoveva Schwaigerl und des August Rechermacher, in seiner Jugend wird er Hans genannt, später Gustl oder August
Cornelia, genannt Nelli, Tochter des August Johann Schwaigerl
Maia, Tochter der Nelli Schwaigerl
Lotte, Freundin der Nelli Schwaigerl
Stephen, ein Freund der Nelli Schwaigerl
Walli, Lebensgefährtin des August Rechermacher
Marie, Lebensgefährtin des August Rechermacher
Die Pfeifenraucherin, August Rechermachers Mutter
Der Viktualienhändler, August Rechermachers Vater
Hans und Ferdl, Söhne aus der ersten Ehe des Viktualienhändlers Rechermacher
Nanni, Tochter aus der zweiten Ehe des Viktualienhändlers Rechermacher
Fred, ein Soldat der US Army
sowie weitere Nebenfiguren
Süßes Nichts
Er steht im Schatten der Birken beim Marshmallow-Fest. Er trägt die Uniform der US Army. Freiwillig hat er sich als Starter des Sackhüpfens gemeldet. Die Hüpfbahn liegt ein wenig abseits des Geschiebes auf den trubligen Feststraßen. Von den MarshmallowGrills zieht Süßliches herüber und erstickt Schwade um Schwade den fein harzigen Duft der Birken. Die Bekräftigung der deutsch-amerikanischen Freundschaft ist Grund und Kern dieses Festes, das Mädchen erwärmt sich eher für das Süße Nichts – mit Gelatine und Maisstärke aufgebauschter Zucker. Die Kinder der GIs bekommen die Marshmallows im PX des PHV, wann immer die Mütter einen Kauf genehmigen. Die GI-Kinder würdigen die festliche MarshmallowGrillerei nun keines Blickes, verpassen, wie der heiße Zucker in weißen Schlieren von den langen Holzspießen tropft und die Grillroste braun verklebt. Auch später, bei der Tombola, wird kein GI-Kind auf den Hauptpreis Wert legen: eine Tüte Rohware Marshmallows. Das Mädchen könnte sie roh aus der Tüte essen, mit Schokolade überziehen oder zwischen Kekse stecken und backen, das Mädchen gewinnt den Preis jedoch nicht. Die GI-Kinder steuern auf einen Glaskäfig zu, in dem Maiskörner tanzen, an die Scheiben schlagen, auf den Käfigboden fallen, aufwirbeln und weitertanzen, bis sie weiß und puffig verkauft werden.
21 Jahre zuvor waren die Soldaten der nordamerikanischen Armee nach Heidelberg gekommen. Sie hatten dem MordenfürGroßdeutschland ein Ende gesetzt. Mitgebracht hatten sie neben schweren Waffen und Fahrzeugen auch ihre Abkürzungen: USFET zuerst, für United States Forces European Theater, später USEUCOM für United States European Command undimmersoweiter. Gleich welchen Rang die Amerikaner hatten, Westdeutsche nannten jeden Soldaten der nordamerikanischen Armee GI. Keiner der Gäste des MarshmallowFests könnte mehr sagen, wofür die beiden Buchstaben stehen. Angeblich hatten sie beim Galvanized Iron, dem verzinkten Eisen, ihren Bedeutungsbeginn. Mit den Abkürzungen brachten die GIs ihre Autos. Die Nummernschilder glichen Codes: 3C-53019, der Herkunftsort des Fahrzeugs war nicht zu enträtseln, der Schriftzug unter der Nummer verwies auf die Institution, der es gehörte: US Forces in Germany. Was US bedeutete, wusste in Heidelberg jedes Kind: Das sind die Amis. Die befestigten oberhalb ihrer Nummernschilder gern Werbungen auf Blech. Das Mädchen las vom Heck eines Dodge Coronet die Frohbotschaft Jesus Saves! Doch in der Unterzeile kam schon die bange Frage: Are YOU saved?
Nach den Autos brachten die Soldaten ihre Frauen und die Kinder nach Heidelberg. Sie brauchten Wohnungen, denn die Heidelberger protestierten längst schon gegen das Beschlagnahmen ihrer Häuser. Also bauten die US Forces in Germany: Die Felder südwestlich des Heidelberger Zentrums verwandelten sich in das Patrick Henry Village und das Dorf wurde abgekürzt: PHV. Zwischen Saratoga Drive und Bull Run Court – alle Straßennamen erinnerten an Amerikas große Schlachten – wohnten bald mehr als tausend Soldatenfamilien und einige hundert junggesellige GIs. Im Patrick Henry Village standen dreistöckige Wohnblocks für einfache Soldaten, Einfamilienhäuser für Offiziere, da waren Schulen, Sportplätze, Geschäfte, Klubs, ein Hotel, das Kino, Kirche, Kindergarten, die Bibliothek und der PX, das bedeutet Post Exchange. Dieser Laden bot – ausschließlich für amerikanische Kundschaft – viele der Waren, die zu der Zeit jeder Drugstore in den USA führte.
Das Mädchen kam an Marshmallows nur im Patrick Henry Village und nur beim MarshmallowFest. Während des übrigen Jahres besuchte sie die amerikanische Kleinstadt zwischen den deutschen Feldern nicht, zu weit war der Weg aus dem Zentrum, und sie hatte dort draußen keine Freundschaften, die GI-Kinder gingen in die amerikanischen Schulen. Einmal durfte sie mit ihrer Klasse an einem Fest in einer amerikanischen Schule teilnehmen. In blau-weißen Uniformen gingen die GI-Kinder im Gänsemarsch hinter einem fahnenschwenkenden Buben auf die Bühne, stellten sich oben im Halbkreis um die Fahne, legten die Hände ungefähr auf die Herzen und sagten gemeinsam: I pledge allegiance to the Flag of the United States of America and to the Republic for which it stands, one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Wie ein Gebet tönte das von der Bühne, würdevoll und ein wenig einschüchternd. Jemand übersetzte die Worte der Kinder unter der Fahne. Das Mädchen erfuhr, man könne einer Fahne die Treue halten, aber sie wusste nicht, wie man das machte.
Der Mann in der Uniform bei den Birken ist erst seit Kurzem wieder, doch schon zum dritten Mal in Heidelberg stationiert. 1945, als er zum ersten Mal in die Stadt kam, hatte er in einem beschlagnahmten Hotel gewohnt. Als er zehn Jahre später wieder an den Neckar versetzt wurde, war das Hotel den ursprünglichen Besitzern zurückgegeben und er wohnte in dem südlichen Stadtteil Rohrbach in der ehemaligen Großdeutschland-Kaserne, die unter den Amis Campbell Barracks hieß. Diesmal hatte er ein Zimmer, ein Einzelzimmer sogar, im Patrick Henry Village bekommen. Dort lebte er nun, die Birken waren kräftig gewachsen.
Das Patrick Henry Village ist ein Durchhaus, jeden Sommer kommen die Lastwagen der Umzugsfirmen, das Lebenszubehör der Soldaten und ihrer Familien wird aus den Häusern hinaus- oder in sie hineingetragen, länger als zwei, drei Jahre lebt kaum jemand hier. Der Soldat bei den Birken hofft, in dieser Garnison bleiben zu dürfen, er will nicht noch einmal in einen Krieg.
Die hochgenabelten Schilde naheten dichtgedrängt und umher stieß lautes Getös auf. Jetzo erscholl Wehklagen und Siegesgeschrei miteinander. Würgender dort und Erwürgter, und Blut umströmte die Erde. Ähnlich den Wölfen sprangen sie wild aneinander und Mann für Mann sich erwürgend.
Ilias, 4. Gesang
Das Mädchen läuft mit ein paar Kindern auf die Birken zu. Sie haben das Schild zwischen den Bäumen entdeckt: Sackhupfen. Die Kinder verstehen auch ohne ü-Punkte. Der Mann in der Uniform deutet auf einen Haufen Säcke: Donated From The People Of The United States, Net Weight 100 lbs – ungefähr 45 Kilo Mehl fasste ein Sack – Use No Hooks, die Buchstaben verblassen. Auf der Uniform des Mannes steht über der rechten Brusttasche ein Name auf dunklem Grund. Über dem Herzen ziert ein kleines Patchwork die Uniform – schmale bunte Rechtecke, ob aus Stoff oder Metall lässt sich aus der Entfernung nicht erkennen, ein Militärmosaik. Die Kinder schnappen die Säcke, schütteln sie zurecht, jedes wurschtelt sich in einen hinein, sieben dürfen gleichzeitig an den Start, die Kinder ziehen die Säcke hinauf über die Nabel, raffen den Stoff, damit sich die Beine nicht verheddern. Das Sackhüpfen ist gratis. Um einen MarshmallowSpieß muss das Mädchen bitten, sie besitzt kein Geld, und oft freut sie sich jetzt an dem Gedanken, dass sogar sie möglicherweise einmal erwachsen sein wird. Falls diese unsichere Zukunftshoffnung einträfe, dann würde das Mädchen sich das Süße von niemandem mehr vorenthalten lassen.
Das Mädchen steht neben den anderen Kindern an der Startlinie, zappelig, schwitzig in den Händen hält sie den Atem an, fiebert dem Signal des Mannes in der Uniform entgegen. Er wird beide Arme über seinen Kopf heben, die Handflächen aneinanderlegen, sie dann schnell öffnen, und während seine Hände einmal gegeneinanderklatschen, wird er rufen: Auf die Platze. Faahtik. Go. Das Mädchen darf das Go nicht überhören, muss das Go heraushören zwischen dem Lärmen und Lachen der Festgäste, muss das Go erhaschen, nicht zu früh und nicht zu spät, aus dem Quietschen des Karussells, zwischen den Trillerpfiffen, mit denen einer Luftballons anpreist und den Rufen – Go! – der Losverkäufer. Da ist es. Schnell den Sack noch enger an den Bauch gerafft, damit ja der erste Hupf gelingt. Da verhüpft sich ein Nachbar, kommt in die Quere, schwankt, sinkt zur Seite und die Sechs sinken mit wie Dominosteine. Fehlstart. Mütterhände sind da, greifen manchen Hüpfern unter die Achseln, wollen aufhelfen. Zurück an die Startlinie, der zweite Versuch gelingt, staksig rucken die Sieben ihre Säcke voran, manchmal gelingt ein Hupf, ein Satz, und dort am Ende der Hüpfbahn fällt schon einer ins sandige Ziel.
Wer ist der Mann, der das Signal zum Start des Sackhupfens gibt? Woher kommt er? Was tut er in dieser Garnison? Warum überhaupt sind die Soldaten hier? Danach fragt kein Mädchen.
Wie der Sackhupfstarter im Patrick Henry Village lebt auch das Mädchen noch nicht lange in Heidelberg. Sie hat noch keine deutschen und noch keine amerikanischen Freundschaften. Im Jahr zuvor ist sie mit ihren Eltern aus dem Dorf gekommen. Wie der Soldat nicht gefragt worden war, ob er noch einmal nach Heidelberg versetzt werden wolle, hatte man auch das Mädchen nicht gefragt, ob sie weg aus dem Dorf und in die Stadt wolle. Zu einer Stadt schienen Soldaten mit anderen Sprachen zu gehören wie Straßenbahnen. Die dunkle Haut mancher Soldaten und mancher Kinder in der Stadt fiel dem Mädchen auf, solch dunkle Haut hatte sie im Dorf nicht gesehen.
An ihrem ersten Schultag in Heidelberg kommt sie in ein Klassenzimmer, das ein kleines Haus mit schrägem Dach ist. Jede Klasse hat hier ihr eigenes Haus und davor einen Hof, den sich zwei Klassen teilen. Der Lehrer ist groß, hat viel dunkles Haar und sein Anzug schlottert ein wenig an ihm. Er nimmt das Mädchen an der Hand und führt sie hinaus auf den Hof. Dort zeigt er ihr die Beete, Blumen wachsen darin, Salate. Wenn sie wolle, sagt er, könne sie dort auch etwas pflanzen, ob sie Radieschen möge? Das Mädchen sieht die Beete, und die Beete im Dorf, aus dem sie kommt, fallen ihr ein. Weil der Lehrer sie an der Hand genommen und ihr die Beete gezeigt hat, vertraut sie ihm. Sie glaubt, er wäre Pestalozzi, nach dem diese Schule heißt. Hat das Mädchen sich einmal eine Vorstellung gemacht, braucht sie lange, bis sie das äußere Wirkliche zulässt und endlich anerkennt statt der selbstgemachten Vorstellung.
Eines Tages führt der Lehrer die Klasse in ein weitläufiges Haus, dessen Wände aus Glas sind. Drinnen erwartet sie eine Frau, die sich als eine der Bibliothekarinnen der neuen Stadtbücherei vorstellt. Die Frau führt sie zu Regalen, in denen die Bücher für Kinder stehen, zeigt ihnen einige ihrer Lieblingsbücher. Die Kinder können in die Stadtbücherei kommen, wann immer sie geöffnet ist, sie dürfen allein kommen, alle Bücher anschauen und ausleihen, sie können aber auch nur zum Lesen kommen. Das Mädchen denkt an den vergangenen Winter, als es im Baumhaus zu kalt war. Das helle Glashaus wird ein Winterort, der sie von außen und innen wärmt. Ihr Pestalozzi und das helle Glashaus kommen dem Mädchen manchmal nachmittags in den Sinn, wenn sie die Rollschuhe anzieht. Sie läuft dann zu einem Parkplatz in der Nähe ihres Wohnhauses, gewinnt leicht gebückt mit kurzen schnellen Schritten auf der elliptischen Bahn rund um die abgestellten Autos an Tempo, zieht Runde um Runde, bis sie schließlich aufgerichtet, mit ausgebreiteten Armen aus dem Lauf gleitet.
Dies ist der zweite Mai des Mädchens in Heidelberg und ihr erstes MarshmallowFest, vielleicht wird es ihr einziges bleiben. In ein paar Wochen muss sie ihren Pestalozzi verlassen. Wie das Patrick Henry Village ist ihr Leben ein Durchhaus. Nach den Sommerferien wird das Mädchen ins Gymnasium am Neckar kommen. Stockblutbraun ist das große Haus, wie die alte Neckarbrücke aus dem Sandstein der Gegend gebaut und benannt nach einem Wittelsbacher Kurfürsten, der den Beinamen Der Weise trug. Dem Mädchen sind fürs Gymnasium neue Schuhe versprochen, die sie sich selbst aussuchen darf. Das Schuhgeschäft ist in der Hauptstraße, das Mädchen wählt einen knöchelhohen Halbschuh aus sandfarbenem Wildleder, zieht ihn an, schnürt zu, er passt wie ein Hausschuh. Die nehm ich, sagt sie. Probier mal die, sagt die Blutsverwandte, zieht ihr den sandfarbenen Schuh vom Fuß und drückt den in einen schwarzen Lackschuh mit Riemchen und flachem Absatz, dieses Modell wird seit Jahr und Tag für das Mädchen gewählt. Die nehmen wir, sagt die Blutsverwandte. Die Verkäuferin ist jung und betrachtet das Mädchen mitleidig. Das Mädchen schämt sich für den mitleidigen Blick und für die Blutsverwandte, wie sie sich schon im Dorf für sie geschämt hat, wenn sie mit ihr im Bus in die Stadt unterwegs war. Das Mädchen fürchtete, die Blutsverwandte könnte ein Wort sagen, dann wüssten alle im Bus, dass die Blutsverwandte anders und von woanders her war. Sie hatte eine andere Frisur als die Frauen im Bus und sie schien dem Mädchen viel älter als die Mütter, die mit ihren Töchtern in die Stadt fuhren. Manchmal hielt man ihre Blutsverwandte für ihre Oma. Im Bus versuchte das Mädchen so zu tun, als gehöre sie nicht zu der Frau, die ihre Blutsverwandte ist. Hier in dem Schuhgeschäft ist das nicht möglich, schon geht die Blutsverwandte zur Kasse und zahlt die schwarzen Lackschuhe.
An dem ersten Schultag am Neckar ist das Mädchen eine von vielen Sextanerinnen und Sextanern, in dem Gewusel fallen zwei schwarze lackige Schuhe nicht auf. Der Klassenraum und seine Fenster sind hoch, im Dorf war nur der Innenraum der Kirche höher gewesen, dunkelbraunes Holz ist da, ein Lehrer, oder stand da an diesem ersten Tag eine Lehrerin? Der oder die scheinen weit entfernt von dem Mädchen. Fragen der Lehrperson beantwortet das Mädchen so knapp wie möglich. Über der Tafel hängt ein Plakat, das einen muskulösen Mann in Badehose zeigt, er stemmt die Fäuste in die Taille. Das Mädchen starrt das Plakat an und kann sich nicht erklären, warum es hier hängt, schief angeklebt. An diesem ersten Tag spricht sie mit keinem anderen Kind in der Klasse. Für jedes Fach kommen andere Lehrerinnen oder Lehrer herein. Einer trägt einen hellen Anzug. Ab und zu unterbricht er seinen Vortrag über das Imperium Romanum, wendet sich zur Tafel, zieht ein flaches metalliges Fläschchen aus seinem Sakko, dreht den Verschluss auf, neigt den Kopf ein wenig zurück, nimmt einen Schluck, dreht zu, steckt ein, wendet sich wieder zur Klasse. Diese Schlucke sind dem Mädchen etwas unheimlich. Der Lehrer muss eine Krankheit haben. Das Mädchen schaut aus dem Fenster, sobald er sich zur Tafel wendet. Puella, puellae, wozu ein Mädchen deklinieren, das man nicht einmal kennt? Das Gymnasium am Neckar unterrichtet Latein ab der ersten Klasse. Ihr Pestalozzi hatte gesagt, die Kurfürstenschule sei die richtige für sie, weil diese Schule auf die Universität vorbereite. Er hatte nicht gesagt, dass die Heimatkunde in der Kurfürstenschule Geographie heißen und ein Hauptwort dort ein Substantiv sein werde. Er hatte nicht gesagt, dass in der Kurfürstenschule viele Worte, die Dinge und alle Menschen fremd sein würden. Um das Mädchen legt sich in der Kurfürstenschule ein Abstand, er gleicht dem schwarzen, behäbigen Reifen, in dem sie schwimmen gelernt hat, in einem österreichischen See. Der Reifen trägt sie zwar durch die neue Fremde, doch er trennt das Mädchen auch ab. Sobald sie die Schule betritt, gleitet sie in diesen Reifen, in halliges Dunkel. Das Dunkle vor allem. Etwas in diesem Haus verschattet ihre Lider, an jedem neuen Schulmorgen verliert sie ein wenig Sehkraft. Das Vertraute und das Vertrauen wie bei ihrem Pestalozzi, die sind hier nicht. Sobald die Schulglocke das Ende der letzten Stunde einläutet, wischt das Mädchen ihre Bücher, Hefte, Stifte in den Ranzen und rennt zum Schultor, draußen auf den Stufen hält sie kurz inne, ihr Atmen ist dann ein Aufatmen, tief wie Seufzen, eine Befreiung, als hätte sie im Schulhaus zu wenig Sauerstoff bekommen. Dort unten ist der Fluss, ein Lastkahn zieht Richtung Rhein, winzige Figuren gehen auf dem Kahn hin und her. Und das Licht ist zurück. Diesen Moment sehnt das Mädchen an jedem der Anfangs-KurfürstenSchultage herbei. Hier draußen regnet es Licht, erhellt ihren Blick, die Stufen, die Straße, das deklinierende Mädchen wird Goldmarie. Nur unter dem Himmel ist Licht. Das Mädchen rennt nach dem Unterricht nicht in den Wald, der südostwärts den Gaisberg hinaufzieht. Sie geht meist nur um die nächste Straßenecke und hält schon inne vor dem Schaufenster einer Buchhandlung. Nach einigen Wochen traut sie sich zum ersten Mal hinein, besieht die ausgelegten Bücher, die Titel bleiben ihr verschlossen, sie weist aber den Buchhändler mit der Hand ab, der ihr die Kinderabteilung vorschlägt, denn die hat sie ohnehin in der Stadtbücherei. Wie findet man aus dieser Büchermenge das für einen selbst richtige Buch? Das Mädchen kommt oft wieder, der Buchhändler duldet sie, die nur kurz nach ihrem Geburtstag und kurz nach Weihnachten ein Buch bei ihm kauft.
Verlässt das Mädchen die Buchhandlung, sieht sie drüben den Bismarckplatz. Vom Rand aus beherrscht den Platz ein vor Kurzem gebautes, kastenartiges fensterloses Gebäude. Dessen weiße, wabenartige Verkleidung erscheint dem Mädchen hässlich. Horten steht in großen Lettern auf der Fassade, und das Mädchen hält das für den Befehl, was man in diesem Haus zu tun habe. Sie weiß nichts von dem Eigentümer des Hauses, der seinem Namen gerecht wird und sein Leben lang Dinge anhäuft, auch arisierte. An manchen Tagen streift das Mädchen nach der Schule durch die Wabe, wie sie das Gebäude für sich nennt, das von oben bis unten gefüllt ist mit klebriger Musik. Damen schnuppern an offen bereitgestellten Parfumflacons, nehmen Handtaschen aus den Regalen, befühlen zwischen den Fingern Stoffe. Das Mädchen lässt sich auf rollenden Treppen in den letzten Stock bringen, dort sind Fahrräder ausgestellt, Federballschläger und Laufschuhe. Auf der rollenden Treppe fährt sie abwärts, lässt unterwegs ihren staubigen Schuh von den Bürstenbändern putzen, die mit den Treppen laufen, im Erdgeschoss schaut sie sich Hefte und Schreibblöcke an, probiert Buntstifte aus. Manchmal reicht ihr eine Verkäuferin ein Bonbon zum Kosten oder ein Stück Schokolade. Das Mädchen schlendert zwischen Körben, in denen sich Büstenhalter, Socken oder Unterhosen türmen, geht vorbei an Marzipan- und Speckbergen, ohne dass jemand fragt, wer sie sei, was sie hier suche oder wünsche. Durch die Stadtbücherei und die Heiliggeistkirche, die das Mädchen einmal allein betreten hat, darf sie auch so ungefragt und ziellos schlendern.
Vor der Wabe auf dem Bismarckplatz treffen einander die Straßenbahnen. Dort steht das Mädchen länger herum, als nötig wäre. Bei den Haltestellen lehnt sie sich an die Wand des Kiosks. Frauen schieben Kinderwagen über den Platz, ein Alter deutet mit seinem Stock auf ein Kaugummipapier, das ein Kind fallen gelassen hat, ein paar Buben jagen einander lachend und rufend. Da kommt eine Straßenbahn, jemand springt schnell noch über die Schienen, die Straßenbahnglocke schrillt, als wäre der Fahrer zornig. Der Bismarckplatz, das ist die Stadt, die Mitte der Stadt, hier ist Unruhe, Hast und keiner kennt einen anderen. Fremd ist dieses Treiben und lockt das Mädchen, ein Teil davon zu werden. Sie sieht zu, wie Straßenbahn um Straßenbahn Richtung Rohrbach abfährt, wohin auch das Mädchen längst hätte fahren sollen, wieder wird sie zu spät nach Hause kommen. Die Straßenbahnen haben kurze Waggons, ein großes Abteil in der Mitte und an der Rückseite einen überdachten fensterlosen Perron, dort steht sie am liebsten, bei jeder Station steigt der Schaffner ab und dann wieder auf, drängt das Mädchen, hinein ins Abteil zu gehen, sie bleibt auf dem Perron, den Fahrtwind will sie am Gesicht. An der Schaffnertasche ist ein Metallröhrchen, aus dem Münzen fallen, wenn der Schaffner den Schnapper drückt. In Rohrbach steigt das Mädchen aus und geht zu dem Haus, vor dem ein Kirschbaum steht. Wenn es windig ist, wischen die Kirschzweige quietschend über ihr Fenster, sie hat im oberen Stock ein Zimmer für sich allein.
In der laublosen Zeit sieht sie durch das Kirschgezweig hinauf zum Wald. Sie müsste nur die verkehrsreiche Rohrbacherstraße überqueren und wäre dann in wenigen Minuten am Waldrand. Es ist ihr nicht verboten worden, allein in den Wald zu gehen, sie kommt selbst nicht auf diesen Gedanken, auch zieht sie keine Sehnsucht dorthin. Mit ihrer Schulklasse macht sie manchmal Waldspaziergänge, die Lehrer führen sie zu alten germanischen Versammlungsplätzen, die dort oben ausgegraben wurden, und sagen nichts von den Nazis, die an diesen Plätzen germanisch gefeiert haben. Manchmal spazieren die Eltern mit dem Mädchen durch den Wald hinauf Richtung Boxberg oder sie nehmen den Waldweg hinüber zum Schloss. An manchen Tagen schleicht das Mädchen auf das benachbarte Grundstück, ein verwilderter Garten, umwachsen mit Brombeerhecken, Waldreben, Efeu. Sie kennt die Schlupflöcher in der Hecke, drinnen formen Zweige und Äste Schattenräume. Das Mädchen macht sich ein Baumzimmer. Von dort schaut sie hinüber zu ihrem Fenster hinter der Kirschbaumkrone.
Einmal in der Woche fährt das Mädchen mit der Straßenbahn und dann mit einem Bus allein an den Rand der Stadt. Dort draußen stehen Stallungen, kaum hat das Mädchen einen der Ställe betreten, umfängt sie herbmürber Geruch, den sie nur in diesem ersten Moment wahrnimmt und an den sie sich schon gewöhnt hat, sobald die Pferdehälse in ihren Blick kommen. Die Köpfe wiegen hin und her, das Mädchen lungert vor den Boxen ein wenig herum, bietet ihrer Lieblingsfriesin den Handrücken zum Gruß und lässt sich beschnuppern. Ein Stallbursche, auf den die Bezeichnung Bursche nicht passt, weil er ein großer kräftiger dunkler Mann ist, dessen Gesicht stets zornig wirkt, kommt in die Stallgasse und ruft ihr grußlos zu: Halle spritzen. Das Mädchen weiß schon, was er damit meint, geht in die Reithalle neben den Ställen, nimmt den Schlauch und spritzt den Boden der Halle, damit den Reitschülerinnen kein Sandstaub in die Nase kommt. Dämchen nennt das Mädchen die Reitschülerinnen, kaum ein Junge lernt hier reiten. In dem Wort Dämchen liegt ein wenig Verachtung, die kommt wohl vom Neid. Neid auf die dünnen, stupsnasigen Wesen in enganliegenden Hosen, Stiefeln, rosaherzgeschmückten Gamaschen und Samtwesten. Nun ist die Halle frischfeucht, das Mädchen geht in die Sattelkammer, holt das Zaumzeug, zäumt ein Pony und einen Schecken auf, führt sie in die Halle, wartet bis die Schülerinnen kommen, hilft ihnen in den Sattel. Für die Dämchen zahlt irgendwer die Reitstunden.
Als das Mädchen zu Hause in der Küche fragte, ob sie reiten lernen dürfe, hörte sie nasskalt die Schneide eines Messers durch die Zwiebel ziehen und die Antwort: Für so etwas haben wir kein Geld. Das Mädchen suchte dann aus dem Telefonbuch die Adresse eines Reitstalls und beim Kiosk auf dem Bismarckplatz fragte sie, wie sie dorthin komme. Sie zog Gummistiefel an und fuhr hinaus zu den Pferden. Dort hieß es, sie könne sich eine Reitstunde verdienen, wenn sie zehn Stunden lang striegle, die Ställe ausmiste, Einstreu und Futter nachlege, aufzäume, die Tiere in die Halle oder auf die Koppel führe. Darauf ließ sich das Mädchen ein und sah nur ein Stirnrunzeln, als sie zu Hause in der Küche sagte, sie verdiene sich ihre Reitstunden nun selbst.
Sobald eine Schülerin aufgesessen ist, bringt das Mädchen die Steigbügel in die richtige Länge. Zurücklehnen, sagt das Mädchen der Schülerin, steigt auf den Hocker neben dem Pferd und hilft mit ihren Händen dem Rückgrat der Schülerin auf. Zurücklehnen, wiederholt nun die Reitlehrerin, die sich am Hallenrand auf einen Tisch gesetzt hat und von dort die Kommandos gibt. Bleib schön hinten sitzen, ruft sie, hinten, noch weiter hinten, und jetzt Schritt reiten, Schritt, Schritt, Schritt. Zügel kürzer nehmen, noch kürzer, Oberkörper bleibt schön hinten und die Ellbogen näher an den Körper ziehen, und jetzt tief in die Ecke reiten, wirklich fleißig in die Ecke reiten, noch fleißiger, Schritt und Schritt und zurücklehnen, nicht nach vorn gehen, lass sie nicht zu langsam werden, noch fleißiger Schritt. Und jetzt die Schlangentour in drei Bögen, Pferd besser umstellen, und jetzt die Ecken abrunden, nicht so tief in die Ecke reiten, abrunden, fass den äußeren Zügel enger, Ellbogen bleiben bei dir und langes Bein. Volles Gewicht in den Sattel ruft die Lehrerin der fliegengewichtigen Schülerin zu, setz dich durch, trab sie los und denk schon wieder ans Bremsen. Schwalben pfeilen durch die Halle. Am Hallentor stehen stolz lächelnd einige Mütter, scherzen und werfen aus den Augenwinkeln Blicke auf ihre Töchter im Sattel. Die lernen, ein anderes Lebewesen zu lenken, anzutreiben, lernen, ihren Willen einem anderen aufzuzwingen, lernen mächtig sein, lernen befehlen. Reitschule ist Lebensschule, stärkt das Selbstbewusstsein. Laut ist die Stimme der Lehrerin, gelangweilt und streng. Sie hatte keine Zeit, vor der Reitstunde ihr Haar zu waschen.
Die Pferde schnauben, weißer Schaum steht vor ihren Zähnen. Innen zupfen, ruft die Lehrerin, und Außenzügel schön dran lassen, und jetzt langsam traben lassen, tief hineinsetzen, ganz kurz nehmen, ruhig traben, ruhiger, zurücklehnen und ausatmen, tief durchatmen und jetzt Übergang zum Schritt. Nein, noch nicht loben. Du darfst sie erst loben nach fünf Schritten im Schritt. Aus der Halle sieht man hinüber zu den Außenställen. Dort steht ein Knecht, trommelt mit den Fingern auf einen Holzzaun, ganz in nervöse Gedanken versunken. Wie schwerfällig sie die Gangart wechseln, ich könnte das besser, denkt das Mädchen und möchte anstelle der Schülerin im Sattel sitzen. Ihr war eine Reitstunde gegen zehn Arbeitsstunden versprochen worden. Das Mädchen hat schon länger als die vereinbarten Stunden gearbeitet. Bis jetzt war nie ein Pferd frei und keine Reitlehrerin hatte Zeit, ihr eine Stunde zu geben. Das Mädchen wagt nicht, an die Vereinbarung zu erinnern, etwas für sich zu verlangen, kommt ihr zwar in den Sinn, doch sie bringt ihren Wunsch nicht über die Lippen. Die Reitschülerinnen nehmen das Mädchen nicht wahr, dass jemand ihnen in den Sattel hilft, scheint ihnen selbstverständlich. Langsamer traben, ruft jetzt die Lehrerin, deine Stute rennt, wie sie will, und jetzt angaloppieren, Bein bleibt lang, sonst weiß sie nicht, dass sie galoppieren soll. Äußeres Bein deutlich nach hinten, inneres Bein Druck, Druck, Druck und jetzt Trabübergang, Trab, nein, nicht schneller werden, doch da hebt es die Schülerin schon aus dem Sattel und sie liegt auf der feuchten Sandbahn. Das Mädchen läuft zu ihr, hilft ihr aufstehen und streicht ihr über den Rücken. Die Kommandos der Reitlehrerin hat das Mädchen auf dem Weg zurück in die Sattelkammer noch im Ohr. Vielleicht kann sie durchs bloße Zuschauen reiten lernen. In der Sattelkammer hängt sie das Zaumzeug an seinen Platz und hat das Gefühl, jemand betrete hinter ihr die Sattelkammer. Sie dreht sich um.
Im Grasland
Da war August. Ein Kind ist er. Er kommt aus dem Grasland, dort spielt er mit Fohlen. Sie staksen auf Flysch, dem einstigen Boden der Tiefsee, dessen Tone, Sande und Mergel innerlich nicht verlässlich zusammenhalten, und der Mergel macht die Böden nur vermeintlich, weil nur für kurze Zeit, fruchtbarer. Unbekümmert geht der Bub mit langen Schritten hinter den Fohlen über die Moränen, Zeugen kalter Zeiten. Die Fohlen traben an, werden schneller und schneller, lassen den Bub hinter sich, er sieht sie fliegen über das wellige Becken, zu dessen Rand hin die ehemaligen Klippen als Hügel ansteigen, am ferneren Horizont entfalten sich hohe Berge. Monatelang bedeckt die höchsten Gipfel Schnee. Das Weiß hält die Erinnerung wach an Gletscher, die über Jahrtausende die bucklige Ebene überzogen, sie menschen- und tierleer hielten. Am Beckenrand kehren die Fohlen um, jagen auf August zu, umkreisen und beschnuppern ihn, sie stehen Auge in Auge. Er öffnet das Gatter zur Weide der Mutterstuten, die Fohlen stieben hinein und schon schnappen die Mäuler nach den Zitzen der Grasenden. Außer Atem und verschwitzt unterbricht August den Heimweg in der Sattelkammer des Pferdestalls beim Bahnhof, nützt den Moment, als in dem ledrigen Raum kein Mensch zu sehen ist. Die Handfläche streicht über gewichste Sättel, manche für schmale, andere für breite Pferderücken, drüben hängen die extralangen, Trachten nennt der Rossknecht diese Sättel mit dem hölzernen Sattelbaum. In der Jagdzeit schnallt er den Sattel auf einen dicht gefilzten Woilach, mit vier Fingern prüft er den Abstand zwischen Widerrist und Sattel. Dann führt er die Pferde vor den Bahnhof, aus dem Hofrätesaal drinnen treten adlige Herren, der Knecht hilft beim Aufsitzen. Die Herren reiten zum Jagen in den Kobernaußerwald, der gehört dem Kaiser in Wien. August dreht die Metallöse an einem Sattel, zieht am Maria-Hilf-Riemen, letzte Rettung falls ein Pferd buckelt. August wendet sich zu den Trensen und Gerten. Ross, das sagt er nicht. August spricht vom Rohs, oder Roos könnte man seine Aussprache buchstabieren. Der Plural klingt aus seinem Mund wie Rössa. Die Rössa verstehen ihn und er versteht sie. Menschen wollen Wörter, Satz um Satz, und verstehen ihn oft doch nicht. Gesten, eine Körperdrehung oder das Stirnrunzeln genügen selten, Menschen brauchen Alphabete.
August ist das zwölfte Kind des Viktualienhändlers Rechermacher und dessen dritter Frau. Die beiden vorigen Frauen starben bei Geburten, von den zwölf Geborenen lebt die Hälfte. Seit je spielt der Händler samstags am Abend im Wirtshaus mit Freunden Grünober. Wer eine Runde des Kartenspiels gewinnt, bekommt einen Zwetschkenkern. An einem Samstag wird der Händler sich mit seinem besten Freund über die Zwetschkenkernzählung nicht einig und wird, bis zu seinem Tod, den einstigen Freund meiden. Augusts Mutter, Müllerstochter vom Fechelbach, wappnet sich morgens für den neuen Tag mit dem Händler, von dem sie zwanzig Jahre und Meinungen trennen. So wenig wie möglich anstreifen an den Mann, das verspricht friedliche Stunden. Beim Kochen zieht die kleine stämmige Frau am Herd an ihrer Pfeife, die ihr hinunter zum Nabel reicht. Die Rumflasche muss sie gefüllt wissen, täglich nimmt sie das eine oder andere Stamperl zur Stärkung für das Sein mit dem Händler. Er schlägt sie nicht, außer im Schlafzimmer ist er nicht sonderlich grob, und tagein, tagaus verliert er kein Wort zu viel. Gesprächig wird er mit seiner Kundschaft. Da kann er palavern, vergisst die Zeit, weiß Geschichte um Geschichte und hört der Kundschaft geduldig zu. Seine dritte Frau hat in jeder ihrer Schwangerschaften die Pfeife geraucht und hat in all ihren schwangeren Monaten zum Stamperl gegriffen. Ihre beste Zeit beginnt in der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag, da steht der Händler um 2 Uhr früh auf und sie mit ihm. Im Morgenmantel, über den sie die Schürze gezogen hat, steht sie auf der Stiege des geöffneten Halbkellers und reicht dem Händler die Waren hinaus. Der nimmt mit gestreckten Armen Käse, Eier, Würste, Speck entgegen und schlichtet sie auf seinen Karren. Ist der gefüllt, zurren sie gemeinsam die Plane darüber und der Händler spannt die Luna ein. Sie wird den Karren nach Salzburg zu einigen Wirtshäusern ziehen. Sobald das Gespann hinter der Wegbiegung verschwunden ist, schließt die Frau den Halbkeller und geht noch einmal zurück ins Bett. Erst um fünf wird sie wieder aufstehen und die Viktualienhandlung mit einem Gehilfen für den Verkauf vorbereiten. Mit ihm und einer Magd steht die Raucherin bis am Abend im Geschäft. Ein langer Tag zwar, aber es ist der Tag, an dem sie die Entscheidungen trifft, der Tag, an dem kein vertieftes Schweigen an ihrer Seite ihre Fragen beantwortet. Am Samstag wird der Händler jede Rechnungsdurchschrift überprüfen und mit dem Warenbestand vergleichen. Nicht, dass je etwas gefehlt hätte an Geld oder Waren, aber doch nur, glaubt der Händler, weil er eisern kontrolliert. Im August muss er den Gehilfen mit dem Karren in die Stadt schicken. Seine Frau ist niedergekommen, ausgerechnet am Donnerstag in der Nacht, wieder ein Bub. Sie wird an diesem Freitag nicht im Geschäft stehen. Den Neugeborenen muss man zum ersten Schrei zwingen. Im achten Monat des Jahres 1905 kommt der Bub in einem der Straßwalchner Weiler auf die Welt, dem Vater ist die Lust zur Namensgebung vergangen und er nennt seinen Jüngsten nach dem gegenwärtigen Monat.