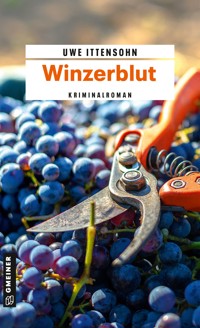Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Achill und Stadtführer Sartorius
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Altbundeskanzler Helmut Kohl soll nach einem Requiem im Dom zu Speyer beigesetzt werden. Der Ludwigshafener Kriminalhauptkommissar Frank Achill koordiniert den Einsatz der örtlichen Polizeikräfte und bittet seinen Freund André Sartorius als ortskundigen Stadtführer um Unterstützung. Alles sieht nach einer harmlosen Routineaufgabe aus. Doch dann mehren sich die Zeichen, dass Extremisten dem Ereignis ihren kaltblütigen Stempel aufdrücken wollen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Uwe Ittensohn
Requiem für den Kanzler
Kriminalroman
Zum Buch
Weltbühne Speyer Helmut Kohl ist tot. Der Altbundeskanzler soll nach einem Requiem im Speyerer Dom auf dem kleinen Kapitelsfriedhof am Rande des Adenauerparks seine letzte Ruhestätte finden. Frank Achill, Hauptkommissar bei der Ludwigshafener Polizei, der den Einsatz der örtlichen Polizeikräfte in Speyer koordiniert, bittet seinen etwas schrulligen Freund André Sartorius als ortskundigen Stadtführer um Unterstützung bei dieser Aufgabe. Zunächst sieht alles nach einer harmlosen Routineaufgabe aus. Doch dann mehren sich die Anzeichen, dass auch Extremisten die Speyerer Weltbühne für ihre Zwecke nutzen wollen, um ein perfides Attentat zu verüben. Wird es André Sartorius mit seinen ausgeprägten analytischen Fähigkeiten gelingen, aus kleinsten Hinweisen, gepaart mit seinen brillanten Ortskenntnissen, das Unheil von seiner Stadt abzuwenden und die Pläne der Terroristen zu durchkreuzen?
Uwe Ittensohn, 1965 in Landau geboren, ist bekennender Pfälzer und lebt seit der Kindheit in Speyer. Der Autor ist bereits seit seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre in der Finanzbranche tätig und war daneben viele Jahre als Lehrbeauftragter an der Dualen Hochschule in Mannheim aktiv. In seiner Freizeit beschäftigt sich Ittensohn intensiv mit der Speyerer Stadtgeschichte. Er renovierte ein verfallenes denkmalgeschütztes Stadtanwesen und kümmert sich um einen historischen Klostergarten, in dessen schattigen Winkeln er auch die Muße zum Schreiben findet. Mit dem vorliegenden Kriminalroman realisiert er den langgehegten Traum, seine geliebte Heimatstadt mit ihren unzähligen Geheimnissen auf eine spannend-humorvolle Art bekannt zu machen.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
2. Auflage 2020
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Bru-nO / pixabay.com
ISBN 978-3-8392-5938-2
Zitat
Wein und Sonne hat der liebe Gott der Pfalz in reichem Maße geschenkt. Wie der Weinstock, der sich in die Erde eingräbt, sind die Menschen tief verwurzelt in ihrer Heimat und vertraut mit deren Geschichte und Geschichten um die Römer, die den Weinbau brachten, um den Dom zu Speyer, in dem deutsche Könige und Kaiser des Mittelalters zu ewiger Ruhe gebettet wurden, um Reichstage zu Speyer und Worms.
Doktor Helmut Kohl
1. Vorspiel
Mittwoch, 14. Juni 2017, 21.45 Uhr
Er überwand sich und legte von hinten die Hand auf die Stirn des alten Mannes. Er spürte dessen Wärme. Fest drückte er den kleinen Kopf mit dem lichten Haar an seine Schulter. Er fühlte den knochigen Rücken des Alten, der ihm hilflos zu entkommen suchte, an seiner Brust. Für einen Wimpernschlag nahm er einen Geruch nach Mottenkugeln wahr.
»Inschallah.« Wie ein leises Wischen klang die Schneide, als sie eine tiefe, klaffende Wunde durch die faltige Kehle grub.
Noch ein letztes Gurgeln, und der kraftlose Körper glitt vor ihm zu Boden. Er zögerte einen Augenblick, überrascht, wie einfach es gewesen war, ein Leben zum Erlöschen zu bringen.
Laut kreischend erhob sich ein Paar giftgrüner Halsbandsittiche, eine Papageienart, die nach und nach auch die Platanen des Philosophenplatzes eroberte, und flog davon. Das eigentümliche Geschrei der tropischen Vögel verlieh der Situation eine unwirkliche Note. Aydin fühlte einen kalten Schauer auf seinem Rücken.
Schockiert starrte er auf das blutige Messer und seine mit Blutspritzern übersäte Hand. Ekel drohte ihn zu übermannen. Hektisch wischte er beides am Hemd des Sterbenden ab und flüchtete unter den Augen seines Bruders in eine dunkle Seitenstraße in der Mannheimer Oststadt.
2. Bezzera
Samstag, 17. Juni 2017, 9.15 Uhr
»Kommst du noch oder soll ich alleine frühstücken?«, fragte Irina genervt.
Verdammt! Er hatte den Wecker überhört. Dabei war es seine Idee gewesen, sich heute mit ihr zu einem ausgiebigen Frühstück zu verabreden. Nach den beiden hektischen Wochen, in denen sie fast täglich eine Prüfung zu bewältigen hatte und häufig ohne einen anständigen Morgenkaffee aus dem Haus stürzte, hatte sie es nun fürs Erste geschafft. Das vierte Semester ihres Betriebswirtschafts-Studiums, das sie in Mannheim an der Uni absolvierte, lag endlich hinter ihr.
Eigentlich wollten sie heute den Tag gemütlich beginnen lassen.
»Ich komme gleich!«, rief er aus seinem Schlafzimmer in die Küche hinunter.
»Beeil dich! Die Cornetti sind noch so schön warm.«
›Auch das noch‹, dachte André. ›Erst versetze ich sie und dann muss sie auch noch zum Bäcker laufen.‹
André mochte es nicht, unzuverlässig zu sein. Wenn ihm dies einer Frau gegenüber passierte, wurmte es ihn erst recht. Er war ein Mann jener Sorte, die man häufig mit der Floskel »alte Schule« bedachte.
Mühsam entwand er sich im gepflegten blauen Satinpyjama dem Bett.
Hätte er nicht verschlafen, hätte er sich rasch geduscht und straßentauglich angezogen. Es entsprach ganz und gar nicht seinem Wesen, sich Fremden im Schlafanzug zu zeigen. Dabei war sie ihm, objektiv gesehen, alles andere als fremd. Die russische Auslandsstudentin aus Speyers Partnerstadt Kursk lebte nun schon seit zwei Jahren bei ihm. Ihr Mietverhältnis, das sich anfänglich nur auf ein kleines Zimmer mit Bad beschränkt hatte, hatte sich mehr und mehr zu einer Wohngemeinschaft fortentwickelt. So, dass sie sich den Haushalt teilten und immer, wenn sich die Gelegenheit bot, die Mahlzeiten miteinander einnahmen. Wenn er ehrlich zu sich war, musste er sich eingestehen, dass längst so etwas wie ein Vater-Tochter-Verhältnis zwischen ihnen herangereift war. Obwohl er ihre Gegenwart in seinem Haus genoss, empfand er es in Momenten wie diesem als belastend, einen Menschen so nahe an sich herankommen zu lassen.
›Sei’s drum‹, dachte er. ›Wer ist schon ohne Widersprüche?‹ Im Übrigen war dauernde Einsamkeit auch keine Alternative.
Als er die Küche betrat, saß sie bereits am Tisch. Eine dünne, blasse 23-Jährige, die man leicht auch fünf Jahre jünger hätte schätzen können. Sie trug ausgebleichte Shorts und ein völlig verzogenes, überweites T-Shirt, in dem sie bereits die Nacht verbracht hatte – ihre übliche Schlafmontur. Lässig hatte sie ihre nackten Füße auf der Sitzfläche ihres Stuhles abgestellt, und ihr Kopf ruhte lauernd auf ihren Knien. Spitzbübisch lächelnd, sprach sie ihn an: »Ui, der alte Mann im Negligé, welch seltener Anblick. Guten Morgen, der Herr!«
»Morgen«, brummte André gespielt genervt.
»Und mit dem falschen Fuß aufgestanden sind wir auch noch«, erwiderte sie und grinste spöttisch.
»Warst du so etwa beim Bäcker?«, fragte er und wies auf ihre Kleider.
»Selbst ist die Frau. Das im Küchenschrank mit dem Fensterchen ist kein Aquarium. Man nennt es Backofen.«
»Ach was. Wenn ich dich nicht hätte, würde ich wahrscheinlich den Kühlschrank für eine Telefonzelle halten.«
»An deine Wundermaschine habe ich mich allerdings nicht getraut. Ich hab keine Lust, mir einen bösen Blick einzufangen und mich wieder stundenlang im Kaffeekochen einweisen zu lassen.«
»Cappu?«, unterbrach er sie und schlurfte, ohne eine Antwort abzuwarten, zur Espressomaschine.
»Same procedure as every day, James!«, sagte sie und beobachtete grinsend Andrés zur Schau gestellten Missmut.
Befriedigt nahm er zur Kenntnis, dass Irina die chromblinkende italienische Siebträgermaschine schon eingeschaltet hatte. Ein Blick auf den linken der beiden Manometer und ein fast liebevolles Streichen über die außenliegende Brühgruppe verriet ihm, dass seine Bezzera schon die notwendige Betriebstemperatur erreicht hatte.
Rasch holte er Milch, Edelstahlaufschäumkännchen und zwei dickwandige Cappuccinotassen. Er legte sich alles zurecht und spülte Auslaufdusche sowie Dampfdüse. Dann stellte er den schweren verchromten Siebträger mit dem für die Marke Bezzera typischen Visconti-Wappen auf dem Griff auf die Briefwaage unter der elektrischen Kaffeemühle, wog exakt 16 Gramm frisch gemahlenen Kaffee ab und füllte ihn ins Sieb. Mit einem massiven Tamper mit Wurzelholzgriff drückte er das Kaffeepulver an und drehte ihn je exakt eine halbe Umdrehung erst nach links und dann nach rechts. Anschließend strich er sorgsam mit dem Finger die Kaffeekrümel von der Kante des Siebträgers. Dann ließ er ihn mit einem leichten Rechtsruck in die Bajonetthalterung der Brühgruppe einrasten. Seine eben noch angespannten Züge hatten sich auf wundersame Weise gelöst. Er genoss es, mit routinierter Hand solchen kleinen Verrichtungen, die er immer exakt nach dem gleichen Muster vollzog, nachzugehen. Vor allem dann, wenn ausreichend Zeit war, präzise und fast meditativ mit schönen ästhetischen Geräten und Gegenständen zu Werke zu gehen. Auf sein Gesicht legte sich ein kindlich zufriedenes Lächeln, als er den Auslasshebel nach oben legte und zuschaute, wie aus der edlen Maschine tiefbraun und sämig dampfender Espresso in die schweren weißen Tassen rann. Genießerisch inhalierte er den Kaffeeduft. Nun konnte der Tag beginnen.
Irina, die ihn die ganze Zeit beobachtet hatte, lachte. »Wenn du nur etwas hast, das du zelebrieren kannst – alter Genießer.«
»Nach fast 30 anstrengenden, hektischen Berufsjahren steht mir das auch zu.«
André hatte vor drei Jahren den Job als Risikoanalyst bei einem Frankfurter Bankhaus an den Nagel gehängt und seine Passion, nämlich die Stadtgeschichte, zum neuen Lebensmittelpunkt werden lassen. Seit einer intensiven Ausbildung vor vier Jahren war er zum Stadtführer seiner geliebten Heimatstadt Speyer avanciert. Mit dem Honorar dafür, der Miete, die er von Irina für das Zimmer mit Bad erhielt, und den Früchten einer kleinen Erbschaft, vermochte er es, gut über die Runden zu kommen.
»Du musst dich nicht wieder verkünsteln«, sagte Irina nachsichtig lächelnd, als André gerade im Begriff war, durch einige gezielte kleine Schwünge aus dem Handgelenk mit der aufgeschäumten Milch ein feingliedriges Blatt auf die Oberfläche des Cappuccinos zu zeichnen.
»Das bin ich dir schuldig, nachdem ich dich schon versetzt habe.«
Irina nickte gönnerhaft.
»Ecco il Caffè«, sagte André und stellte, einen italienischen Kellner imitierend, die Tasse vor Irina auf den Tisch.
»Ich merke, der alte Mann hat seine Betriebstemperatur erreicht«, sagte Irina lachend.
André nahm sich seine Tasse, griff sich eines von Irinas selbst gebackenen Cornetti und setzte sich ihr gegenüber.
Als sie ihren ersten Hunger gestillt hatten, teilten sie sich wie ein altes Ehepaar die Tageszeitung.
Sie schnappte sich den vorderen Teil der Rheinpost mit Politik und Wirtschaft, er den Regionalteil, der dahinter folgte. Er tat dies ganz bewusst. Für ihn war es das Privileg derer, die sich zur Ruhe gesetzt hatten. Sich nicht mehr mit den großen Problemen der Politik und Wirtschaft zu belasten, sondern sich den kleinen einfachen Dingen zu widmen, die sich unmittelbar vor seiner Haustür hier in Speyer abspielten.
»Hast du schon mitgekriegt, euer Einheitskanzler ist gestern gestorben?«
»Wie? Wer?«
»Na, Gorbis Freund.«
»Du meinst Helmut Kohl?«
»Ja, wen sonst?«
»Oh!«, seufzte André betroffen.
»Wie kommt es eigentlich, dass ein Mann wie er so wenig präsent bei euch ist?«
»Na ja, seine Amtszeit liegt schon lange zurück, und am Ende war da diese Parteispendenaffäre.«
Irina lachte und schüttelte ihren Kopf. »Ihr habt schon eine merkwürdige Art, mit euren Nationalhelden umzugehen. Hätte er Russland wiedervereinigt, würde wahrscheinlich auf jedem Marktplatz eine meterhohe Statue von ihm stehen.«
André lächelte. »Wahrscheinlich hast du recht. In Deutschland hat man ein traumatisches Verhältnis zu Nationalhelden aller Art.«
»Wie ich euch kenne, werdet ihr erst in 100 Jahren wissen, was ihr an ihm hattet. In Deutschland muss man tot sein, wenn man verehrt werden will. Was für eine merkwürdige Geschichtsauffassung.«
»Ich für meinen Teil weiß, was wir an ihm hatten. Er gab uns ein europäisches Lebensgefühl. Es kommt nicht von ungefähr, wenn viele Menschen einen gewissen europäischen Stolz entwickelt haben. Was wären wir ohne italienischen Espresso, das französische Savoir-vivre, britische Noblesse, spanischen Wein …«
»… und natürlich die Anmut slawischer Frauen«, ergänzte Irina lachend.
André fiel mit in ihr Gelächter ein.
»Und ist es bei euch anders? Hat Gorbatschow noch viele Fans?«
»Mich schon. Ohne ihn würde ich hier nicht studieren. Aber manche sagen, er hat Russland kleingemacht. Gerade die russischen Nationalisten sind nicht gerade begeistert von ihm und natürlich auch nicht von Kohl. Man wirft den beiden vor, für das Auseinanderbrechen der Sowjetunion verantwortlich zu sein.«
3. Mission
Montag, 19. Juni 2017, 15.25 Uhr
»Khaled hat angerufen. Er wird uns treffen.«
»Uns?«
»Ja, er lobt dich für das, was du mit dem Alten in Mannheim gemacht hast. Er wird einen Bekennerbrief an die Zeitung schicken.«
Aydin nickte mit einem beklommenen Gefühl.
»Er meinte, wir hätten die Gegend gut ausgewählt. Die Furcht, die es unter den Ungläubigen verbreitet, ist umso größer, je sicherer sie sich in einem Stadtteil fühlen. Die Oststadt, wo ihre Banken liegen und die Reichen wohnen, war perfekt.«
Aydin schaute betroffen. Er fühlte sich noch nicht bereit, die Freude seines Bruders Fayyadh zu teilen. Der Gedanke an das warme Blut, das aus der Kehle des Alten auf seine Hand gespritzt war, verursachte ihm immer noch Ekel.
Du wirst an meiner Seite eine heldenhafte Mission erfüllen. Ich habe mich bei ihm für dich verbürgt. Ich will ihm zeigen, was ich für einen mutigen Bruder habe.«
Aydin schaute unsicher. Wie sollte er Fayyadh klarmachen, dass er noch nicht bereit war – bereit, um noch mehr Ungläubige zu töten.
»Nimm den Kopf hoch und schaue auf zum Himmel. Du bist jetzt einer von uns und reif für größere Aufgaben. Das, was du in Mannheim getan hast, spricht für deinen unerschütterlichen Glauben und deinen Mut. Unser Vater wäre stolz auf dich.«
Aydin nickte nur stumm. Gefangen in einer Mischung aus Angst und schlechtem Gewissen. Aufmunternd tätschelte ihm Fayyadh die Wange.
4. Besuchsandrohung
Dienstag, 20. Juni 2017, 9.05 Uhr
»Du André?«, sprach Irina ihn zögerlich an, als er Zeitung las.
Seismografisch registrierte er das ungewohnt ängstliche Timbre, das in ihrer Stimme mitschwang. Aufgeschreckt erhob er den Blick. »Was ist los mit dir?«
»Wieso, wie kommst du darauf, dass etwas mit mir los wäre?«
»Seit zwei Jahren hast du mich nicht mehr mit meinem Namen angesprochen?«
»Es ist …«
»Was ist passiert? Du warst gestern schon so schweigsam. Stimmt etwas bei deiner Familie nicht? Seit dem Anruf gestern Abend drückst du dich hier rum wie eine Katze ohne Schwanz.«
»So fühle ich mich auch«, bekannte Irina und senkte sorgenvoll den Blick.
»Ist jemand ernsthaft krank in deiner Familie?«
»Nein, so schlimm ist es nicht.«
»Spann mich nicht auf die Folter.«
»Es ist eher was mit dir.«
»Mit mir? Ich fühle mich kerngesund.«
Irina lächelte geknickt. »Nein, das meine ich nicht. Ich muss dich etwas fragen und weiß nicht, wie du reagieren wirst.«
»Willst du etwa ausziehen?«, fragte er ernst.
Irinas Gesicht erhellte sich. »Dass du so etwas sagst und dabei ernst guckst, ehrt mich, alter Mann.«
»Vielleicht wirfst du mich ja raus, wenn ich damit rausrücke.«
»Nun lass mich nicht länger zappeln. Hast du etwa einen Verehrer, der zu dir ziehen will?«
Irina lachte verschmitzt. »Du weißt doch, dass der Mann, der meinen hohen Qualitätsanforderungen genügen könnte, erst noch geboren werden muss. Natürlich dich ausgenommen.«
»Jetzt wird’s aber ernst, wenn du mir so Honig ums Maul schmierst.«
»Ja, schon … Tante Ludmilla und Onkel Kazimir wollen nach Deutschland kommen.«
»Ja und?«, fragte André verwirrt. »Was ist daran schlimm?«
»Sie wollen zu dir kommen. Wollen wissen, wo und wie ich wohne, und schauen, ob ich in guten Händen bin.«
André lachte. »Ist ja fast so, wie wenn das Tierheim jemanden zur Nachkontrolle schickt.«
»Danke, du Ekel. Ich kann auch nichts dafür. In Russland achtet man eben auf seine Familie. Sie meinen es halt gut mit mir.«
»Und wieso sollte ich etwas dagegen haben, dass sie’s gut mit dir meinen?«
»Na ja, weil du du bist«, sagte Irina spöttisch grinsend.
»Jetzt bist du das Ekel von uns beiden. Habe ich nicht oft genug Besuch im Haus?«
»Besuch schon, aber die schlafen nicht hier.«
»Schlafen?«, sagte André und schluckte hörbar.
»Ja, nur eine Nacht oder so.«
»Oder so?«, fragte André, nur mühsam sein Entsetzen unterdrückend.
»Ich wusste, dass es dich abtörnt.«
»Wieso abtörnt? Ich wollte nur wissen, was auf mich zukommt.«
»Ist schon gut. Ich schick sie ins Hotel«, sagte Irina sichtlich enttäuscht.
»Spinnst du? Die sollen ruhig erleben, was Speyerer Gastfreundschaft bedeutet!«, sagte André mit Pathos in der Stimme.
»Als ob?«, erwiderte sie ungläubig.
»Ja, ganz sicher, wir machen das«, sagte er und gab ihr einen aufmunternden Klaps auf die Schulter.
»Aber ich muss dich warnen. Die beiden sind …«
»Was bitte? Was sind sie? Doch wohl keine Russen«, sagte er lachend.
»Doch schon. Richtig typische Russen, und ich weiß nicht, ob sie André-kompatibel sind.«
»Wie man an dir sieht, bin ich ja glücklicherweise Russen-kompatibel.«
»Wir werden sehen«, sagte Irina lachend und wurde durch das läutende Telefon unterbrochen.
André nahm rasch ab. Er ertrug es nicht, einem klingelnden Telefon zuzuhören und nicht zu wissen, was man von ihm wollte. Es war Adelheid, die Koordinatorin für Stadtführungen von der Speyerer Tourist-Info.
»Ich habe einen Anschlag auf Sie vor. Einer Ihrer Kollegen ist krank geworden, und wir brauchen Ersatz für den ›Speyermer Stadtspaziergang‹ am Samstag.«
André überlegte kurz, ehe er antwortete. »Geht in Ordnung, ich habe nichts vor. Und wenn ich Ihnen damit einen Gefallen tun kann, dann erst recht. Irgendwann muss ich ja auch mal in den sauren Apfel beißen.«
»Sie sind ein Schatz, danke für Ihre Flexibilität. Wir sehen uns dann am Samstag um elf am üblichen Treffpunkt«, schloss Adelheid das Telefonat.
Die wöchentlich stattfindenden, offenen Stadtspaziergänge, waren das Brot- und Buttergeschäft der Stadtführer und nicht sonderlich beliebt unter ihnen. Da jeder ohne Voranmeldung einfach erscheinen konnte, wusste man nie, mit was für einer Gruppe man es zu tun hatte. Meist war es ein, über alle Nationalitäten und Altersklassen hinweg zusammengewürfelter Haufen mit unterschiedlichsten Interessen, dessen Ansprüchen man nur schwer gerecht werden konnte. Den einen informierte man zu oberflächlich, den anderen zu detailverliebt. Manche empfanden den Rundgang als zu kurz, für andere war er zu langatmig. André war es lieber, Führungen für geschlossene Gruppen durchzuführen. Hier wusste man, mit wem man es zu tun hatte und kannte die Vorstellungen der Teilnehmer. Man konnte sich vorher abstimmen, vorbereiten und entsprechende Schwerpunkte setzen. Das war zwar fachlich fordernder, aber gewährleistete auch eine höhere Zufriedenheit bei den Gästen.
Trotzdem war es für André keine Frage gewesen einzuspringen, schließlich hatte Adelheid ihm schon häufig aus der Patsche geholfen. Ihr einen Wunsch abzuschlagen, schien ihm schier unmöglich.
»Die hast du aber wieder ganz schön angeschleimt, alter Charmeur.«
»Im Gegensatz zu dir, ist sie ja auch nett.«
Irina streckte ihm die Zunge heraus. »Ekel!«
»Ich bin gespannt, ob in deiner Familie alle so schlechte Manieren haben wie du.«
»Heißt das etwa …?«
»Heißt das was?«, stellte er sich dumm.
»Dass sie wirklich kommen dürfen.«
»Natürlich, das sagte ich doch schon. Stell mich nicht wieder wie einen menschenfeindlichen Eremiten hin.«
»Es ist nur … ich hatte befürchtet, du könntest es dir anders überlegen.«
»Mhh, du könntest mich mittlerweile besser kennen. Ich bin noch einer von der altmodischen Sorte. Bei mir gilt eben noch: ›ein Mann, ein Wort‹.«
»Das ist echt lieb von dir. Ich weiß, dass es dir nicht leichtfällt«, sagte Irina und hauchte ihm ein Küsschen auf die Stirn.
»Diese Seite von dir kannte ich ja noch gar nicht«, sagte er schmunzelnd. »Und wann schlagen sie hier auf?«
»Am Freitagnachmittag.«
André schluckte. »Diesen Freitag schon?«
Irina lachte. »Dachtest du etwa an Weihnachten?«
»Ich dachte nur, dass auch Russen ihre Urlaube sorgfältig planen. Wenn sie wie du aus Kursk kommen, sind das immerhin 2.500 Kilometer bis zu uns.«
»Sie kommen aus Kursk und Onkel Kazimir will mit dem Auto anreisen.«
»Na, dann«, sagte André grinsend. »Wenn man nur zwei oder drei Tage Fahrzeit hat, kann man das ja mal spontan machen.«
»Ich kann auch nix dafür, so sind sie eben.«
»Schon gut. Dann sag ihnen schnell zu, sie müssen ja direkt losfahren, wenn sie pünktlich sein wollen.«
André schüttelte ungläubig den Kopf. Für ihn war es unvorstellbar, eine solche Reise spontan anzutreten. Schließlich bedurfte alles einer durchdachten Vorbereitung und Organisation.
»Und vergiss nicht zu erwähnen, dass ich mich freue, sie kennenzulernen und ich sie zu meiner Stadtführung am Samstagvormittag einlade«, fügte er hinzu.
5. Sputnik
Dienstag, 20. Juni 2017, 20.25 Uhr
»Verschwinde, du Schlampe!« Mit einem Fußtritt beförderte der Hüne, der den Decknamen Sputnik trug, die zierliche Asiatin aus dem Bett.
Das nackte Mädchen rappelte sich vom Boden auf die Füße und rieb sich die Hüfte. Sie stand einen Augenblick unschlüssig neben dem mit rotem Satin überzogenen Bett. »Und mein Geld?«, fragte sie mit dünner Stimme.
Der muskulöse Mann mit dem großen Totenkopftattoo auf der Brust lachte dröhnend. »Geh weg, du Amateurnutte, sonst hole ich mir, was ich will. Und sag unten Bescheid, dass ich eine neue Frau brauche. Eine, die sich nicht so ziert wie du und die es auch ohne Gummi mit mir treibt. Los lauf, sie soll einen Wodka mitbringen!« Mit seinen letzten Worten ließ er einen 200er vors Bett segeln. »Der ist für den Wodka, nicht für dich, du dummes Stück.«
Das Mädchen bückte sich linkisch nach dem Geldschein. Sie zitterte am ganzen Körper. Eilig zog sie sich ein knappes rotes Kleid über, schnappte sich ihre Unterwäsche und verließ den Raum.
Ein überlegenes Grinsen huschte über sein pockennarbiges Gesicht.
Wenige Minuten später erschien eine füllige Blondine mit einer Wodkaflasche unterm Arm in der Tür. »Man hat mir gesagt, du suchst eine richtige Frau«, säuselte sie mit kaum überhörbarem, laszivem osteuropäischem Akzent und reichte ihm die Flasche.
Der Hüne zog genüsslich an der Zigarette, die er sich gerade angezündet hatte, und musterte sie. »Dreh dich um!«
Sie tat, was er ihr befohlen hatte, und blieb mit emporgereckten Brüsten und in die Seiten gestemmten Armen vor ihm stehen. »Hier ist Rauchen verboten!«, sagte sie ohne sichtbare Scheu.
Er zog die Zigarette aus dem Mund und schnippte sie ihr vor die Füße.
Eilig hob sie sie auf und versenkte sie im halbvollen Sektglas ihrer Vorgängerin.
»Los, zieh dich aus, Schlampe!«
Während sie sich vor ihm langsam auszog und ihm stolz ihre üppigen Brüste präsentierte, trank er einen tiefen Schluck aus der Wodkaflasche.
»Was ist das für ein elendes Zeug?«, mit angeekeltem Gesichtsausdruck ließ er die nur noch zu zwei Dritteln gefüllte Flasche auf den Teppichboden kullern.
Sie ignorierte seine Bemerkung und beugte sich nackt über ihn und bot ihm ihre gewaltige Oberweite dar.
»Komm schon, zeig, was du drauf hast, geiles Stück«, sagte er und zog sie zu sich.
In diesem Moment klingelte sein Handy. Er horchte auf und nestelte mit der großen Pranke das kleine Gerät aus der neben dem Bett auf dem Boden liegenden Hose. Er blickte aufs Display und seine Züge wurden ernst.
»Verschwinde, es ist geschäftlich!«
»Lass sie warten, wir haben was Besseres vor«, raunte sie süßlich.
Er grinste wölfisch. »Du hast es wohl nötig? So wie du aussiehst, wirst du wohl heute kaum noch einen anderen finden. Trotzdem, Schluss jetzt!«
»Und meine 200 Euro?«, setzte sie nach.
Sie hatte kaum ausgesprochen, klatschte sein Handrücken auf ihre Wange. »Hast du nicht gehört? Raus!«, brüllte er mit heiserer Stimme.
Mit der Hand an der roten Wange, ihre Kleider vor ihren nackten Leib haltend, verließ sie unverrichteter Dinge das Zimmer.
»Privjet Major! … Da … Da … Njet … Speyer … Da … Do svidanija Major!«
Schon nach wenigen Sekunden war das Telefonat beendet. So kurz, dass kein Geheimdienst der Welt nachvollziehen konnte, woher es wirklich gekommen war.
Der Hüne mit dem Pockengesicht erhob sich drahtig aus dem Bett und lief mit dem Handy in der Hand nackt in das kleine Bad. Mit geübten Griffen öffnete er mit seinen Pranken das Handygehäuse, entnahm die SIM-Karte und warf sie in die Toilettenschüssel. Danach pinkelte er mit einem dicken gelben Strahl und machte sich einen Spaß daraus, die in der Schüssel schwimmende SIM-Karte zu treffen. Als er fertig war, betätigte er die Wasserspülung, wandte sich zum Waschbecken um, sog grunzend Luft durch die Nase und rotzte einen Batzen Schleim hinein. »Mahlzeit«, sagte er stolz, sein kleines grünes Werk auf dem weißen Porzellan begutachtend.
6. Auftrag
Mittwoch, 21. Juni 2017, 11.45 Uhr
»Was hast du da?«, fragte André neugierig Irina, die gerade eine Einkaufstüte auspackte.
»Einen Aschenbecher!«
»Einen Aschenbecher? Für was?«
»Du fragst, als würde ich gerade einen Nuklearteilchenbeschleuniger auspacken. So was nutzt man, um Zigarettenasche abzuklopfen oder Kippen darin auszudrücken.«
»Aber doch nicht hier?«, erwiderte André mit einer Mischung aus Empörung und Entsetzen in seiner Stimme.
»Wo sonst? Auf der Straße kann er sie ja fallen lassen, aber in deinem Haus …?«
»Wer, er?«
»Na, Onkel Kazimir.«
»Willst du damit sagen, dass er raucht?«
»Was sonst? Ich wollte dich noch warnen, aber du hast mich unterbrochen und bist in deinen euphorischen Gastfreundschaftsmodus gefallen.«
»Dann soll er eben draußen rauchen«, sagte André störrisch.
Irina lachte. »Dann solltest du ihm draußen auch ein Sofa und ein Bett aufstellen. Onkel Kazimir ist Kettenraucher.«
»Kann er das nicht mal ein paar Tage sein lassen?«
»Nein, das kann er nicht. Als sie ihn vor fünf Jahren an der Hüfte operierten, rauchte er noch im OP-Vorraum.«
André schluckte resigniert. »Na, das kann ja heiter werden. Du solltest mir von deinem nächsten Einkauf eine Gasmaske mitbringen und für ihn einen Sessel unter die Dunstabzugshaube stellen.«
Noch bevor die Schockbilder von durch Zigaretten in Brand geratenen Häusern und rauchgeschwängerten Wohnungen aus seinem Gehirn verschwunden waren, klingelte das Telefon.
Es war Frank Achill, Hauptkommissar beim Polizeipräsidium Ludwigshafen, das unter anderem auch für Speyer zuständig war, und seit Jahren mit André befreundet.
»Alles okay bei dir?«, erkundigte er sich.
»Außer, dass die Russen kommen, ja.«
Achill lachte. »Ich denke, denen liegt die Krim noch schwer im Magen.«
»Sei dir da nicht zu sicher.«
»Aus polizeilicher Sicht sehe ich jedenfalls derzeit kein akutes Risiko für Deutschland«, entgegnete Achill lachend.
»Ist ja auch nur eine kleine Kommandoeinheit, die es mit einem Giftgasangriff versuchen wird. Sie besteht, nach Aussage meiner gewöhnlich gut informierten Mieterin, aus Onkel Kazimir und Tante Ludmilla.«
»Lass mich raten. Ihr erwartet Besuch von Irinas Familie?«
»So ist es«, seufzte André.
»Das will ich erleben, vergiss nicht, mich einzuladen, wenn es so weit ist.«
»Damit ihr mich zu zweit auslachen könnt, wenn mir die Züge entgleisen. Das würde euch so gefallen.«
Nach einer kurzen Pause fuhr Achill mit ernster Stimme fort. »Hör zu, André, ich rufe dich heute dienstlich an.«
»Willst du mich etwa schon vorbeugend festnehmen, damit ich Onkel Kazimir nicht ermorde?«
»Das, was du meinst, nennt sich Sicherungsverwahrung. Aber Spaß beiseite, ich habe dich wirklich etwas Dienstliches zu fragen«, sagte Achill ungeduldig.
André spürte, dass es ihm ernst war. Sein Anruf schien tatsächlich offizieller Natur zu sein.
»Wie kann ich dir helfen, Frank?«
»Wie du sicherlich in der Zeitung gelesen hast, soll Helmut Kohl am 1. Juli hier in Speyer beigesetzt werden.«
»Ja, natürlich weiß ich das. Ich habe ja schon die für die Bestattung vorbereitete Stelle im Adenauerpark gesehen.«
»Der Schutz dieser Bestattung und vor allem der vielen Staatsgäste bei den Trauerfeierlichkeiten im Dom und der anschließenden Überführung durch die Stadt stellt die Polizei vor eine logistische Herausforderung.«
»Ich verstehe, und was hat das mit mir zu tun?«
»Die direkte Sicherung des Domes und des Trauerzuges obliegt den auswärtigen Polizeikräften, die aus ganz Rheinland-Pfalz zusammengezogen werden. Insgesamt werden das rund 1.600 Beamte sein.«
André folgte konzentriert Achills Ausführungen, während Irina, die näher gekommen war, fast vor Neugier platzte.
»Mir und meinem Team hat man dabei eine spezielle Aufgabe zugewiesen«, fuhr Achill fort. »Ich soll zunächst die Gefahrenlage erforschen und spezielle, möglicherweise verdeckte Gefährdungsbereiche vor der Veranstaltung lokalisieren, damit man vorbeugende Sicherungsmaßnahmen ergreifen kann. Während der Veranstaltung sollen wir als unabhängige Hintergrundeinheit eigenständig agieren und auf Hinweise aus der Bevölkerung oder akute Bedrohungslagen reagieren. Man erwartet, dass die örtlichen Polizeikräfte durch ihre besseren Ortskenntnisse dafür geeigneter sind.«
Ein breites Grinsen zog sich über Andrés Gesicht. Die Art wie sein Freund gerade mit ihm sprach, war typisch für ihn. In der Freizeit war Frank ein lockerer Typ, der immer zum Flachsen aufgelegt war und mit dem man Pferde stehlen konnte. Wurde es dienstlich, schien er jedes Mal eine Metamorphose durchzumachen. Er wurde ernst und alles, was er sagte, klang, als sei es eins zu eins einer behördlichen Anordnung entsprungen.
»Klingt logisch«, bestätigte André, der immer noch nicht wusste, worauf sein Freund hinauswollte.
»Ich habe vorgeschlagen, dass ich mich dabei von besonders ortskundigen Kräften unterstützen lasse. Die Stadtverwaltung stellt mir jemand aus der Liegenschaftsabteilung zur Verfügung, der die Schlüsselgewalt über alle städtischen Bauwerke im Einsatzgebiet hat. Zusätzlich brauche ich noch jemanden wie dich, der jeden Quadratmeter des historischen Stadtkerns und des Doms wie seine Westentasche kennt.«
André schluckte überrascht. »Und wieso kommst du da gerade auf mich? Es gibt aktuell 85 Stadtführer und die meisten davon sind schon viel länger im Dienst als ich?«
»Du bringst etwas mit, was keiner der anderen aufweisen kann. Ein gewisses, … mmh, … wie soll ich es nennen? Na so eine besondere Art, die Dinge zu sehen, wie es andere eben nicht können. Ein Blick fürs Detail. Vielleicht auch ein kriminalistisches Gespür.«
»Du machst dich gerade über mich lustig«, sagte André ungläubig.
»Nein, ganz und gar nicht. Du wirst für die Stunden, in denen du im Einsatz bist, sogar wie eine polizeiliche Hilfskraft besoldet.«
André lachte. »Na, wenn das so ist, hast du mich aber überzeugt.«
»Heißt das, du machst es?«, fragte Achill etwas verwirrt nach.
»Lieber Frank, das heißt: Ich bin immer da, wenn du mich brauchst, so wie du immer für mich da warst, und das mit der Besoldung ist nicht nötig. Ich mache das für dich, wenn du meinst, dass es dir etwas bringt.«
»Danke«, erwiderte Achill trocken. »Kannst du mir vielleicht schon übermorgen am Vormittag bei einem Stadtrundgang zur Verfügung stehen?«
»Kein Problem, ich habe am Freitagvormittag frei. Nur am Abend bin ich als Empfangskomitee für die russische Delegation eingeteilt.«
»Prima, dann treffen wir uns am Freitag um 10.00 Uhr auf der Rheinpromenade am Flaggenmast. Danke, dass du mitmachst«, sagte Achill und legte auf.
7. Vorbereitung
Donnerstag, 22. Juni 2017, 9.05 Uhr
Der Major hatte ihn gestern wieder angerufen. Wieder hatte das Telefonat nur einige Sekunden gedauert, wieder hatte er danach, genauso wie man ihn angewiesen hatte, die SIM-Karte vernichtet und die mit der nächsthöheren Nummer in sein Smartphone eingelegt. So wusste der Major immer, wie er ihn erreichen konnte, ohne Spuren zu hinterlassen. Er bewunderte den Major und war stolz darauf, ihm und damit seinem Vaterland oder besser dem, was von der Sowjetunion übrig war, zu dienen. Es gab aber noch ein anderes Gefühl ihm gegenüber, das ebenso stark war – nämlich kalte Angst. Er spürte, dass der Major alles, was er tat, kritisch verfolgte. Ihn beobachtete und ihn, wenn er es wollte, wie eine ausgerauchte Kippe einfach ausdrücken konnte.
Trotzdem gefiel er sich in seiner Rolle. Er, der Junge vom Lande bei Sankt Petersburg, der es in der früheren sowjetischen Armee trotz seines fehlenden Schulabschlusses immerhin zum Praporschtschik, einem Dienstgrad knapp unterhalb der Offiziersränge, gebracht hatte. Er und viele seiner Kameraden galten nach dem Fall der UdSSR als nicht mehr kompatibel zu den modernen russischen Streitkräften. Gerade das, was man früher so an ihm geschätzt hatte, seine unnachgiebige Art, an die Dinge heranzugehen, auch wenn es Kollateralschäden bei der Zivilbevölkerung verursachte, war nicht mehr gefragt. Jetzt war auch in Russland der sogenannte saubere Krieg angesagt. Ein Krieg, der virtuell wirkte – genau so, wie es die Leute von Computerspielen kannten – und der ihnen vorgaukelte, es käme dabei niemand ums Leben. Und wenn, dann genau die, die es auch verdient hatten. All das, was ihn letztlich im zweiten Tschetschenienkrieg so erfolgreich gemacht hatte, galt nun nicht mehr als zeitgemäß. Wo früher Härte und Abschreckung gefragt waren, zog nun die Verweichlichung ein. Man hatte ihn deswegen einfach unehrenhaft aus der Armee entlassen. Obwohl es er und seine Kameraden gewesen waren, die zu jener Zeit zuverlässig die Kohlen aus dem Feuer geholt hatten.
Damals war es der Major gewesen, der ihm einen neuen Sinn und eine neue Heimat gegeben hatte. Ihn nach Deutschland geholt hatte, um von hier aus dafür zu kämpfen, dass aus Russland wieder die große, starke Sowjetunion wurde.
Er hatte sich mit diesem neuen Leben sehr gut arrangiert. Der Major brauchte ihn nicht oft. Zwischen seinen Aufträgen hatte er sich ein sehr einträgliches Gewerbe aufgebaut. Als er den Major damals um Erlaubnis gefragt hatte, stimmte er ohne Weiteres zu. Im Gegenteil, er fand, dass es eine gute Tarnung wäre und er damit finanziell selbstständig würde.
Bei diesen Gedanken grinste Komarow breit. Und angenehm war es allemal. Wenn ihm danach war, holte er sich eines der Mädchen, die für ihn liefen, und tobte sich ganz umsonst bei ihm aus. Die anderen Zuhälter ließen ihn in Ruhe. Sie hatten schon mit seiner unbändigen Kraft und mit seiner ausgeprägten Gewissenlosigkeit Bekanntschaft gemacht. Abdul, der Türke, noch vor zwei Jahren eine feste Größe im Prostituiertenmilieu der Region, war der Erste, der zu lernen hatte, dass man mit ihm nicht spaßte. Er hatte ihm damals mit bloßen Fingern die Augen eingedrückt. Ein Lächeln umspielte gerade seine Mundwinkel, als er sich an das leise Ploppen erinnerte, als die Augäpfel dem Druck seiner Daumen nachgaben und wie reife Tomaten platzten. Mittlerweile war seine Position unangefochten. Sie hatten gelernt, dass er sich stets das holte, was er wollte. Er machte sich einen Spaß daraus, in ihren Klubs oder bei ihren Mädchen aufzutauchen und sich eine Nacht auszutoben, ohne dafür zu bezahlen oder um Erlaubnis zu fragen. Sie ahnten, dass er über mächtige Kontakte in Russland verfügte. Die Gewissheit hatte sich längst unter ihnen breitgemacht, dass sie, selbst wenn sie ihn aus dem Weg räumten, es mit seinen Hintermännern zu tun bekämen.
Für ihn ein alles in allem ideales Lebenskonzept. Er konnte der russischen Sache dienen und führte dabei ein Leben ganz nach seinem Geschmack.
Die einzige Voraussetzung für diesen Lebensstil war es allerdings, die Anweisungen des Majors zu 100 Prozent auszuführen, keine Fragen zu stellen und gründlich zu sein. Aber das fiel ihm nicht schwer. Er war in erster Linie Soldat und damit gewohnt, Befehle konsequent, ohne darüber nachzudenken, zu befolgen.
»Sei am 22. um 9.15 Uhr in der Passagierkabine auf dem oberen Deck der Antonow im Technikmuseum und setz dich an den Tisch. Bleib dort, bis ich mich melde, egal, was passiert. Wir müssen reden«, hatte ihm der Major militärisch kurz befohlen.
Der Ort war neu, die Methode altbewährt. Aufträge gab ihm der Major stets persönlich. Es war wie ein Tick von ihm, dem Telefon nicht zu vertrauen. Eine weitere Marotte war es, sich nie zu zeigen. Wie hatte er einmal gesagt: »Der Tag, an dem du mir in die Augen siehst, wird dein letzter sein!«
*
Das Technikmuseum in Speyer war ein riesiger Komplex, der sich über mehrere Hallen und Freiflächen erstreckte. Unzählige historische Flugzeuge, Schiffe, Lokomotiven und Autos drängten sich hier. Das Museum hatte vor ein paar Minuten geöffnet. Es war eine gute Zeit für ein diskretes Treffen. An den Kassen war noch kaum jemand, sodass die Wahrscheinlichkeit erkannt zu werden, gering war. Die wenigen Besucher, die zu so früher Stunde aufgeschlagen waren, hielten sich ausnahmslos an den vorgeschlagenen Besuchsparcours. Die abseits gelegenen Exponate im Außenbereich, die erst weiter hinten auf dem Rundgang lagen, warteten noch einsam auf den Ansturm der Neugierigen. So auch die Antonow, der Brontosaurus auf dem Gelände. Alt, gewaltig und ohne die Reißzähne der sonstigen Militärmaschinen in Form von Geschütz- und Bombenattrappen.
Komarow kannte die Antonow noch von seiner Militärzeit. Die hier ausgestellte AN-22 gehörte zu einer Generation von Transportflugzeugen, die noch bis vor wenigen Jahren ihren Dienst bei den russischen Streitkräften geleistet hatte. Berühmt für ihre enorme Größe und ihre Zuverlässigkeit. Noch etwas müde stapfte er die metallene Wendeltreppe empor. Als er die offene Flugzeugtür passiert hatte, stand er im riesigen Laderaum, der mit seinen beeindruckenden Ausmaßen eher an eine Lagerhalle erinnerte als an ein Flugzeug. Er war leer. Komarow war beruhigt. Für einen Augenblick schwelgte er in Erinnerungen an seine Militärzeit. Vor seinem inneren Auge sah er den T-62 Panzer, der sie bei einer Mission in Zentralasien begleitet hatte, wie er massig den Bauch des Fliegers ausfüllte. Zielstrebig wandte er sich nach links und steuerte auf den Bug der Maschine zu. Dem Laderaum schloss sich ein schmaler Gang an, von dem gleich rechts ein paar Metallstufen nach oben in die spartanische Passagierkabine führten. Alles fühlte sich vertraut an. Der Ölgeruch, der Klang der Schritte auf dem Bodenblech und das abgenutzte, zweckmäßig gehaltene Interieur. Mehr als einmal hatte er hier vor seinen diversen Einsätzen Stunden der Anspannung verbracht. Die positive Art von Nervenkitzel, die wachsam und konzentriert machte, genau so, wie man es für einen gefährlichen Auftrag brauchte.
Er nahm immer zwei Stufen auf einmal und hatte schnell die steile Metallstiege erklommen. Der schmale, etwa zwei mal fünf Meter große Raum war nahezu fensterlos. Lediglich eine Lichtkuppel in der Decke sowie eine Luke auf der rechten Seite mit eingetrübten Kunststoffscheiben ließen ein fahles Licht herein. So wie der Major gesagt hatte, gab es auf der linken geschlossenen Flugzeugseite, unmittelbar neben der Bodenöffnung, durch die er die Kabine erstiegen hatte, einen am Rumpf befestigten Klapptisch mit einer Sitzgelegenheit davor.
Vorsichtig, die Tragfähigkeit des antiquierten Sitzes auslotend, nahm er Platz. Nervös schaute er auf die Uhr – 9.12 Uhr – er war pünktlich. Gut so. Der Major akzeptierte Unpünktlichkeit nicht. Er stützte den Kopf auf seine große Hand und sog den ölig-metallischen Geruch, den die alten hydraulischen Aggregate der Maschine selbst Jahre nach dem letzten Flug noch ausströmten, in sich. Wieder überkamen ihn nostalgische Gefühle. Er wartete, so wie man beim Militär immer wartet – auf Befehle, auf die Dämmerung, auf den Einsatz. Nach etwa 15 Minuten spürte er, wie jemand die Metalltreppe erklomm und in Vibrationen versetzte, die sich auf den Flugzeugrumpf übertrugen. Dann hörte er Schritte auf dem Riffelblech, mit dem man den Boden des Laderaums ausgekleidet hatte. Direkt unter ihm blieb der Besucher stehen. Genau an der Stelle, von der man gleichermaßen in Sprechweite zur Passagierkabine war, aber noch immer den Zugang zur Maschine im Blick hatte. Würde sich jemand anschicken, das Flugzeug zu betreten, würden ihn die Schrittgeräusche auf den Metallstufen schon von Weitem ankündigen. Im Gegensatz zu seinem Besucher war Komarow geradezu blind. Er hatte weder die Möglichkeit, durch den Bodeneinstieg nach unten zu schauen, noch konnte er durch ein Fenster nach außen blicken. Wie sorgfältig der Major doch wieder vorgegangen war, um ungesehen zu bleiben.
»Privjet Sputnik!«, hörte er die vertraute Sprechweise seines Vorgesetzten ihn begrüßen.
»Privjet Major«, antwortete Komarow mit belegter Stimme.
»Bleib sitzen und hör zu!«, begann der Major mit eisigem Tonfall auf Russisch.
»Da«, sagte Komarow und schluckte. Nervös trommelte er mit den Fingerkuppen auf der metallenen Tischplatte. In Gegenwart des Majors fühlte sich der Koloss stets klein und unsicher. Wusste er doch, dass jener über sein Leben entscheiden konnte.
»Du hast Gelegenheit, dich zu beweisen. Der Auftrag kommt von ganz oben.«
Komarow schluckte wieder. Wenn er ehrlich mit sich war, wusste er noch nicht einmal, wo ganz oben war und wer ganz oben stand. Freilich war ihm über die Jahre klar geworden, dass der Major in einem engen Beziehungsgeflecht mit der russischen Armee und dem russischen Militärgeheimdienst, GRU, stand. Ausgeschrieben stand die Abkürzung GRU für Glawnoje Raswedywatelnoje Uprawlenije, was übersetzt »Hauptverwaltung für Aufklärung« hieß. Ob er allerdings der klassischen Hierarchie unterstand oder ob es eine Art Paralleluniversum gab, in dem sich die nationalistisch orientierten Kräfte bewegten, war ihm unklar.
»Du wirst hier ein Exempel statuieren. Die Beerdigung unterbinden und der Welt zeigen, dass Russland auch trotz diesem Kohl, der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass unsere Sowjetunion zerbrach, immer noch stark ist und die Zeiten der Verweichlichung zu Ende sind. Du wirst das, was Putin auf der Krim begonnen hat, hier fortsetzen und allen demonstrieren, dass unser schlafender Riese wiedererwacht ist.«
Komarow spuckte aus. Er war froh, dass er sitzen konnte und ihn der Major nicht sah. Er schämte sich dafür, dass ihm gerade die Knie weich wurden.
»Verstanden!«, sagte Komarow dürr. »Und wie soll es laufen?«
»Du wirst den Sarg in die Luft jagen, ganz einfach. Man hat mir aufgetragen, dir klarzumachen, dass so wenig wie möglich Zivilisten dran glauben sollen. Verstehst du das? Du wirst dich auf den Sarg konzentrieren und nicht den Dom in die Luft jagen, du Idiot. Ist das klar?«
»Ja, verstanden Major!«
»Wir haben nicht viel Zeit. Du hast drei Tage, bis wir uns wieder treffen und du mir sagst, was du brauchst. Hast du das begriffen?«
»Drei Tage«, wiederholte Komarow kleinlaut.
Komarow spürte, dass es dem Major ernst war. Er hatte das Gefühl, als legte sich eine kalte Hand auf seine Kehle.
»Du wirst mir das Zeichen geben und ich werde da sein, um zu hören, was du vorhast.«
Komarow nickte. Als ihm bewusst wurde, dass ihn der Major nicht sah, schob er ein eiliges »da« hinterher.
»Und versau es nicht, sonst …«
Der Major machte eine Pause. Er ließ Komarow die Zeit sich auszumalen, was sonst passieren würde, wenn er scheiterte.
»Du bleibst noch zehn Minuten hier sitzen! Verstanden?«
»Da«, antwortete Komarow eingeschüchtert.
Er hörte noch fünf Schritte unter sich auf dem Aluminiumblech und spürte gleich darauf die Vibrationen der Treppe, dann war er allein. Allein mit sich und der Angst zu scheitern.
8. Begehung
Freitag, 23. Juni 2017, 10.00 Uhr
Ihr Treffpunkt war ein 25 Meter hoher, dem Besanmast eines Segelschiffes nachgebildeter Stahlpfeiler, der just an der Stelle aufgestellt war, wo die Hauptzufahrt – die Rheinallee – auf die Rheinpromenade traf. Wie es in den Tourismusbroschüren hieß, war er für all jene, die die Stadt über den Wasserweg besuchten, die Visitenkarte Speyers.
Die Sonne war auf der gegenüberliegenden badischen Rheinseite aufgegangen und hatte schon deutlich an Höhe gewonnen. Ihre noch goldenen Strahlen wurden vom Wasser des Stroms reflektiert und verhießen einen warmen Frühsommertag. Insgeheim beneidete André die Touristen, die gerade nach einem ausgiebigen Frühstück aus einem der großen Ausflugsdampfer quollen, um die Stadt, vielleicht zum ersten Mal überhaupt, zu erkunden.
Als André näher kam, erkannte er Achill, der bereits in Entourage mit einer jungen Frau und einem grimmig dreinblickenden älteren Herren auf ihn wartete. Achill begrüßte ihn herzlich und machte kurz die Anwesenden untereinander bekannt.
»Darf ich vorstellen: Inspektorin Verena Bertling, unsere Spezialistin für operative Fallanalyse und das EDV-Genie meiner Abteilung.«
Bertling errötete leicht.
André gab der jungen Frau die Hand und spürte einen festen, eine Spur zu entschlossenen Händedruck, so als wollte sie damit ihre Verlegenheit kompensieren. ›Die hat noch was zu beweisen‹, dachte er.
Sie war von eher zierlicher Statur. Für einen Moment wunderte sich André, wie sie es damit in den Polizeidienst geschafft hatte. Ihr Haar war nackenlang und weizenblond. Ihr Gesicht wirkte noch eine Spur jugendlich. Sie trug einen Blazer, mit ihrer Hand umklammerte sie einen Tablet-Computer.
›Keine typische Polizistin‹, dachte André.