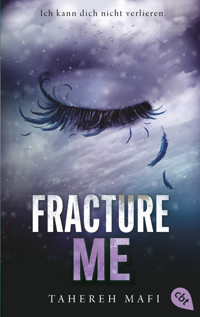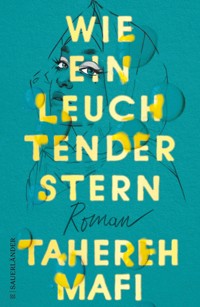8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die "Shatter Me"-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Das Mädchen, das mit nur einer Berührung töten kann, hält nun die Welt in ihrer Hand.
Juliette Ferrars dachte, sie hätte gewonnen. Sie hat die Macht in Sektor 45 übernommen und ist zur Obersten Befehlshaberin ernannt worden – und all das mit Warner an ihrer Seite. Doch als das Schicksal sie einholt, muss sie sich der Dunkelheit stellen, die in ihr wütet.
Die TikTok Sensation – Mitreißende Young Adult Romantasy-Reihe mit Suchtfaktor für alle Fans von Leigh Bardugo, Sarah J. Maas und Victoria Aveyard.
Erstmals in deutscher Übersetzung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 346
Sammlungen
Ähnliche
Tahereh Mafi
Restore Me
Aus dem Amerikanischenvon Mara Henke
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung.Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Erstmals als cbt Taschenbuch Oktober 2023
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel
»Restore Me« bei Harper, an imprint of Hitzfeld Publishers, New York.
Dieses Werk wurde vermittelt durch
die Literarische Agentur Thomas Schlück, 30161 Hannover.
© 2023 für die deutschsprachige Ausgabe cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Aus dem amerikanischen Englisch von Mara Henke
Lektorat: Ulla Mothes
Covergestaltung: Geviert, Grafik & Typografie
Cover art © 2014 by Colin Anderson.
Cover art inspired by a photograph by Sharee Davenport
skn · Herstellung: bo
E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-31391-3V001
www.cbj-verlag.de
Für Jodi Reamer,die immer glaubte
JULIETTE
Ich wache nicht mehr schreiend auf. Mir wird nicht übel, wenn ich Blut sehe. Ich zögere keine Sekunde, bevor ich schieße.
Ich werde mich nie wieder dafür entschuldigen, überlebt zu haben.
Und dennoch –
Zucke ich erschrocken zusammen, als eine Tür zuknallt. Unterdrücke ein Keuchen, fahre herum, berühre instinktiv die Pistole in meinem Holster.
»Wir haben ein massives Problem, J.«
Kenji starrt mich an, die Augen verengt, die Hände in die Hüften gestemmt, das T-Shirt straff über der Brust gespannt. Das hier ist ein wütender Kenji. Ein besorgter Kenji. Sechzehn Tage sind vergangen, seit wir den Sektor 45 erobert haben und ich mich selbst zur Obersten Befehlshaberin des Reestablishment ernannt habe. Seither ist alles ruhig. Entnervend ruhig. Jeden Morgen erwache ich beschwingt und ängstlich zugleich, rechne mit Botschaften von feindlich gesonnenen Nationen, die mich stürzen und Krieg gegen uns führen wollen – jetzt scheint dieser Moment gekommen zu sein. Deshalb hole ich tief Luft, hebe das Kinn und sehe Kenji entschlossen an.
»Sag es mir.«
Er presst die Lippen zusammen. Blickt zur Decke hoch. »Also – erst mal musst du wissen, dass es nicht meine Schuld war, okay? Ich wollte nur hilfreich sein.«
Ich zögere. Runzle die Stirn. »Was?«
»Ich meine, ich wusste ja, dass dieser Arsch eine gigantische Dramaqueen ist, aber das ist jetzt echt nur lächerlich –«
»Warte mal – wie?« Ich nehme die Hand vom Holster. »Was redest du da, Kenji? Es geht gar nicht um Krieg?«
»Krieg? Was für einen Krieg? Hörst du mir überhaupt zu, J? Dein Freund führt sich auf wie ein Irrer, du solltest diesen Idioten zur Vernunft bringen, damit ich mir den nicht vorknöpfen muss.«
Ich atme gereizt aus. »Im Ernst jetzt? Dieser Mist wieder? Herrgott, Kenji.« Ich schnalle das Holster ab und werfe es aufs Bett hinter mir. »Was hast du diesmal angerichtet?«
»Na, siehst du?« Kenji deutet auf mich. »Siehst du, wie du mich gleich verurteilst, Prinzessin? Warum nimmst du sofort an, dass ich was falsch gemacht habe? Wieso ausgerechnet ich?« Er verschränkt die Arme vor der Brust, spricht leiser weiter. »Und weißt du, ich wollte ohnehin schon länger mal mit dir reden, weil ich nämlich finde, dass du als Oberste Befehlshaberin nicht jemanden so bevorzugen darfst, aber –«
Kenji verstummt abrupt.
Als er hört, wie die Tür aufgeht, fahren seine Augenbrauen hoch; eine Bewegung hinter ihm, ein Klicken, und er erstarrt, als er den Lauf einer Pistole am Hinterkopf spürt. Kenji starrt mich mit aufgerissenen Augen an, und seine Lippen formen mehrmals stumm das Wort Psychopath.
Besagter Psychopath zwinkert mir zu und grinst, als hielte er nicht gerade unserem gemeinsamen Freund eine Waffe an den Kopf. Es gelingt mir, nicht lauthals zu lachen.
»Sprich weiter«, sagt Warner, immer noch grinsend. »Erklär mir, warum du findest, dass unsere Oberste ihren Job nicht gut macht.«
»Hey –« Kenji hält gespielt ergeben die Hände hoch. »Das hab ich nie gesagt, okay? Und du übertreibst ja wohl total –«
Warner haut Kenji mit der Pistole an den Kopf. »Idiot.«
Kenji fährt herum, reißt Warner die Waffe aus der Hand. »Was stimmt nicht mit dir, Mann? Ich dachte, es sei alles cool zwischen uns.«
»War’s auch«, sagt Warner eisig. »Bis du meine Haare angefasst hat.«
»Du hast doch gesagt, ich soll dir die Haare schneiden –«
»Hab ich nicht! Ich hab gesagt, du sollst die Spitzen schneiden!«
»Was ich auch getan habe.«
»Das hier«, sagt Warner und dreht sich um, damit ich das Fiasko betrachten kann, »sind ja wohl kaum geschnittene Spitzen, du unfähiger Vollidiot –«
Ich keuche entsetzt. Warners Hinterkopf sieht völlig verwüstet aus, die Haare sind krumm und schief geschnitten, ganze Büschel wegrasiert.
Kenji räuspert sich betreten. »Na ja«, sagt er, steckt die Hände in die Hosentaschen. »Ich meine … also, Schönheit liegt ja immer im Auge des Betrachters –«
Warner zieht eine zweite Pistole und richtet sie auf ihn.
»Hey!«, schreit Kenji. »Ich bin nicht hier, um mich misshandeln zu lassen, ist das klar?« Er deutet auf Warner. »Für so einen Scheiß bin ich auch gar nicht zuständig!«
Während Warner ihn erbost anstarrt, geht Kenji langsam rückwärts hinaus, um weiteren Attacken zu entkommen; aber in dem Moment, als ich erleichtert aufseufze, späht er noch mal herein und sagt:
»Ich finde den Haarschnitt aber echt süß«,
worauf Warner ihm die Tür vor der Nase zuknallt.
Willkommen in meinem neuen Leben als Oberste Befehlshaberin des Reestablishment.
Warner starrt auf die geschlossene Tür, atmet aus, seine Schultern lösen sich, und ich sehe noch deutlicher, was Kenji angerichtet hat. Warners dichtes goldblondes Haar – ein wichtiges Element seiner Schönheit –, von achtlosen Händen verschandelt.
Ein Desaster.
»Aaron«, sage ich leise.
Er lässt den Kopf hängen.
»Komm her.«
Warner dreht sich halb um und sieht mich aus dem Augenwinkel an, als habe er irgendetwas angestellt, dessen er sich schämen müsste. Ich räume die Waffen vom Bett, damit wir beide Platz haben. Mit einem bedrückten Seufzer legt Warner sich zu mir.
»Ich sehe entsetzlich aus«, murmelt er.
Ich schüttle lächelnd den Kopf und berühre seine Wange. »Warum hast du Kenji überhaupt erlaubt, dir die Haare zu schneiden?«
Warner sieht mich mit seinen grünen Augen perplex an. »Du hast doch gesagt, ich soll Zeit mit ihm verbringen.«
Ich lache schallend. »Und deshalb hast du dir von ihm die Haare schneiden lassen?«
»Nein, das war so nicht gedacht«, antwortet Warner finster. »Es sollte –«, er zögert, »eine Geste der Kameradschaft sein. Ein Akt des Vertrauens, ich habe das bei meinen Soldaten erlebt. So oder so«, er wendet den Kopf ab, »habe ich keine Erfahrung damit, wie man eine Freundschaft aufbaut.«
»Na ja«, sage ich, »wir sind schließlich auch Freunde, oder nicht?«
Das bringt ihn zum Lächeln.
»Und?« Ich stupse ihn an. »Das war doch bisher gut, nicht wahr? Du hast es gelernt, netter zu Menschen zu sein.«
»Schon, aber ich will das gar nicht. Es passt nicht zu mir, nett zu sein.«
»Ich finde, das passt sogar ganz wunderbar zu dir«, widerspreche ich strahlend. »Ich liebe es, wenn du nett bist.«
»Das sagst du nur so.« Er sieht aus, als müsse er lachen. »Aber Nettsein fällt mir wirklich schwer, Süße. Du musst Geduld mit mir haben, wenn ich nur langsam Fortschritte mache.«
Ich ergreife seine Hand. »Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Zu mir bist du doch total freundlich.«
Warner schüttelt den Kopf. »Ich weiß, ich habe versprochen, dass ich mir Mühe geben will, netter zu deinen Freunden zu sein. Das tue ich auch weiterhin – aber ich hoffe, du bist trotzdem darauf gefasst, dass ich auch scheitern kann.«
»Was willst du damit sagen?«
»Nur dass ich hoffe, dich nicht zu enttäuschen. Unter Druck kann ich eine gewisse Freundlichkeit an den Tag legen, aber du musst wissen, dass ich null Interesse daran habe, mit anderen so umzugehen wie mit dir.« Sein Blick ruht jetzt auf meinen Lippen; seine Hand wandert zu meinem Hals. »Das«, sagt er leise, »ist für mich sehr, sehr außergewöhnlich.«
Ich höre auf
höre auf zu atmen, zu sprechen, zu denken –
Kaum hat er mich berührt, rast mein Herz; Erinnerungen durchfluten mich wie glühend heiße Wellen; das Gewicht seines Körpers an meinem; der Geschmack seiner Haut; die Hitze seiner Berührung und sein heftiges Atmen und alles, was er nur im Dunkeln zu mir gesagt hat.
Schmetterlinge flattern unter meiner Haut, ich verscheuche sie.
Das ist alles noch so neu, seine Berührung, seine Haut, sein Duft, so neu, so neu und unfassbar –
Er lächelt, legt den Kopf schief; ich imitiere die Bewegung, er atmet sachte ein, seine Lippen öffnen sich, und ich rühre mich nicht, meine Lunge scheint zu versagen, meine Finger tasten nach seinem Hemd, als er sagt:
»Ich werde mir den Kopf rasieren müssen, weißt du«
und sich abwendet.
Ich blinzle, er küsst mich noch immer nicht.
»Und ich hoffe sehr«, sagt er, »dass du mich auch noch lieben wirst, wenn ich wiederkomme.«
Und dann ist er weg, und ich zähle an den Fingern ab, wie viele Männer ich getötet habe, und verstehe nicht, dass ich dennoch in Warners Nähe komplett die Kontrolle verliere.
Ich nicke, als er mir zuwinkt, rufe mich zur Vernunft und sinke wieder aufs Bett, um mich mit komplizierten Gedanken über Krieg und Frieden herumzuschlagen.
Dass es leicht sein würde, eine Anführerin zu sein, habe ich nicht erwartet, aber ich glaubte, es wäre einfacher:
Ständig zweifle ich meine eigenen Entscheidungen an. Jedes Mal, wenn ein Soldat meine Befehle befolgt, bin ich peinlicherweise total erstaunt. Und ich bekomme immer mehr Angst davor, dass wir – auch ich – noch so viele Menschen töten müssen, bevor die Welt Frieden findet. Doch vor allem diese Stille bringt mich völlig durcheinander.
Seit sechzehn Tagen.
Ich habe Reden gehalten über unsere Pläne für die Zukunft; wir hatten Gedenkfeiern für die Gefallenen und konnten schon Versprechen für Veränderungen in die Tat umsetzen. Castle hält sein Wort und arbeitet hart für Verbesserungen in der Landwirtschaft, bei der Bewässerung und an der dringlichsten Aufgabe, nämlich den Menschen aus den Siedlungen anderes Wohnen als die Containerblocks zu ermöglichen. Doch alles kann nur Schritt für Schritt erledigt werden; es wird ein langsamer und mühevoller Prozess sein – ein Kampf um die Welt, der ein Jahrhundert dauern kann. Das ist uns wohl allen klar. Und wenn es nur um diese Projekte ginge, würde ich mir auch keine Sorgen machen. Ich bin aber beunruhigt, weil ich nur allzu gut weiß, dass wir diese Welt nicht retten können, wenn wir weiter jahrzehntelang Kriege führen.
Dennoch bin ich darauf gefasst, dass wir kämpfen müssen.
Ich würde es gern vermeiden, bin aber bereit, Krieg zu führen, wenn es nötig ist, um Veränderungen zu ermöglichen. Nur wünschte ich, es wäre alles einfacher. Zurzeit ist mein größtes Problem auch das verwirrendste:
Für Kriege braucht man Feinde, aber ich scheine keine zu haben.
In den sechzehn Tagen, seit ich Anderson in die Stirn geschossen habe, hat sich nirgendwo Widerstand geregt. Niemand hat versucht, mich zu verhaften. Ich wurde nicht von anderen Oberbefehlshabern angegriffen. Von allen 554 weiteren Sektoren auf diesem Kontinent ist kein einziger abtrünnig geworden, hat uns den Krieg erklärt oder schlechte Propaganda über mich verbreitet. Nirgendwo gab es Proteste oder Aufstände. Aus irgendwelchen Gründen spielt das Reestablishment mit.
Oder tut jedenfalls so.
Was mich wahnsinnig nervös macht.
Wir befinden in uns einem Stagnationszustand, in einer seltsamen Neutralität, und das, obwohl ich dringend mehr tun möchte. Für das Volk von Sektor 45, für Nordamerika, für die ganze Welt. Aber diese eigenartige Stille bringt uns alle aus dem Tritt. Wir waren absolut sicher, dass sich die anderen Oberbefehlshaber nach Andersons Tod gegen uns erheben würden – dass sie ihre Heere schicken würden, um uns zu zerstören – mich zu zerstören. Doch stattdessen demonstrieren uns die anderen Staatsoberhäupter der Welt, dass wir unwichtig sind: Sie ignorieren uns wie eine lästige Fliege, haben uns in einem Glas gefangen, wo wir mit verletzten Flügeln gegen Wände prallen, solange der Sauerstoff reicht. Der Sektor 45 bleibt sich selbst überlassen; man hat uns Autonomie gewährt und die Autorität, die Infrastruktur unseres Sektors ohne Einmischung zu gestalten. Überall tun alle so, als habe sich nicht das Geringste geändert. Unsere Revolution hat sich in einem Vakuum ereignet. Unser Sieg danach wird als so geringfügig betrachtet, als hätte es ihn gar nicht gegeben.
Psychospielchen.
Castle kommt häufig vorbei, um mich zu beraten. Es war sein Vorschlag, dass ich aktiv sein sollte – dass ich den ersten Schritt machen sollte. Anstatt ängstlich und defensiv abzuwarten, solle ich handeln, sagte er. Ich solle Präsenz zeigen, Ansprüche stellen. Einen Platz am Tisch einnehmen. Und versuchen, Allianzen zu bilden, bevor ich zum Angriff überginge. Ich solle mich mit den fünf anderen Oberbefehlshabern der Welt verbünden.
Weil ich für Nordamerika sprechen kann – aber was ist mit dem Rest der Welt? Mit Südamerika? Europa? Asien? Afrika? Ozeanien?
Berufen Sie eine internationale Konferenz ein, riet Castle.
Zum Austausch.
Und streben Sie zunächst Frieden an, sagte er.
»Die müssen doch vor Neugierde fast umkommen«, sagte Castle zu mir. »Ein siebzehnjähriges Mädchen an der Spitze von ganz Nordamerika? Eine Siebzehnjährige, die Anderson getötet und sich selbst zur Obersten Befehlshaberin erklärt hat? Ihnen muss klar sein, dass Sie zurzeit viel Einfluss haben, Ms Ferrars – den sollten Sie zu Ihrem Vorteil nutzen!«
»Ich?«, fragte ich verwundert. »Inwiefern habe ich Einfluss?«
Castle seufzte. »Sie sind auf jeden Fall ungemein mutig für Ihr Alter, Ms Ferrars, aber leider ist Ihre Jugendlichkeit auch verbunden mit Unerfahrenheit. Ich drücke das mal etwas deutlicher aus: Sie haben übermenschliche Kräfte, nahezu unverletzbare Haut, ihre Berührung ist tödlich, Sie zählen nur siebzehn Jahre und haben eigenhändig den Diktator dieser Nation gestürzt. Und da zweifeln Sie noch daran, dass Sie nicht die ganze Welt das Fürchten lehren könnten?«
Ich warf ihm einen verlegenen Blick zu.
»Alte Gewohnheiten, Castle«, sagte ich leise. »Schlechte alte Gewohnheiten. Sie haben natürlich recht. Natürlich haben Sie recht.«
Er sah mich durchdringend an. »Sie sollten begreifen, dass die einhellige Stille seitens Ihrer Feinde kein Zufall ist. Die haben sich garantiert abgesprochen – und auf dieses Verhalten geeinigt –, um zu beobachten, was Sie als Nächstes tun werden.« Er schüttelte den Kopf. »Sie warten auf Ihren nächsten Schritt, Ms Ferrars. Weshalb ich Sie beschwöre, dass er gut werden muss.«
Ich lerne also.
Ich befolgte Castles Rat und ließ vor drei Tagen von Delalieu Botschaften an alle fünf weiteren Oberbefehlshaber des Reestablishment schicken. Ich lud sie für den nächsten Monat zu einer internationalen Konferenz hier in Sektor 45 ein.
Eine Viertelstunde, bevor Kenji in mein Zimmer geplatzt war, hatte ich die erste Antwort erhalten.
Ozeanien hat zugesagt.
Und ich kann überhaupt nicht einschätzen, was das zu bedeuten hat.
WARNER
In letzter Zeit war ich nicht ich selbst.
Und ehrlich gesagt hält dieser Zustand schon so lange an, dass ich mich inzwischen frage, ob ich überhaupt weiß, wer ich bin. Ich starre, ohne zu blinzeln, in den Spiegel, während das Surren des Haarschneiders den Raum erfüllt. Es ist nicht sehr hell im Badezimmer, aber ich sehe genug, um zu erkennen, dass ich hagerer geworden bin. Mein Gesicht ist kantiger; meine Augen wirken größer. Meine Bewegungen sind bedrückt und mechanisch, während ich mir selbst den Kopf rasiere und die letzten Reste meiner Eitelkeit zu Boden rieseln.
Mein Vater ist tot.
Das surrende Gerät in der Faust, schließe ich die Augen, um mich gegen die unerwünschte Enge in der Brust zu stählen.
Mein Vater ist tot.
Seit knapp über zwei Wochen. Zweimal in die Stirn geschossen von einer Person, die ich liebe. Sie tat mir etwas Gutes, indem sie ihn tötete. Und war mutiger, als ich es je gewesen bin, drückte den Abzug, was ich niemals geschafft hätte. Er war ein Monster. Er hatte noch viel Schlimmeres verdient.
Dennoch –
Dieser Schmerz.
Ich atme tief ein, öffne blinzelnd die Augen wieder, dankbar, dass ich allein bin; dankbar auch für die Gelegenheit, etwas von mir mit Gewalt zu entfernen. Es hat eine seltsam befreiende Wirkung.
Meine Mutter ist tot, denke ich, während ich die elektrische Klinge über meinen Kopf ziehe. Mein Vater ist tot, denke ich, als die Haare zu Boden fallen. Alles, was ich war, alles, was ich tat, alles, was ich bin, entstand entweder aus dem Handeln oder aber der Untätigkeit dieser beiden Personen.
Wer bin ich, frage ich mich, in ihrer Abwesenheit?
Als der Kopf geschoren, das Gerät ausgeschaltet ist, stütze ich mich auf den Waschtisch und versuche im Spiegel zu erkennen, wer aus mir geworden ist. Ich fühle mich alt und rastlos, Herz und Geist führen Krieg miteinander. Die letzten Worte, die ich zu meinem Vater sagte –
»Hey.«
Mein Herz pocht heftig, als ich herumfahre; ich versuche, mir nichts anmerken zu lassen. »Hi«, sage ich, zwinge mich zu langsamen, ruhigen Bewegungen, als ich mir Haare von den Schultern wische.
Juliette betrachtet mich mit großen Augen, wunderschön und besorgt.
Mir fällt ein, dass ich lächeln könnte. »Wie sehe ich aus? Nicht zu schlimm, hoffe ich.«
»Aaron«, sagt sie leise. »Ist alles okay mit dir?«
»Alles in Ordnung«, antworte ich und schaue wieder in den Spiegel. Ich streiche mit der Hand über den weich-stachligen zentimeterhohen Flaum, den ich übrig gelassen habe, und stelle fest, dass ich mit diesem Haarschnitt härter – und kälter – wirke als vorher. »Ich muss allerdings zugeben, dass ich mich selbst kaum wiedererkenne«, füge ich mit einem halben Lachen hinzu. Ich stehe mitten im Badezimmer, nur bekleidet mit Boxershorts. Nie zuvor war ich schlanker und sehniger, noch nie haben sich die Linien meiner Muskeln deutlicher abgezeichnet; mein Körper wirkt roh und wild und mit dem kruden Haarschnitt fast unzivilisiert – und ich bin mir selbst so fremd, dass ich den Blick abwenden muss.
Juliette steht jetzt dicht vor mir.
Ihre Hände legen sich auf meine Hüften, ziehen mich vorwärts; ich komme ins Stolpern. »Was machst du?«, sage ich, aber als ich ihr in die Augen schaue, finde ich dort Zärtlichkeit und Fürsorge. Etwas in mir beginnt zu schmelzen. Meine Schultern entspannen sich, und ich hole tief Luft, als ich Juliette in die Arme nehme.
»Wann sprechen wir darüber?«, murmelt sie an meiner Brust. »Über alles? Alles, was geschehen ist –«
Ich zucke innerlich zusammen.
»Aaron.«
»Mir geht’s gut«, lüge ich. »Sind nur Haare.«
»Du weißt, dass ich das nicht meine.«
Ich wende den Blick ab. Starre ins Leere. Wir bleiben beide stumm.
Schließlich bricht Juliette das Schweigen.
»Bist du böse auf mich?«, flüstert sie. »Weil ich ihn erschossen habe?«
Ich erstarre.
Sie sieht mich mit großen Augen an.
»Nein – nein.« Ich sage die Worte zu schnell, meine sie aber. »Nein, natürlich nicht. Darum geht es nicht.«
Juliette seufzt.
»Ich bin mir nicht sicher, ob dir das bewusst ist«, sagt sie, »aber es ist vollkommen in Ordnung, um seinen Vater zu trauern, auch wenn er ein schrecklicher Mensch war, weißt du?« Sie betrachtet mich forschend. »Du bist kein Roboter.«
Ich schlucke heftig, um den Kloß in meinem Hals loszuwerden, und löse mich behutsam aus ihren Armen. Küsse sie auf die Wange, verharre einen Moment in dieser Haltung. »Ich muss jetzt duschen.«
Juliette sieht unglücklich und verwirrt aus, aber ich weiß nicht, was ich ansonsten tun könnte. Ich liebe es, sie in meiner Nähe zu haben, aber im Moment sehne ich mich nur nach Alleinsein.
Also dusche ich. Nehme später ein Bad. Gehe spazieren.
So mache ich das schon seit Tagen.
Als ich später ins Bett komme, schläft Juliette schon.
Ich möchte sie an mich ziehen, ihren weichen, warmen Körper spüren, fühle mich aber wie gelähmt. Diese grauenvolle Halbtrauer stürzt mich in dunkle Abgründe. Ich habe Angst, die anderen könnten glauben, ich würde das Handeln meines Vaters gutheißen. Um nicht missverstanden zu werden, kann ich also nicht zugeben, dass ich dennoch um diesen grausamen Mann trauere, der mich großgezogen hat. Und weil mir der gesunde Weg deshalb versperrt bleibt, bin ich seit dem Tod meines Vaters wie versteinert.
Bist du böse auf mich? Weil ich ihn erschossen habe?
Ich habe ihn gehasst.
Ich habe ihn mit einer so heftigen Intensität gehasst wie niemand anderen. Aber das Feuer glühenden Hasses wird wohl auch genährt vom Sauerstoff der Zuneigung. Ich könnte nicht so intensiv leiden und hassen, wenn ich nicht auch geliebt hätte.
Und das – die unerwiderte Liebe zu meinem Vater – war immer meine größte Schwäche. Deshalb liege ich nun hier, durchtränkt von einem Kummer, über den ich nicht sprechen kann, während Reue mein Herz auffrisst.
Ich bin Waise.
»Aaron?«, flüstert Juliette, und ich kehre zurück in die Realität.
»Ja, Süße?«
Schläfrig dreht sie sich zu mir und stupst mit dem Kopf meine Schulter an. Ich lächle, als ich sie an mich ziehe. Sie nimmt den leeren Platz an meiner Brust ein, drückt ihr Gesicht an meinen Hals, legt einen Arm um meine Hüfte. Ich schließe die Augen wie beim Gebet, und mein Herz schlägt wieder normal.
»Du fehlst mir«, flüstert sie so leise, dass ich sie kaum hören kann.
»Ich bin doch da«, erwidere ich und berühre sachte ihre Wange. »Ich bin hier, Liebste.«
Sie schüttelt den Kopf. Und das tut sie auch noch, während sie in meinen Armen langsam einschlummert.
JULIETTE
Ich frühstücke allein heute Morgen – bin aber nicht einsam.
Der Frühstücksraum ist voller Menschen, die ich kenne, und alle haben irgendetwas nachzuholen: Schlaf; Arbeit; Unterhaltungen. Die Energielevel hier sind immer abhängig von den Koffeinmengen, die wir intus haben, und im Moment ist noch alles ziemlich ruhig.
Brendan, der schon die ganze Zeit bei einem einzigen Becher Kaffee sitzt, winkt mir zu. Ich erwidere das Winken. Brendan ist der Einzige von uns, der kein Koffein braucht; seine Gabe, Elektrizität zu erzeugen, wirkt in seinem eigenen Körper wie ein Generator. Er sprüht immer förmlich vor Energie, und allein sein schlohweißes Haar und die eisblauen Augen wirken auf andere elektrisierend, sogar auf Abstand. Allmählich glaube ich, dass Brendan überhaupt nur Kaffee trinkt, um Winston Gesellschaft zu leisten, der ohne Koffein wahrscheinlich nicht lebensfähig wäre. Die beiden sind zurzeit unzertrennlich – obwohl Brendans Aufgedrehtheit Winston manchmal nervt.
Die beiden haben schon viel zusammen durchgemacht. Wir alle.
Brendan und Winston sitzen mit Alia zusammen, die ihr Skizzenbuch neben sich liegen hat und zweifellos irgendeine fantastische neue Gerätschaft entwickelt, die uns im Kampf nützlich sein kann. Ich bin zu müde, um mich aufzuraffen, ansonsten würde ich zu den anderen gehen; stattdessen stütze ich den Kopf in die Hand und betrachte dankbar meine Freunde. Die Narben in Brendans und Winstons Gesicht erinnern mich allerdings an eine Zeit, an die ich lieber nicht mehr denken möchte – eine Zeit, in der wir glaubten, die beiden verloren zu haben. Und auch noch zwei andere Freunde. Diese Gedanken sind mir plötzlich zu düster fürs Frühstück. Ich wende den Blick ab. Trommle mit den Fingern auf den Tisch.
Ich bin mit Kenji zum Frühstück verabredet – so beginnen wir immer gemeinsam unseren Arbeitstag – und habe mir deshalb noch nichts zu essen geholt. Jetzt knurrt mein Magen lautstark, weil Kenji zu spät kommt. Die anderen machen sich über köstlich duftende Stapel Pancakes her. Das gesamte Angebot sieht verlockend aus: dampfende Berge Bratkartoffeln, Schalen mit frischem Obstsalat, kleine Krüge mit Ahornsirup. Der Tod von Anderson und die Übernahme von Sektor 45 haben jedenfalls dafür gesorgt, dass wir hier besseres Frühstück bekommen. Aber das wissen vielleicht gar nicht alle richtig zu schätzen.
Warner frühstückt nie mit uns. Er arbeitet eigentlich dauernd, macht nicht mal Pausen, um zu essen. Frühstück ist für ihn nur ein weiterer Termin für Arbeitsgespräche, er nimmt es allein mit Delalieu ein. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob Warner dann überhaupt etwas isst. Er genießt Essen nicht, sondern empfindet es als – eher lästige – Nahrungsaufnahme, die notwendig ist, damit sein Körper weiterfunktioniert. Einmal, als er beim Abendessen in irgendwelche wichtigen Papiere vertieft war, habe ich ihm einen Keks auf den Teller vor ihm gelegt, nur um zu sehen, was dann passieren würde. Er blickte zu mir hoch, dann wieder auf die Papiere, murmelte danke, und verspeiste den Keks mit Messer und Gabel. Dabei schien er ihn nicht einmal bewusst zu schmecken. Womit Warner das komplette Gegenteil von Kenji ist, der Essen liebt, ständig irgendetwas futtert und mir nach der Szene sagte, bei diesem Anblick wäre er fast in Tränen ausgebrochen.
Apropos Kenji: dass er heute Früh mir gegenüber so ausgeflippt ist, sieht ihm gar nicht ähnlich und macht mir Sorgen. Als ich gerade zum dritten Mal auf meine Uhr schaue, steht plötzlich Adam an meinem Tisch. Er wirkt, als sei ihm unbehaglich.
»Hi«, sage ich, etwas zu laut. »Was, ähm, was gibt’s?«
Wir sind uns in den letzten Wochen ein paarmal begegnet, aber immer nur durch Zufall. Dass Adam jetzt vor mir steht, ist eigenartig, und ich bin so verblüfft, dass mir einiges erst auf den zweiten Blick auffällt:
Er sieht gar nicht gut aus.
Erledigt. Vernachlässigt. Extrem erschöpft. Hat er etwa geweint? Ich hoffe, nicht wegen unserer gescheiterten Beziehung.
Dennoch regen sich meine Instinkte, uralte Gefühle werden wach.
Wir sprechen gleichzeitig.
»Alles … in Ordnung mit dir?«, frage ich.
»Castle möchte dich sprechen«, antwortet Adam.
»Castle hat dich geschickt, um mich zu holen?«, sage ich. Die Gefühle sind schlagartig vergessen.
Adam zuckt mit den Schultern. »Bin wahrscheinlich gerade im passenden Moment an seiner Tür vorbeigekommen.«
»Ah. Okay.« Ich bemühe mich um ein Lächeln. Castle kann die Spannung zwischen Adam und mir nicht ertragen und versucht immer wieder, für Versöhnung zu sorgen. »Hat er gesagt, dass ich sofort zu ihm kommen soll?«
»Ja.« Adam nickt und steckt die Hände in die Hosentaschen. »Jetzt gleich.«
»Okay«, sage ich. Das Ganze kommt mir seltsam vor. Adam bleibt reglos stehen, während ich meine Sachen nehme, und ich will ihm eigentlich sagen, dass er weggehen soll, dass er aufhören soll, mich anzustarren, dass das lästig ist, dass wir uns getrennt haben, was extrem unangenehm und bizarr war, und zwar wegen ihm. Aber dann merke ich, dass er gar nicht mich anstarrt. Er schaut auf den Boden, als sei er vollkommen geistesabwesend.
»Hey – ist wirklich alles in Ordnung mit dir?«, frage ich, diesmal sanfter.
Adam blickt abrupt auf. »Was?«, sagt er. »Was, ähm – oh, ja, klar, mir geht’s gut. Hey, weißt du, dass, ähm –«, er räuspert sich, blickt um sich, »hast du, ähm –«
»Was denn?«
Adam wippt auf den Fersen vor und zurück, sein Blick schweift durch den Raum. »Warner ist nie zum Frühstück hier, oder?«
Ich ziehe erstaunt die Augenbrauen hoch. »Du suchst Warner?«
»Was? Nein. Ich frage mich nur, ähm, warum er nie hier ist. Das finde ich seltsam.«
Ich starre Adam an.
Er bleibt stumm.
»So seltsam ist das nicht«, sage ich langsam und betrachte ihn forschend. »Warner hat keine Zeit, um mit uns zu frühstücken. Er arbeitet dauernd.«
»Ach«, sagt Adam, wirkt irgendwie enttäuscht. »Schade.«
»Findest du?«, frage ich stirnrunzelnd.
Aber das scheint Adam nicht mehr zu hören. Er ruft nach James, der daraufhin sein Frühstückstablett wegbringt. Die beiden treffen sich in der Mitte des Raums und gehen zusammen raus.
Ich habe nicht die geringste Ahnung, was die zwei Brüder den ganzen Tag lang machen. Ich habe nie gefragt.
Das Rätsel von Kenjis Abwesenheit beim Frühstück klärt sich in dem Moment auf, als ich auf die offene Tür zu Castles behelfsmäßigem Büro zugehe: Die beiden sind in einer Unterredung.
Ich klopfe höflich an die offene Tür. »Hallo«, sage ich. »Sie wollten mich sprechen?«
»Ja, ja, Ms Ferrars«, antwortet Castle eifrig. Er steht auf und winkt mich zu sich. »Nehmen Sie Platz. Ach, und schließen Sie bitte vorher die Tür.«
Ich bin schlagartig nervös.
Nachdem ich die Tür zugemacht habe, gehe ich etwas zögernd auf die beiden zu. Kenjis ausdruckslose Miene trägt nicht zu meiner Beruhigung bei.
»Was ist los?«, frage ich. »Wieso warst du nicht beim Frühstück?«
Castle deutet wortlos auf den freien Stuhl.
Ich setze mich.
»Ms Ferrars«, sagt er drängend. »Sie haben eine Nachricht aus Ozeanien?«
»Wie bitte?«
»Die Zusage. Sie haben die erste Zusage für die Konferenz erhalten, nicht wahr?«
»Ja, das stimmt«, antworte ich langsam. »Aber das kann eigentlich noch niemand wissen – ich wollte es Kenji heute Morgen beim Frühstück erzählen –«
»Unsinn«, fällt Castle mir ins Wort. »Jeder weiß darüber Bescheid. Mr Warner weiß es garantiert. Und Lieutenant Delalieu.«
»Was?« Ich sehe Kenji an, der nur mit den Schultern zuckt. »Wie ist das möglich?«
»Seien Sie doch nicht so schnell geschockt, Ms Ferrars. Ihre Korrespondenz wird zweifellos überwacht.«
Ich starre ihn erstaunt an. »Was?«
Castle macht eine ungeduldige Handbewegung. »Zeit ist kostbar, könnten Sie also vielleicht –«
»Zeit ist immer kostbar«, erwidere ich gereizt, »aber wie soll ich hilfreich sein, wenn ich nicht weiß, wovon Sie reden?«
Castle massiert seinen Nasenrücken. »Kenji«, sagt er dann unvermittelt, »würden Sie uns bitte alleine lassen?«
»Na klar.« Kenji springt auf und salutiert übertrieben. Als er zur Tür eilen will, halte ich ihn am Arm fest.
»Warte«, sage ich. »Was geht hier vor sich?«
»Ich hab keinen blassen Schimmer, Mädel«, sagt Kenji lachend und befreit seinen Arm. »Ich habe nichts zu tun mit eurer Unterredung. Castle hat mich vorhin reingerufen, um mit mir über Kühe zu reden.«
»Kühe?«
»Ja, du weißt schon, oder?« Er zieht eine Augenbraue hoch. »Diese Nutztiere. Ich hatte von Castle den Auftrag bekommen, Hunderte Hektar Farmland auszukundschaften, das vom Reestablishment geheim gehalten wurde. Da gibt’s jede Menge Kühe.«
»Wie spannend.«
»Ist es tatsächlich«, sagt Kenji mit leuchtenden Augen. »Durch das Methan kann man sie ganz leicht aufspüren. Ich frage mich ja, warum die nicht irgendwas unternehmen, um das zu verhindern –«
»Methan?«, frage ich verwirrt. »Ist das nicht so was wie ein Gas?«
»Mit Kuhscheiße kennst du dich wohl nicht gut aus, wie?«
Ich reagiere nicht darauf, sondern sage stattdessen: »Deshalb warst du heute Morgen nicht beim Frühstück? Weil du dir Kuhkacke angeguckt hast?«
»So ähnlich, ja.«
»Na, das erklärt jedenfalls den Geruch«, bemerke ich.
Kenji braucht einen Moment, bis er das kapiert hat, dann verengt er die Augen und tippt mir mit dem Zeigefinger auf die Stirn. »Du wirst in der Hölle landen, das ist dir klar, oder?«
Ich grinse breit. »Sehen wir uns nachher? Ich will noch unseren Morgenspaziergang mit dir machen.«
Kenji gibt ein lustloses Grunzen von sich.
»Na, komm schon«, sage ich. »Es wird diesmal spaßig, ich versprech’s dir.«
»Na klar, das pure Vergnügen.« Kenji verdreht die Augen und salutiert noch mal lässig mit zwei Fingern. »Bis später, Sir.«
Castle nickt ihm lächelnd zu.
Während Kenji zur Tür geht und sie hinter sich zuzieht, verändert sich Castles Miene. Das freundliche Lächeln, der Eifer: verschwunden. Jetzt, da wir nur noch zu zweit sind, wirkt er beunruhigt, ernst, vielleicht sogar etwas … ängstlich?
Und kommt sofort zur Sache.
»Als Sie die Zusage erhalten haben – wie war sie formuliert? Ist Ihnen irgendetwas daran aufgefallen?«
»Nein«, antworte ich stirnrunzelnd. »Ich weiß nicht. Aber wenn meine Korrespondenz ohnehin überwacht wird – dann müssten Sie das doch schon wissen, oder?«
»Natürlich nicht! Ich bin ja nicht die Person, die das macht.«
»Wer denn dann? Warner?«
Castle sieht mich nur an, ohne die Frage zu beantworten. »Ms Ferrars, diese Nachricht ist absolut außergewöhnlich.« Er zögert. »Vor allem, da es die erste Zusage ist, die Sie bekommen haben.«
»Okay«, sage ich unsicher. »Was ist denn so außergewöhnlich daran?«
Castle schaut auf seine Hände, dann zur Wand. »Wie viel wissen Sie über Ozeanien?«
»Wenig.«
»Wie wenig?«
Ich zucke die Schultern. »Auf einer Landkarte kann ich draufzeigen.«
»Sie waren noch nie dort?«
»Ist das Ihr Ernst?« Ich werfe ihm einen verblüfften Blick zu. »Selbstverständlich nicht. Ich war nirgendwo, haben Sie das vergessen? Meine Eltern haben mich aus der Schule genommen. Mich in Heimen untergebracht. Und am Ende in die Psychiatrie sperren lassen.«
Castle atmet tief ein. Schließt die Augen, während er langsam sagt: »Ist Ihnen noch irgendetwas Besonderes in Erinnerung von der Nachricht, die Sie vom Obersten Befehlshaber von Ozeanien bekommen haben?«
»Nein«, antworte ich. »Ich wüsste nicht, was.«
»Wirklich nichts?«
»Na ja, sie war vielleicht ein bisschen informell. Aber ich glaube nicht, dass –«
»Inwiefern informell?«
Ich schaue beiseite und überlege. »Die Nachricht war sehr kurz«, sage ich schließlich. »Lautete nur Bin gespannt, Sie zu sehen, ohne weitere Worte.«
»Bin gespannt, Sie zu sehen?«, wiederholt Castle stirnrunzelnd.
Ich nicke.
»Nicht, Sie zu treffen«, sagt er, »sondern, Sie zu sehen.«
Ich nicke erneut. »Wie gesagt: ziemlich informell. Aber sie klang zumindest höflich. Was ich eigentlich für ein gutes Zeichen halte.«
Castle seufzt tief, während er sich in seinem Bürostuhl zur Wand dreht, die Fingerspitzen unter dem Kinn aneinandergelegt. Ich betrachte die scharfen Linien seines Profils, während er leise sagt:
»Ms Ferrars, wie viel hat Mr Warner Ihnen über das Reestablishment berichtet?«
WARNER
Ich sitze allein im Konferenzraum, streiche mir gedankenverloren über die ungewohnt kurzen Haare, als Delalieu hereinkommt. Er zieht einen kleinen Kaffeewagen hinter sich her, das vertraute vage Halblächeln auf den Lippen, das immer beruhigend auf mich wirkt. Unsere Arbeitstage sind in letzter Zeit noch anstrengender als sonst; zum Glück hatten wir keine Gelegenheit, über die jüngsten Ereignisse zu reden, und ich bezweifle auch, dass wir es jemals tun werden.
Dafür bin ich aufrichtig dankbar.
Hier, zusammen mit Delalieu, befinde ich mich in meinem geschützten Raum, in dem ich so tun kann, als hätte sich kaum etwas geändert in meinem Leben.
Ich bin immer noch Oberkommandeur und Regent der Soldaten von Sektor 45; es ist immer noch meine Pflicht, diejenigen zu aktivieren und anzuführen, die mit uns gegen den Rest des Reestablishment rebellieren. Und diese Rolle ist mit Verantwortung verbunden. Wir mussten viel umstrukturieren, während wir unsere nächsten Schritte koordinierten, und dabei war mir Delalieu eine unverzichtbare Stütze.
»Guten Morgen, Sir.«
Ich nicke zum Gruß, während er für uns beide Kaffee einschenkt. Jemand vom Rang eines Lieutenant müsste sich eigentlich nicht selbst bedienen, aber wir ziehen es vor, unter uns zu sein.
Ich trinke einen Schluck von der schwarzen Flüssigkeit – in letzter Zeit habe ich Gefallen an dem bitteren Geschmack gefunden – und lehne mich auf meinem Stuhl zurück. »Neuigkeiten?«
Delalieu räuspert sich.
»Ja, Sir«, antwortet er und stellt rasch seine Tasse ab, wobei etwas Kaffee überschwappt. »Sogar einige von heute Morgen, Sir.«
Ich lege abwartend den Kopf schräg.
»Die Arbeiten am neuen Hauptquartier machen gute Fortschritte. Wir rechnen damit, dass sie innerhalb der nächsten zwei Wochen abgeschlossen sind. Und die Privaträume werden bereits ab morgen beziehbar sein.«
»Gut.« Unser neues Team unter der Leitung von Juliette besteht aus vielen Mitgliedern mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen, und mit Ausnahme von Castle, der sich im Obergeschoss sein kleines behelfsmäßiges Büro eingerichtet hat, nutzen bislang alle meine privaten Trainingsräume als Hauptquartier. Anfänglich war mir das als praktische Idee erschienen, aber der Trainingsbereich ist nur durch meine Wohnräume zugänglich; und da sich jetzt alle überall frei bewegen können, tauchen sie ständig unangekündigt in meiner Wohnung auf.
Was mich natürlich zum Wahnsinn treibt.
»Was noch?«, frage ich.
Delalieu blickt auf seine Liste und antwortet: »Es ist uns endlich gelungen, die Unterlagen Ihres Vaters zu sichern, Sir. Wir haben ziemlich lange gebraucht, um sie aufzuspüren und hierherzuschaffen. Die Kisten befinden sich jetzt in Ihrem Schlafzimmer, Sir, und können nach Belieben von Ihnen gesichtet werden. Ich dachte mir –«, er räuspert sich, »dass Sie diese persönlichen Dinge vielleicht durchsehen wollen, bevor sie in den Besitz unserer neuen Oberbefehlshaberin übergehen.«
Eine bleiernes, eiskaltes Grauen erfasst mich.
»Ich fürchte, es ist eine ganze Menge, Sir«, fährt Delalieu fort. »Seine gesamten täglichen Aufzeichnungen. Jeder Bericht, den er abgeheftet hat. Wir haben sogar einige seiner privaten Tagebücher gefunden.« Delalieu zögert. Dann fügt er in einem Tonfall hinzu, den nur ich deuten kann: »Ich hoffe sehr, dass seine Aufzeichnungen Ihnen nützlich sein werden.«
Ich schaue auf, unsere Blicke begegnen sich. In Delalieus Augen sehe ich Besorgnis. Fürsorge.
»Danke«, sage ich leise. »Daran hatte ich nicht mehr gedacht.«
Ein unbehagliches Schweigen tritt ein, und einen Moment lang scheinen wir beide nicht zu wissen, was wir sagen sollen. Wir haben bislang kein einziges Wort über den Tod meines Vaters gesprochen. Den Tod von Delalieus Schwiegersohn. Dem schrecklichen Ehemann seiner verstorbenen Tochter, meiner Mutter. Wir sprechen nie darüber, dass Delalieu mein Großvater ist. Die einzige Vaterfigur, die ich noch habe.
Das vermeiden wir.
Deshalb klingt Delalieus Stimme seltsam gepresst, als er schließlich weiterspricht.
»Ozeanien hat, wie Sie sicher gehört haben, Sir, zugesagt, an einer Konferenz mit unserer neuen Oberbefehlshaberin teilzunehmen –«
Ich nicke.
»Aber die anderen«, fügt er hastig hinzu, »werden die Einladung nicht beantworten, solange sie nicht vorher mit Ihnen gesprochen haben, Sir.«
Ich sehe ihn abwartend an.
»Sie –«, Delalieu räuspert sich erneut, »nun ja, Sir, wie Sie wissen, sind die allesamt alte Freunde der Familie, und sie … tja, also –«
»Ja«, flüstere ich. »Natürlich.«
Ich wende den Blick ab, starre auf die Wand. Mein Gesicht fühlt sich plötzlich wie versteinert an. Insgeheim hatte ich mit so etwas gerechnet. Aber nach zwei Wochen hatte ich begonnen zu hoffen, dass sich vielleicht niemand von ihnen mehr rühren würde. Es gab keinerlei Kontakt mit diesen alten Freunden meines Vaters, keine Kondolenzbezeugungen, keine weißen Rosen, keine Trauerkarten. Keine Post – wie es früher täglich üblich gewesen war – von den Familien, die ich seit meiner Kindheit kenne, den Familien, die für die verwüstete Welt verantwortlich sind, in der wir jetzt leben. Ich hatte mich der Hoffnung hingegeben, dass man mich in Ruhe lassen würde.
Was offenbar nicht der Fall ist.
Offenbar ist Hochverrat nicht schwerwiegend genug, um in Ruhe gelassen zu werden. Offenbar waren die täglichen Schreiben meines Vaters, in denen er sich über meine »groteske Obsession mit einem Experiment« ereiferte, nicht Grund genug, um mich aus dieser Gruppe zu verstoßen. Er beklagte sich gern wortreich über mich, mein Vater, ließ sich bei seinen alten Freunden – den einzigen lebenden Menschen, die ihn von Angesicht zu Angesicht kannten – gern über sein Missfallen und seinen Abscheu aus. Und tagtäglich demütigte er mich vor allen anderen. Verhöhnte meine Welt, meine Gedanken und Gefühle als nichtig und wertlos. Täglich häuften sich die Schreiben in meinem Posteingang, endlose Tiraden von diesen Freunden meines Vaters, in denen ich angefleht wurde, Vernunft anzunehmen, wie sie es nannten. Mich zu beherrschen. Meine Familie nicht mehr zu blamieren. Auf meinen Vater zu hören. Endlich erwachsen zu werden, mich wie ein Mann zu verhalten, aufzuhören, um eine todkranke Mutter zu weinen.
Nein, diese Leute werden mich wohl nicht in Ruhe lassen. Die Bindungen sind zu stark.
Ich kneife die Augen zusammen, um die Gesichter aus meinem Gedächtnis zu verdrängen, diese Erinnerungen aus meiner Kindheit, und sage: »Teilen Sie denen mit, dass ich mich melden werde.«
»Das wird nicht nötig sein, Sir«, erwidert Delalieu.
»Wie bitte?«
»Ibrahims Kinder sind bereits unterwegs.«
Ich fühle mich schlagartig wie gelähmt.
»Was meinen Sie damit?«, sage ich aufgebracht. »Unterwegs wohin? Hierher?«
Delalieu nickt.
Mir wird glühend heiß, und als ich abrupt aufspringe, muss ich mich am Tisch festhalten. »Wie können die es wagen«, sage ich mit mühsam beherrschter Wut. »Diese Missachtung … die haben keinerlei Berechtigung –«
»Ja, Sir, ich verstehe, Sir«, sagt Delalieu, der jetzt sehr verstört aussieht, »es ist nur … wie Sie wissen … so verhalten sich die führenden Familien seit jeher, Sir. Eine altehrwürdige Tradition. Eine Weigerung meinerseits wäre als offener Akt von Feindseligkeit gedeutet worden – und die Oberste hat mich angewiesen, so lange wie möglich diplomatisch zu bleiben, deshalb dachte ich, dass … ich … ich dachte mir … Ach, das tut mir so leid, Sir –«
»Sie ahnt nicht, mit wem sie es zu tun hat«, sage ich scharf. »Mit diesen Leuten ist kein diplomatischer Umgang möglich. Unsere neue Oberste konnte das nicht wissen, aber Sie«, ich bin jetzt eher verletzt als wütend, »hätten das wissen müssen. Ein Krieg hätte sich gelohnt, um die jetzt bevorstehende Situation zu vermeiden.«
Ich sehe Delalieu nicht an, als er mit zitternder Stimme erwidert: »Es tut mir unendlich leid, Sir.«
Eine altehrwürdige Tradition, in der Tat.
Das Recht auf unangekündigte Besuche gilt schon seit langer Zeit. Die Familien der Obersten Befehlshaber waren auch ohne vorherige Einladung im Land der anderen jederzeit willkommen. Als die Bewegung sich in den Anfängen befand und wir Kinder klein waren, hielten die Familien fest zusammen. Und inzwischen regieren diese Familien – und ihre Kinder – die Welt.
So sah mein Leben lange Zeit aus. Am Dienstag ein Spieltreffen in Europa; am Freitag ein Dinner in Südamerika. Und unsere Eltern allesamt wahnsinnig.
Meine einzigen Freunde hatten Eltern, die noch verrückter waren als meine. Ich habe nicht das geringste Bedürfnis, irgendjemanden von denen jemals wiederzusehen.
Und dennoch –
Großer Gott, ich muss Juliette warnen.
»Und was die … die Zivilisten angeht, Sir«, spricht Delalieu weiter, »habe ich auf Ihre … Ihre Anweisung mit Castle besprochen, wie man den Umzug aus den Siedlungen am besten –«
Doch der Rest des Morgens vergeht für mich wie in einem Nebel.
Als es mir schließlich gelingt, Delalieu loszuwerden, gehe ich auf direktem Weg in meine Wohnung. Um diese Tageszeit hält Juliette sich normalerweise dort auf, und ich will sie möglichst schnell sprechen, um sie zu warnen, bevor es zu spät ist.
Doch ich komme nicht dazu.
»Ähm, hallo –«
Ich schaue auf und bleibe abrupt stehen. Versuche mir mein Erstaunen nicht anmerken zu lassen.
»Kent«, sage ich leise.
Mit einem einzigen Blick erfasse ich, dass es ihm nicht gut geht. Er sieht sogar richtig schlimm aus. Dünner denn je; dunkle Schatten unter den Augen. Angegriffen und erschöpft.
Ich frage mich, ob ich wohl auf ihn auch so wirke.
»Ich wollte fragen«, beginnt er, wendet den Blick ab, presst die Lippen zusammen. Dann räuspert er sich. »Also, ich wollte –«, noch ein Räuspern, »fragen, ob wir mal reden könnten.«
Ich spüre einen unangenehmen Druck auf der Brust. Starre Kent an, registriere seine angespannten Schultern, die strähnigen Haare, die abgekauten Fingernägel. Er bemerkt meinen Blick und steckt die Hände rasch in die Hosentaschen, schaut beiseite.
»Reden«, bringe ich mühsam hervor.
Er nickt.