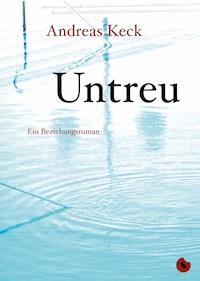5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Periplaneta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
„Schneeblind“ erzählt von einem jungen Menschen, der nicht in das Leben eintreten will. Matthias ist vierundzwanzig und wurde gerade in die Psychiatrie eingeliefert. Mit seinen eigenen Worten erzählt er, wie es dazu kam. Der Komik und dem Zynismus seiner Ausführungen ist dabei ein deutliches Maß an Tragik abzufühlen. Und so muss er als vollkommen untypischer Patient seine Nische und seine Rolle finden, mit der er die Zeit in der Klinik überbrücken kann. Im Laufe der Zeit jedoch findet er zusehends Gefallen an der Kuriosität seiner Mitpatienten, ihren schauerlichen oder wunderbaren Lebensgeschichten. Und er verliebt sich in Anna, die eigentlich auch nicht verrückt ist. Anstatt diesem „verrückt sein“ zu entgehen, will Matthias der Welt seinen Stempel aufdrücken. Er droht zu scheitern, aber er leugnet dies und sein Leugnen ist gewaltig. Er begeistert, polarisiert, irritiert und schafft es immer wieder, der gewohnten Realität ein Schnippchen zu schlagen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Ähnliche
„Baby save up all your tears,
you might need them some day!“
Gloria Estefan, `Cry in the Night´
Andreas Keck: Schneeblind Ein Patientenroman
© Periplaneta - Verlag und Mediengruppe
Edition Periplaneta, Dezember2011
Inh. Marion Alexa Müller, Postfach: 580 664, 10415 Berlin
www.periplaneta.com
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Übersetzung, Vortrag und Übertragung, Vertonung, Verfilmung, mechanische, elektronische oder fotografische Vervielfältigung, eine kommerzielle Verwertung des Inhaltes, gleich welcher Art, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags.
Ungekürzte, digitale Ausgabe der Printausgabe (ISBN 978-3-940767-04-2).
E-Book-Version: 1.3
Lektorat: Jasmin Bär, Marion Alexa Müller Titelbild: Thomas Manegold, Marion Alexa Müller Zeichnungen: Andreas Keck Satz, Konvertierung: Thomas Manegold, Johannes Schönfeld
Umschlaggestaltung: Thomas Manegold
Andreas Keck
Schneeblind
Ein Patientenroman
periplaneta
I
Ich sehe keinen Sinn darin, zu erklären, warum ich hier bin. Am Ende sagten einfach alle, du musst hierher, anders geht’s nicht mehr weiter, mit dir – mit mir.
Und jetzt bin ich eben hier. In einer psychiatrischen Klinik. Einer Anstalt. Einem Irrenhaus. Schweigen. Keiner antwortet.
Soll ich weitererzählen? Ja? In Ordnung.
Es ist eine Universitätsklinik. Angegliedert an eine Uni. Das heißt, hier wird Psychologie studiert. Erstes Semester, zweites Semester, drittes... In dem war ich auch, im Dritten. Als es losging. Aber ich studierte nicht Psychologie, sondern Zoologie. Hier in München. Komme eigentlich vom Land, mittlere Kleinstadt. Zwei Autostunden entfernt von München. Wo ich jetzt einsitze. Aber ich bin ja freiwillig hier. Könnte jederzeit wieder gehen. Müsste das nur mit Doktor Fink absprechen, meinem Psychiater.
Richtige Psychologen gibt’s hier nicht. Nur Psychiater. Aber Doktor Fink ist anders. Er ist feinsinniger. Als diese Metzger. Die sonst hier herumstolzieren. Auf den Catwalks der Normalität. Das sind Chemiker hier, keine... Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall sind sie normal, und ich bin es nicht. Und ich beneide sie dafür. Oh Gott, wie ich sie dafür beneide.
Und dann natürlich erst meinen Arzt, Doktor Fink, vielleicht sieben Jahre älter als ich. Ich bin vierundzwanzig. Und ich schwöre bei Gott, oder was mir heilig ist, ich weiß es nicht, das ist ja mein Problem, auf jeden Fall schwöre ich, oder besser gesagt, es ist einfach eine Tatsache, dass ich dreiundzwanzig Jahre lang kein Problem hatte.
Normale Probleme schon, alltägliche. Aber nichts Psychisches. Depressionen oder so was. Nichts davon. Was ist das!? Ich hatte Heuschnupfen, o.k., aber das war alles. Und Heuschnupfen ist, glaub ich, nicht psychosomatisch, oder. Zugegeben, ich hatte einen verfluchten Heuschnupfen. Es ging jeden März los und... O Gott, was tu ich hier. Einen schlimmeren Albtraum gab es für mich nicht, als Psychiatrie. Alles meinetwegen. Ein Arm weniger. Eine seltene Krankheit. Keine Eltern. Das wäre alles o.k. Aber nicht Irrsinn. Oder wie soll ich es nennen. Wahnsinn. Aber ich denke noch ganz klar. Bin auch nicht gerade dumm, oder wie soll man dazu sagen. War mal Schulbester.
Zum Abitur hin hat’s dann nachgelassen. Und für Jura hat’s dann nicht gereicht, der Notendurchschnitt. Da gab’s die hübschesten Studentinnen. In Jura. Ich sah mir die Unis an, bevor ich mich entscheiden wollte. Und München gefiel mir, als Stadt. War hübsch. Und Zoologie. Na ja. Ich hab mich immer schon für Tiere interessiert. Mein Vater erzählt immer, dass ich jedes noch so kleine Kriechtier entdeckte, auf unseren Spaziergängen, mein Vater und ich, wir machten häufig Spaziergänge, oder Wanderungen, wie auch immer.
Schrecklich schöne Gegend, da, wo ich herkomm’. Auf jeden Fall ist mir kein Insekt entgangen, meinen Augen. Und dann hob ich es auf, zeigte es meinem Vater und wickelte es in irgendwas ein. Meistens in das Taschentuch meines Vaters. Damals hatte man noch Stofftaschentücher. Und mein Vater hatte immer eins dabei. Sauber. Nur meistens ein bisschen knittrig. Und dann tat ich das Ganze vorsichtig in meine Hosentasche oder ich trug es die ganze Wanderung lang in der Hand und spürte, wie es summte oder surrte oder krabbelte. Und daheim tat ich’s dann in ein Aquarium, das ich mir flugs baute. Einrichtete. So, dass es möglichst schön aussah, wie die echte Natur eben, mit Farnen, Wurzeln, Steinen.
Und meist schon nach vier, fünf Tagen war das Tier dann tot. Ich wusste nie genau, was die genau fressen. Warf immer irgendwas hinein und wartete. Aber nirgends im Aquarium war es ausfindig zu machen, das Tier, meistens ein Insekt. Ich liebe Insekten. Und es war furchtbar, als es dann tot war. Na ja, wie komm ich jetzt darauf?! Ach so, ja, mein Vater, das Taschentuch, gerade musste ich mich schnäuzen, und es ist seins. Seine Initialen sind drauf. A. R.
Er hätte großes Vertrauen, mein Vater, in diesen Arzt, meinte er, als wir zum Vorstellungsgespräch hier waren, in Doktor Fink. Aber es war eigentlich kein Vorstellungsgespräch, sondern eher, wie könnte man sagen, eher ein Missverständnis. Also es war so, dass mein Bruder von einem befreundeten Medizinstudenten erfahren hatte, dass in München eine Klinik sei, in der es ein Verfahren gäbe, mit dem man feststellen könne, ob es, also das, worunter ich leide, ob das endogen oder exogen sei.
Exogen heißt von außen verursacht, also dass es äußere Gründe gibt, für meine Niedergeschlagenheit, wie zum Beispiel, dass meine Eltern gleichzeitig gestorben wären – was übrigens nicht der Fall war, auch nichts anderes. Es war einfach so passiert, über Nacht, aus heiterem Himmel.
Oder ob meine Sache endogen war. Das bedeutet, dass es von innen kommt, von einem Organ zum Beispiel. Denn dann wäre es gar nicht so schlimm. Dann wüsste man die Ursache und könnte gezielt dagegen vorgehen.
Und auf jeden Fall fuhren wir hin, nach München, mein Vater und ich, und gingen in die psychiatrische Universitätsklinik, Kirschbaumstraße 14, und fragten an der Rezeption nach diesem Verfahren. Der extrem massige Kerl hinter dem Glas schaute meinen Vater, der das Sprechen übernommen hatte, mit ungläubigem Blick an, und mein Vater, der ihn dann überfreundlich anlächelte und sich zehnmal entschuldigte, dass er es nicht genau wisse, dass er es eben nur gehört hätte, dass da ein Verfahren entwickelt worden sei, und er nannte es „Neues Verfahren“, ich erinnere mich noch genau, wie er sich herunterbeugte und dem Pförtner, der nichts verstand, höflich verkrampft lächelnd erklärte, „ein neues Verfahren“. Woraufhin der unsympathische Pförtner, der mir Angst machte, so von wegen Festbinden und Injizieren, vom Anblick meines verzweifelten Vaters erweicht, auf die Idee kam, dass wir erst mal im Ambulanzzimmer der Notaufnahme Platz nehmen sollten, da käme dann schon jemand, ein Arzt, der sicherlich Bescheid wüsste; und der Pförtner sah mich an, bevor er die Schließtür zur Notaufnahme frei schaltete, als wüsste er längst Bescheid, als bedürfe es keiner Untersuchung mehr, sondern wäre längst klar, dass es sich unmissverständlich um mich handelte, der untersucht werden sollte, und dass ich unmissverständlich ein Irrer war, ein psychisch Kranker, wie sie jeden Tag zu Hunderten an seinen Augen vorbei passierten, ihm, der zwar nicht schön anzusehen war und auch keine besondere Tätigkeit ausübte, der aber normal war und abends getrost nach Hause gehen konnte, was die anderen nicht konnten, die vielleicht zehnmal hübscher und intelligenter und beruflich erfolgreicher waren als er, aber eben nicht funktionstüchtig, wie er es war, funktionstüchtig.
Ich sah zurück auf den Pförtner, nachdem mir mein Vater einen aufmunternden und positiven Blick zugeworfen hatte, im Sinne von „Komm Junge, wir sind hier schon richtig, wir sind bald am Ziel, wir wissen bald, was mit dir los ist, es kann doch nichts Schlimmes sein, alles war immer in Ordnung, all die Jahre, das kriegen wir auch noch hin, schließlich leitete ich mal ein großes Aluminiumschmelzwerk und ich habe großes Vertrauen in diese Verfahrensweise und hörte, dass es die nur hier gibt, und München ist eine der fortschrittlichsten und modernsten Städte, und das ist eine Universitätsklinik und wir werden...
Auf jeden Fall warf ich einen kurzen Blick auf den fülligen und abschreckenden Pförtner und schmunzelte ihn an, versuchte zu schmunzeln, ihm zu zeigen, dass das ja alles eigentlich ein Witz war, dass ich ja genau wüsste, dass es kein Verfahren gäbe, und dass mein Vater ein netter und höflicher Spinner ist, der keine Ahnung hat, und dass ich überhaupt hier nicht hergehörte, und er mich nicht ein einziges Mal mehr wiedersehen würde.
Er erwiderte mein Schmunzeln nicht.
Und so saß ich mit meinem Vater auf der schmalen Bank eines Wartezimmers, in einem Gebäude, das mir mehr und mehr Angst machte, denn wenn es wirklich kein Verfahren gäbe, dann, dann könnten dieses Gebäude und dieses Personal mir eventuell zum schnellen Verhängnis werden. Dann könnte einer dieser Ärzte meinem Vater erklären, dass es gar keine Schande sei, einmal in der Psychiatrie gewesen zu sein, dass noch Betten frei wären, dass ich gleich heute Abend dableiben könnte.
Und genau so geschah es. Ein, auf meinen Vater besonders optimistisch wirkender, junger Arzt, Doktor Fink, erklärte, dass er nichts von einem solchen Verfahren wüsste und dass es in meinem Fall besser wäre...
Wir hätten wirklich Glück, meinte er im weiteren Verlauf der Unterredung, denn nachher um 15:oo Uhr sei Teambesprechung auf P 1, der Spezialabteilung für Depressionen, also Menschen, ähnlich wie ich, meinte er, die nicht zu den schwereren Fällen zählten.
Und bei dem Wort Spezialabteilung horchte mein Vater auf und sah mich hoffnungsvoll an. Und wir könnten beide teilnehmen, an der Teambesprechung, meinte Doktor Fink, und würden dann mehr erfahren. Dann könnte er auch noch mal genauer erfragen, ob doch vielleicht einer seiner Kolleginnen oder Kollegen etwas von diesem Verfahren wüsste.
Womöglich sei er einfach nicht genügend informiert.
In diesem Moment begann mein Gehirn zu arbeiten, hatte es sich doch die letzten Tage ausgiebig erholt. Gefahr! Alles ein Trick, beziehungsweise nicht ein Trick, denn dieser Arzt, dem ist wirklich Glauben zu schenken, aber mein Vater, dem beginnt dieser Arzt zu gefallen, wirklich zu gefallen, immer besser zu gefallen. Und als wir dann einen Stock höher in der Depressionsstation nun schon auf Stühlen, nicht mehr nur einer Holzbank warteten, bis im Konferenzraum die Interna des Teams besprochen wären, und wir vortreten könnten, als wir da so warteten, meinte mein Vater wohlwollend:
„Also dieser Arzt, wie heißt der noch mal?“
Und ich antwortete: „Ich glaube Spatz, oder Fink, ja Fink, Fink.“ „Ich glaube, Matthias, dieser Doktor Fink ist ein sehr tiefsinniger und feiner Mensch, der könnte doch was sein, oder. Weißt du, das wäre schon wichtig, wenn du hier bliebst.“
„Was Papa, hier bleiben?“
„Na, jetzt wart mal, er will ja fragen, nachher, wenn wir dabei sind, ob es dieses Verfahren wirklich nicht gibt, aber weißt du, sonst, wenn es das wirklich nicht gibt, dann weiß ich auch nicht mehr, was wir mit dir tun sollen. Zurück nach Krummbach fahren, ich weiß nicht, Matthias, du bist jetzt seit fünf Monaten bei uns zu Hause, seitdem du dein Studium abgebrochen hast, und es wird nicht besser. Es wird doch nicht besser, oder. Oder wird es besser.“
Ich saß da und hatte es gehört, in seiner Stimme, den Entschluss. Er war da. Er war längst gefasst. Und wenn ich nun nicht alle, aber wirklich auch alle Register ziehen würde, dann wäre es zu spät. „Herr Renert!“
Die Tür zum Konferenzraum wurde geöffnet und Doktor Fink kam einladend auf meinen Vater zu.
Nicht auf mich. Auf meinen Vater. Die beiden hatten sich gefunden. Sie waren ein Paar. Und er lächelte, mein Vater, er lächelte. Und Doktor Fink blieb ganz cool, ganz distanziert, professionell, was das Schlimmste war, denn dadurch wurde sein Eindruck auf meinen Vater nur noch verstärkt, sein guter Eindruck, sein äußerst guter Eindruck. Und er war wirklich gut, dieser Eindruck, auch auf mich, er wirkte vollkommen, dieser junge Arzt. Und gut sah er auch aus. Nicht nur gut, er sah zu allem Überfluss auch noch intellektuell aus, wie ein Philosoph, hager, ernsthaft, zu alt für sein Alter, schlank – Philosophen sind nie dick.
„Bitteschön!“
Wir nahmen Platz. Und Doktor Fink führte uns ein. Ich glaube, es war relativ unkonventionell, dass er uns einfach mitnahm, in eine Ärztebesprechung. Das war wahrscheinlich nicht der Normalfall, und ich hatte nicht die leiseste Ahnung, was dieser Doktor Fink nun vorhatte, was sein Plan war. Er stellte mich und meinen Vater kurz mit Namen vor und sagte dann, wir sollten doch am besten selbst vortragen, weswegen wir hier seien. Und er sah meinen Vater an, der sofort verstand, sich räusperte, auf einen Schlag furchtbar ernst dreinblickte, das gute Dutzend weißer Ärzte um uns herum kalkulierte und dann, wie in einer der Vorstandsitzungen seines Aluminiumschmelzwerkes, das er einst leitete, einführte:
„Also ja, ich erkläre es wirklich am besten selbst, weshalb wir hier sind.“
Und wie er so redete, hatte ich für einen kurzen Moment wieder die Gewissheit, es gäbe in der Tat ein neuartiges Verfahren, mit dessen Hilfe man mich im Anschluss an diese Unterredung untersuchen könnte, um dann genau festzustellen, was denn der Grund für meine nun schon fünf Monate lang anhaltende Verzweiflung sei.
Ich sah mir die Ärzte an, während mein Vater vorsprach, bemerkte, wie sie sein Äußeres musterten, seine Handbewegungen, seine Haltung, sah, dass sie mehr auf den Tonfall und die syntaktische Richtigkeit seiner Sätze achteten, als auf den Inhalt, und wusste, dass wir beide längst verloren hatten. Nur Doktor Fink sah meinen Vater noch ernstnehmend an.
Ich hatte das Gefühl, mein Vater verwechsle die Themen. Als schriebe er in diesem Moment die Abschlussprüfung seines Lebens, einen Aufsatz, und als wäre der eine eindeutige Themaverfehlung. Wir gehörten einfach nicht hierher. In diese Besprechung. Der Ärzteschaft. Mein Vater und ich. Und wie mein Vater redete. Er hat Kaufmann gelernt. Und so redete er auch. Natürlich schon wie ein Firmenchef, rhetorisch gewandt, zielsicher, gewinnversprechend, aber letztlich eben doch wie ein Kaufmann. Und nicht wie ein Wissenschaftler. Von denen hier zwölf versammelt waren. Und als er geendet hatte, sah er auffordernd, mit ernsthaft zusammengepressten Lippen seinen Doktor Fink an und wartete auf eine Antwort. Und Doktor Fink sagte, dass er nichts von einem solchen Verfahren wisse, aber womöglich wisse einer der Anwesenden Bescheid, darüber.
Schweigen. Hände gingen an Nasen, um peinlich berührt zu kratzen, Lippen wurden leicht bewegt, um den Anschein von Nachdenken zu geben. Und alle Blicke landeten schließlich bei einem Arzt, der am anderen Ende des Konferenztisches saß, und saugten sich an seinem Antlitz fest. Chefarzt Martens, schneeweißes Haar, riesiges Gesicht, ausufernde Augenbrauen. Er sammelte die Blicke seiner Untergebenen, fixierte dann mich, meinen Vater schlichtweg ignorierend, und sagte:
„Was ist denn Ihr Problem?“
„Mein Problem?!“ fragte ich verwundert.
„Ja!“
„Ich weiß es nicht. Also, ich meine, ich bin einfach, ich weiß nicht, was ich habe.“
Doktor Martens sah weiterhin nur mich an und fuhr fort:
„Sie wissen nicht, was Sie haben? Dann ist ja alles in Ordnung, oder?“ Und bei dem „oder“ sah er mich an wie Gott Vater selbst. Voller Wissen, Güte und Weisheit. Und diese wissende Güte gab mir zu verstehen:„Du musst keine Angst haben, jetzt komm erst mal zur Ruhe, wir werden uns um dich kümmern, am besten ist, du bleibst erst mal hier, hier bei uns, schau mich an, denkst du ich bin ein Ungeheuer oder die andern hier, wir sind Ärzte, und Ärzte sind gut, Ärzte helfen, und wir werden dir helfen, wenn du jetzt kooperierst, aber nur wenn du jetzt kooperierst.“
Ich sah ihn an, mit aller Entschlossenheit, die ich in meiner Situation noch aufbringen konnte, und das war eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass ich in dieser Situation jetzt schon seit etwa fünf Monaten bin, und dass diese Situation ein ununterbrochener Zustand von...., ich sah ihn an, mit letzter Kraft, und antwortete auf seine Aussage, dass dann ja alles in Ordnung sei?!, mit „Ja!!“ und lächelte. Und sah meinen Vater an und lächelte. Und ich meinte es wirklich ernst, in diesem Moment, sonst hätte ich nicht so siegessicher lächeln können, sagend, ich habe mich nur im Raum geirrt, im Gebäude, in der Stadt... wir sind auch gleich wieder weg, mein gutmeinender Vater und ich.
Und dann schwafelte ich irgendetwas von wegen Missverständnis bezüglich dieses Verfahrens, und dass wir doch eigentlich deswegen hier seien und aus keinem anderen Grund sonst, und dass es nicht nötig sei, dass ich hier bliebe, und säte so geschickt Verwirrung, dass am Ende Doktor Martens nichts anders übrig blieb, als mir und meinem Vater verständlich zu machen, dass wir natürlich heute wieder weggehen könnten, zusammen, dass es aber eigentlich ein Fehler sei, und dass es sich mein Vater genau überlegen solle, und ob Selbstmordgefahr bestünde, bei mir, und dass ich dann noch diese Erklärung hier unterzeichnen müsste:
Hiermit bestätige ich, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht den Wunsch verspüre, mich zu suizidieren, oder so ähnlich, denn falls ich das nicht unterzeichnete, hätten sie, das heißt die Klinik, eine gesetzliche Verpflichtung, mich hier zu behalten, bis dieser Wunsch – dieser innige Wunsch, oh ja, dieser innigste Wunsch – verschwunden sei.
Ich, na ja, ich unterschrieb und sah meinen Vater an, der bedenklich die Augenbrauen hob und furchtbar traurig aussah. Und er sagte vor versammelter Ärzteschaft: „Es ist deine Entscheidung, Matthias.“ Ach ja, genau, so heiße ich. Matthias. Es ist deine Entscheidung! Und ich nickte und nickte nur, und tat so, als wäre ich im Vollbesitz meiner Kräfte, meiner geistigen, psychischen und physischen, während ich zu einem großen M ausholte und der Rest meines Namens sich in Form fein gekräuselter Wellenlinien anschloss. Vom Nachnamen, für den ich den Stift erneut ansetzte, war eigentlich gar nichts mehr erkennbar, außer einem Kreuz am Anfang und einer krummen Schleife am Ende. Ich sah nicht auf dabei, während ich unterschrieb, weil hätte ich auch nur einen Moment gezögert, dann hätte einer von denen gezögert und dann noch einer und noch einer, und dann hätte ich hier bleiben müssen, hätte ein Bett gekriegt, wie sie es nannten. Ein Bett.
Was ist das. Wozu brauche ich ein Bett. Ich habe kein gebrochenes Bein. Ich muss nicht liegen. Obwohl ich das seit Wochen tue. Ich stehe nicht mehr auf. Ich bleibe einfach im Bett. Ich bleibe liegen. Denn wenn ich liege, spüre ich wenigstens nicht mehr so viel. Von dem, was ich nicht mehr bereit zu spüren bin. Was ich so hautnah spüre, wenn ich wach bin. Dass es mich zerreißt. Deshalb liegen. In immer einer Stellung. Denn wenn du dich bewegst, auch nur einen Millimeter, dann spürst du es, das Leben, und das ist wirklich alles andere als akzeptabel. Alles andere.
Jetzt habe ich ein Bett hier. Jetzt bin ich in der Psychiatrie. Seit einer Woche. Aber an jenem Freitagabend fuhren wir tatsächlich wieder nach Hause, zusammen, mein Vater und ich. Ich kann mich an keinen Tag erinnern, an dem ich mit so viel Elan in den Wagen meines Vaters einstiegen war, wie an jenem Abend, nachdem wir das Klinikgebäude verlassen hatten, wie zwei normale Menschen, von denen keiner je in der Psychiatrie gewesen ist – was man einem ja ein Leben lang nicht vergisst, was nie wieder abwaschbar ist, Psychiatrie – und wie wir dann gemeinsam zu seinem großen vertrauten Mercedes gingen und einstiegen. Aber er sagte nichts. Mein Vater. Und das gefiel mir nicht.
Irgendwie wusste ich, dass ich etwas kaputt gemacht hatte. Und zwar irreparabel. Und dass er mir nicht mehr glaubte, mein Vater. Und das hatte er getan, bisher. Felsenfest. Jedes Wort, das ich sprach. Ich tat es ja selber. Ich glaubte mir. Aber nachdem er den Motor gestartet hatte und in die stark befahrene Lindwurmstraße eingebogen war, da spürte ich, dass sich etwas verändert hatte, in ihm. Und ich hätte losschreien können, heulen, dass er mir wieder Vertrauen schenken solle, sein volles Vertrauen, auf der Stelle, dass ich es ansonsten nicht aushalte. Aber ich konnte auch nichts sagen, in diesem Moment. Ich hoffte nur, dass er weiterfahren würde, immer weiter, gerade aus und rechts und wieder gerade aus und weiter und weiter.
Und dann unterbrach er die Stille mit einer Frage. Ob ich Hunger hätte. Ich wusste, er wollte nun einkehren, zu Abend essen. Seine Lieblingstätigkeit. Essen in Gasthäusern. Ja. Natürlich. Und wie. Sehr sogar. Ich habe Hunger. Und ich konnte aufatmen, weil ich wusste, dass ich jetzt das Richtige geantwortet hatte. Dass er jetzt gleich irgendwo parken würde, um mit mir hineinzugehen, in eine gemütliche Gaststätte, gehobene Preisklasse. Wo wir uns wohlfühlen könnten, zusammen genießen könnten. Und als er mich fragte, ob ich nicht mit ihm zusammen Fisch essen wolle, da wusste ich, dass alles wieder im Reinen war.
Und wir aßen Fisch. Forelle. Blau.
Dazu Pellkartoffeln. In geschmolzener Butter. Nicht Fischstäbchen. Wie heute Mittag. Aus der Klinikgroßküche. Sondern Forelle. Sich zart von den Gräten abtrennende Fischhäppchen. Keine fettigen Krusten zerbrochener Stäbchen. Von denen jeder gerade mal fünf Stück erhielt. Vier Halbe und drei Ganze. Die eine Mitpatientin ausgeteilt hatte. Eine von den sogenannten Depressiven meiner Station, mit denen ich mir vorgenommen hatte, kein Wort zu wechseln, kein Sterbenswörtchen. Damit sie bemerkten, dass ich eigentlich nicht hierher gehörte. Arrogant – nein, das bin ich nicht. Ich komme eigentlich mit jedem klar – sofort, auf der Stelle. Aber hier gehöre ich nicht her. Das war mir von Anfang an klar.
Wie sie mich angesehen hatte. Diese Patientin. Als sie die uringelben Fischstäbchen mit einer Engelsgeduld verteilte. Einer Engelsgeduld und Langsamkeit, die mich erschaudern ließen. So voller Verbitterung und Hass war sie. Und sämtliche Stäbchen zerbrachen in der Mitte. Aber keiner sah sie an deswegen. Als wäre es ihnen sowieso egal. Sie wirkte beinahe stolz, in ihrer Bedächtigkeit, ihrer Verbitterung.
Solchen Menschen sieht man alles an. Das ist wirklich Depression, nehme ich an. Die haben ihre Nische gefunden. Beneidenswert. Oh ja. Gut geht’s denen nicht. Aber sie wissen, was sie haben. Sie haben eine Depression. Was man von mir nicht behaupten kann. Ich weiß nicht, was ich habe.
Heute Abend auf jeden Fall habe ich das erste Gespräch. Mit ihm. Doktor Fink. Und ich werde keinen hier ansprechen. Ich will nicht arrogant wirken. Aber ich werde mit niemandem sprechen. Solange wie möglich. Vorhin hat mich einer gefragt, ob ich neu sei. Hier. Der war ja ganz nett. Aber ich tat so, als hätte ich ihn nicht gehört.
Aber ich wollte an anderer Stelle weitererzählen. Da, wo mein Leben noch in Ordnung war. Außerklinisch war. Was es jetzt nicht mehr ist. Nie mehr ist. Denn wenn du erst mal hier bist, hast du die doppelte Pein. Die Verzweiflung. Und die Klinik. Und wenn du auch wieder hundertprozentig gesund werden würdest, du würdest hier gewesen sein, in einer psychiatrischen Klinik, und das würde dir dein Leben lang anhängen.
Und so tat ich auch alles, in der nächsten Woche, daheim, bei meinen Eltern, damit es nicht soweit käme. Die ersten Tage im Tulpenweg waren auch wirklich gut. Es schien, als wäre ich wieder voll hergestellt, völlig in Ordnung. Ich ging sogar spazieren. Am nächsten Morgen. Im Wald. Hinter unserm Haus. Und als ich zurückkam, empfing mich meine Mutter an der Tür, mit feuchten Augen, und sagte:
„Mein Junge, ich versteh das nicht, jetzt siehst du wieder so gut aus, jetzt könnte man meinen, es sei alles in Ordnung.“
Und ich lächelte sie an und sagte: „Ja, ich glaube, es wird wieder gut mit mir, es geht wieder bergauf, der Tag in der Klinik hat mir die Augen geöffnet, wahrscheinlich muss ich mich einfach ein bisschen mehr zusammenreißen.“
Der Tag darauf war dann auch noch o.k. Ich wollte sogar baden gehen. Im Stützen-Weiher. Der Sommer begann gerade. Ich war aufgewacht, am Morgen, mit Vogelgezwitscher, von draußen, kristallklar, wie in der Kindheit, vielversprechend, alles versprechend. Ich hatte mich sogar rasiert. Was ich seit Tagen nicht mehr getan hatte. Meine Badesachen zusammengesucht.
Mich aufs Rad gesetzt. Losgefahren. Und mitten auf der Strecke daran gedacht, dass der ganze Grund für meinen bisherigen Zustand das Studium gewesen sein muss. Die Wahl des falschen Studienfachs. Des Rätsels Lösung sozusagen.
Und ich radelte schneller.
Dann sah ich, als ich aus dem Wald herauskam, die roten Zwiebeltürme der Klosterkirche Weihenburg in der Ferne, und in diesem Moment wurde mir wieder ganz anders. So wie immer eben. Wie eine Schussfahrt mit dem Fahrrad ins Tal. Ein Tal, das nicht enden will. Ohne Lenker. Ohne Stange. Ohne Sattel.
Nach zehn Minuten war ich daheim, brach vor meiner Mutter nieder und weinte. Solange, bis ich nichts mehr spürte. Bis ich nass war. Bis ich die Nässe bemerkte und die Tränen nichts mehr mit den Augen zu tun hatten, sondern zum Gesicht geworden waren. Zu meinem Gesicht. Das meine Mutter dann nicht mehr wiedererkannte. Ich hörte wie sie irgendetwas vor sich hinseufzte:
„Nach der Erfahrung der letzten Tage, wo du so warst wie früher, wie man dich kannte, wie dich jeder kannte, und kennt.“
Und meine Mutter nahm mich zu sich und erzählte mir, wie ich früher war. Und ihre Worte waren wie heiße Schokolade. Für eine Sekunde. Karamell für meine blankgeheulte Seele. Ich wusste jetzt, dass ich lange genug geweint hatte. Dass sie mich erhört hatte. Denn ich konnte mich daran erinnern, wie ich war, für eine Sekunde, wie ich früher einmal war. Doch gleich nach dieser Erinnerung wurde mir bewusst, wie ich jetzt war, wie gegensätzlich, zu dem. Und dann flehte ich meine Mutter an, mir zu sagen, warum es so gekommen sei. Ob nicht sie es wüsste. Sie kenne mich doch. Sie müsse den Grund kennen. Oder.
Aber sie hatte keine Ahnung. Keinen blassen Schimmer. Nur leid tat ich ihr, endlos leid.
Weinen beinhaltet zwei Möglichkeiten. Zum einen kann man solange weinen, bis man sich endlich wieder spürt. Oder aber man spürt sich zu stark; dann weint man solange, bis nichts mehr von einem da ist.
Der Körper schüttelt sich aus. Er stottert. Er verliert seine Funktion, seine eigentliche. Krümmt sich zusammen, verkleinert sich, verkleinert seine Oberfläche, damit nicht so viel hineinkommt, von außen. Er gehorcht nur noch dem Inneren. Das sonst verschlossen bleibt. Aber hier regiert es. Und es regiert auf bizarre Weise. Lässt ihn lächerlich erscheinen.
Wie einen Idioten. Oder besser gesagt, macht ihn zum Idioten.
Klares Anzeichen dafür, dass es, das Innere, mit dem Rest von uns nichts anzufangen weiß. Shake it, baby, shake the shit.
Hier, in diesen Hallen, wird mich keiner weinen sehen. Aber vermissen werd ich es schon. Ach, wem erzähl ich das. Dass mich jetzt hoffentlich keiner für einen Schwächling hält, einen flennenden Schwächling. Dann hat er oder sie nämlich noch nie geweint, wirklich geweint. Es ist nämlich mitunter das Stärkste. Man geht an die Grenze. Man presst nur noch und presst und presst. Und wenn kein Salz mehr da ist, drückt man weiter. Man wimmert. Erzeugt derartig kurze Atemfrequenzen, dass man in diesem Moment das ganze System unter Kontrolle hat, für einige Sekunden. Schließlich bestimmt man etwas, das Atmen, das sonst einen selber bestimmt.
Hu hu hu hu. Wie ein Kehrvers, ein Refrain. Aber wem erzähl ich das. Hier werde ich jedenfalls nicht mehr so ausfällig und so herrlich weinen können wie zu Hause.
Mein Hoch war also zu Ende, damals. Bereits nach zweieinhalb Tagen. Und meine Eltern sahen mich höchstverdächtig an. In Punkto Aktion. Psychiatrie-Aktion. Und als sie es aussprachen, dass ich es doch sehen müsse, dass es nicht besser würde, eher schlimmer, und dass sie bald selber auch nicht mehr könnten, dass sie sich bald selbst einweisen könnten, wenn es so weiterginge, in diesem Moment, das muss ich an dieser Stelle zugeben, fand ich die Idee auch gar nicht so schlecht. Ich willigte ein.
Ich willigte wirklich ein.
Und dann sagte mein Vater, dass er heute Mittag bereits angerufen habe. Wir könnten kommen. Morgen Vormittag. Er hat mit einer Schwester gesprochen. Die war sehr nett.
„Hm Matthias. Was meinst du. Denk doch mal an deinen Arzt, Doktor Fink. Ich glaube, so ein Glück hast du nicht mehr. So einen Arzt. Der interessiert sich auch für dich.“
Das habe er gemerkt, mein Vater. Ja gut. Es war mir egal. Es war mir wirklich egal in diesem Moment. Scheißegal. Ich war mir egal. Ich hatte aufgegeben. Meinen Willen. Meinen Widerwillen gegen Psychiatrie. Es ist ein Krankenhaus, sagte ich mir. Sagte ich mir noch den ganzen Abend lang, ein Krankenhaus. Für Menschen mit Krankheiten. Aus Mauern, Steinen, Mörtel, Sand, Wasser. Und Geist. Einer corporate identity. Einem Image. Wie Nike. Oder Sony. Nur nicht so cool. Aber was heißt „nur nicht so cool“. Interessante Typen waren schon in der Psychiatrie gewesen. Hemingway. Gleich dreimal. Hesse.
Es hat auch was Geniales. Und ein bisschen Touch von Genie hatte ich schon immer. Mein Deutschlehrer sagte, dass er schwer befürchte, dass ich ein Genie wäre und dass er mich nicht verstünde. Aber seine Vermutung wiege schwer.
Ich warnte meine Eltern, auch nur ein Sterbenswörtchen zu erwähnen, vor irgendjemandem. Wenn auch nur einer davon erführe. Dann würde ich, dann könnte ich...