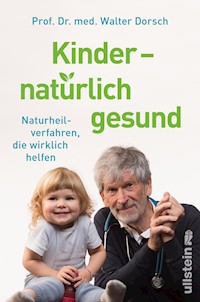13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Familienfrieden trotz Schulproblemen
Viele Familien kennen die Schwierigkeiten, die sich mit dem Eintritt in die Schule ergeben: Kinder, die nicht lernen wollen, die Probleme mit Freunden oder Lehrern haben oder Schulen, die mehr einer Wissensanstalt gleichen als einem inspirierenden Lernraum.
Wie gehen Eltern mit diesen Herausforderungen um? Wie kann es ihnen gelingen, daran zu wachsen, und nicht daran zu scheitern? Diesen Fragen gehen der Kinderarzt Prof. Dr. Walter Dorsch und der Schulpädagoge Prof. Dr. Klaus Zierer nach. Dabei stehen nicht nur Schulprobleme an sich im Fokus, sondern wie sich diese auf das gesamte Familiensystem auswirken. Episodenhafte Erzählungen einer fünfköpfigen Familie veranschaulichen die schulischen Krisen und werden ergänzt durch konkrete Lösungsvorschläge und Handlungsempfehlungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 240
Ähnliche
Das Buch
»Nur wenn Elternhaus und Schule offen zusammenarbeiten, kann sie das sein, was sie sein soll: die Schule für das Leben.«
Viele Eltern kennen zahllose Probleme, die sich mit dem Schulbesuch ihrer Kinder auftun können, zum Beispiel:
Sie sind anfangs begeistert, haben dann aber Angst.Sie freuen sich über neue Freunde, bekommen dann aber Schwierigkeiten in der Klasse.Die Lehrer sind zu streng oder erkennen ihre Begabungen nicht. Die Schule erscheint plötzlich als feindliche Institution.Wie gehen Familien mit diesen Herausforderungen um? Und wie kann es ihnen gelingen, daran zu wachsen? Die erfahrenen Autoren Walter Dorsch und Klaus Zierer geben wissenschaftlich fundierte Antworten auf die häufigsten Fragen. Dazu begleiten sie die fiktive Familie Reinhardt durch die Schulzeit ihrer drei Kinder und helfen ihr bei der Bewältigung ihrer Probleme. So vermitteln die Autoren praktische Erziehungskompetenz im Umgang mit schulpflichtigen Kindern und zeigen Lösungswege für schulische wie familiäre Probleme auf.
Die Autoren
Walter Dorsch, Prof. Dr. med., geboren 1949, ist Kinder- und Jugendarzt mit den Spezialgebieten Lungenheilkunde, Allergologie und Naturheilverfahren. Er war Oberarzt an der Mainzer Universitätskinderklinik. Er arbeitet seit 1994 in München in einer Praxisgemeinschaft mit den zusätzlichen Schwerpunkten Psychosomatische Grundversorgung und Familientherapie. Er ist Vater von sechs Kindern.
Klaus Zierer, Prof. Dr. phil., geboren 1976, ist seit 2015 Ordinarius für Schulpädagogik an der Universität Augsburg und Associate Research Fellow am ESRC Centre on Skills, Knowledge and Organisational Performance (SKOPE) der University of Oxford. Besondere Beachtung finden seine Arbeiten im Anschluss an John Hattie, die er in eigenständigen Projekten und Publikationen fortführt. Er ist Vater von drei Kindern.
Prof. Dr. Walter Dorsch & Prof. Dr. Klaus Zierer
Schulkinder gleich Sorgenkinder?
Schulprobleme als Familie meistern
Kösel
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber an den aufgeführten Zitaten ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall nicht möglich gewesen sein, bitten wir um Nachricht durch den Rechteinhaber.
Copyright © 2020 Kösel-Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlag: Weiss Werkstatt, München
Umschlagmotiv: © plainpicture/Thierry Foulon
Redaktion: Ralf Lay
E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN978-3-641-25104-8V001
www.koesel.de
Inhalt
Vorwort
Einführung
Für Tobias beginnt der Ernst des Lebens
Bei Familie Reinhardt: Episode Nr. 1
Es darf sich nicht alles um das kranke Kind drehen | Erziehung zur sprachlichen Kompetenz: früh beginnen! | Kinder sollen im Haushalt mithelfen | Lernen: zu Hause top, in der Schule ein Flop
Kontroverse 1: Krippenbetreuung für Kinder unter drei Jahren?
Den Schwestern reicht’s: »Müsst ihr euch denn immer streiten?«
Bei Familie Reinhardt: Episode Nr. 2
Das Dreieck der Mutter-Kind-Vater-Beziehung | Mangelnde oder falsche Kommunikation | Kommunikation über Erziehung auf vielen Ebenen | Strukturiert miteinander reden: die Familienkonferenz
»Mein Kind muss aufs Gymnasium!«
Bei Familie Reinhardt: Episode Nr. 3
Lernstörungen, Schulprobleme und Aufmerksamkeitsdefizit | Das Aufmerksamkeitsdefizit(-Hyperaktivitäts-)syndrom (AD[H]S) | Wie behandeln wir Kinder mit Aufmerksamkeitsstörungen? | Wenn das Kind den Sprung aufs Gymnasium nicht schafft
Kontroverse 2: Was bedeutet das Abitur heute?
Tobias will nie mehr in die Schule gehen
Bei Familie Reinhardt: Episode Nr. 4
Mobbing, ein ernst zu nehmendes Problem in der Schule | Resilienz: Kinder stärken als zentrale Aufgabe | Weitere Herausforderungen meistern
»Diese Lehrkraft geht gar nicht!«
Bei Familie Reinhardt: Episode Nr. 5
Die Schule: ein Kampfplatz? | Die Lehrperson: allein entscheidend für den Lernerfolg? | Kooperation zwischen Schule und Eltern: Motor des Schulerfolgs | Wenn alle Versuche der Kooperation scheitern
Kontroverse 3: Die Schule – was kann sie, was soll sie zwischen Wunschdenken und Realität?
Silvias innere Emigration
Bei Familie Reinhardt: Episode Nr. 6
Krisenbewältigung in der Pubertät | »Null Bock« – wenn Schule keine Freude (mehr) macht | Schulfreude wiedererlangen und Langeweile besiegen: die Ordnungstherapie
Tobias, der traurige Klassenclown
Bei Familie Reinhardt: Episode Nr. 7
Schulwechsel: Herausforderung für Kinder und Eltern
Belohnen und Bestrafen | Schulverweigerung: wenn alles »den Bach runterzugehen« droht | Ein positives Selbstkonzept: Herausforderungen meistern können
Kontroverse 4: Chancengleichheit – Inklusion
Im pädagogischen Wunderland
Bei Familie Reinhardt: Episode Nr. 8
Digitalisierung ohne Bedenken? | Digitale Technik als Lernhilfe | Digitale Technik als Lerninhalt | Risiken digitaler Medien | Digitalisierte Schule – schöne neue Welt?
Es kracht bei den Reinhardts
Bei Familie Reinhardt: Episode Nr. 9
Gemeinsame Elternschaft ist das Wichtigste | Häusliche Gewalt – lebenslange Nachwirkungen | Regeln und Rückmeldungen: Strategien zur Konfliktbewältigung | Mehr Zivilcourage wagen – mehr Verantwortung leben!
Kontroverse 5: Geschiedene Eltern – beschädigt fürs Leben?
Ein Neuanfang
Bei Familie Reinhardt: Episode Nr. 10
Schule und Elternhaus arbeiten zusammen | Die Initiativen im Einzelnen
Anhang
Bildungspolitisch relevante Einflussgrößen: die Studie Visible Learning
Index
Anmerkungen
Die Autoren
Vorwort
Betrachtet man die große Zahl von Erziehungsratgebern, die Eltern angeboten werden, möchte man meinen, dass nahezu jedes pädagogische Problem leicht gelöst werden kann. Aber auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, dürften erfahren haben, dass dies nicht so ist. Wir beide möchten Sie deshalb davor warnen, von irgendeinem, also auch von diesem Buch Patentlösungen zu erwarten.
Was ist richtig, was ist falsch in der Erziehung unserer Kinder, sei es zu Hause oder in der Schule? Seit Jahrtausenden beschäftigt diese Frage Eltern und Erzieher. Frühere Generationen – so scheint es uns heute – haben es sich einfach gemacht: Man müsse die Kinder nur zu »Recht und Ordnung« erziehen und sie auf eine strenge Schule schicken. So würden aus ihnen zuverlässige, zufriedene und dann auch glückliche Staatsbürger. Heute findet man eher das gegenteilige Extrem: Man müsse nur Verständnis für die Kinder haben, und schon würden sie glückliche, zufriedene, hilfsbereite und erfolgreiche Menschen.
Die Wahrheit dürfte irgendwo in der Mitte liegen: Manches klappt, manches klappt nicht. Wo diese Mitte liegt, darüber wird seit Urzeiten gestritten. Hierzu haben wir eine klare Position, die aus unseren Professionen folgt: Als Kinderarzt und Schulpädagoge vertreten wir die Auffassung, dass wissenschaftliche Erkenntnisse uns helfen können, Erziehung erfolgreicher werden zu lassen. Heute liegt ein großer Fundus an Erkenntnissen vor, sodass es töricht wäre, das nicht zu berücksichtigen. Fakten zu leugnen führt häufig zu Mythen und in der Folge auch zu Verunsicherungen. Und dennoch ist Vorsicht geboten. Denn wissenschaftliche Erkenntnisse sind nicht immer der Wahrheit letzter Schluss. Neuere Studien widerlegen nicht selten altes Wissen über Erziehung. Zudem lehrt uns der Alltag immer wieder, dass so manches wissenschaftlich eindeutig scheint, sich aber in der Praxis nicht bewährt.
Wir beide hatten das Glück, viele eigene Kinder mit großziehen und sehr viele Kinder, die uns anvertraut wurden, mit betreuen zu dürfen. Noch immer üben wir uns darin, reiben uns an den Theorien, an den wissenschaftlichen Ergebnissen und an unserer Erfahrung in der Praxis. Und beides ist es, was uns wichtig ist. Wir glauben an wissenschaftliche Erkenntnisse, und wir vertrauen der menschlichen Vernunft. Nicht immer deckt sich beides, aber beides ist wichtig.
Begleiten Sie uns auf eine Reise durch die Erziehung, bei der wir wissenschaftlichen Erkenntnissen ebenso folgen wie unseren Erfahrungen! Bei dieser Reise begleiten wir eine fiktive Familie, die Familie Reinhardt. Ihre Erlebnisse bilden den roten Faden des Buches, sie sind Ausgangs- und Endpunkt für unsere Überlegungen. Sie helfen uns, sperrige Themen anschaulich darzustellen. Viele Eltern mit schulpflichtigen Kindern erleben ähnliche Krisensituationen, außerdem lohnt es sich, über den Tellerrand der eigenen Familie hinaus Hintergründe von Krisen zu betrachten und darüber nachzudenken, wie sie ihre und wie man selbst die eigenen Probleme lösen könnte. (Natürlich werden Sie in diesem Buch auch erfahren, wie Kinder in anderen als der beschriebenen Familienkonstellation gut, manchmal besser zurechtkommen können.)
Wir dürfen Ihnen jetzt die Familie Reinhardt vorstellen.
Einführung
Die Reinhardts sind »eine ganz normale« Familie. Der Vater Georg ist städtischer Angestellter, die Mutter Klara hat hauptsächlich die Kinder versorgt, als sie noch klein waren, und auch danach ihren Beruf, sie ist Erzieherin, nur halbtags ausgeübt. Beide Eltern hatten verabredet, dass Klara wieder ganztags arbeiten würde, wenn auch der Jüngste aus dem Gröbsten herausgewachsen wäre.
Die zwei älteren Töchter, Sarah und Silvia, kamen sehr dicht hintereinander auf die Welt. Ihre Geburtstage liegen nicht einmal zwei Jahre auseinander, sodass manche sie fast für Zwillinge halten. Anfangs waren sie ein Herz und eine Seele. Der kleinere Bruder, Tobias, war zu Beginn seiner Familienlaufbahn der verwöhnte Prinz. Das hat sich im Lauf der Zeit geändert. Zu Beginn der Geschichte waren Sarah elf, Silvia neun und Tobias sechs Jahre alt.
Diese Familie hat – wie viele andere auch – Krisen erlebt und sie mehr oder weniger gut bewältigt. Die Probleme bezogen sich auf den Familienalltag, die Schule, das tägliche Lernen, Freunde, den Umgang mit Streit untereinander und vieles andere mehr.
Wir beide haben diese (fiktive) Familie sieben Jahre lang begleitet und ihr zu helfen versucht. Ihre Erfahrungen sind hier in zehn Kapiteln aufgezeichnet.
Für Tobias beginnt der Ernst des Lebens
Der kleine Bruder ist kürzlich eingeschult worden. Als verwöhntes Nesthäkchen hat er erhebliche Schwierigkeiten. Die Grundschule liegt in der Nähe eines sozialen Brennpunkts. Deutsche Namen sind unter den Klassenkameraden in der Minderheit. Der Schulweg wird zum Drama, das Lernen zu Hause mit der Mama dauert stundenlang, die älteren Schwestern fühlen sich vernachlässigt.
Über Geschwisterliebe und wie wir sie nutzen können.
Den Schwestern reicht’s: »Müsst ihr euch denn immer streiten?«
Vater und Mutter streiten sich über den richtigen pädagogischen Umgang mit dem kleinen Jungen. Die beiden Schwestern versuchen einzugreifen. Es gibt also vier divergierende Erziehungskonzepte.
Über elterliche Konflikte und wie wir sie zum Wohl unserer Kinder austragen können.
»Mein Kind muss aufs Gymnasium!«
Silvia, die jüngere der Schwestern, will eigentlich nicht aufs Gymnasium. Es taucht die Frage auf, ob sie ausreichend begabt ist oder ob sie an einem stillen Aufmerksamkeitsdefizit leidet.
Elternwille und Schulerfolg: über Lernfreude und Leistungsmotivation als zentrale Aufgaben familiärer Unterstützung.
Tobias will nie mehr in die Schule gehen
Tobias hat es bis in die dritte Klasse der Grundschule geschafft. Er ist immer noch schüchtern, hat aber zwei feste Freunde. Ältere Mitschüler drangsalieren die jüngeren, Gruppen unterschiedlicher Herkunft und Männlichkeitsideale treffen aufeinander. Bei Konflikten fühlt sich Tobias von seinen Freunden im Stich gelassen.
Was passiert, wenn Kinder keine Freunde in der Schule haben?
»Diese Lehrkraft geht gar nicht!«
Sarah erlebt in der vierten Klasse ihres neusprachlichen Gymnasiums einen massiven Leistungsknick in der Konfrontation mit einer, wie sie und die Eltern meinen, bösartigen Lehrperson. Die Eltern glauben, diese müsse entlassen oder zumindest versetzt werden.
Eltern, Lehrpersonen und gegebenenfalls das Kinderzentrum diskutieren über alternative Bildungswege.
Silvias innere Emigration
Silvias beste Freundin verlässt die Schule. Silvia ist von den vielen Familienkrisen erschöpft. Sie fühlt sich vernachlässigt, zieht sich zurück und driftet ab in Computersucht und hängt nur noch am Smartphone. Ihre Schulleistungen sinken. Die Eltern wissen nicht, wie sie den Tagesablauf für die Familie strukturieren können. Eines Tages gibt ihnen der Kinderarzt einen wertvollen Tipp. Silvia kehrt allmählich zurück.
Über die Notwendigkeit klarer Tagesabläufe. Wie lassen sich Smartphone, Tablet & Co. sinnvoll in die Familie integrieren?
Tobias, der traurige Klassenclown
Tobias hat zwar den Übergang aufs Gymnasium geschafft, scheitert aber am Lateinunterricht. Auf der Realschule hat er erneut Probleme, sich einzuordnen. Er versucht, sie durch aufsässiges Benehmen und die Rolle des Klassenclowns zu lösen.
Warum die Rolle des Klassenclowns so gar nicht lustig ist.
Im pädagogischen Wunderland
Angesichts der Schulprobleme der Kinder und wachsenden Spannungen in der Familie sucht Georg grundsätzlich andere Lösungen. Eines Tages überrascht er die Familie mit einem Riesenpaket von Prospekten, Broschüren und Büchern, die die moderne Pädagogik im Zeitalter der Digitalisierung und vieles andere behandeln.
Wie die Digitalisierung die Lebenswelt im Kleinen wie im Großen verändert.
Es kracht bei den Reinhardts
Die Reinhardts haben beschlossen, die Schule nicht zu wechseln. Auch der Besuch eines Internats wird verworfen. Man wollte dann doch lieber als Familie zusammenbleiben. Dem Familienleben drohen aber neue Zerreißproben, als der Vater im Beruf Schwierigkeiten hat und die Mutter nicht alle Bürden auf sich nehmen will. Die Sorgen belasten die ganze Familie. Immer wieder kommt es daher zu Streitigkeiten, bis eines Tages die Situation eskaliert und Georg seiner ältesten Tochter eine Ohrfeige gibt.
Was passiert, wenn Eltern die Fassung verlieren?
Ein Neuanfang
Die Mutter möchte, wie zwischen den Eheleuten lange verabredet, wieder ganztags arbeiten. Der Vater fürchtet den Tag schon lange und hofft insgeheim, dass die Mutter die vermeintliche Notwendigkeit erkennt, zu Hause zu bleiben. Allen Hoffnungen zum Trotz: Die Mutter bleibt – vollkommen zu Recht – bei ihrem Plan: Sie möchte so ganz allmählich wieder in ihre frühere Tätigkeit zurückkehren und nicht riskieren, ihren beruflichen Anschluss zu verlieren, wenn sie wartet, bis alle Kinder aus dem Haus sind. Die alte Familienstruktur zerbricht, neue Regeln müssen ausgehandelt werden. Beide Eltern stimmen ihre Berufstätigkeiten aufeinander ab. Klara schafft den Wiedereinstieg. Georg kann zurückstecken, ohne seine Karriere zu gefährden. Sarah hat sich verliebt, wird bald ihr Abitur ablegen und möchte dann wie ihr Freund Architektur studieren. Silvia muss die Klasse nicht wiederholen und lernt tanzen. Ihre Eltern auch. Tobias leitet eine Sprachfördergruppe in der Schule.
Wie alle fünf Reinhardts die Schule als soziale Aufgabe entdecken und als Team zusammenarbeiten.
Für Tobias beginnt der Ernst des Lebens
Bei Familie Reinhardt: Episode Nr. 1
Endlich war es so weit: Tobias, der Jüngste der Familie, war kürzlich eingeschult worden. Dies gestaltete sich nicht einfach. Der Junge hatte immer im Mittelpunkt der Familie gestanden. Man kann es verstehen: Seine Mutter Klara hatte während der Schwangerschaft große gesundheitliche Probleme, auch die Entbindung war schwierig. Als Säugling litt er an Ernährungsstörungen, als Kleinkind an allergischen Reaktionen auf Milch und andere Nahrungsmittel sowie an häufigen Infektionen der Atemwege, teilweise begleitet von Asthma bronchiale. Er benötigte immer besondere Zuwendung. Zu sprechen hatte er erst spät begonnen. Seine Mutter und die Schwestern lasen ihm jeden Wunsch von den Lippen ab. Er war immer umsorgt. An häuslichen Pflichten musste er sich nur selten beteiligen. Die Eingewöhnung in den Kindergarten verlief schwierig, weil ihm die Kinder oft zu laut und zu frech waren. Bei Vorsorgeuntersuchungen im Alter von vier und fünf Jahren hatte der Kinderarzt auf eine verzögerte Sprachentwicklung aufmerksam gemacht, Übungen für zu Hause besprochen und regelmäßige Kontrollen verabredet. Die intensivere Behandlung durch eine Logopädin wurde diskutiert, aber zunächst nicht durchgeführt.
Beim Einschulungstermin stellte sich heraus, dass das Defizit in der Sprachentwicklung doch größer war als gedacht. Außerdem wurde die emotionale und soziale Entwicklung als verzögert eingeschätzt, sodass man — übrigens dem Wunsch der Eltern entsprechend — die Einschulung um ein Jahr verschob. Drei der vier engeren Freunde, die Tobias hatte, wurden regelhaft eingeschult. Dadurch wurde der Kontakt zu ihnen immer spärlicher. Viel Freizeit musste er für logopädische und ergotherapeutische Behandlungen opfern. Zusätzlich begann die Mutter, mit ihm intensiver zu üben: Mit bewundernswerter Geduld führte Klara mit Tobias täglich die empfohlenen häuslichen Übungen durch. Darüber hinaus lasen sie viel in Büchern, Klara las vor, gemeinsam bastelten und sangen sie viel. Tobias hat fast alles aufgeholt und ein Jahr später die Schuleignungsuntersuchung bestanden.
Klaras Zeitaufwand war beträchtlich. Sie war täglich ein bis zwei Stunden nur mit Tobias beschäftigt. Die Schwestern fühlten sich zunehmend zurückgesetzt und ließen Tobias deutlich spüren, dass sie mit seiner Rolle als Prinz absolut nicht einverstanden waren.
Die Eltern Georg und Klara hatten zeitweilig überlegt, ob Tobias nicht besser eine Montessori-Schule besuchen sollte, damit er dort seinen Begabungen entsprechend besser gefördert werden könne. Nach intensiver Diskussion mit Georg ließ sich Klara davon überzeugen, dass die Regelschule sinnvoller sei: Zum einen lag die Montessori-Schule weit entfernt, sodass der Transport sich mit dem Alltag der Familie nicht koordinieren ließ. Zum anderen wollte Tobias in die gleiche Schule gehen wie seine Schwestern.
Die Sprengelschule hatte ein großes Einzugsgebiet. Viele Kinder aus Problembezirken der Stadt gingen dorthin. Tobias wunderte sich anfangs, dass viele der Kinder ausländische Vornamen trugen. Er kam nicht mit allen gut zurecht. Dem Unterricht wollte oder konnte er oft nicht folgen. Zu Hause erzählte er, ihm sei langweilig gewesen. Nach mehreren Gesprächen mit der Lehrerin verstärkte die Mutter ihre pädagogischen Maßnahmen: Sie war jetzt insgesamt zwei bis drei Stunden pro Tag intensiv mit dem Jungen beschäftigt. Der Erfolg in der Schule blieb aber aus.
Mit dieser Vorgeschichte müssen sich die Eltern auseinandersetzen. Sie suchen erneut Tobias’ Lehrkräfte und seinen Kinderarzt auf. Sowohl beim Arztbesuch als auch in einer Elternsprechstunde schildert vor allem die Mutter die Schwierigkeiten. Der Vater beteiligt sich nur wenig an den Gesprächen. Für die Mutter liegt das Hauptproblem darin, dass Tobias zwar zu Hause jede geforderte Leistung bringen könne, die Lehrerin aber überhaupt nicht zufrieden sei. Er könne nicht lesen wie die anderen Kinder, sei sehr leicht ablenkbar und habe wenig Ausdauer im Unterricht, auch beim Werken und textilen Gestalten. Die älteren Schwestern, die früher so hilfsbereit gewesen wären, würden zunehmend gehässiger, auch eifersüchtig, weil sich immer alles um den kleinen Tobias drehe. Sie würden immer nur noch »Pimpf« zu ihm sagen und wären doch früher so lieb gewesen.
Liebe Eltern, vielleicht haben Sie Ähnliches erlebt oder beobachtet und suchen wie die Reinhardts nach Lösungen. Wir glauben, dass es sich lohnt, sich hierzu folgende Bereiche genauer anzusehen.
Es darf sich nicht alles um das kranke Kind drehen
Zugegeben, Tobias war und ist noch immer ein Problemkind. Aber jedes Mitglied einer Familie sollte gleiche Rechte und Pflichten haben, natürlich seinem jeweiligen Können und Entwicklungsstand angemessen. Vor allem bei Familien mit chronisch kranken Kindern ist häufig zu beobachten, dass die gesamte Aufmerksamkeit der Familie ausschließlich um das eine kranke Kind kreist. So manche Familie ist daran zerbrochen, insbesondere solche mit schwerbehinderten Kindern. Eine derartige Entwicklung nutzt aber niemandem, auch nicht dem Problemkind. Wenn Eltern nicht auf Ausgewogenheit achten, entstehen häufig offen oder verdeckt Neid und Eifersucht. Die Eltern geraten in Streit über die richtige Umgangsweise mit dem kranken Kind. Unmittelbare Folge dieser ausschließlichen Fokussierung auf das Problemkind ist eine zunehmende Schieflage der Familienstruktur. Statt dass sich alle um beste Lösungen bemühen, trifft in unserem Beispiel die Mutter immer einsamere Entscheidungen und fühlt sich vom Rest der Familie alleingelassen. Halten Sie sich bitte stets vor Augen: Erfolgreiche Erziehung ist Teamarbeit! Sie erfordert den regelmäßigen Austausch von allen – im Fall einer dreiköpfigen Familie ergäbe sich daraus eine Trias aus folgenden Beziehungsgeflechten: Mutter und Kind, Vater und Kind, Mutter und Vater – und Letztere ist in ihrer Komplexität und Wirkung nicht zu unterschätzen.
Einem chronisch kranken Kind ist nicht damit geholfen, dass Mutter oder Vater oder gar beide darauf verzichten, ein eigenes Leben zu leben. Vor allem für allein- oder getrennt erziehende Eltern besteht eine besondere Gefahr, dass sie sich fast nur mit den verschiedenen Aspekten der Krankheit ihres Kindes beschäftigen und vollkommen vergessen, dass sie ja auch ein eigenes leben dürfen. Hier ist ein funktionierendes soziales Netz besonders wichtig, das den alleinerziehenden Eltern Erleichterung verschafft. Das können zum Beispiel Elterngemeinschaften sein, aber auch ganz gewöhnliche Mitgliedschaften in Vereinen.
Was den Schulerfolg anbelangt: Allein- oder getrennt erziehende Eltern können und wollen wir an dieser Stelle beruhigen. Wie noch näher erläutert wird, spielt die Art der Familienstruktur für die Lernenden keine große Rolle, entscheidend ist die Qualität der Interaktion zwischen den Partnern.
Erziehung zur sprachlichen Kompetenz: früh beginnen!
So manche Eltern wundern sich, dass ihr zweites (oder drittes) Kind spät zu sprechen begonnen hat. Sie schildern oft, dass sich ihr erstes schon sehr früh mit Worten auszudrücken wusste und mit zwei Jahren bereits wie ein Wasserfall plapperte. Das zweite nun sei ausgesprochen mundfaul. Es würde zwar alles verstehen und sich blendend durchsetzen können. Aber selbst reden wolle es einfach nicht.
In der kinderärztlichen und schulischen Sprechstunde lässt sich in solchen Fällen oft beobachten, wie die nonverbale Kommunikation zwischen den Eltern, den älteren Geschwistern und dem Kleinkind hervorragend funktioniert. Die kleine Prinzessin oder der kleine Prinz muss nur auf das Lesebuch deuten, schon wird es gebracht und vorgelesen, der Griff zur Handtasche versorgt das Kleinkind sofort mit einer Süßigkeit, es deutet auf ein Spielzeug, es wird gebracht, es hebt die Arme und wird getragen. Ein wunderbares Leben! Wozu soll man sich dann darum bemühen, sprechen zu lernen?
Hierzu eine kleine Anekdote aus dem Alltag: Das recht niedlich wirkende Karlchen feiert seinen ersten Geburtstag und verzaubert alle Familienmitglieder mit seinem Lächeln. Ein Jahr später sind wieder alle um ihn versammelt. Jeder will mit ihm reden und spielen. Er macht alles mit, wieder lächelt er nur, statt zu reden. Ähnlich verläuft auch der dritte Geburtstag. Beim vierten schlägt er mit der Faust auf den Tisch und ruft laut: »Die Suppe ist schlecht, keiner kann sie essen!« Alle sind überrascht und erstaunt, freuen sich aber dann doch über den plötzlichen Redefluss. Als der Großvater nachfragt, weshalb er denn nicht früher schon gesprochen habe, lautet die Antwort kurz und bündig: »Es hat ja nichts zu reklamieren gegeben!«
Aus solchen Erfahrungen leitet sich die Empfehlung ab, früh und intensiv mit den eigenen Kindern zu reden, und zwar mit ihnen und nicht über sie hinweg (weil man ohnehin zu wissen glaubt, was sie wollen). Reden bedeutet immer Rede und Gegenrede, Wort und Antwort. Und häufig ist für die Eltern zuzuhören wichtiger, als zu reden. Denn so erfährt man, was Kinder wirklich denken und fühlen. Die sich daraus ergebenden Fragen sind geeignet, um mit Kindern über ihre Welt ins Gespräch zu kommen.
Die Erziehung zur sprachlichen Kompetenz muss also früh beginnen. Wie wichtig der frühe und intensive Spracherwerb für die intellektuelle Entwicklung ist, zeigt eine in Fachkreisen sehr bekannte Studie »The Early Catastrophe: The 30 Million Words Gap by Age 3«1 von Betty Hart und Todd R. Risley von der University of Kansas. Was haben sie gemacht?
Die Forscher besuchten mehr als zwei Jahre lang 42 Familien zu Hause und registrierten die Interaktionen zwischen Kindern und ihren Eltern. Hierfür wurden die Familien einmal im Monat eine Stunde lang begleitet, und alle Geschehnisse wurden beobachtet, aufgezeichnet und analysiert – insgesamt mehr als 1300 Stunden. Die Kinder waren zu Beginn der Studie zwischen sieben und neun Monaten alt und am Ende drei Jahre. Sie teilten die Familien ihrem sozioökonomischen Status entsprechend ein in ein oberes (dreizehn Familien), ein mittleres (zehn Familien) und ein unteres Niveau (dreizehn Familien) sowie von Sozialhilfe abhängige Familien (sechs) und gewannen so bemerkenswerte Erkenntnisse.
Es stellte sich heraus, dass Kinder (spätestens) im Alter von drei Jahren bereits ihre Eltern kopieren – beim Reden, beim Gehen, beim Spielen und sogar beim »Erziehen« der Puppe. Im Detail kommen die Forscher zu dem Ergebnis, dass es in den untersuchten Familien einen dramatischen Unterschied im Hinblick auf Interaktion und Dialog gibt und dieser in einem Zusammenhang mit dem sozioökonomischen Status steht. So unterscheiden sich Kinder im Alter von drei Jahren in Hinblick auf ihren Wortschatz deutlich: Kinder aus einem bildungsnahen Milieu verfügen über einen fast dreimal so großen Wortschatz wie Kinder aus einem bildungsfernen. Dieser Unterschied schwindet in den darauffolgenden Schuljahren nicht. Schule und Unterricht führen zu keiner Kompensation, im Gegenteil: Die Unterschiede bleiben nicht nur bestehen, sie nehmen sogar weiter zu.
Als einen Grund für diese Unterschiede in den sprachlichen Fähigkeiten identifizieren Hart und Risley das häusliche Anregungsniveau im Hinblick auf die sprachliche Interaktion mit den Kindern. Durch ihre Beobachtungen kamen sie zu folgender Rechnung: Kinder aus bildungsnahen Milieus hören bis zum Alter von drei Jahren ungefähr 45 Millionen Wörter, wohingegen Kinder aus bildungsfernen Milieus gerade mal fünfzehn Millionen Wörter wahrnehmen. Das ergibt die berühmt-berüchtigte »Dreißig-Millionen-Wörter-Lücke«. Natürlich kommt es auch auf die Art an, wie man miteinander redet: Quantität sagt wenig über Qualität aus.
Hart und Risley untersuchten ebenfalls, wie das Verhältnis zwischen sprachlicher Ermutigung und sprachlicher Entmutigung aussieht. Auch hier ein eindeutiges Ergebnis: Kinder aus bildungsnahen Milieus erhalten bis zu siebenmal häufiger eine Ermutigung als eine Entmutigung, und Kinder aus bildungsfernen Milieus hören gut doppelt so oft eine Entmutigung als eine Ermutigung.
Die Schlussfolgerung der Forscher ist eindeutig: Bis zum Alter von drei Jahren werden im Hinblick auf Bildung Weichen gestellt, die später kaum noch wettzumachen sind – und wenn, dann nur mit ungeheuer großem Aufwand. Die einzige Lösung sehen sie folgerichtig in der Stärkung der Familien und in der Kooperation mit Bildungseinrichtungen.
Im häuslichen Gespräch kommt es vor allem auf Gespräche an, die Kinder und Jugendliche zum Nachdenken bringen. Fragen Sie also nach! Bringen Sie Ihre Kinder dazu, ihre Meinung zu äußern, sie zu begründen, sie zu verteidigen und sie zu erläutern. Und reduzieren Sie den »Business Talk« – »Erledige bitte die Hausaufgaben«, »Räum bitte deinen Schulranzen auf«, »Wasch dich« und Ähnliches mehr – auf ein Minimum. So wichtig er ist, als Endlosschleife bringt er Ihrem Kind nichts. Viele Kinder nehmen dauernde Ermahnungen nur noch als soziales Hintergrundgeräusch der Eltern wahr, das man getrost überhören kann.
Im Fall der Familie Reinhardt bleibt noch nachzutragen, dass Tobias’ Gehör selbstverständlich mehrfach überprüft und immer als normal befunden wurde. Kinderarzt und Lehrperson sind wegen der späten Empfehlung einer Logopädie zu kritisieren. Beide hätten den Beteuerungen der Eltern, dass sie »schon alles richtig machten«, nachgehen und konkret erfragen können, was denn tagtäglich an Förderung passiert.
Kinder sollen im Haushalt mithelfen
Viele Eltern, so auch Klara, entbinden ihre Kinder von Arbeiten in der Familie, damit sie sich voll auf das Lernen konzentrieren können – vor allem wenn sie sich in der Schule schwertun. Die Idee, die dahintersteckt, klingt überzeugend: Das Kind soll nicht wertvolle Zeit mit so banalen Tätigkeiten vergeuden wie den Tisch abräumen, den Müll wegbringen, das Kinderzimmer aufräumen und beim Einkaufen helfen. Stattdessen soll es sich voll auf seinen Haupt»beruf«, den der Schülerin beziehungsweise des Schülers, konzentrieren. Leider führt dieses Konzept selten zum erwünschten Erfolg, wie in mehreren Studien gezeigt werden konnte. Man hat festgestellt, dass ein gelungener Start in das Schulleben hoch mit dem Bildungsgrad der Eltern sowie einer umfassenden Einbindung des Kindes in familiäre Alltagspflichten korreliert. Mit anderen Worten: Je mehr die Kinder im Vorschulalter gelernt hatten, etwas Verantwortung im Familienleben zu übernehmen, desto leichter war für sie der Start in der Schule.
Dass die elterliche Schulbildung ebenfalls einen sehr starken Einfluss auf den Erfolg der Kinder in der Schule hat, ist allgemein bekannt und hat zu vielfältigen politischen Diskussionen geführt, auf die wir später noch eingehen werden. Interessant und wichtig ist ein Nebenbefund: Das Eingebundensein der Kinder in familiäre Pflichten korreliert nicht mit dem Bildungsgrad ihrer Eltern. Das bedeutet, dass Kinder aus höheren Bildungsschichten nicht nur durch Zwang und Disziplin zu besseren Schulleistungen gebracht werden und dass Eltern, die nicht das Glück hatten, eine höhere Bildung in die Wiege gelegt zu bekommen, viel dazu beitragen können, dass ihre Kinder in der Schule Erfolg haben. Übertragen Sie also im steten Austausch mit Ihrem Partner und dem Kind Verantwortung an Ihre Kinder, ihrem jeweiligen Entwicklungsstand entsprechend. Im Übrigen können Kinder, die aktiv im Haushalt mithelfen, viel über strukturiertes Arbeiten lernen, über sinnvolle Zusammenarbeit, Grundrechenarten, sogar über Grundprinzipien der Botanik, der Physik, der Chemie, der Elektrizität und vieles, vieles andere mehr.
Seneca übertreibt mit seiner ironischen Zuspitzung »Non vitae, sed scholae discimus« (»Nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir«). Umgekehrt ist es richtig: Kinder lernen nicht nur in der Schule und nicht nur für die Schule. Schule ist Leben, und Leben ist Schule. Kinder in den Alltag mit einzubeziehen und die Dinge des täglichen Lebens zu erklären ist die beste Vorbereitung für die Schule, Einbindung in familiäre Alltagspflichten, Mitarbeit in der Familie und ein hohes häusliches Anregungsniveau sichern den Schulerfolg! Und das können alle Eltern ermöglichen, unabhängig vom eigenen Bildungsabschluss!
Lernen: zu Hause top, in der Schule ein Flop
Warum kann denn Tobias nur zu Hause alle Aufgaben lösen, nicht aber in der Schule? Das gemeinsame Lernen Tobias’ und seiner Mama entwickelte sich immer mehr zu einem ganz besonderen Ritual. Der Küchentisch wurde leer geräumt, es gab Naschereien und feine Getränke. Tobias sollte sich konzentrieren können, also wurden alle anderen Familienmitglieder angewiesen, sich möglichst ruhig zu verhalten. Mit der Besprechung der Hausaufgaben und ihrer gemeinsamen Bearbeitung, mit Sprechübungen zur Verbesserung des Redeflusses und der Artikulation, funktioneller Entspannung, Atemtherapie, gemeinsamem Singen und Konzentrationsübungen vergingen rasch zwei, manchmal fast drei Stunden. Enttäuschend war, dass Tobias in der Schule keineswegs die gleichen Leistungen abliefern konnte wie zu Hause in Gegenwart seiner Mutter. Beide, Tobias und seine Mama, überlegten, ob nicht die Lehrperson eine besondere Abneigung gegenüber dem Jungen hegte. Allerdings war sie bei anderen Familien durchaus beliebt. Es schien ein Mysterium.
Des Rätsels Lösung könnte sicher sein, dass sich Tobias nicht auf das Lernen konzentrierte, sondern vor allem die ausschließliche Zuwendung seiner Mutter genoss, die er auf eine so einfache Art und Weise erwerben konnte. Die Mutter wiederum war innerlich möglicherweise so sehr mit ihrem Sohn verbunden, dass sie, auch ohne es zu hinterfragen, fast immer davon überzeugt war, dass Tobias alle Fragen, die die Lehrperson ihm würde stellen können, glänzend beantworten könnte.