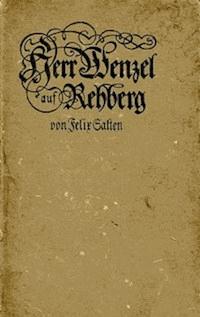0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 470
Ähnliche
Anmerkungen zur Transkription:
Die Rechtschreibung und Zeichensetzung des Originals wurde weitgehend übernommen, lediglich offensichtliche Druckfehler wurden korrigiert. Eine Liste vorgenommener Korrekturen befindet sich am Ende des Textes. Die Originalvorlage ist in Fraktur gedruckt; davon abweichende, in Antiqua gedruckte Textstellen sind in der vorliegenden Version kursiv dargestellt, soweit es sich nicht um Einzelbuchstaben, römische Zahlen, Maßeinheiten oder den Titel »Dr.« handelt. Gesperrt gedruckte Textstellen sind auf Ebook-Betrachtern fett wiedergegeben.
Aus der Zeit des Weltkrieges
Aus Dankbarkeit meinen Jungs!
Seeteufel
Abenteuer aus meinem Leben
von
Graf Felix v. Luckner
Korvettenkapitän a. D. ehemaligem Kommandanten des Hilfskreuzers »Seeadler«
Mit 133 Abbildungen und einer Karte
Neue, vermehrte Auflage
101. bis 160. Tausend
Leipzig
Verlag von K. F. Koehler
1923
(Schutzformel für die Vereinigten Staaten:)
Copyright 1921 by K. F. Koehler, Leipzig.
Druck vom Bibliographischen Institut, Leipzig.
Inhaltsverzeichnis
Erster Teil
Seite
1. Kapitel: Wie ein Seemann entsteht
1
2. Kapitel: Auf der Suche nach einem passenden Beruf
19
3. Kapitel: Als Matrose rund um die Welt
31
4. Kapitel: Wieder auf der Schulbank
69
5. Kapitel: Kaisers Rock
75
6. Kapitel: Offizier und immer mal wieder Matrose
83
7. Kapitel: In Kamerun
100
8. Kapitel: Krieg und Seeschlacht
110
Zweiter Teil
9. Kapitel: Das Segelschiff als Kreuzer
132
10. Kapitel: Blockadebrecher
147
11. Kapitel: Eine peinliche Untersuchung
156
12. Kapitel: Kaperfahrt
169
Dritter Teil
13. Kapitel: Schiffbruch und Robinsonleben
200
14. Kapitel: Zweitausenddreihundert Seemeilen im offenen Boot
219
15. Kapitel: Im Zuchthaus
237
16. Kapitel: Auf Motuihi
249
17. Kapitel: Flucht und neue Kaperfahrt
276
Letztes Kapitel: Der Vogel im Käfig
291
Die Besatzung des »Seeadler«
310
Die Besatzung der »Kronprinzessin Cäcilie« und der »Moa«
311
Verzeichnis der Abbildungen
315
Das Umschlagbild mit Darstellung des »Seeadler« wurde mit gütiger Erlaubnis des Marinemalers Christopher Rave nach einem im Besitze des Grafen Luckner befindlichen Ölgemälde gedruckt.
Neben dem Verfasser haben hauptsächlich die Herren Karl Kircheiß, Alfred Kling, Franz Pfeil und R. Hofmann durch Übermittlung der in ihrem Besitz befindlichen Photographien den reichen Bilderschmuck ermöglicht.
Seit Erscheinen der 1. Auflage ist das von I. K. H. der Kronprinzessin dem Seeadler bei seiner Ausfahrt gestiftete Bild in Deutschland eingetroffen. Auf Seite 151 findet sich eine getreue Reproduktion des Originals. Die Wiedergabe erfolgt mit Erlaubnis der Firma W. Niederastroth, Kgl. Hofphotograph, Potsdam.
Allen Genannten sei auch an dieser Stelle verbindlichster Dank ausgesprochen.
Auf Grund von Aufzeichnungen, die Leutnant z. S. Kling nach seiner Rückkehr aus Chile in freundlicher Weise zur Verfügung stellte, konnten die Erlebnisse des in Mopelia verbliebenen Hauptteiles der Seeadler-Besatzung in der vorliegenden Auflage (Seite 247/48) ausführlicher behandelt werden. Den vielen Freunden des Buches wird diese Ergänzung willkommen sein.
Die Verlagsbuchhandlung.
Erster Teil.
Erstes Kapitel.Wie ein Seemann entsteht.
Seitdem ich das vielleicht letzte Segelschiff der Kriegsgeschichte auf seiner Piratenfahrt geführt habe, werde ich häufig von Freunden und Fremden nach meinen Lebensschicksalen gefragt. Man vermutet, daß nicht ganz normale Entwicklungslinien zu dem ungewöhnlichen Gedanken hingeführt haben, im zwanzigsten Jahrhundert den Krieg per Segel auf das Weltmeer hinauszutragen.
In der Tat habe ich mancherlei rund um die Welt erlebt und aus besonderen Tiefen mich emporarbeiten müssen. Heute als Seeoffizier in der deutschen Reichskriegsmarine sollte ich vielleicht verheimlichen, was alles ich schon in meinem Leben gewesen bin. Aber da nun einmal meine besondere Art und Weise, Krieg zu führen, nur aus meiner Jugendentwicklung zu verstehen ist, so will ich ruhig bekennen, wie mich der Seeteufel von frühen Tagen an beim Schopf gefaßt und hin und her geschleudert hat.
Ihr, in glückliche Lebenslagen Hineingeborene, seid nicht zu streng mit armen Schelmen, die ihren Geburtsschein eine Zeitlang in den Strumpf wickeln müssen; vielleicht ziehen sie ihn später wieder mit Ehren heraus. Und ihr, die ihr hart und mühselig arbeitet, um einen Weg aus der Niederung des Lebens emporzuklimmen, verzaget nie! Das Mauseloch findet sich. Vielleicht steht auch ihr noch einmal auf der Kommandobrücke.
Und ihr deutschen Leser insgesamt, denen das Herz blutet beim Gedanken an die weite, herrliche, große See, wo jetzt die deutsche Flagge nicht mehr fahren soll, seid getrost! Ein Volk, das die blauen Jungens vom »Seeadler« hervorgebracht hat, wird auch die See wieder grüßen dürfen, dessen seid in Not und Schmach gewiß!
Wenn ich nun so unbescheiden sein darf, von mir zu erzählen, ersuche ich den geduldigen Leser, sich zunächst in die Quinta des Gymnasiums zu Dresden zu versetzen, und zwar genauer in die Seele eines bereits recht hoch aufgeschossenen, in Quinta doppelt seßhaften Jünglings.
Als ich nicht nach Quarta versetzt wurde, wie ich versprochen hatte, gab es zu Hause das Jack voll.
Meine Großmutter aber hatte eine andere Erziehungsart als mein Vater. Sie war viel sanftmütiger und weicher.
Es ging ihr immer wie ein Stich durchs Herz, wenn man mich mit brutaler Gewalt bessern wollte. Eines Tages sagte sie zu meinem Vater: »Ich will mal versuchen, den Jungen mit Liebe zu erziehen.«
»Du wirst den Bengel noch mehr verderben, aber versuch’ es,« war die Antwort.
Großmutter nahm mich beiseite und sprach: »Kind, wenn du versprichst, fleißig zu sein, erhältst du für jeden Platz, den du in der Klasse hinaufkommst, fünfzig Pfennige.«
Im Augenblick war ich außerstande auszurechnen, wieviel Geld ich dabei verdienen konnte, aber ich sagte: »Großmütterchen, ich verspreche dir, fleißig zu sein.«
»Das genügt,« sagte sie.
Ich war so stolz, daß man mir solches Vertrauen schenkte, und fing an tüchtig zu arbeiten. Das erste Extemporale kam, aber ich ging enttäuscht nach Hause und sagte: »Nicht versetzt.«
»Macht nichts, mein Kind,« sagte Großmütterchen, »ich merke, dein Ehrgeiz rührt sich.«
Das nächste Mal: Vier Plätze höher. »Siehst du,« sagte sie, »das ist der Lohn deines Fleißes.« Also zwei Mark.
Das nächste Mal: Zwei Plätze herunter. »Macht nichts,« meinte die Großmutter. »Du kannst dich noch nicht auf solcher Höhe halten, bewahre nur deinen Ehrgeiz.«
Sie zog aber die heruntergekommenen Plätze nicht ab. Ich entdeckte, daß ich somit aus allen Geldverlegenheiten kommen könnte. An Gewinnsucht habe ich nie besonders gelitten, aber die Sache hatte auch ihre sportliche Seite. Ich wollte mir nämlich eine Karnickelzucht anlegen und einen Kaninchenbock kaufen. Der kostete 7 Mark, dazu mußte ich also mindestens 14 Plätze springen.
Und es gelang!
Freilich nur ganz vorübergehend. Der Mammon machte mich zu einem ganz abscheulichen Kerl. Die Sprünge hinauf und hinunter wurden infolgedessen immer größer, immer gewagter. Ich wurde auf diese Weise eines Tages sogar Primus.
Großmutter selbst legte mir nahe, es dem Vater noch nicht zu erzählen. Aber als sie in jenen Tagen einmal den Gymnasialdirektor Oertel traf, konnte sie ihren Stolz doch nicht zurückhalten: »Was sagen Sie nun zu Felix? Das Kind ist durch meine Methode, durch diese bescheidene Sache mit den fünfzig Pfennigen, sogar Primus geworden. Ich bin so glücklich. Was steckt doch in dem Kinde.«
Da sagte der Direktor erstaunt: »Felix Primus? Das muß wohl ein Irrtum sein. Der Ordinarius hat ja in keiner Konferenz etwas davon erwähnt. Ich glaube, Felix ist immer noch der Letzte.«
Großmütterchen war außer sich. Sie eilte nach Hause und machte mir die bittersten Vorwürfe, doch so, daß Vater nichts hörte. Denn sie wollte sich nicht mit ihrer Erziehungsweise blamieren. Nun besaß sie zwei Möpse. Georg, der jüngere, war 13 Jahre alt, Friedrich, der ältere, 14 Jahre; beide waren starke Asthmatiker. Georg fuhr immer Schlitten auf dem Teppich, wenn er unten gewesen war. Dem Friedrich mußte das wohl gefallen und er ahmte es nach, gerade als Großmütterchen mich vorhatte. So wurde sie von dem Thema abgelenkt und bemerkte dabei, daß der Friedrich eine unverdauliche Wurstschnur gefaßt hatte, die ihn genierte und die er eben abschleppen wollte. Georg lag seines Asthmas wegen am Sessel und pumpte Luft. Großmütterchen, als sie Friedrich sah, war ganz entsetzt, denn ihre Möpse standen ihr näher, und dabei entschlüpfte ich ihrer Strafpredigt. Nachdem Großmutter sich wieder mir zugewandt hatte, erklärte sie nur noch kurz: »Mit uns beiden ist es aus!« und so stand ich in meiner ganzen Schlechtigkeit wieder auf neutraler Zone, ihr nicht zu nahe und dem alten Herrn nicht zu nahe. Aus einem solchen Bösewicht konnte alles werden, nur nichts Ordentliches.
Als Ostern herankam, wurde ich versuchsweise versetzt, aber mir nahegelegt, die Schule zu verlassen. So kam ich nach Halle a. Saale, zu Hütter & Zander, einer berühmten Presse, die vielerlei versprach und mich durchaus noch nicht verloren gab. Versetzt mußte ich ja schließlich noch ein paarmal werden, um die Offizierslaufbahn einschlagen zu können. Mein Vater nahm mir noch einmal das Versprechen ab, mich ernstlich dahinterzusetzen, um Kaisers Rock tragen zu können.
Das ging mir sehr nahe. Ich versicherte: »Ja Vater, ich werde versetzt! Ich verspreche dir, Kaisers Rock in Ehren zu tragen.«
Ich ahnte damals so wenig wie mein Vater, daß ich den zweiten Teil dieses Gelöbnisses einmal auch ohne den ersten Teil erfüllen konnte. Freilich nur nach ungewöhnlichen Krisen.
Vater versprach mir seinerseits, daß ich in den Ferien zu meinem Vetter reisen dürfte, wenn ich zu Ostern versetzt würde. Die Ferien begannen; ich aber fiel durch.
Meine Eltern waren verreist. Der Hauslehrer, ein Student, der Vollmacht erhalten hatte, mir die Reiseerlaubnis zu erteilen, kam mir schon entgegen: »Bist du versetzt?«
Ich biß auf die Zähne und erwiderte: »Jawohl, aber der Rektor ist verreist und hat die Zensur noch nicht unterschreiben können. Sie wird nach der Unterschrift per Post an Ihre Adresse gehen.«
Der Student war hocherfreut, daß sein Unterricht Erfolg gehabt hatte und beglückwünschte mich. Ich durfte reisen.
Ich traf nun in Ruhe meine Vorbereitungen.
Mein Bruder und ich besaßen jeder eine Kasse, da wurde, wenn Onkel oder Tante zu Besuch kamen, zuweilen je ein Goldfuchs hineingesteckt. Diese Kasse sollte schon immer mein Retter in der Not sein. Ich holte meine 80 Mark heraus, nahm aus meines Bruders Kasse auch 40 Mark ... sollten sie liegen bleiben? Etwas wollte ich ihm ja lassen ... Aber es handelte sich jetzt für mich um das Betriebskapital zur Gründung einer Existenz, und ich hoffte, ihm diese Zwangsanleihe dereinst mit Zins und Zinseszins zurückzahlen zu können. Mein Plan war einfach und beruhte auf angenehmen Vorstellungen, die das wenige, was ich vom Seemannsleben wußte, in mir erweckt hatte (das Landleben war mir in meinem bisherigen Schuldasein über große Strecken hin reichlich trocken vorgekommen). Insbesondere war mir einmal eine Speisekarte des Schnelldampfers »Fürst Bismarck« in die Hand gefallen. »Was, so feine Sachen gibt das auf See? Und Offizier auf einem solchen Schiff kann jeder werden?« Man hat Geschichten gelesen vom listenreichen Odysseus, der im Meer so viel herzkränkende Leiden erduldet, von Sindbad, dem Seefahrer. Aber diese größeren Vorgänger können dem ewigen Tertianer, der weder ein griechischer König noch ein arabischer Kaufmann ist, wenig praktische Winke für die Laufbahn hinterlassen. Seemännische Erfahrungen hatte ich bisher nur auf der Saale sammeln können, insbesondere in der Badeanstalt, wo mir Paddel- und Rammversuche mit einem selbstgezimmerten Kistenboot den Spitznamen »Seeräuber« eingetragen hatten.
Nun packte ich die Koffer, Jagdzeug vom Vater, Revolver und Dolch, und alles, was man in dieser Richtung brauchen konnte, dazu auch eine Tabakspfeife. Dann ging ich zum Bahnhof und fuhr nach Hamburg. Ich wollte gleich von unten anfangen und dachte: IV. Klasse ist das richtige. Ein Schlachtergeselle wurde mein Sitznachbar; der wollte auch zur See gehen. Weshalb, begriff ich nicht ganz. Bei mir wäre ohne Latein nie dieser Schwung in das Leben gekommen.
Als wir abends um ½ 11 Uhr am Klostertorbahnhof ankamen, sah ich ein großes Schild: »Concordia-Schlafsäle, Bett 50 Pfennig und 75 Pfennig.« Ich fand das für meinen Barbestand schon reichlich vornehm. Ein Dienstmann mit zweirädrigem Karren bietet sich mir hilfreich an. »Wohin soll das Gepäck?« »Nach Hotel ›Concordia‹.« »So! Na de Concordia! Denn komm man mit, min Jung, di hevt se woll na See to jagt?« Ich war nicht wenig erstaunt über die plötzlich vertrauliche Tonart und den feinen Riecher, den dieser olle Hamburger hatte. So kam ich zum erstenmal in meinem Leben über St. Pauli und war erstaunt über das riesenhafte Tingeltangel-Getriebe dieser internationalen Vergnügungszentrale der seefahrenden Nationen. Hier sah ich Chinesen, Schwarze. Wie ist das alles interessant! Vor allem belustigten mich die Schwarzen, die in bunten Röcken als Reklamefiguren vor den Lokalen standen.
Als wir in der »Concordia« ankamen, die sich im Hinterhaus befand, bestelle ich bei dem Portier ein Bett für 75 Pfennig. Der Dienstmann schleppt den Koffer nach oben. Der Portier öffnet die Tür und zeigt mir ein Zimmer, worin sich sechs Betten befanden. Ich sage ihm darauf: »Ich habe doch ein Bett für 75 Pfennig bezahlt.« »Ja Mensch, schlafen dir da noch nicht genug darin? Da nimm schon lieber ein Zimmer zu 50 Pfennigen, da hast du das Vergnügen, mit 50 zusammen zu schlafen.« Ich zog denn doch vor, das Zimmer zu behalten. Darauf überreichte er mir den Schlüssel, an dem sich ein riesiges Brett befand. Zunächst dachte ich: Du bist jetzt ein freier Mann, sieh dir doch zunächst einmal das Hamburger Leben an, das solch großen Eindruck auf dich gemacht hat. Als ich den Portier passierte und das Schlüsselbrett ellenlang aus meiner Tasche herausschaute, bemerkte er in seiner rohen Art: »För di kann man wohl ’n Balken an ’t Schlötelbrett hängen, dann steckst du den ok noch in. Denkst du, daß wir für alle Menschen, die da kampieren, einen Extraschlüssel zur Hand haben?«
Am nächsten Morgen erkundigte ich mich, wie man zu einem Schiff kommt. Mir wurde gesagt, ich müßte zu einer Reederei gehen.
»Die warten schon auf dich,« sang es in meinem Herzen, und ich begab mich zu Laeisz.
Dort wurde mir gesagt, man wollte mich gern vornotieren, ich müßte aber einen Erlaubnisschein vom Vater mitbringen, eine Urkunde über mein Lebensalter, genügend Geld für die Ausrüstung usw.
O weh, einen Erlaubnisschein? Aber es gab noch andere Reedereien am Platze. Ich ging also zu Wachsmuth und Krogmann, zu Dalström. Überall dieselbe Frage.
Nun dachte ich bei mir: Geh lieber selber auf ein Schiff und sprich mit dem Kapitän. Ich pirsche mich also nach dem Segelschiffshafen durch. Da lag das mächtige Becken mit seinem Mastenwald, und im stillen überströmte mich der Gedanke: Jetzt gehörst du in diesen Kreis.
(Mit Genehmigung der Firma Glückstadt & Münden, Hamburg.)
».. Da lag das mächtige Becken mit seinem Mastenwald.«
Aber wie sollte ich nun auf ein Segelschiff kommen? Denn wider mein Erwarten lagen diese nicht am Kai, sondern draußen an Pfählen.
Ich erfuhr, in dem Häuschen dort am Landungssteg säße ein Jollenführer, der würde mich rüberbringen. Ich sehe durch die Scheiben in das enge, gemütliche Innere der Bude und gewahre ein altes Seemannsgesicht. Der Alte fragt: »Wat willst, Jung?«
»Ich will auf ein Segelschiff.«
Ich trat zu ihm ein; er trank seinen Kaffee zu Ende, danach gingen wir zum Boot, und er brachte mich hinüber. Er wriggte mit einem Riemen[1]; ich war sprachlos über diese Rudertechnik. So kamen wir längsseit irgendeines Schiffes, das er mir auf meine Bitte erklärte. Da sah ich die hohen Masten aus der Nähe und hatte einige Furcht, daß man da hinauf müßte. Indessen beruhigten mich die Taue und Rahen, denn ich dachte, das wär eine Art Rouleausystem, das man gemächlich von Deck aus auf- und niederzieht. Zweifelnd wagte ich die Frage: »Müssen da Menschen hinauf?« »Aber natürlich,« sagte mein Führer, »möt de Minschen da herop, un ganz boben, da hürt de Schipjung hen. In Hobn (Hafen) is dat nich slimm, aber wenn dat Schip op See is un hen un her kullert un stampen deit, denn denkst du wat anners.«
»... un ganz boben, da hürt de Schipjung hen.«
Da fühlte ich doch einen gewissen Block auf dem Herzen sitzen.
Alles wurde mir erklärt; durch die hohen Masten hatte ich trotzdem etwas die Begeisterung verloren.
Als wir wieder an Land kamen, schüttete ich dem Alten mein Herz aus. Da sagte er mir: »Min Jung, lot dat no (laß das nach)! Ik fohr all fiefuntwinting Johr na See to un bün nich wider kamen, wie as Kaptein op min lüttje Joll. Wat is denn din Vadder?«
»Gutsbesitzer.«
»Wie heetst du denn, min Jung?«
»Graf Luckner.«
»Wat, en Grof,« sagt er, »du büst ’n Grof? Un willst no See to? Min Jung, en Grof is doch ’n Mann, de ’n Bondsche (Geschäft) bi ’n König hett? Dank din Vadder op Kneen, dat he so ’n feines Bondsche hett. Lat di dat Jack full hauen, un dank em bi jeden Slag daför. Ik wull, ik kunn för ’n Jack full so ’n Vadder mit so ’n Bondsche kriegen, denn wull ik woll ruhig hen holln.«
Aber daß ich den Eltern entlaufen war, gab ihm doch zu denken, und er meinte: »Ik heet Pedder, segg du man ›du‹ to mi, ik will di wol torecht helpen. Du sallst nich no See to. Da kümmst du nich wider. Kik mi ollen Mann an, ik möt op so ’n lütt Schip fohren un krieg kein Penn för de Ladung.«
(Mit Genehmigung der Firma Ludwig Carstens, Hamburg.)
»... Ik heet Pedder, segg du man ›du‹ to mi.«
»Pedder, ich will aber doch zur See.«
Ich kam den nächsten Tag wieder, brachte ihm einen Priem Kautabak mit und lernte bei ihm das Wriggen. Er riet andauernd dringend ab. »Du sallst nich to See gahn.« Allgemach kam ich so weit, daß ich ihm das Fahren abnehmen konnte, und wriggte für ihn die Passagiere, während er den Kaffee kochte. So wurden wir Freunde. »Meine Eltern wissen noch nicht, daß ich fortgelaufen bin,« sagte ich, »aber ich will nicht zurück, denn wenn ich wieder auf die Schule gehe, dann weiß ich schon, wie es kommen wird; in Obertertia heben sie mich zum Militär aus, lange bevor ich das Einjährige habe.«
»Jung, Jung, lat dat Schipfohren sin. Bliev hier, min Jung.«
Er versicherte mir wiederholt, das Fahren wäre unmöglich, ich müßte die Erlaubnis dazu beibringen und zwei- bis dreihundert Mark für die Ausrüstung. Heutzutage würde aus den Schiffsjungen nur Geld gemacht und dergleichen.
Ich ließ mich aber nicht abbringen. Als ich nun am fünften Tag morgens wieder zu ihm kam, da winkte er mir schon von ferne und rief mir freudestrahlend zu:
»Jung, ik hev en Schip för di. Ik hev ’n russischen Kaptein översett nah sin Schip. Ik hevn fragt, ob he en düchtigen Jung hebben wull. ›Ja, gern,‹ seggt de Kaptein, ›wenn he kein Heuer[2] hebben will.‹
›He will bloot en Schip,‹ harr ik seggt. ›Denn lat em man an Bord kamen,‹ seggt de Kaptein.«
Am liebsten hätte ich oll Pedder bei dieser Nachricht umarmt.
»So min Jung, jetzt bring ik di röver op dat russische Bullschip ›Niobe‹ un stell di vör.«
Der russische Kapitän machte einen wenig vertrauensvollen Eindruck auf mich, sah gelb und häßlich aus, halb Mephisto, halb Napoleon III., mit einem fiesigen Ziegenbart.
»Du kannst mitkommen,« sagte er in gebrochenem Deutsch. »Finde dich morgen ein.«
Er gefiel mir nicht.
»Min Jung, dat is ganz egal,« sagte oll Pedder und klopfte mir auf die Schulter, »ob dat en dütschen odern engelschen Schip is oder ’n Russen is, dat blievt sick glik. Seefahrt is överall datsülwige. So, min Jung, nu wüllt wi an Land gahn un di ’ne Utrüstung besorgen.«
Er machte sich landfein, schloß sein Häuschen ab und wankte mit mir nach Hamburg hinüber.
Es waren noch etwa 90 Mark, die ich hatte. Davon kaufte er bedächtig prüfend alles ein, was ich brauchte, warmes Zeug, Ölzeug, Messer mit einer Scheide und eine sachgemäße Pip mit Tobak. Wie war ich stolz. Aber für eine Seekiste und für einen Seesack langte es nicht mehr. Oll Pedder sagte: »Ick gew’ di min Seekist, mit de ik all 25 Johr um de Welt seilt bin. Ick hev damit glücklich fohren, un dat sallst du ok.«
Wir biegen in eine schmale, graue Straße im ältesten Hamburger Hafenviertel, in den »Brauerknechtsgraben« ein. Eine schmale, steile Holztreppe führt nach oben. Peter steigt schwer, sich an dem Geländer festhaltend, hinauf. An der Tür steht auf einem Messingschild »Peter Brümmer«. Er grabbelt umständlich nach seinem Schlüssel, fühlt mit dem Finger nach dem Schlüsselloch und schließt auf. »So, min Jung, hier bin ik to Hus, komm mal rin.« Zunächst fällt mir ein geschwärztes Dreimastvollschiff an der Wand auf, das ich anstaune. Ich frage: »Pedder, hast du das gemacht?«
»Ja, min Jung.«
Ferner hing ein ausgestopfter fliegender Fisch an der Decke, ein auf Segeltuch gemaltes Schiff mit einem selbst an Bord verfertigten Rahmen an der Wand, auf der Kommode standen verschiedene chinesische Sachen und sonstige Reiseerinnerungen. In der Ecke stand ein Käfig mit einem Papagei, der ziemlich zerrupft war und ebenso alt aussah wie Pedder. »Ja,« sagt er, »den hew ik von Brasilien mitbröcht, de snackt blot span’sch.« Dann: »Hier is min Kist.« Er schloß die Kiste auf, kramte aus und zeigte mir noch verschiedenes, was er früher an Bord an Flechtwerk gemacht hatte, packte alles bedächtig heraus und bemerkte: »Min Jung, de Kist’ swemmt, de hölt waterdicht.« Während er meine Sachen in die Kiste verstaut, werde ich auf das bescheidene Sofa genötigt, dessen Bezug mit weißen Porzellanknöpfen angenagelt war. Als die Kiste gepackt war, trugen wir sie gemeinsam an den Griffen zum Hafen hinab.
Nachdem ich den letzten Tag ganz mit ihm verbracht hatte, fuhr er mit mir an Bord. Er führte mich an die Koje, wo ich schlafen sollte, packte Matratze und Keilkissen hinein und sagte: »Un noch eins, min Jung, een Hand för ’t Schip un een Hand för die sülwsten[3].«
Dann gab er mir noch den Rat, nicht unter meinem Namen zu fahren. Als Graf ginge das nicht. »Dat is all datsülwige, as wenn en Oldenburger Faut (Fuß) in Pariser Schohtüg (Schuhzeug) sett.« Wie denn meiner Mutter Mädchenname hieße. Danach riet er mir, ich sollte mich Luckner genannt Lüdicke nennen. Das war fortan mein Name, sieben lange bunte Jahre hindurch. Pedder drückte mir zum Abschied die Hand mit den Worten: »Min Jung, verget din oll Pedder nich!« Das Schiff warf los. Der Schlepper war vorgespannt, und oll Pedder wriggte neben dem sich langsam in Bewegung setzenden Schiff bis nach St. Pauli Landungsbrücken. »So, min Jung, wider kann ik nich,« und mit Tränen in den Augen: »Goode Reis’ nah Australien. Min Jung, ik seh di nie wedder, du geihst mi doch nah.« Ich wollte was sagen, aber die Tränen kullerten mir runter. Ich hatte nicht Heimweh nach Hause, aber nach meinem alten, braven Seemann. Wie ich nachher die Kiste aufmache und sehe, wie er alles gepackt hat, da liegt ein Bild von ihm obenauf mit einer Widmung drauf: »Verget din Pedder nich.« Ne, min oll, good Pedder, ik verget di nich!
Ich verstand nichts von der Sprache der Leute auf dem Schiffe und der Kapitän zeigte auch bald böse Miene, denn ich war natürlich sehr unbeholfen. Der Steuermann, der etwas englisch sprach, fragte, was mein Vater wäre.
Ich sagte: »Landwirt.«
»Na, dann können wir dich ja gleich zum Oberinspektor machen.« Der Steuermann bedeutete mir, ihm zu folgen. Ich war sehr neugierig, was das für eine Würde wäre. Dann hielten wir am Schweinestall.
»Gewiß, das kann ich machen.«
»Und dann bist du ferner noch Direktor der Steuerbord- und Backbord-Apotheke.«
Darunter versteht man, wie ich bald erfuhr, einen Ort, den sich jeder allein denken mag.
Wie eine Takelage von Deck aussieht.
Ich hatte mich dort mit der Kanalisierung vertraut zu machen, daß die immer klar wäre. Die Schweine durfte ich nicht herauslassen, sondern mußte zu ihnen hinein. Das eine Schwein schubberte sich stets an meiner Seite ab, wenn ich mit Eimer und Schrubber einstieg, um Reinlichkeit zu verbreiten. Das Schmutzwasser lief beim Scheuern in die Stiefel. Ich sah schlimmer aus, als die Schweine selbst. Seife und Wasser mußten gespart werden. Zwei Paar Beinkleider hatte ich nur zum Wechseln. Jeder gab mir einen Fußtritt, weil ich so wie ein Schwein aussah. Dazu die »Apotheke«! Kurz, ich war mir selbst übel.
Nach dem Mast wagte ich mich nicht hinauf, machte höchstens die ersten Versuche zum Mars. Ich klammerte mich auf jeder Stufe fest, glaubte, obwohl es gar nicht hoch war, in schwindelnder Höhe zu stehen, und rief, sie sollten mal gucken, was ich für ein couragierter Kerl wäre! Aber das Klettern machte wenig Fortschritte, bis einst ein Matrose mir sagte: »Was du kannst, kann auch eine alte Köchin.«
Das verletzte meinen Ehrgeiz. Lieber »von oben kommen«,[4] als das noch einmal hören!
Dazu sah ich, wie die anderen Jungs oben herumwippten. Wir lagen vor Cuxhaven vor Anker und warteten auf günstigen Wind. So hatte ich noch Gelegenheit, mich bei ruhigem Wetter an die Masten zu gewöhnen, und zwang mich mit aller Gewalt: »Rauf.«
»... und zwang mich mit aller Gewalt: ›Rauf‹.«
Wenn ich abends Wache an Deck ging, 4 Stunden Wache und 4 Stunden Schlaf abwechselnd, und ich sah in Cuxhavens Straßen die Kinder spielen, dann überkam mich das Heimweh. War ich selbst doch noch ein halbes Kind. Kein Mensch, der mich verstand, und mit dem ich mich aussprechen konnte. Ich fühlte mich verlassen, und der abgeschüttelte Druck der Schule ward vergessen über der verlorenen Schönheit des Elternhauses.
Endlich kam guter Wind, die Segel wurden gesetzt, und wir nahmen Kurs auf Australien. Zehn Tage, nachdem ich von zu Hause weg war, verließen wir die deutsche Heimat. Bald hatten wir den Kanal hinter uns und schwammen auf dem Atlantik, und die guten Eltern glaubten immer noch, ich verlebte meine berechtigten Ferien bei den Verwandten.
Das war ein hartes Schiff, was ich unter den Füßen hatte; viel Keile gab’s und wenig Brot. Die Speisekarte des »Fürsten Bismarck« fand ich nirgends vor. An Stelle des Frühstückskaffees gab es Wutki; darin wurde das Hartbrot aufgeweicht. An das scharfe Salpeterfleisch habe ich mich auch nur langsam gewöhnt.
Allmählich verwuchs ich mit meinem Beruf und mit dem Schiff und lernte einiges von der Sprache der Besatzung. Der Steuermann war mir wohlgesinnt, der Kapitän aber mein Feind, der Feind aller Deutschen. Trotzdem war ich bestrebt, auch ihn für mich zu gewinnen.
Äquatortaufe auf »Seeadler«.
Ein wichtiger Einschnitt im Leben des Seemannes ist die Äquatortaufe, die jeder, der zum erstenmal den Trennungsstrich der beiden Erdhälften überfährt, empfängt. Am Abend vorher künden bereits große Vorbereitungen die Wichtigkeit dieses Ereignisses an. Am Bug des Schiffes, wo eine Plattform gelegt ist, kommen graue Gestalten herauf und rufen: »Schip ahoi! Wie heet dat Schip?« »Niobe.« Der Kapitän ruft hinüber: »Kommt mal her!« In ihrem Meereskostüm klettern die Gestalten an Seilen hoch, als wenn sie aus dem Meer tauchten. Es ist Neptun mit seinen Gesandten und Kundschaftern, durch die er feststellen läßt, wer das Schiff ist und wie die Täuflinge heißen, die schmutzig von der Nordseehälfte zum erstenmal in seine Gewässer kommen. Eine Liste wird ihm überreicht; er dankt und geht mit seiner Gefolgschaft wieder in die Tiefe bis zum nächsten Tag. Da kommt er wieder, um die Taufe zu überwachen, weißbärtig, mit Dreimastszepter, in einem Talar, der von Meerschlinggewächsen überwuchert ist, hinter ihm seine Frau in prächtiger Aufmachung und dann der Pastor, der Friseur, der die Täuflinge rasiert, da er den Erdenschmutz von ihnen abkratzen soll. Ihm folgt der Einseifer mit einer Rasierquaste und einem Teerpott. Zuletzt kommt die Polizei in Gestalt von Negern. Aufs würdigste wird Neptun von dem Kapitän begrüßt. Die Täuflinge müssen Aufstellung nehmen und an ihm vorbeiziehen, damit er prüfen kann, ob sich keiner versteckt hat, und noch einmal untersucht die schwarze Polizei gründlich das Schiff. Eine Riesenbalge steht an Deck, das sogenannte Taufbecken, mit einem langen Sitzbrett darauf. Einzeln werden die Täuflinge herangeführt; der Pastor liest jedem eine Epistel vor über das, was geschieht, und fragt sie, ob sie die Taufgelübde halten wollen. Beim jedesmaligen »Ja« wird dem Täufling die Teerquaste durch den Mund gezogen und dann mit den großen Rasierholzmessern der Teer abgekratzt. Darauf zieht man das Sitzbrett plötzlich unter ihm los, und der Täufling fällt hinterrücks in die Balge, wo er noch sechsmal untergetaucht wird. Damit ist der Taufakt beendet, über den ein Schein ausgestellt wird, und der nächste Täufling steht zur selben Prozedur bereit.
Den ganz naiven Jungs gibt man auch noch ein Fernrohr, über dessen Glas ein Haar gezogen ist, das sie dann, wenn sie hindurchsehen, für den Äquator halten.
In früheren Jahren soll die Taufzeremonie in dem sogenannten »Kielholen« bestanden haben. Mit einem Tau wurden dem Täufling die Füße zusammengebunden, ein Tauende wurde um seine Arme geschlungen, das andere um das Schiff herumgenommen und der Täufling unter dem Schiffskiel hindurchgezogen, zuweilen drei- bis viermal. Diese grausame Prozedur, bei welcher mancher Täufling durch Haie den Tod fand, ist, wie mir die Kameraden erzählten, mit der Zeit zu der jetzigen Form der Äquatortaufe abgemildert worden.
Neptun hat aber bei mir offenbar eine gründlichere Taufe für nützlich gehalten.
Eines Tages, als wir schweren Sturm gehabt hatten, auf welchen starke Dünung folgte, war alles, bis auf Sturmsegel festgemacht, und die Obermarssegel sollten gesetzt werden, damit das Schiff ruhiger läge. Ich wollte dem Kapitän zeigen, wie schnell ich das könnte und begab mich nach oben, das Segel loszumachen. Da vergaß ich das Wort des alten Pedder: »Eine Hand fürs Schiff und eine Hand für dich,« das Segel schießt infolge eines Windstoßes los wie ein Ballon, ich verliere den Halt, falle hintenüber, will mich halten, an dem halb aufgeschossenen Seising. Das Tau saust mir durch die Hände, verbrennt sie, und ich falle über Bord, dicht an der Bordwand entlang, an welcher ich also um ein Haar zerschmettert wäre. Meine Mütze fiel noch auf Deck.
Wer kennt die Taue?
Das Schiff sauste mit acht Meilen Fahrt davon. Ich komme am Heck hoch, im Kielwasser, das mich umdreht, sehe eine mir nachgeworfene Rettungsboje und höre noch den Ruf: »Mann über Bord«, dann verschwand ich im Wassertal und sah nichts mehr von dem Schiff.
Als ich nach Minuten, die einer Ewigkeit glichen, wieder hochgeworfen wurde, erblickte ich das Schiff weitab. »Das Schiff kriegst du nicht wieder, aber vielleicht kommt ein anderes.« In solch unbegreiflichen Hoffnungen wiegte einen der liebe Wunsch zu leben. Als ob gerade auf dem weiten Ozean ein Schiff da entlang kommen müßte, wo ich ins Wasser gefallen war.
Um mich her flatterten die Albatrosse, jene riesigen Seevögel, die immer des Glaubens sind, alles, was im Wasser liegt, sei für sie zum Fressen da. Sie stießen auf mich zu, einer, der dicht an mir vorbeistrich, kriegt mich mit dem Schnabel an der ausgestreckten Hand zu fassen, ich will ihn festhalten ... in der Angst des Ertrinkens klammert man sich an allem fest, sogar an einem Vogel ... da hackt er mir jene tiefe Wunde, deren Narbe ich noch als Andenken an jenen Kampf im Wasser trage, in die Hand.
Ich löste die Stiefel und das Ölzeug von mir; der Sweater aber, der sich vollgesogen hatte, ging nicht ab. Da fielen mir die Worte meiner Mutter ein, die einmal, als ich von meiner Neigung zur See sprach, gesagt hatte: »Da hast du dir den richtigen Beruf erwählt; du wirst nichts weiter werden als Haifischfutter.« Als mir jetzt beim Wassertreten diese Worte durch den Sinn gingen, stieß ich zufällig mit dem einen Fuß gegen den andern. Mich durchzuckte die Vorstellung, das wäre ein Hai, der mich faßte. Das traf mich wie ein Nervenschlag. Ich wußte nicht mehr, wie mir geschah und was vor sich ging, bis ich plötzlich auf einem Wellenkopf hoch über mir ein Boot sah, das im gleichen Augenblick schon tief unter mir vorbeiglitt. Ich schrie: »Hier, hier.« Es war der Steuermann.
Bald saß ich zitternd im Bug des Bootes, und die stämmigen Matrosen ruderten zum Schiff zurück. Blutüberströmt von meiner Wunde erzählte ich dem Steuermann den Zweikampf im Wasser. Da meinte er, den Albatrossen hätte ich mein Leben zu verdanken, denn sie allein hätten ihm angegeben, wo ich war. Man hatte zuerst den Rettungsgürtel gefunden, dann mich.
Die Matrosen waren sichtbar erfreut, mich gerettet zu haben, und selbst dachte ich bei mir, wie wird sich erst der Kapitän freuen, daß er mich wieder hat. Er geht auf dem Achterdeck hin und her, siedend vor Wut. Er schreit mir entgegen: »Du verfluchter Deutscher, ich wollte, du wärest versoffen. Sieh, wie die Segel kaputtgegangen sind durch deine Untauglichkeit.«
Wir kamen längsseit des Schiffes, aber jetzt begann erst die Hauptaufgabe, das Boot wieder an Bord zu bringen. Wenn das Schiff herunterstampfte, wurde das Boot hochgedrückt, und wenn das Schiff hochging, wurde das Boot nach unten gezogen. So tanzte es immer hin und her, und man bemühte sich vergebens, die Bootstaljen hineinzubekommen. Ich war so aufgeregt, daß ich, wie das Boot höher als die Reeling stand, hinübersprang auf Deck und bewußtlos zusammenbrach.
Schwere See.
Den Seeleuten gelang es nicht, an Bord zu kommen. Das Boot wurde zertrümmert, die Mannschaft sprang ins Wasser und kletterte an zugeworfenen Tauen an Bord.
Der Kapitän nahm eine Flasche Wutki, preßte sie mir zwischen die Zähne und rief: »Hier sauf, du deutscher Hund.« Am nächsten Tage war ich beim Aufwachen ganz benommen und habe von diesem Schreckenstag noch heute einen leichten Tatterich. Der Kapitän, als er mich am andern Morgen noch in der Koje fand, haute mich heraus mit den Worten: »Ob ich zum Fressen und Schlafen an Bord sei,« obwohl ich kaum aufrecht stehen konnte.
Mir wurde erzählt, als ich über Bord fiel, hätte der Steuermann gerufen: »Freiwillige ins Boot.« Aber der Kapitän hätte mich nicht retten lassen wollen; er hatte das auch nicht nötig, denn nach den Bestimmungen braucht er von sich aus kein Boot auszusetzen, wenn er glaubt, daß dabei andere gefährdet werden. Er hatte mit einer Harpune dagestanden und den Steuermann bedroht: »Wenn du das Boot herunterlässest, stoße ich dir die Harpune in den Bauch.« Aber der hatte sich einfach umgedreht: »Ich habe meine Freiwilligen, stoß zu,« und fuhr ab. Das hatte die Wut des Kapitäns noch gesteigert.
Der Kurs ging um das Kap der Guten Hoffnung, und endlich kamen wir nach Australien. Meine erste Seereise war vollendet. Ein harter Anfang. Aber zurück zur Schule? Nein. Ist man schon ein Lausbub, soll man nicht andern zur Last fallen. Lieber zusehen, was sich eben mit eigener Kraft aus dem Leben machen ließ.
[2] Lohn.
[3] D. h.: Wenn du oben in der Takelage arbeitest, halte dich immer mit der einen Hand fest.
[4] Seemännischer Ausdruck für Abstürzen.
Zweites Kapitel.Auf der Suche nach einem passenden Beruf.
In Freemantle ging ich viel an Land und bereitete mich zu einem Fluchtplan vor. Geld verdiente ich ja keins. Auch hatte ich mir Australien interessanter vorgestellt, lauter Neger mit Pfeil und Bogen und Palmen dort erwartet. Der Anblick einer kahlen, langreihigen Stadt wie Freemantle enttäuschte mich.
Ich sah auch ein deutsches Schiff dort und hörte, wie gut es die Leute darauf hätten. Es tat mir wohl, mich wieder mit Deutschen unterhalten zu können. Die Landsleute luden mich gelegentlich ins Hotel Royal ein. Dort schüttete ich der Tochter des Hauses mein Herz aus: Ich wäre ein freier Mann und wollte von dem abscheulichen Russen ausreißen, ihr Vater sollte mir helfen.
Der Vater sagte: Ja, ich könnte aber höchstens als Tellerwäscher bleiben.
Ich antwortete, auf dem Schiff hätte ich so vielerlei gemacht und auch das. Ich würde bleiben.
Ich erhielt ½ Schilling am Tag, freie Station und Kleidung.
Deutsche Kameraden halfen mir, meine Seekiste von Bord zu schmuggeln gerade am Tag, bevor die »Niobe« in See ging. Die Flucht gelang. Der russische Kapitän übte sein Recht, mich durch die Polizei suchen zu lassen, nicht aus.
Nun war ich in meinem neuen Beruf. Ich merkte aber bald, daß er nicht für mich war.
Das Seemännische sagte mir doch mehr zu.
Meine Feierabendstunden benutzte ich dazu, die Heilsarmee aufzusuchen. Selten hat mich etwas so überrascht und angezogen, wie ihre Gesänge.
Auf ihrer Station besaß die Heilsarmee ein Grammophon, das ich nie vorher gesehen hatte.
Ich komme hierher nach Australien, um ein Land mit wilden Menschen zu sehen, und finde ein solches zivilisiertes Teufelsding. Ich denke immer, da sitzt doch einer darunter, der den Kopf im Kasten hat, denn das Grammophon stand auf einem Tisch.
Ich muß ausfindig machen, wer da spricht, und wie er das machte, gucke wie verrückt darauf. Nun zeigt es sich, daß, wenn man von der Heilsarmee als »Seele« aufgenommen wird, man auf die vorderste Bank zu sitzen kommt, während die bloßen Zuschauer die hinteren Reihen füllen. Ich lasse mich also mit einem Kameraden vom deutschen Schiff zusammen als Seele aufnehmen. Ich überzeuge mich dann, daß niemand unter dem Grammophon saß. Bei der Aufnahme versprach ich natürlich auch, keinen Alkohol zu trinken.
Die ganze Geschichte gefiel mir aber so, daß ich meinen Beruf als Tellerwäscher aufgab und zur Heilsarmee überging. Da ich nun frommen Boden betrat, glaubte ich die Wahrheit sagen zu müssen und gab an, ich wäre ein Graf. Da benutzte man mich gleich als Reklameartikel.
Es hieß nun: »We saved a German count. Before he came here, he drank whisky like a fish water.« (Wir haben einen deutschen Grafen gerettet. Bevor er hierher kam, hat er Schnaps getrunken, wie ein Fisch Wasser.) Da kamen die Leute aus der Stadt und wollten den Grafen sehen.
Ich mußte zuerst mit Mottenpulver arbeiten und die durch wohltätige Leute geschenkten Kleider einmotten.
Da ich rasch Englisch lernte, erhielt ich dann eine höhere Aufgabe. Ich hatte die für die verschiedenen Staaten Australiens einzeln gedruckten »Kriegsrufe« nach ihrem Erscheinen durchzuarbeiten und herauszusuchen, wieviele Seelen Kapitän Soundso gerettet hatte usw. Nach sechs Wochen bekam ich eine Uniform und verkaufte »Kriegsrufe«, die ich glänzend los wurde. Ich dachte: »Hier kannst du ja auch Kapitän werden von der Heilsarmee!« Die Menschen waren gut zu mir. Den Alkohol, den ich kaum kannte, zu entbehren, wurde mir auch nicht schwer. Aber ich wurde furchtbar in Versuchung geführt mit Limonade. Kaum betrat ich mit meinem »Kriegsruf« eine Wirtschaft, so riefen die Leute: »Halloh, count! Do you like a ginger-ale?« (Graf, nehmen Sie eine Ingwer-Limonade?) Ich antwortete: »Yes, behind the bar.« (Ja, aber hinter dem Schenktisch), denn ich glaubte irrigerweise, es wäre Alkohol, da es so gut schmeckte. Und so machte ich den Leuten großen Spaß, ohne recht zu wissen wodurch.
Es kam aber die Zeit, da ich mir sagte, das ist doch nichts solch ein frommer Kapitän oder Leutnant; du willst doch lieber Seemann werden. Ich legte das den guten Leuten dar, und sie waren auch einverstanden. Da ich aber noch so jung wäre, bemühten sie sich, für mich etwas Verwandtes zu finden. Und wirklich! Nach drei Tagen war ich Leuchtturmwärterassistent auf Cape Lewien.
Assistent, das klang ganz fein. Und Leuchtturm? Auf einem Leuchtturm sitzen, wenn die Schiffe in tosendem Sturm vorbeifliegen, das war mein Ideal.
Ich wußte ja, wie es dann an Bord aussah.
Also die Heilsarmee tat ihr Bestes und rüstete mich noch rührend aus mit tadellosen Anzügen, Wäsche und dergleichen.
Ich fuhr mit einer Postkutsche von Freemantle nach Port Augusta. In Cape Lewien wurde ich auf das herzlichste empfangen.
Jeder der drei Leuchtturmwächter bewohnte ein Häuschen an der Klippe, die hundert Meter hoch war und steil abfiel zum brausenden Meer. Der Leuchtturm hatte sein Fundament dicht über Wasser, aber das Licht stand in Höhe der Klippe, damit man es bei diesigem Wetter besser sehen konnte.
Ich bewunderte alles, und meine Pflichten wurden mir mitgeteilt. »Das Fensterputzen, das ist ein bißchen langweilig, und dann wird das Gewichtaufwinden deine Aufgabe sein. Am Tage kannst du oben sitzen und Nachricht geben, wenn ein Schiff signalisiert.«
Mir wurde ein kleines Zimmer angewiesen, sauber und nett. Jeder Wärter bezahlte 3 Pence für mich, zusammen also 9 Pence, das war mehr, als ich bisher verdient hatte. Ich war nicht wenig erstaunt, als ich die vielen Scheinwerfer sah, die Tausende von geschliffenen Gläsern des Reflektors. Da hatte ich nun allerdings beim Putzen fast den ganzen Vormittag zu tun, und nachts mußte ich alle 4 Stunden hinauf, um das Gewicht 80 Meter hoch zwanzig Minuten lang ohne Unterbrechung heraufzukurbeln. Mit der Zeit gewöhnte ich mich auch daran. Meine Lieblingsstunden waren es, wenn ich am Tage die Wärter oben ablösen durfte, um mit dem Kieker in der Hand über das Meer zu schauen. Wie schön war es dort oben, wenn der Sturm tobte! Eigentlich nahm ich den Leuten für die 9 Pence ihre ganze Arbeit ab.
Es gefiel mir aber sehr. Besonders gut gefiel mir die Tochter des einen Wärters. Eva hieß sie dazu. Wir haben uns schließlich einmal ganz harmlos ein bißchen geküßt. Dies geschah, da auf kahler Klippe weit und breit kein lauschiges Plätzchen war, an einem vielleicht nicht ganz passenden, verschließbaren Ort, der nach außen offen über den Felsen vorragte, dort, wo unten bei Flut das Wasser bis an die Klippe heranspülte. Da saß einer der Wärter unten beim Fischefangen, sah uns oben und benachrichtigte seinen Kollegen. Auf einmal wurde an der Tür gerüttelt. Aber wir machten nicht auf, denn ich schämte mich doch. Draußen wuchs die Wut. Die Drohungen wurden immer kräftiger. Ich sagte mir: ein kurzer Entschluß ist der beste, also die Türe auf und weg!
Gesagt, getan. Der Leuchtturmwärter flog zur Seite, ich war weg und habe mich nie wieder sehen lassen. Nur am Abend schlich ich mich noch einmal zurück, um mir eines von den Pferden zu holen, die ich so gern leiden mochte, und die damals dort höchstens dreißig Mark das Stück kosteten. Dafür ließ ich meine ganze sonstige Ausrüstung in Cape Lewien und ritt los in die Welt.
In Port Augusta befand sich ein Sägewerk. Dort fing ich an, in der Holzmühle zu arbeiten. Als Tagelohn wurden 20 Mark geboten. Doch das war ein Locklohn, denn erstens war es zu schwere Arbeit, das Holz zu schleppen, und zweitens waren die Preise dort so hoch (sogar das Wasser mußte man bezahlen), daß man kaum einige Mark täglich übrig behielt. Aussichtsvoll war die Bezahlung eigentlich nur für die Chinesen, die dort arbeiten, bei deren genügsamer Lebensweise.
In vierzehn Tagen, die ich dort blieb, hatte ich etwa sechzig Mark erspart. Dann hielt ich es nicht mehr aus und zog weiter.
Als ich auf der Landungsbrücke sitze, um auf den Wochendampfer zu warten, der mich zum nächsten großen Hafen und dort zu einem Segelschiff bringen sollte, sitzt neben mir ein Jäger, ein langer Norweger, mit einem Martini-Henry und vielen Patronen. Er erzählte mir, daß er Känguruhs und Volopies gejagt und genug Felle davon verkauft hätte. Ich fragte ihn, was er für seinen Martini haben wollte. Er antwortete fünf Pfund.
Soviel besaß ich nicht. Aber ich gab ihm all mein Geld und dazu meine Uhr, ein gutes Stück. Er war sofort einverstanden.
Wie ich nun das Gewehr hatte, regte sich die Weidmannslust in mir und ich ging in das Innere auf Känguruhjagd.
Aber der Norweger hatte übertrieben. Es gab höchstens ein paar kleine Volopies. Ich holte mir Rat bei einem dortigen Lotsen, einem Deutschen, der gab mir Bescheid, wohin ich gehen sollte. Auf dem Wege fand ich eine verlassene Farm, dort kampierte ich mich ein.
Aber die Einsamkeit bedrückte mich bald. Ich gab das Weidwerk wieder auf, kehrte nach Port Augusta zurück und verkaufte mein Gewehr. Als ich im Hafen ankam, wurde gerade ein Dampfer gelöscht, dem eine indische Fakirgesellschaft entstieg. Man fragte mich, was ich wäre. Ich sagte »Seemann«. Da meinten die Fakire, so einen könnten sie gerade gut gebrauchen zum Aufschlagen der großen Zelte und Pferdeputzen und dergleichen. Sie erklärten, sie wären eigentlich so ziemlich dasselbe wie Seeleute, nur daß sie auf dem Land umherzögen. Das lockte mich. Dazu kam, daß eine Anzahl dunkeläugiger Hindumädels dabei war. Die zogen mich auch an. Ich wurde also Fakirgehilfe.
Als wir nun durch Australien reisten, baute ich überall auf den Plätzen die Schaubuden und Zelte auf. Mit der Leinewand umzugehen, das erinnerte so an die Seefahrt.
Als wir in Freemantle waren, und ich die Reklamezettel austrug, ging es auf einmal an: »Halloh, count, no more Salvation Army?« (Nicht mehr bei der Heilsarmee?) Meine Anwesenheit steigerte sofort den Zuspruch der Leute.
Ich versuchte es mit allen Listen, mir die Fähigkeiten der Fakire anzueignen. Aber sie hielten ihre Wissenschaft streng geheim. Ich kam hinter nichts. Schließlich dachte ich bei mir, du mußt es anders anfangen, und bändelte mit einer kleinen Malaiin an. Anfänglich war sie sehr zurückhaltend, aber nach vierzehn Tagen kam sie mir schon etwas entgegen, und ich erfuhr den Hergang einiger Kunststücke. Nun wurde es mir leichter, meinen Brotherren selbst etwas abzugucken. Wenn ich auch nur Pferdeputzer war, so bekam ich jetzt doch nach und nach eine Schlagseite vom Fakir. Freilich, die eigentlichen virtuosen Fakirkünste zu erlernen, dürfte für einen Europäer so gut wie unmöglich sein. Die alten Meister dieser Kunst, gewohnt, von der Menge angestaunt und als sozusagen übernatürliche Wesen verehrt zu werden, verhalten sich auch ihren Angestellten gegenüber unnahbar. Die zwei Oberhäupter unserer Truppe machten mit ihren langen Bärten und ihrer durch langjährige Schulung der Willenskraft durchgebildeten Haltung einen erhabenen Eindruck. Unter ihren Leistungen war besonders überraschend das Wachsen eines Mangobaumes. Der Fakir hatte einen Kern, den er in die Erde steckte. In kurzer Zeit sieht man, wie die Erde bricht und ein Blatt zum Vorschein kommt und ein kleiner Stiel. Der Fakir deckt ein Tuch darüber und spricht einige Worte. Auf einmal ist der Mangobaum ein Meter groß. Das Tuch wird wieder darüber gedeckt und der Mangobaum wächst weiter und bekommt 3–4 Blätter. Ich selber habe beim Wegräumen nicht entdecken können, daß irgend etwas in Vorbereitung war.
Irgendein Zuschauer kommt und der Fakir fragt ihn: »Was haben Sie denn da für einen Ring, der ist sehr wertvoll, den dürfen Sie nicht verlieren. Aber Sie haben ihn ja schon verloren. Sehen Sie, ich habe ihn hier,« und der Fakir hat den Ring an seiner Hand. Ich habe dies oft mit angesehen und genau darauf geachtet, aber es ist unmöglich, sich zu erklären, wie es gemacht wird, welche geheimnisvolle Kraft den Leuten das ermöglicht. Man würde Hypochonder werden, wenn man darüber nachgrübelte. Sie haben als Apparat eigentlich nichts weiter als den Wagen, mit dem sie sich fortbewegen.
»... Man würde Hypochonder, wenn man darüber nachgrübelte.«
Ganz besonders hat mich folgendes überrascht. Eine große Schale mit Wasser wird gebracht, die zeigt der Fakir dem Publikum. Der Fakir setzt sich so, daß die Schale mit Wasser nicht zu sehen ist. Nach einer Weile tritt er zurück und die Schale ist voll lebender Goldfische.
Meine Herren kletterten außerdem an Tauen in die Luft. Das Tau hatten sie in der Hand und warfen es hoch, und dort blieb es in der Luft stehen, trotzdem kein Balken oder ähnliches da war. Dann kletterten sie an dem Tau in die Höhe. Doch ich will mich hierüber nicht weiter verbreiten, denn das Zaubern ist nur unterhaltend, wenn man es mit ansehen kann. Auch die Kunststückchen, die ich damals mir aneignen konnte, würden dem freundlichen Leser nur Vergnügen bereiten, wenn ich einmal den Vorzug haben sollte, ihn persönlich in diese kleinen Geheimnisse einzuweihen.
Die Fahrt mit den Fakiren ging durch das ganze australische Staatengebiet. Aber in Brisbane mochte ich nicht mehr mitmachen, wollte wieder auf ein Schiff, Seemann werden und nicht meinen Beruf verfehlen.
Ich komme auf eine englische Bark und sitze da eines Sonntagsmorgens am Strand und wasche mein Zeug. Da kommen drei Herren auf mich zu; meine Muskulatur bewundernd, fragen sie nach meinem Alter. Ich sage »fünfzehn«.
Ob ich Lust hätte, das Boxen zu lernen?
Ja, dazu hätte ich Lust. Wenn man boxen kann, kriegt man nicht so leicht Prügel.
So ging ich nach Feierabend in die Boxschule, um mich prüfen zu lassen. Nach genauer Untersuchung wurde mir angeboten, ich sollte sechs Pfund Sterling erhalten und ausgebildet werden, mich dafür aber verpflichten, nur für Queensland zu schlagen. Die Australier geben sich alle Mühe, wenn sie einen Menschen gefunden haben, dessen Körper etwas verspricht, ihn zum Preisboxer auszubilden. Mit allen möglichen Apparaten erhielt ich nun eine hervorragende Pflege. Nachdem der Körper ein Vierteljahr mit allem durchgebildet war, durfte ich zum erstenmal Schlagbewegungen ausführen. Ehe man Schläge austeilt, wird man aber selbst geschlagen, damit die Partien des Körpers, besonders die Brust, abgehärtet werden.
Es gefiel mir dort ausgezeichnet. Ich sollte bald nach San Franzisko geschickt werden, um dort weitere Grundlagen zu gewinnen. Als ich aber soweit war und als Boxer überall hätte auftreten können, hatte ich den »Preisboxer für Queensland« genug und wollte wieder zur See.
Wo immer ich war, welche Ablenkung sich mir bot, die Sehnsucht nach dem Schiff kam stets zurück.
»... die Sehnsucht nach dem Schiff kam stets zurück.«
Ich strebte diesmal nach einem amerikanischen Schiff und kam auf die »Golden Shore«, einen Viermastschoner, der von hier nach Honolulu und später die Route San Franzisko-Vancouver-Honolulu fuhr, die eine Fahrt mit Zucker, die andere mit Holz.
Es war eine ideale Zeit. Ich wurde gut bezahlt, 45 Dollar den Monat, und gleich als Vollmatrose angenommen. Eigentlich geht das nicht so schnell. Die regelmäßige Laufbahn führt vom Schiffsjungen über den Jungmann und Leichtmatrosen zum Vollmatrosen. Es gab harte und schwere Arbeit, namentlich beim Laden und Löschen, während auf einem Schoner seemännisch leichtere Arbeit an Deck ist wie auf einem Rahschiff.
An Bord des Schoners war mein besonderer Freund ein Deutscher, Namens Nauke, ein verkrachter Geigenmacher, der als Kajütsjunge an Bord war.
Eines Tages, als wir in Honolulu ankern, fordert mich Nauke auf, mit an Land zu gehen, und bringt mir gleich eine Dose kondensierte Milch aus der Kajüte mit, weil ich die so gern mochte. Wir sahen uns dann den König an, der im Park eines ihm von Amerika gebauten Palastes in einem bequemen Rohrsessel, umgeben von zwei oder drei Weibern, beim Tee saß, und erprobten darauf die Eßbarkeit der Roßkastanien, die vor des Königs Parkgitter wuchsen, in der Annahme, auf Hawaii wäre alles eßbar. Da kommt ein besser gekleideter Herr auf uns zu und fragt auf Englisch: »Was treiben Sie hier?«
»Wir sehen uns den König an.«
»Ach was, König, ihr solltet den Hulla-Hulla-Tanz sehen.«
»Hast du Lust, Nauke?«
»Ja, wenn nette Mädels dabei sind,« antwortete Nauke.
Da fragt der Herr auf einmal, ob wir keine besseren Anzüge hätten? Ich sage: »Nein, wir haben nichts Besseres.«
»Na,« war die Antwort, »dann ist das gleichgültig, dann bekommt ihr einen Anzug von mir.«
Wir steigen nun zusammen den Schloßberg hinunter und wurden eingeladen, in einem vierspännigen Eselwagen Platz zu nehmen. Ich sagte zu Nauke, das schiene ja ein recht wohlhabender Mann zu sein. Da drehte sich der Herr um und rief: »Sie müssen sich nicht so viel mit Ihrem Freund unterhalten, ich kann auch deutsch.«
Als wir in die Zuckerplantagen außerhalb des Ortes gelangt sind, gibt der Herr dem Kutscher das Zeichen zu halten. Wir gehen durch einen Feldweg in die Plantage hinein und kommen zuletzt an ein vornehmes Europäerhaus. In einer Einzäunung weideten junge Fohlen. Wie ich durch die Riesenfenster der vornehmen Villa ins Innere blicke, bemerke ich eine Reihe großer schwarzer Tische wie in einem Kollegsaal. Während ich neugierig hineinschaue, bietet der Mann Nauke ein Stück Pudding an und ersucht ihn, vor dem Hause zu warten. Ich warne ihn noch, er möchte nicht weggehen.
Wie ich nun eintrete, wird mir sonderbar zumute. Der Mann führt mich in einen Raum neben dem Saal mit den vielen Tischen. Dieser Raum hatte drei Fenster und enthielt einen großen Tisch. Der Mann will die Tür abschließen. Ich sage: »Nein, nicht schließen.«
Am Kopfende des Tisches war seltsamerweise ein Moskitonetz gespannt, darunter lagen zwei Kopfkissen. Eine Seitentür führte zu einer Treppe, die nach der Mansardenwohnung hinaufging.
Der Mann wollte nun ein Metermaß holen, wie er sagte, zum Anmessen des neuen Anzugs. Allright, sage ich.
Er geht die Treppe hinauf und ich setze mich neben die Tür auf einen Koffer. Wie ich sitze, da gewahre ich unter dem Tisch zwei lange Kisten, groß und schmal mit starken Verschlüssen auf beiden Seiten. Ich sage mir: »Menschenskind, das kommt mir unheimlich vor. Wenn du nur nicht in eine solche Kiste gerätst.« Ich verließ mich aber auf meine Kräfte, hatte ja auch boxen gelernt. Da kam der Fremde wieder herunter, hatte ein Maß, sprach mit mir und fing an, am Arm zu messen, seltsamerweise von unten nach oben, und sagte: »Thirty«. Wiederholte es, murmelte noch einmal Zahlen, drehte mich herum, klappte mir den Rock über den Rücken herunter, so daß meine Arme behindert waren. Er sagt, die Beleuchtung wäre ungünstig, und schiebt mich so, daß ich mit dem Rücken gegen die äußere Tür stehe. Ich höre aber am Knirschen des Sandes, daß sich da einer hinter der Tür bewegt.
In diesem Augenblick sehe ich am Fußende des Tisches auf dem Boden eine Menge altes Zeug liegen, das Seeleuten gehören mochte, unordentlich hingeworfen. Da kriege ich wieder Mut und denke: es mag doch mit dem Anzug stimmen.
Er nimmt wieder Maß und schnallt dabei den Gürtel auf, legt ihn zusammen mit meiner leeren Messerscheide auf den Tisch. Ich denke: du hast doch ein Messer darin gehabt, hast noch dem Koch Kartoffeln schälen helfen; solltest du es haben liegen lassen? Wie ich noch umhersehe, gewahre ich auf dem Fensterbrett zwischen leeren Flaschen zu meinem Entsetzen einen abgeschnittenen menschlichen Daumen, an dem noch eine lange Sehne hing.
Gerade habe ich noch Zeit zum Luftholen, der Mann wollte mir eben das Beinkleid öffnen, dann hätte ich mich nicht mehr rühren können. Ich schiebe den Rock wieder hoch, ergreife meine Milchdose und Messerscheide vom Tisch, werfe den Kerl mit einem wuchtigen Stoße beiseite, gebe der ersten besten Tür einen Tritt, daß sie aufspringt, und rufe draußen aus Leibeskräften: »Nauke!«
Nauke kommt kauend an, ich kriege ihn zu fassen, laufe in die Plantage und werfe mich mit ihm zwischen die Rohre.
Er fragt: »Was ist denn los?«
»Ja Nauke, wenn ich das wüßte.«
Ein Pfiff ertönt, Pferdegalopp, und etwa vier Menschen laufen zu Fuß hinterdrein. Sie vermuteten uns auf dem Weg, den wir hergekommen waren. Wir liefen aber am Haus vorbei nach der entgegengesetzten Richtung und kamen nach längerem Umherirren wieder in Honolulu an den Strandweg. Ich erzählte alles einem Polizisten. Der zuckte mit den Achseln. Wenn er ausfindig machen sollte, wie oft hier Seeleute verschwänden, müßte eine ganz andere Organisation erst neu geschaffen werden. Wir erzählten es dem Kapitän, der sagte aber: »Sie hätten euch ruhig das Jack vertobacken sollen, was treibt ihr euch auch draußen herum?«
Wir Kameraden verabredeten, am nächsten Sonntag die Bude in der Plantage zu stürmen, und legten uns allerlei Waffen dafür zurecht. Aber am Freitag kam der Befehl: Quarantäne! Da war eine ansteckende Krankheit ausgebrochen.
So blieb für mich das Rätsel dieses Erlebnisses bis heute ungelöst wie ein wirrer Traum. Ich weiß nicht, ob einer meiner Leser über den Schlüssel des Verständnisses verfügt.
Das Messer hatte ich übrigens tatsächlich beim Koch liegen lassen.
So war alles ganz klug eingefädelt: Nauke bekam als der Schwächere den Pudding. Erst sollte ich allein abgefertigt werden. Ein älterer Herr, der Honolulu gut kannte, erzählte mir später, daß schon viele Seeleute verschwunden wären, aber ein so genauer Bericht, wie der meinige, war ihm noch nie bekannt geworden. Vielleicht haben alle anderen, die in jenes Haus kamen, keine Gelegenheit mehr gehabt, zu berichten.
Ich sollte noch eine sehr peinliche Erfahrung durchmachen, bevor mein brennender Drang, neue Berufe kennenzulernen, sich endgültig legte. Ein Freund vom Schiff, August H., ein Neffe des berühmten Schäfers Ast, aus Winsen an der Luhe, heckte einen Plan aus, an dem ich großen Gefallen fand. Der Leser wird dem, was ich jetzt zu berichten habe, nur mit Kopfschütteln folgen, auch wenn er bedenkt, daß ich noch in dem Alter stand, welches Schülerstreichen eine gewisse Straflosigkeit verleiht, und wenn man hinzurechnet, daß meine Erziehung doch stark aus den Fugen gegangen war und das Herumschweifen unter immer neuen Menschen und Völkern zur Festigung der moralischen Begriffe nicht gerade beitragen konnte. Bei der Erinnerung an jene Tage kecken Schiffsraubs ist klar, daß nicht nur äußere, sondern auch innere Gefahren meine Entwicklung bedroht haben, und daß ich dem Geschick danken muß, das mich durch diese verschlungenen Pfade doch nach oben geführt hat.
Also, mein Freund August und ich fanden es notwendig, einmal aus der abhängigen Stellung an Bord hinüberzuwechseln zu