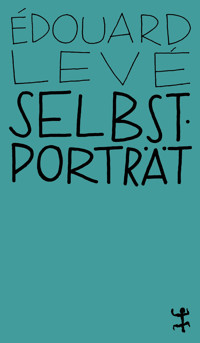
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
»›Autoportrait‹ ist ein Lesegenuss. In dem gut hundertseitigen Werk genauester Beobachtungen hat Levé sich in der Beschreibung aller Facetten des Alltäglichen sowohl entblößt als auch verhüllt.« - Jacques Morice, Télérama Der Mensch ist die Summe seiner einzelnen Teile. Edouard Levé nimmt diese Aussage wörtlich, nimmt sein eigenes Leben bis in die kleinsten Teile auseinander und breitet es vor dem Leser aus. Er erspart kein Detail und berührt, wühlt auf, provoziert, irritiert, lässt schmunzeln, nachdenken, zustimmen, sich wieder erkennen - und wirft dabei Fragen auf, die, an der Oberfläche leicht und angenehm, auf den zweiten Blick beuruhigend tief in das Herz der menschlichen Existenz vordringen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 134
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Édouard Levé
Autoportrait
Édouard Levé
AUTOPORTRAIT
Aus dem Französischen vonClaudia Hamm
Inhalt
Autoportrait
Als Jugendlicher glaubte ich, eine Bedienungsanleitung Leben könnte mir beim Leben helfen und eine Bedienungsanleitung Selbstmord beim Sterben. Ich habe drei Jahre und drei Monate im Ausland verbracht. Ich schaue lieber nach links. Einer meiner Freunde befriedigt sich mit Seitensprüngen. Das Ende einer Reise hinterlässt bei mir denselben traurigen Nachgeschmack wie das Ende eines Romans. Was mir nicht gefällt, vergesse ich. Vielleicht habe ich schon einmal mit einem Mörder gesprochen, ohne es zu wissen. Wenn ich an Sackgassen vorbeigehe, schaue ich prüfend hinein. Was am Ende des Lebens kommt, macht mir keine Angst. Ich höre selten auf das, was andere mir sagen. Es überrascht mich, wenn Leute mir einen Kosenamen geben, obwohl sie mich kaum kennen. Ich begreife nur langsam, wenn jemand mich schlecht behandelt, so sehr überrascht es mich: Das Böse ist irgendwie irreal. Ich archiviere. Als ich zwei Jahre alt war, habe ich mit Salvador Dali gesprochen. Konkurrenz spornt mich nicht an. Mein Leben genau zu beschreiben würde mich mehr Zeit kosten als es zu leben. Ich frage mich, ob ich mit dem Alter reaktionär werden könnte. Wenn ich mit nackten Beinen auf Kunstleder sitze, rutscht meine Haut nicht, sondern quietscht. Ich habe zwei Frauen betrogen, ich habe es beiden gesagt, der einen war es egal, der anderen nicht. Ich scherze mit dem Tod. Ich liebe mich nicht. Ich hasse mich nicht. Ich vergesse nicht zu vergessen. Ich glaube nicht, dass es einen Satan gibt. Ich bin nicht vorbestraft. Ich wünschte, eine Jahreszeit würde eine Woche lang dauern. Ich langweile mich lieber allein als zu zweit. Ich streife durch leere Orte und gehe in trostlosen Restaurants essen. Ich mag Salziges lieber als Süßes, Rohes lieber als Gekochtes, Hartes lieber als Weiches, Kaltes lieber als Warmes, Duftendes lieber als Geruchloses. Ich kann nicht in Ruhe schreiben, wenn in meinem Kühlschrank nichts zu essen ist. Ich kann leicht auf Alkohol und Tabak verzichten. In einem fremden Land wage ich nicht zu lachen, wenn mein Gesprächspartner während der Unterhaltung rülpst. Es fällt mir auf, wenn Leute vorzeitig graue Haare haben. Ich sollte besser keine medizinischen Fachbücher lesen, speziell die Passagen, die die Symptome bestimmter Krankheiten beschreiben: Je mehr ich von ihrer Existenz weiß, desto eher spüre ich sie in mir wuchern. Das Phänomen Krieg kommt mir so unwirklich vor, dass es mir schwerfällt zu glauben, mein Vater sei im Krieg gewesen. Ich habe einen Mann gesehen, dessen linke Gesichtshälfte etwas anderes ausdrückte als die rechte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich New York mag. Ich sage nicht »A ist besser als B«, sondern »ich mag A lieber als B«. Ich ziehe ständig Vergleiche. Bei der Rückkehr von einer Reise ist der schönste Augenblick für mich weder der Gang durch den Flughafen noch die Ankunft zuhause, sondern die Taxifahrt dazwischen: Sie gehört noch zur Reise, aber nicht mehr wirklich. Ich singe falsch, also singe ich nicht. Da ich lustig bin, hält man mich für glücklich. Ich hoffe, nie ein Ohr auf einer Wiese zu finden. Ich mag Wörter nicht mehr als Hämmer oder Schrauben. Ich kenne die Green Boys nicht. In den Schaufenstern angelsächsischer Länder lese ich »sale« auf Französisch: dreckig. Ich kann nicht neben jemandem schlafen, der sich herumwälzt, schnarcht, laut atmet oder an der Decke zieht. Mit jemandem, der sich nicht bewegt, kann ich auch Arm in Arm schlafen. Ich hatte die Idee zu einem Traummuseum. Aus Bequemlichkeit neige ich dazu, Leute »Freunde« zu nennen, die keine sind; ich finde kein anderes Wort, um Menschen zu bezeichnen, die ich kenne und mag, aber mit denen ich nicht wirklich befreundet bin. Wenn ich im Zug gegen die Fahrtrichtung sitze, sehe ich die Dinge nicht kommen, sondern gehen. Ich bereite mich nicht auf die Rente vor. Ich schätze, der beste Teil eines Strumpfs ist das Loch. Ich achte nicht auf den Stand meines Bankkontos. Mein Konto ist selten in den roten Zahlen. Die Dokumentarfilme Shoah, Numéro Zéro, Mobuto – King of Zaïre, Urgences, Titicut Follies und La Conquête de Clichy haben mich mehr geprägt als die besten Spielfilme. Die Ready-made-Filme von Jean-Marc Chapoulie haben mich mehr zum Lachen gebracht als die besten Komödien. Ich habe einmal einen Selbstmordversuch unternommen und war viermal versucht, einen Selbstmordversuch zu unternehmen. Das ferne Brummen eines Rasenmähers im Sommer weckt angenehme Kindheitserinnerungen in mir. Es fällt mir schwer, Dinge wegzuwerfen. Eine meiner Verwandten hatte einen Sammelwahn, nach ihrem Tod fand man eine Schuhschachtel, auf der ein sorgfältig beschriftetes Etikett verkündete: »Kleine nutzlose Bindfadenstücke«. Ich glaube nicht, dass die Weisheit von Weisen verloren geht. Ich hatte einmal die Idee, ein Buch als Museum für Alltagsnotizen einzurichten, es sollte nach Typen geordnete, faksimilierte handschriftliche Mitteilungen von Unbekannten enthalten wie Suchmeldungen für verlorengegangene Tiere, Rechtfertigungen, die man Politessen auf der Windschutzscheibe hinterlässt, um keine Parkgebühren zahlen zu müssen, auf der Straße ausgehangene Zeugenaufrufe, Hinweise zu Inhaberwechseln, Büronotizen, Zettel im Haushalt oder Merkzettel, die man sich selbst schreibt. Als mir ein Greis seine Lebensgeschichte erzählte, dachte ich: »Der Mann ist ein Museum seiner selbst.« Als ich den Sohn eines schwarzen amerikanischen Aktivisten und einer französischen Soziologin reden hörte, dachte ich: »Der Mann ist ein Ready-made.« Als ich einen leichenblassen Mann sah, dachte ich: »Der ist ein Phantom seiner selbst.« Meine Eltern gingen jeden Freitagabend ins Kino, bis sie sich einen Fernseher zulegten. Ich mag das leicht identifizierbare Rascheln von Papiertüten, aber nicht das Knistern von Polyurethan-Tüten. Ich habe schon gehört, aber noch nie gesehen, wie eine Frucht vom Baum fiel. Eigennamen faszinieren mich, weil ich nicht weiß, was sie bedeuten. Ich habe einen Freund, der bei Einladungen zum Essen die Gerichte nicht in Schüsseln serviert, sondern auf garnierten Tellern wie im Restaurant, man kann sich also nicht nachnehmen. Ich habe mehrere Jahre ohne jede soziale Absicherung gelebt. Ich kann mich mit einem netten Menschen weniger wohlfühlen als mit einem hinterhältigen. Es ist lustiger, wenn ich von schlechten Reiseerlebnissen erzähle als von guten. Es verwirrt mich, wenn ein Kind »Herr« zu mir sagt. In einem Swingerklub habe ich zum ersten Mal Leute vor meinen Augen Sex haben sehen. Ich masturbiere nicht vor den Augen einer Frau. Ich masturbiere weniger angesichts von Bildern als angesichts von Erinnerungen. Ich habe es nie bereut, gesagt zu haben, was ich wirklich dachte. Liebesgeschichten langweilen mich. Ich rede nicht über meine Liebesgeschichten. Ich spreche wenig über die Frauen, mit denen ich zusammen bin, aber ich höre gern meinen Freunden zu, wenn sie über ihre sprechen. Eine Frau reiste mir einmal nach anderthalb Monaten des Getrenntseins in ein fernes Land nach, sie hatte mir nicht gefehlt, in wenigen Sekunden begriff ich, dass ich sie nicht mehr liebte. In Indien habe ich eine Nacht lang mit einem mir unbekannten Schweizer zusammen in einem Reisebus gesessen, wir durchquerten die Ebenen von Kerala, in wenigen Stunden erzählte ich ihm so viel über mich wie meinen besten Freunden in mehreren Jahren, ich wusste, ich würde ihn nicht wiedersehen, er war ein Ohr ohne Folgen. Manchmal bin ich misstrauisch. Das Betrachten von alten Fotografien bringt mich dazu zu glauben, der Körper entwickele sich weiter. Ich werfe anderen dieselben Dinge vor, die ich vorgeworfen bekomme. Ich bin nicht knauserig, aber ich halte viel von Ausgaben im richtigen Maß. Manche Uniformen gefallen mir, nicht wegen ihrer Symbolik, sondern wegen ihrer funktionalen Sachlichkeit. Manchmal erzähle ich jemandem, den ich mag, von einer für mich guten Nachricht und stelle erst später verblüfft fest, dass er neidisch darauf ist. Ich hätte nicht gern berühmte Eltern. Ich bin nicht schön. Ich bin nicht hässlich. Sonnengebräunt und in schwarzem Hemd kann ich mich aus manchen Perspektiven gesehen schön finden. Ich finde mich öfter hässlich als schön. Die Momente, in denen ich mich schön finde, sind nicht dieselben, in denen ich es gern wäre. Im Profil finde ich mich hässlicher als frontal. Meine Augen, meine Hände, meine Stirn, meine Pobacken, meine Arme und meine Haut mag ich, meine Schenkel, meine Waden, mein Kinn, meine Ohren, die Krümmung in meinem Nacken und meine Nasenlöcher von unten gesehen mag ich nicht, über meine Geschlechtsteile habe ich kein Urteil. Ich habe ein schiefes Gesicht. Die linke Hälfte meines Gesichts hat keine Ähnlichkeit mit der rechten. Ich mag meine Stimme, wenn ich verkatert aufwache oder Grippe habe. Ich brauche nichts. Ich versuche keine Frau zu verführen, die Birkenstocks trägt. Ich mag Zehen nicht. Ich hätte gern keine Fingernägel. Ich hätte gern keinen Bart zu rasieren. Ich bin nicht auf Ehrungen aus, Auszeichnungen beeindrucken mich nicht, es ist mir gleichgültig, was ich verdiene. Ich habe ein Faible für seltsame Leute. Für unglückliche Leute empfinde ich Sympathie. Paternalismus ist mir zuwider. Ich fühle mich mit alten Menschen wohler als mit jungen. Es kommt vor, dass ich Leuten, die ich nie wiederzusehen glaube, unzählige Fragen stelle. Irgendwann werde ich schwarze Cowboystiefel zu einem lila Samtanzug tragen. Der Geruch von Jauche erinnert mich an eine vergangene Epoche, der Geruch von feuchter Erde dagegen lässt mich an keine bestimmte Zeit denken. Ich kann mir Vornamen von Leuten, die mir vorgestellt werden, schlecht merken. Ich schäme mich nicht für meine Familie, aber ich lade sie nicht zu meinen Vernissagen ein. Ich habe oft geliebt. Ich liebe mich weniger als ich von anderen geliebt wurde. Ich staune darüber, dass man mich liebt. Ich glaube nicht, attraktiv zu sein, nur weil eine Frau mich attraktiv findet. Ich bin nicht immer gleichermaßen intelligent. Meine Verliebtheitszustände ähneln einander und denen von anderen mehr als meine Arbeiten einander gleichen und denen von anderen nicht. Irgendetwas am Schmerz einer zu Ende gehenden Beziehung erscheint mir amüsant. Ich mache mit niemandem gemeinsame Kasse. Ein Freund machte mich darauf aufmerksam, dass ich zufrieden aussah, als Gäste bei mir eintrafen, aber auch, als sie wieder gingen. Ich beginne mehr als ich vollende. Es fällt mir leichter anzukommen als fortzugehen. Es gelingt mir schlecht, Gesprächspartner, die mich langweilen, zu unterbrechen. An kostenlosen Büffets stopfe ich mich voll bis zum Erbrechen. Ich verdaue gut. Ich mag Sommerregen. Die Niederlagen anderer bekümmern mich mehr als meine eigenen. Die Niederlagen meiner Feinde freuen mich nicht. Es fällt mir schwer zu verstehen, warum man blödsinnige Geschenke macht. Geschenke berühren mich unangenehm, egal, ob ich sie selbst überreiche oder bekomme, außer es sind gute, und das ist selten. Die Liebe verschafft mir ungeheure Freuden, aber sie kostet mich zu viel Zeit. Wie das Skalpell eines Chirurgen Organe freilegt, führt mich die Liebe zu anderen Ichs, deren Unbekanntheit mir obszön erscheint und Angst macht. Ich bin nicht krank. Ich gehe höchstens einmal im Jahr zum Arzt. Ich bin kurzsichtig und habe einen leichten Astigmatismus. Ich habe nie vor meinen Eltern eine Geliebte geküsst. Auf Korsika überredeten mich Freunde zu einem gemeinsamen Einführungskurs ins Sporttauchen, ein Lehrer nahm mich innerhalb von wenigen Sekunden auf eine Tiefe von sechs Metern mit, mein linkes Ohr implodierte; als ich wieder an der Oberfläche war, hatte ich keinen Gleichgewichtssinn mehr, seitdem spüre ich bei Flugzeuglandungen eine Nadel mein Innenohr durchstoßen, bis plötzlich Luft durch das Trommelfell entweicht. Ich kann mir Blumennamen schlecht merken. Ich erkenne Maronibäume, Linden, Pappeln, Weiden, Trauerweiden, Eichen, Kastanien, Kiefern, Tannen, Buchen, Platanen, Haselnusssträucher, Apfelbäume, Kirschbäume, Flieder, Pflaumenbäume, Birnbäume, Feigenbäume, Zedern, Mammutbäume, Affenbrotbäume, Palmen, Kokospalmen, Korkeichen, Ahorn und Olivenbäume. Ich kenne die Namen, aber nicht das Aussehen von Eschen, Zitterpappeln, Ulmen, Pfaffenhütchen, Erdbeerbäumen, Bougainvilleen und Trompetenbäumen. Ich hatte einmal Guppys, Sumatrabarben, Neonfische, einen gelb-schwarz gestreiften, schlangenförmigen Fisch und andere Aquarienfische, deren Namen ich vergessen habe. Ich hatte einen weiblichen Hamster, ihr Name war Pirouette, weil sie das türkisblaue Plastikhamsterrad so mochte und so schnell darin lief, dass sie sich beim Drehen überschlug. Eine Freundin mit schlechten Englischkenntnissen verstand beim Lied Boogie Wonderland statt »Set in your shoes« »C’est quelque chose«. Manchmal gehe ich dunkle Wege entlang. Ein Onkel spielte Scorlipochon eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn mit mir, ich musste es bewerkstelligen, Scorlipochon eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn zu sagen, während er mich durchkitzelte. Einer meiner Onkel mochte Skandale und Spiele, er klaute nur zum Spaß, kaufte die Zeitschrift Hara-Kiri und brachte sie mir zum Lesen, er spielte geisteskrank am Strand, sprang schreiend herum und sabberte auf eine Frau, die sich gerade sonnte, er stellte einer benachbarten Bauersfrau Fragen mit Worten, die es nicht gibt, er machte Unbekannten am Telefon weis, am Flughafen Orly warte eine Giftschlange darauf, von ihnen abgeholt zu werden, er spielte im Kasino und legte es auf ein Hausverbot an, er versuchte, die Miete von Nachtklubs einzutreiben, die sein Vater beim Pokern gewonnen hatte, und endete stockbesoffen, weil die mafiösen Mieter ihn mit Champagner umgestimmt hatten. Ich spiele nicht im Kasino. Ich frage mich, wie ich mich unter Folter verhalten würde. Im Museum sehe ich die Welt mit dem Blick der ausgestellten Künstler, auf der Straße mit dem meinen. Ich kenne vier Namen für Gott. Eine Freundin sagte mir, viermal zu gähnen würde einer Viertelstunde Schlaf entsprechen, ich habe es oft ausprobiert, aber die versprochene Wirkung nie verspürt. Ich habe Temperaturen von minus fünfundzwanzig bis plus fünfundvierzig Grad kennengelernt. Ich bin Katholiken begegnet, Protestanten, Mormonen, Juden, Moslems, Hinduisten, Buddhisten, Amish People, Zeugen Jehovas und Scientologen. Ich habe Erde, Berge und Meere gesehen. Ich habe Seen, Ströme, Flüsse, Rinnsale, Sturzbäche und Wasserfälle gesehen. Ich habe Vulkane gesehen. Ich habe Flussmündungen, Küsten, Inseln und Kontinente gesehen. Ich habe Grotten, Canyons und Zauberhüte gesehen. Ich habe Wüsten, Strände und Dünen gesehen. Ich habe die Sonne und den Mond gesehen. Ich habe Sterne, Kometen und eine Sonnenfinsternis gesehen. Ich habe die Milchstraße gesehen. Ich bin nicht mehr zehn Jahre alt. Ich habe nie geglaubt, man könne einem Wolpertinger wirklich begegnen. Ich frage mich, ob es Satanslästerer gibt und ob es von Satans Standpunkt aus – aber auch von dem Gottes – eine Sünde wäre, ihn zu lästern. Monster interessieren mich. Wenn ich lese »Pincode o.k.«, verstehe ich »Pincodoquet«. Einsamkeit gibt mir Standfestigkeit. Eine Freundin meiner Eltern entdeckte mit fünfzig, dass es in den Knochen keinen Mumm gibt. Wenn früher ein Erwachsener zu mir sagte: »Ist diese Lüge wirklich wahr?«, wusste ich nicht, was ich antworten sollte. Wenn ein Erwachsener zu mir sagte: »Lass mich in Ruhe«, zwang ich mich zu lächeln. Mein Vater ist lustig. Meine Mutter liebt mich, ohne mich zu vereinnahmen. Ich habe die Existenz von »schweinischen Bildern« in einem kleinen himmelblauen Prospekt entdeckt, der verschiedene Sünden verzeichnete; ein Priester hatte ihn mir vor meiner ersten Beichte gegeben, um meiner Erinnerung auf die Sprünge zu helfen, welche davon ich möglicherweise begangen hatte. Ich bin auf eine Schule gegangen, an der mehrere Pädophile ihr Unwesen trieben, aber ich gehörte nicht zu ihren Opfern. Einer meiner Schulkameraden wurde mit zwölf Jahren von einem alten Mann bis ins Treppenhaus verfolgt und dort in einen Keller gezerrt und gewaltsam geküsst. Der Hund einer meiner Freunde hat dessen besten Freund, als er vierzehn war, entstellt. Ich habe kein Flugzeug verpasst, das dann während des Flugs explodiert ist. Ich hätte mit dem Auto fast drei Mitfahrer getötet, als ich mit hundertachtzig auf der Autobahn Paris-Reims fuhr und im Handschuhfach nach einer Kassette suchte. Mein Vater überraschte mich einmal beim Sex mit einer Frau; als er an die Tür klopfte, sagte ich mechanisch »herein«, sein Gesicht erhellte sich, und er machte die Tür sofort wieder zu; als diese Freundin später versuchte, diskret das Haus zu verlassen, stürzte er zu ihr und sagte: »Kommen Sie wieder, wann Sie wollen.« Wie die meisten Menschen weiß ich nicht, warum die Stadt, in der ich lebe, den Namen trägt, den sie trägt. Einer meiner Onkel ist kurz nach der Pleite seiner Kunstgalerie, in die er alles investiert hatte, an Aids gestorben. Einer meiner Onkel fand den Mann seines Lebens, als er mit seinem roten Cabrio langsam durch die Straßen von Paris fuhr; der besagte Mann, ein ungarischer Immigrant, war verzweifelt und planlos losmarschiert, um sich umzubringen, mein Onkel hatte bei ihm angehalten und gefragt, wohin er gehe; sie trennten sich nicht mehr, bis dass der Tod sie schied. Der Freund meines Onkels brachte mir bei, über Dinge im Fernsehen zu lachen, die nicht unbedingt lustig waren, zum Beispiel die Frisur von Bobby Ewing in Dallas





























