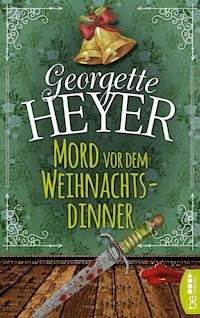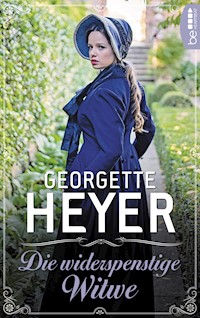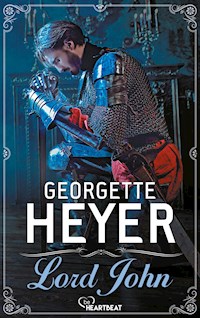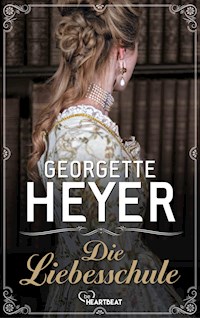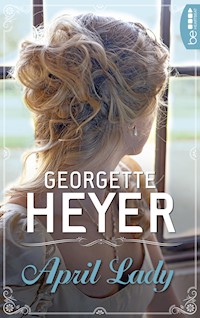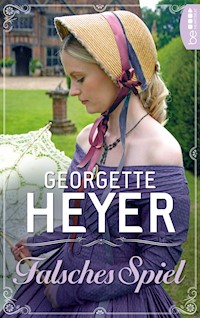6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Liebe, Gerüchte und Skandale - Die unvergesslichen Regency Liebesromane von Georgette
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
England, 1816: Die eigenwillige Serena erfährt zu ihrem Entsetzen, dass ihr verstorbener Vater den Marquis of Rotherdam zu ihrem Vormund ernannt hat. Vor Jahren waren sie einander versprochen, doch dann zerbrach die Verlobung an einem heftigen Streit. Und jetzt soll dieser Mann wieder Macht über Serenas Leben haben? Niemals! Die junge Frau reist nach Bath und trifft dort auf einem Ball ihren Jungmädchenschwarm wieder, den schneidigen Offizier Hector, der bald schon um ihre Hand anhält. Doch in dieser Angelegenheit hat ihr strenger Vormund ein Wörtchen mitzureden ...
"Serena und das Ungeheuer" (im Original: "Bath Tangle") besticht mit funkensprühenden Streitgesprächen, charmanten Nebenfiguren und dem meisterhaft eingefangenen Flair der eleganten Kurstadt Bath.
Jetzt als eBook bei beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
"Ich könnte ihre Bücher immer wieder und wieder lesen." Stephen Fry
"Einfach entzückend!” The Guardian
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 566
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Über dieses Buch
England, 1816: Die eigenwillige Serena erfährt zu ihrem Entsetzen, dass ihr verstorbener Vater den Marquis of Rotherdam zu ihrem Vormund ernannt hat. Vor Jahren waren sie einander versprochen, doch dann zerbrach die Verlobung an einem heftigen Streit. Und jetzt soll dieser Mann wieder Macht über Serenas Leben haben? Niemals! Die junge Frau reist nach Bath und trifft dort auf einem Ball ihren Jungmädchenschwarm wieder, den schneidigen Offizier Hector, der bald schon um ihre Hand anhält. Doch in dieser Angelegenheit hat ihr strenger Vormund ein Wörtchen mitzureden …
Über die Autorin
Georgette Heyer, geboren am 16. August 1902, schrieb mit siebzehn Jahren ihren ersten Roman, der zwei Jahre später veröffentlicht wurde. Seit dieser Zeit hat sie eine lange Reihe charmant unterhaltender Bücher verfasst, die weit über die Grenzen Englands hinaus Widerhall fanden. Sie starb am 5. Juli 1974 in London.
Georgette Heyer
Serena und das Ungeheuer
Aus dem Englischen von Emi Ehm
Digitale Neuausgabe
«be» – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Copyright © Georgette Heyer, 1955
Die Originalausgabe BATH TANGLE erschien 1955 bei William Heinemann.
Copyright der deutschen Erstausgabe:
© Paul Zsolnay Verlag GmbH, Hamburg/Wien, 1960.
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven © Richard Jenkins Photography
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 978-3-7325-8916-6
www.lesejury.de
Kapitel 1
In der Bibliothek des Herrenhauses Milverley Park saßen zwei Damen; die jüngere – deren Häubchen und wogender schwarzer Krepp die Witwe erkennen ließen – neben einem Tisch, auf dem ein Gebetbuch lag; die ältere, eine Schönheit von etwa fünfundzwanzig Jahren mit tizianrotem Haar, in einer der tiefen Fensternischen, die auf den Park hinausgingen. Die Witwe hatte die Totengebete mit ihrer hübschen Stimme ehrerbietig vorgelesen, aber das Gebetbuch war schon vor einer Weile geschlossen und beiseite gelegt worden, und die Stille wurde nur von gelegentlichen Bemerkungen der einen oder anderen Dame und vom Ticken der Uhr auf dem Kaminsims unterbrochen.
Die Bibliothek, deren eigenartig geschnitzte Bücherborde und vergoldete und bemalte Decke in jedem »Führer durch Gloucestershire« gewürdigt wurden, war ein schöner Raum, im Erdgeschoss des Herrenhauses gelegen und mit düsterer Noblesse eingerichtet. Bis vor Kurzem war sie fast nur vom verstorbenen Earl of Spenborough benutzt worden. Ein zartes Aroma von Zigarren hing noch immer in der Luft, und von Zeit zu Zeit schweiften die blauen Augen der Witwe zu dem großen Mahagonischreibtisch, als erwartete sie, den Earl hinter ihm sitzen zu sehen. Eine sanfte Trauer umschwebte sie, und in ihrem bezaubernden Gesicht stand ein Ausdruck der Bestürzung, als könnte sie den Verlust, der sie getroffen, noch kaum fassen.
Dieser war ebenso plötzlich wie unerwartet eingetreten. Niemand, geschweige denn der Earl selbst, hätte angenommen, dass er, ein schöner, robuster Mann von fünfzig, seinen Tod einer so schäbigen Ursache wie einer bloßen Verkühlung zu verdanken haben würde, die er sich beim Lachsfischen am Wye-Fluss zugezogen hatte. Keine noch so dringenden Bitten seiner Gastgeber hatten ihn zu überreden vermocht, diesem geringfügigen Unwohlsein etwas Aufmerksamkeit zu schenken; er hatte das Fischen noch einen weiteren Tag lang genossen, doch als er nach Milverley zurückkehrte, machte er sich zwar standhaft über seinen Zustand lustig, war aber so schlecht beisammen, dass sich seine Tochter einfach über sein Verbot hinwegsetzte und sofort um den Arzt sandte. Die Diagnose lautete auf beiderseitige Lungenentzündung, und eine Woche später war er tot. Er hinterließ eine Gattin und eine Tochter, die ihn beweinten, und einen etwa fünfzehn Jahre jüngeren Neffen, der ihn in Rang und Würden beerbte. Außer dieser Tochter hatte er keine anderen Kinder, was man allgemein seiner Ehe mit dem hübschen Mädchen zuschrieb, das er vor drei Jahren überraschend geheiratet hatte und das noch keine zwanzig Jahre alt war. Nur die nachsichtigsten seiner Freunde konnten mit dieser Verbindung einverstanden sein. Denn weder seine glänzende körperliche Verfassung noch sein schönes Gesicht vermochten über die Tatsache hinwegzutäuschen, dass er älter als der Vater seiner Braut war, denn schließlich war sein Geburtsdatum in jeder englischen Genealogie nachzulesen, und seine Tochter war schon seit vier Jahren großjährig und hatte seinem Haushalt vorgestanden. Als der ungleichen Verbindung kein Erbe des Titels entsprang, verkündeten jene, die das exzentrische Wesen des Earls am meisten verurteilten, dies sei eben die Strafe, und seine Schwester, Lady Theresa Eaglesham, fügte zwar unklar, aber nachdrücklich hinzu, dies würde Serena eine Lehre sein. Wenn ein Mädchen von einundzwanzig seine Anstandsdame entlasse, zwei schmeichelhafte Heiratsanträge ablehne und von der Verlobung mit der glänzendsten Partie auf dem Heiratsmarkt zurücktrete, dann geschehe es diesem Mädchen nur recht, wenn der Vater eine junge Frau ins Haus bringe, um die Tochter zu verdrängen, sagte Lady Theresa. Und alles das ganz vergeblich, wie sie es ja gleich vorausgesagt habe!
Ähnliche Überlegungen schienen in der jungen Witwe vorzugehen. Denn tieftraurig sagte sie: »Wenn ich bloß meine Pflicht besser erfüllt hätte! Ich war mir ihrer so tief bewusst, und gerade jetzt bedrückt mich der Gedanke so!«
Ihre Stieftochter, die mit dem Kinn in die Hand gestützt dasaß und auf die Bäume im Park, die die erste Spur herbstlichen Goldes trugen, hinausschaute, wandte den Kopf und sagte aufmunternd: »Unsinn!«
»Deine Tante Theresa –«
»Seien wir froh, dass Tante Theresas Abneigung gegen mich sie uns in dieser Zeit vom Leib gehalten hat!«, unterbrach Serena.
»Oh, sag das nicht! Wenn sie nicht indisponiert gewesen wäre –«
»Das war sie noch nie in ihrem Leben. Onkel Eaglesham hat ihre Ausrede ziemlich kläglich vorgebracht! Er ist ein armer Teufel.«
»Dann ist sie vielleicht weggeblieben, weil sie mich nicht mag«, sagte die Witwe kleinlaut.
»Aber gar nicht! Sei bloß nicht albern, Fanny! Als brächte es auch nur ein einziger Mensch fertig, dich nicht leiden zu können! Ich jedenfalls bin ihr äußerst dankbar, dass sie in Sussex geblieben ist. Wann immer wir zusammentreffen, gibt es eine Reiberei, und obwohl ich sie für das rüdeste Frauenzimmer halte, das existiert, gebe ich zu, dass sie allerhand ertragen musste, als ich meine erste Saison unter ihrem Dach verbrachte. Armes Weib! Sie hielt zwei passende Partien für mich parat, und mir gefielen beide nicht. Ich konnte mich in ihren Augen erst rehabilitieren, als ich dumm genug war, mich mit Ivo Rotherham zu verloben, und verdarb es mir dann endgültig, als ich mit jener abscheulichsten Episode meines Lebens Schluss machte!«
»Wie schrecklich das für dich gewesen sein muss! Einen Monat vor der Hochzeit!«
»Aber nicht im geringsten! Wir stritten noch großartiger denn je, und es machte mir ein ausgesprochenes Vergnügen, die Verlobung zu lösen. Du musst doch zugeben, dass es eine Leistung war, den grässlichen Marquis sitzenzulassen!«
»Ich hätte so etwas nie gewagt. Sein Benehmen ist so – so äußerst unverbindlich, und er schaut einen an, als verachtete er einen; das stürzt mich immer in Verwirrung, so sehr ich mich bemühe, diese Torheit zu unterdrücken.«
»Ein abscheulicher Mensch!«
»Oh, still, Serena! So kannst du nicht immer gedacht haben!«
Ihre Stieftochter warf ihr einen prüfenden Blick zu. »Hast du eine deiner romantischen Anwandlungen? Gänschen! Ich habe mich mit Ivo verlobt, weil ich dachte, es wäre ganz schön, eine Marquise zu werden, weil Papa die Verbindung stiftete, weil ich Ivo schon immer kannte, weil wir in einigen Dingen den gleichen Geschmack haben, weil – oh, weil es eine Menge ausgezeichneter Gründe gab! Oder zumindest schienen sie es zu sein, bis ich entdeckte, dass er unerträglich ist.«
»Ich wundere mich wirklich nicht, dass du ihn nicht lieben konntest, aber bist du nie – bist du nie jemandem begegnet, für den du eine – eine ausgesprochene Zuneigung empfunden hast, Serena?«, sagte Fanny und schaute sie fragend an.
»Oh, doch! Hebt mich das nun in deiner Achtung?«, antwortete Serena lächelnd. »Ich bildete mir ein, sehr verliebt zu sein, als ich neunzehn Jahre alt war. Ein ausgesprochen schöner Mensch und so einnehmende Manieren! Du wärst vor Entzücken außer dir gewesen! Leider, leider war er nicht reich, und Papa wollte die Verbindung nicht dulden. Ich glaube, ich habe eine Woche lang geheult – aber so genau kann ich das nach so langer Zeit nicht mehr sagen.«
»Oh, jetzt machst du dich lustig!«, sagte Fanny vorwurfsvoll.
»Auf meine Ehre, nein! Ich hatte ihn wirklich sehr gern, aber ich habe ihn seit sechs Jahren nicht mehr gesehen, meine Liebe, und so traurig es klingt, Papa hatte sehr recht, als er mir versicherte, ich würde schon über die Enttäuschung hinwegkommen.«
Die Witwe sah drein, als hielte sie das wirklich für sehr traurig. »Wer war es denn, Serena – wenn es dir nichts ausmacht, es mir zu sagen?«
»Aber gar nicht! Er hieß Hector Kirkby.«
»Und du hast ihn nie wiedergesehen?«
»Nie wieder! Aber er war Soldat, und sein Regiment wurde damals gerade nach Portugal abkommandiert, sodass das kein Wunder ist.«
»Aber jetzt, da der Krieg aus ist –«
»Fanny, du bist unverbesserlich!«, rief Serena aus, und in ihrem Gesicht malte sich liebevoller Spott. »Jetzt, da der Krieg aus ist, bin ich kein junges Ding mehr, und Hector – wenn er überhaupt lebt, was ich aufrichtig hoffe – ist aller Wahrscheinlichkeit nach verheiratet und Vater einer hoffnungsvollen Kinderschar, und es dürfte ihm sehr schwerfallen, sich auch nur an meinen Namen zu erinnern!«
»Oh, nein! Du hast ihn doch auch nicht vergessen!«
»Stimmt, nein«, gab Serena zu, »aber aufrichtig gesagt, ich habe seit Jahren nicht mehr an ihn gedacht, bis du mich jetzt an ihn erinnert hast! Ich fürchte, ich bin ja doch ein kaltherziges Frauenzimmer!«
Fanny hatte es erlebt, dass Serena mit verschiedenen ernst zu nehmenden Bewerbern geflirtet und sie dann hatte abblitzen lassen, und war fast geneigt zu glauben, dass sie wirklich kaltherzig war. Aber niemand konnte dieses schöne Gesicht sehen – mit dem bezaubernden, eigenwilligen Mund, den glänzenden Augen, die unter schweren, lächelnd gebogenen Lidern strahlten – und seine Besitzerin für kaltherzig halten. Ja, es war sogar das letzte Attribut, das jemand einem so vitalen, leidenschaftlichen Geschöpf wie Serena hätte zuschreiben können, dachte Fanny. Sie war halsstarrig und eigensinnig, manchmal schrecklich burschikos, ebenso exzentrisch wie ihr Vater, leicht aufbrausend, impulsiv, unbeherrscht und kümmerte sich nicht um den äußeren Schein; aber trotz all dieser und noch vieler anderer Fehler besaß sie einen solchen Reichtum an Güte und Großmut und eine solche Ritterlichkeit, dass sie von den Angestellten ihres Vaters vergöttert wurde.
»Du bringst mich ja ganz aus der Fassung! Warum starrst du mich so an?«
Der Klang der tiefen, melodiösen Stimme rief Fanny in die Gegenwart zurück; sie schrak leicht zusammen, wurde rot und sagte: »Als könnte dich je etwas aus der Fassung bringen! Verzeih – ich war geistesabwesend! Oh, Serena, wie unendlich lieb du immer zu mir bist!«
»Heiliger Himmel!« Serena zog die Augenbrauen hoch – die sie ohne Gewissensbisse färbte –, und die Augen, die mehr grün als braun glitzerten, waren voll sanften Spotts. »Mein armes Liebes! Dieses trübe Ereignis hat dir geradezu krankhafte Gedanken in den Kopf gesetzt! Oder ist vielleicht mein Vetter Hartley daran schuld? Wenn das der Fall ist, kann ich es dir wahrhaftig nicht übel nehmen!«
Von ihrem ursprünglichen Gedankengang abgelenkt, rief die junge Witwe unwillkürlich aus: »Wie sehr musst du es mir übel nehmen, dass ich alle deine Hoffnungen enttäuscht habe, ihn von der Erbfolge ausgeschlossen zu sehen!«
»Blödsinn! Solche Hoffnungen hatte ich nie! Nein, wirklich! Ich stehe sogar tief in deiner Schuld dafür, dass du mir keinen Stiefbruder gegeben hast, der jung genug gewesen wäre, mein Sohn zu sein. Wie lächerlich ich gewirkt hätte! Nicht auszudenken!«
»Du bist zu großmütig!«, sagte Fanny in ihr schwarzumrandetes Taschentuch hinein. »Und erst dein Papa –! Nie ein Wort des Vorwurfs für mich, aber ich weiß, wie ihm der Gedanke zuwider war, dass Hartley sein Nachfolger werden würde!«
»Liebe Fanny, ich bitte dich, weine nicht! Gleich werden wir meine Onkel und deinen Vater und Mr. Perrott am Hals haben, von Hartley nicht zu reden! Es stimmt, gewünscht hätte man es sich ja nicht, dass gerade er in Papas Fußstapfen tritt, aber schließlich ist das wirklich nicht so wichtig! Wenn dir etwas Nachteiliges von ihm bekannt ist, dann weißt du mehr als ich.«
»Dein Papa sagte, er hätte ihn sogar besser leiden können, wenn er etwas Nachteiliges von ihm gewusst hätte«, sagte Fanny betrübt.
Darüber musste Serena lachen, sagte aber: »Sehr wahr! Er ist tugendhaft und stinklangweilig! Ich bin überzeugt, er ist der erste Carlow, der so ist. Aber das war ja meinem Vater seit zwölf Jahren bekannt, und wenn es ihm ernstlich nahegegangen wäre, hätte er ja wieder heiraten können, lange bevor du aus der Schule kamst. Wenn du annimmst, dass er dich nur um eines Erben willen geheiratet hat, zeigt das, dass du ein großer Einfaltspinsel bist. Himmel, machen sie denn ewig nicht Schluss mit diesem Gelage? Es ist eine volle Stunde vergangen, seit die Wagen zurückgekehrt sind!«
»Serena! Doch nicht Gelage!«, protestierte Fanny. »Wie kannst du nur so etwas sagen?«
»Ein Festmahl über den sterblichen Resten eines Verstorbenen zu halten ist eine Sitte, die jeden halbwegs empfindsamen Menschen nur anwidern muss!«
»Aber es ist doch nur ein kalter Imbiss!«, sagte Fanny ärgerlich.
Die Tür am Ende des Zimmers öffnete sich sachte, und der Butler meldete, dass die Trauergäste aufbrächen, die Kutschen herbeigerufen seien und Mr. Perrott, der Rechtsanwalt des Verstorbenen, ihn gebeten habe, Mylady seine Empfehlungen zu überbringen und zu fragen, ob es ihr genehm sei, ihn jetzt zu empfangen. Dann wandte er sich an Serena und erzählte unaufgefordert, das Begräbnis sei so gut besucht gewesen, dass einige der einfacheren Trauergäste sich unmöglich einen Weg in die Kirche erzwingen hätten erzwingen können; ein Umstand, der ihn sehr zu trösten schien. Als ihm Fanny versichert hatte, sie sei bereit, Mr. Perrott zu empfangen, zog er sich zurück.
Die Zeit schleppte sich dahin. Fanny sagte zaghaft: »Ich weiß nicht, warum einen das eigentlich so aufregt. Natürlich muss das Testament verlesen werden, aber ich wollte, es wäre schon vorüber!«
»Ich jedenfalls halte das für ein völlig überflüssiges Getue!«, sagte Serena. »So ein Aufmarsch, so eine dumme Formalität, zu der nicht die geringste Veranlassung besteht! Die Einzigen, die die Verlesung gern mit anhören würden, sind die, denen mein Vater private Legate vermacht hat, und die sind nicht dazu eingeladen! Weder für dich noch für mich noch sogar für meinen Vetter kann es Überraschungen enthalten.«
»Oh, nein! Es ist nur meine Dummheit – und die Angst, meinen Papa zu erzürnen. Nach dem, was er mir sagte, dürften er und Mama von mir erwarten, dass ich nach Hause zurückkehre – nach Hartland nämlich. Er redete so, als wäre das schon ausgemacht. Ich sagte nichts darauf, weil dazu keine Zeit war – oder vielleicht, weil ich nicht den Mut dazu hatte«, fügte sie mit einem kläglichen kleinen Lächeln hinzu.
»Sag mir, was du gern tätest!«
»Wenn es meine Pflicht ist, zurückzukehren, würde ich es tun«, stammelte die junge Witwe.
»Das ist doch keine Antwort auf meine Frage! Deine Wünsche spielen in Hartland keine Rolle; aber hier war das immer ganz anders!«
»Ja, das ist wahr!«, sagte Fanny, und die Tränen stiegen ihr hoch. »Das ist es ja gerade, warum ich mich frage, ob es nicht vielleicht Schlechtigkeit und Egoismus von mir ist, dass ich mir einbilde, ich hätte in erster Linie Pflichten gegen dich und nicht gegen Papa!«
»Wenn du dich nicht wohlfühlst ohne die Versicherung, dass du nur deine Pflicht erfüllst, dann sage ich dir hiermit, dass ich ganz und gar auf dich angewiesen bin – Mama!«, sagte Serena sehr förmlich, aber in ihren Augen, glitzerte unbändiger Humor. »Was wird aus mir, wenn du mich nicht in deine Obhut nimmst? Ich warne dich fairerweise, dass ich weder bei Tante Theresa noch bei Tante Susan leben werde! Und sogar ich würde zögern, einen eigenen Haushalt aufzutun ohne ein ehrbares weibliches Wesen, das mir Gesellschaft leistet. Das aber würde Kusine Florence bedeuten, verlass dich darauf! Die Carlows und die Dorringtons wären sich darin einig, dass das arme Geschöpf diesem Zweck geopfert werden müsste.«
Fanny lächelte, sagte aber ernsthaft: »In Obhut kann ich dich nicht nehmen, aber ich kann sehr gut deine Anstandsdame sein, und obwohl es sehr dumm klingt, glaube ich wirklich, es würde dir mehr zusagen, als bei Lady Theresa oder selbst bei Lady Dorrington leben zu müssen. Und wenn du es gerne möchtest, liebste Serena, dann zweifle ich nicht, dass auch dein Papa wünschen würde, dass ich es tue, denn er liebte dich mehr als irgendeinen anderen Menschen.«
»Aber nein, Fanny!«, sagte Serena und streckte impulsiv die Hand nach ihr aus.
»Das ist doch gar nicht verwunderlich! Du bist ihm so ähnlich. Und deshalb weiß ich schon ganz genau, was ich zu tun habe. Ich hoffe nur, dass Papa nicht über mich verfügen wird, denn es wäre zu schrecklich, ihm ungehorsam sein zu müssen.«
»Das wird er nicht tun. Er muss doch einsehen – obwohl du selbst es nicht tust –, dass du Lady Spenborough und nicht mehr Miss Claypole bist! Außerdem –« Sie hielt inne, aber als sie Fannys fragenden Blick sah, fuhr sie freimütig fort: »Verzeih, aber ich bin überzeugt, dass weder er noch Lady Claypole dich drängen werden, zu ihnen zurückzukehren. Bei einer so zahlreichen Familie und deiner älteren Schwester, die noch ledig ist – oh, nein, sie können es ja gar nicht wünschen, dass du heimkommst!«
»Nein, wirklich nicht! Oh, wie recht du hast!«, rief Fanny aus, und ihre Stirn glättete sich. »Besonders Agnes würde es gar nicht gern sehen, bestimmt!«
Sie konnten das Thema nicht weiter erörtern. Die Tür öffnete sich, und einige Herren in Trauerkleidung traten ein.
Angeführt wurde die Prozession von dem ältesten und zweifellos eindrucksvollsten unter ihnen: Lord Dorrington, den man wegen seines Umfangs mehr als einmal mit dem Herzog von York verwechselt hatte. Er war der Bruder der ersten Lady Spenborough, und da er große Stücke auf seine eigene Wichtigkeit hielt und stark dazu neigte, sich in die Angelegenheiten anderer zu mischen, hatte er sich selbst zum Doyen der Gesellschaft ernannt. Gewichtig schritt er herein, sein Mieder krachte leise, die vielen Falten seines Halstuches stützten sein massives Kinn, und nachdem er sich vor der Witwe verbeugt und mit asthmatischer Stimme einige Worte des Beileids vorgebracht hatte, übernahm er unverzüglich die Aufgabe, die Gesellschaft zu den verschiedenen Sitzgelegenheiten zu dirigieren. »Ich werde unseren guten Mr. Perrott bitten, sich an den Schreibtisch zu setzen. Serena, Liebste, ich nehme an, du und Lady Spenborough werdet es am bequemsten auf dem Sofa finden. Spenborough, willst du, bitte, hier Platz nehmen? Eaglesham, mein Guter, wenn du, und – ah – Sir William hier Platz nehmen wollt, würde ich Rotherham vorschlagen, es sich im Lehnstuhl bequem zu machen.«
Da nur Mr. Eaglesham auf diese Rede hörte, wurde nur er von ihr gereizt. Weil das Recht des Vortritts über Bord geworfen worden war, hatte er die Bibliothek in Lord Dorringtons breitem Kielwasser betreten. Er war so mager wie Seine Lordschaft korpulent, und trug den abgehetzten Ausdruck, der – wie unfreundliche Leute versicherten – für den Gemahl der Lady Theresa Carlow nur natürlich war. Da er mit der Schwester des verstorbenen Earls verheiratet war, meinte er, mehr Recht als Dorrington zu haben, die Leitung der Angelegenheit in die Hand zu nehmen, aber er wusste nicht, wie er sich seiner versichern konnte; also musste er sich gezwungenermaßen damit zufriedengeben, dass er auf einen Stuhl lossteuerte, der so weit wie möglich von jenem entfernt stand, den ihm Dorrington angewiesen hatte, und Anspielungen auf anmaßende und aufdringliche alte Laffen vor sich hinzumurmeln; was ihn besänftigte und für die anderen unhörbar blieb.
Der Erste im Rang war der Letzte, der eintrat – der Marquis of Rotherham; er sagte: »Na, gehen Sie schon, Menschenskind, so gehen Sie doch schon!«, schob den Anwalt vor sich durch die Tür und schlenderte hinter ihm drein in die Bibliothek.
Kaum war er eingetreten, war jede Gezwungenheit dahin. Lady Serena, die sich ja nie durch Sinn für Anstand auszeichnete, starrte ihn ungläubig an und rief aus: »Ja, was in aller Welt führt denn dich daher, möchte ich nur wissen?!«
»Das möchte ich auch!«, gab Seine Lordschaft zurück. »Wie gut wir zusammengepasst hätten, Serena! Wo wir so viel gemeinsame Gedanken hegen!«
Fanny, die an solche Wortwechsel gewöhnt war, warf Serena nur einen flehenden Blick zu; Mr. Eaglesham lachte kurz auf; Sir William Claypole war sichtlich erschrocken; Mr. Perrott, der seinerzeit den Heiratsvertrag verfasst hatte, schien plötzlich taub zu sein; und Lord Dorrington, der eine Gelegenheit sah, sich schon wieder einmischen zu können, sagte in einem Ton, der autoritär klingen sollte: »Aber, aber! Wir dürfen nicht vergessen, aus welch traurigem Anlass wir uns hier versammeln! Zweifellos ist mit der unvermeidlichen Anwesenheit Rotherhams eine kleine Peinlichkeit verbunden. Ja, als ich von unserem guten Perrott erfuhr –«
»Peinlichkeit?«, rief Serena, wurde rot und ihre Augen blitzten. »Ich versichere dir, ich empfinde keine, mein Verehrtester! Wenn sich Rotherham ihrer bewusst sein sollte, kann ich nur sagen, ich bin erstaunt, dass er sich in eine Angelegenheit einzudrängen beliebt, die nur die Familie etwas angeht!«
»Nein, einer Peinlichkeit bin ich mir durchaus nicht bewusst«, antwortete der Marquis. »Nur einer unerträglichen Langeweile!«
Bedrückt wandten sich mehrere Augenpaare Serena zu, aber sie war nie eine Kämpferin gewesen, der ein Gegenschlag etwas ausmachte. Dieser schien ihre Wut eher zu besänftigen als anzustacheln. Sie lächelte zögernd und sagte sanfter: »Na schön. Aber was hat dich dann veranlasst, herzukommen?«
Mr. Perrott, der mittlerweile einige Dokumente auf dem Tisch ausgebreitet hatte, hüstelte leicht und sagte: »Euer Gnaden müssen wissen, dass der verstorbene Earl Lord Rotherham zu einem der Testamentsvollstrecker bestimmte.«
An Serenas weit aufgerissenen Augen sah man, dass diese Mitteilung ebenso unerwartet wie unwillkommen war; sie ließ den Blick voll Zweifel und Abscheu von Rotherham zum Anwalt gleiten. »Ich hätte ahnen können, dass es so weit kommen würde!«, sagte sie, wandte sich betroffen ab und ging zu ihrem Stuhl in der Fensternische zurück.
»Dann ist es jammerschade, dass du es nicht geahnt hast!«, sagte Rotherham ätzend. »Ich wäre dann rechtzeitig gewarnt gewesen, um dieses Amt ablehnen zu können, für das es wohl kaum einen Ungeeigneteren gibt als mich!«
Sie gönnte ihm keine Antwort, sondern wandte sich ab und starrte wieder aus dem Fenster. Ein böser Geist gab ihrem Vetter ein – der mit seiner neuen Würde noch nicht zurechtkam –, sich Autorität anzumaßen und vorwurfsvoll zu sagen: »Ein solches Benehmen ist sehr unpassend, Serena! Ich muss das feststellen, da ich durch das jüngste unglückselige Ereignis Chef des Hauses geworden bin. Ich weiß wirklich nicht, was Lord Rotherham von solchen Manieren halten muss.«
Damit aber begab er sich in das Kreuzfeuer zweier Augenpaare, das eine voll wütenden Erstaunens, das andere voll grausamen Spotts.
»Nun, darüber kannst du dir durchaus klar sein!«, sagte Rotherham.
»Ich jedenfalls«, sagte Dorrington mürrisch, »halte es für sehr seltsam von meinem armen Schwager, wirklich sehr sonderbar! Man hätte angenommen – aber er war ja schon immer so! Exzentrisch! Ich finde kein anderes Wort dafür.«
Das reizte Mr. Eaglesham dazu, Seine Lordschaft voll Empörung darauf hinzuweisen, dass dessen Verwandtschaft zum verstorbenen Earl nur sehr entfernt sei. Er sei so frei, ihm zu sagen, dass es andere gebe, deren Anspruch darauf, zum Testamentsvollstrecker ernannt zu werden, viel größer wäre als der seine. Die roten Wangen Lord Dorringtons liefen so erschreckend purpurrot an, dass Spenborough hastig sagte, ihm persönlich sei die Ernennung Lord Rotherhams durchaus genehm, wie immer sie die anderen auffassen mochten.
»Sehr liebenswürdig von dir!«, sagte Rotherham über die Schulter, als er quer durch das Zimmer zu Fanny ging, die noch immer nervös neben ihrem Stuhl stand. »Kommen Sie! Warum setzen Sie sich nicht?«, sagte er in seiner kurz angebundenen, rauen Art. »Sie werden doch bestimmt ebenso wie wir alle froh sein, wenn diese Angelegenheit erledigt ist!«
»Oh ja! Danke!«, murmelte sie. Sie schaute flüchtig zu ihm auf, als sie sich niedersetzte, und stammelte: »Es tut mir sehr leid, wenn es Ihnen unangenehm ist. Ich fürchte wirklich, es wird Ihnen viel Mühe bringen!«
»Nicht sehr wahrscheinlich: Zweifellos wird sich Perrott um alles kümmern.« Er zögerte und fügte dann noch brüsker hinzu: »Ich sollte Ihnen mein Beileid aussprechen. Erlassen Sie es mir, bitte! Ich bin nicht sehr geschickt mit höflichen Unaufrichtigkeiten und glaube zu Ihrer Ehre, Sie wollen gar nicht als untröstlich dastehen.«
Sie war ganz vernichtet, als er sie verließ; er ging zu einem Stuhl neben dem Fenster, an dem Serena saß. Diese nutzte den Augenblick, da Sir William Claypole eben die Aufmerksamkeit seiner Tochter beanspruchte, und sagte: »Du könntest ihr wenigstens zugestehen, dass sie einen ganz natürlichen Kummer empfindet!«
»Aus Pflichtgefühl.«
»Sie war meinem Vater sehr aufrichtig zugetan!«
»Schon, das gestehe ich ihr zu. Aber von diesem Gefühl wird sie sich bald erholen und müsste schon sehr unaufrichtig sein, wenn sie nicht erleichtert wäre, von höchst unnatürlichen Banden befreit zu sein.« Er blickte sie unter dem dicken Strich seiner schwarzen Brauen hervor an, und seine Augen glitzerten spöttisch. »Doch, du bist auch meiner Meinung, nur willst du es nicht zugeben. Wenn schon Mitgefühl von mir erwartet wird, dann gilt es dir. Du tust mir leid, Serena – dich trifft es hart.«
Weder Stimme noch Ausdruck waren weich, aber sie kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass er es aufrichtig meinte. »Danke. Ich glaube, es wird mir ganz erträglich gehen, sobald ich mich einmal – ein bisschen mehr daran gewöhnt habe.«
»Ja, wenn du nicht irgendeine Dummheit begehst. Dagegen allerdings möchte ich keinen roten Pfennig wetten. Schau mich nicht so durchdringend an! Das wirkt nicht auf mich.«
»Wenigstens unter diesen Umständen könntest du mich mit deinem Spott verschonen!«
»Erst recht nicht. Mit mir streiten rettet dich davor, in Trübsinn zu verfallen.«
Sie würdigte ihn keiner Antwort, sondern wandte sich ab und schaute wieder zum Fenster hinaus; und er, sowohl der Abfuhr wie ihrem Ärger gegenüber unempfindlich, rekelte sich in seinem Stuhl zurecht und musterte höhnisch die übrige Gesellschaft.
Von den sechs anwesenden Herren sah er am wenigsten wie ein Trauergast aus. Sein schwarzer Rock, den er hochgeknöpft trug, stand in seltsamem Gegensatz zu dem Halstuch, das er in der ihm eigentümlichen sportlichen Art geknüpft hatte; und sein Benehmen ließ alle Feierlichkeit vermissen, die die älteren Mitglieder dieser Versammlung auszeichnete. Seinem Aussehen nach vermochte man sein Alter nicht zu schätzen; in Wirklichkeit war er Ende dreißig, mittelgroß, sehr kräftig gebaut, mit breiten Schultern, einem mächtigen Brustkasten und Schenkeln, die viel zu muskulös waren, um bei der herrschenden Mode der hautengen Beinkleider vorteilhaft zu wirken. In diesem Aufzug erschien er allerdings nur selten, für gewöhnlich trug er Schaftstiefel und Reithosen. Seine Röcke waren sehr gut geschnitten, aber so gemacht, dass er ohne fremde Hilfe in sie schlüpfen konnte; und an Schmuck trug er ausschließlich seinen goldenen Siegelring. Er hatte wenig Einnehmendes an sich, denn seine Manieren waren rau bis zur Grobheit, er machte sich ebenso viele Feinde wie Freunde, und wäre er nicht von vornehmer Geburt, hohem Rang und großem Reichtum gewesen – die besseren Kreise hätten ihn sehr wahrscheinlich gemieden. Aber diese magischen Attribute besaß er nun einmal, und sie wirkten auf seine Welt wie ein Talisman. Seine Sportkrawatten und sein unkonventionelles Benehmen mochten zwar bedauert, mussten aber akzeptiert werden: Er war eben Rotherham.
Ein schöner Mann war er nicht, aber sein Gesicht war ausdrucksvoll, denn seine Augen, von einem seltsamen hellen Grau, waren strahlend und saßen unter geraden Brauen, die fast zusammenwuchsen. Er hatte kohlrabenschwarzes Haar und einen dunklen Teint; seine Gesichtszüge waren hart, die Stirn war etwas gefurcht, das Kinn gespalten, und die herrische Nase saß zwischen schmalen Wangen. Das einzig Schöne an ihm waren die Hände, kraftvoll und wohlgeformt. Jeder Dandy hätte alle möglichen Tricks angewandt, um mit ihnen zu prahlen – Lord Rotherham vergrub sie in den Taschen.
Da Lord Dorrington und Mr. Eaglesham keine Anstalten machten, ihren bissigen Dialog zu beenden, und die höflichen Versuche Lord Spenboroughs, ihnen ihre Umgebung zum Bewusstsein zu bringen, nicht beachteten, schritt Rotherham ein, indem er ungeduldig sagte: »Habt ihr eigentlich vor, den ganzen Tag weiterzustreiten, oder bekommen wir das Testament zu hören?«
Beide Herren starrten ihn finster an; und Mr. Perrott, der die plötzliche Stille ausnutzte, entfaltete ein knisterndes Dokument und verkündete streng, dies sei der Letzte Wille und das Testament des George Henry Vernon Carlow, des Fünften Earl of Spenborough.
Wie Serena vorausgesagt hatte, enthielt es für die Zuhörer wenig Interessantes. Weder Rotherham noch Dorrington hatten etwas zu erwarten; Sir William Claypole erfuhr, dass der Witwenanteil seiner Tochter gesichert war; und sobald sich Mr. Eaglesham vergewissert hatte, dass die verschiedenen Andenken, die seiner Frau versprochen worden, ihr ordnungsgemäß hinterlassen waren, verlor auch er alles Interesse an der Lesung des Testaments und überlegte sich einige bissige Aussprüche, die er Lord Dorrington verpassen würde.
Serena saß mit abgewandtem Gesicht still da, die Augen auf den Ausblick vom Fenster geheftet. Der Schock über den plötzlichen Tod ihres Vaters hatte zunächst keinen Raum für andere Empfindungen als den Kummer um ihn gelassen, aber mit der Ankunft seines Nachfolgers traten ihr die üblen Seiten ihrer gegenwärtigen Lage deutlicher vor Augen. Milverley, das fünfundzwanzig Jahre lang ihr Heim gewesen war, gehörte ihr nicht länger. Sie, die seine Herrin gewesen war, würde es von nun an nur mehr als Gast betreten. Sentimentale Überlegungen lagen ihr nicht, auch war sie sich zu Lebzeiten ihres Vaters keiner tiefen Verbundenheit mit dem Besitz bewusst gewesen. Sie hatte es als selbstverständlich hingenommen, ihm aus Pflichtgefühl und Traditionsbewusstsein zu dienen. Jetzt erst, da sie Milverley verlieren würde, wurde sie sich ihres doppelten Verlustes bewusst.
Der Mut sank ihr, nur mit Mühe vermochte sie Haltung zu bewahren, und es war ihr unmöglich, ihre Aufmerksamkeit dem Anwalt zu schenken, der mit unpersönlicher Stimme und einer Fülle unverständlicher juristischer Ausdrücke eine lange Liste kleiner persönlicher Legate herunterlas. Sie waren ihr alle bekannt, viele davon waren mit ihr besprochen worden. Sie kannte die Quellen, aus denen Fannys Erbe floss, und jene Besitzungen, die ihren eigenen Anteil liefern würden; Überraschungen konnte es nicht geben, nichts, was sie von ihren melancholischen Überlegungen hätte ablenken können.
Sie irrte sich. Mr. Perrott hielt inne und räusperte sich. Dann las er weiter und seine trockene Stimme wurde noch ausdrucksloser. Die Worte: »... alle meine Besitzungen in Hernesley und in Ibshaw« drangen in Serenas schweifende Gedanken und kündigten an, dass nun ihr Teil an den Legaten erreicht worden war. Die nächsten Worte ließen sie den Kopf mit einem Ruck wenden.
»... werden Ivo Spencer Barrasford, dem sehr edlen Marquis of Rotherham, zu treuen Händen übergeben –«
»Was?!«, entfuhr es Serena.
»... für meine Tochter, Serena Mary«, fuhr Mr. Perrott fort und hob die Stimme leicht, »zu dem Zweck, dass er ihr, solange sie unverheiratet bleibt, jene Summen als Taschengeld zur Verfügung stelle, die sie bisher erhielt; und ihr besagte Besitzungen bei ihrer Verheiratung zu ihrer ausschließlichen Verfügung übergebe unter der Bedingung, dass diese Ehe mit seiner Zustimmung und Billigung eingegangen wird.«
Erstauntes Schweigen folgte diesen Worten. Fanny sah bestürzt drein, Serena völlig benommen. Plötzlich wurde die Stille unterbrochen. Der sehr edle Marquis of Rotherham war in unbändiges Gelächter ausgebrochen.
Kapitel 2
Serena war aufgesprungen. »Hat mein Vater den Verstand verloren?«, schrie sie. »Ausgerechnet Rotherham –! Rotherham soll meiner Heirat zustimmen?! Oh, erbärmlich, abscheulich!«
Sie erstickte fast an ihren Gefühlen; mit großen Schritten ging sie auf und ab, rang nach Atem, schlug mit der geballten Faust in die Handfläche, stieß ihren Onkel Dorrington wild beiseite, als er salbungsvoll versuchte, ihr Einhalt zu tun.
»Ich bitte dich, Serena –! Ich bitte dich, mein liebes Kind, beruhige dich! Es ist ja wirklich abscheulich, aber versuch doch, dich zu fassen! Einen Kurator zu bestellen, der nicht zur Familie gehört! Das übersteigt alle Grenzen! Ich bin wohl ein Niemand! Ich, dein Onkel! Wer wäre dazu geeigneter gewesen? Gott im Himmel, eine derartige Herausforderung habe ich noch nicht erlebt!«
»Man kann wohl sagen, dass die Exzentrizität damit zu weit getrieben wurde!«, bemerkte Mr. Eaglesham. »Sehr ungehörig! Theresa wird das bestimmt sehr verurteilen!«
»Das muss jeden einigermaßen taktvollen Menschen empören!«, erklärte Spenborough. »Meine liebe Kusine, deine Gefühle sind in diesem Fall durchaus verständlich. Kein Mensch kann sich über deinen sehr berechtigten Unwillen wundern, aber verlass dich darauf, es kann eine Lösung gefunden werden. Eine derart grillenhafte Klausel kann doch bestimmt annulliert werden – Perrott wird uns beraten!« Er hielt inne und blickte zum Anwalt hinüber, der jedoch ein entmutigendes Schweigen wahrte. »Nun, man wird ja sehen! Jedenfalls kann das Testament für Rotherham nicht verbindlich sein! Es liegt doch bestimmt in seiner Macht, ein solches Kuratorium abzulehnen.«
»Der!«, brach es aus Serena heraus. Sie drehte sich wütend um und stürmte auf den Marquis los, geschmeidig wie eine Wildkatze und ebenso gefährlich. »Hast du das so gedreht? Ja?«
»Guter Gott, nein!«, sagte er verächtlich. »Eine nette Aufgabe – mir so etwas aufzubürden!«
»Wie konnte er nur so etwas tun? Wie konnte er bloß?«, fragte sie. »Und ohne dein Wissen und deine Zustimmung? Nein, nein! Das glaube ich einfach nicht!«
»Wenn du mit diesem Toben und Schäumen aufhörst, wirst du vielleicht dazu imstande sein! Dein Vater hat unsere Heirat über alles gewünscht, und das ist eben sein Plan, sie herbeizuführen. Aber das ist eine Methode, die nicht zieht!«
»Nein!«, sagte sie mit flammenden Wangen und blitzenden Augen. »Ich lasse mich nie und nimmer zwingen!«
»Ich auch nicht!«, sagte er brutal. »Ja, glaubst du dumme Xanthippe wirklich, dass vielleicht ich mir eine Frau unter solchen Bedingungen wünsche? Da irrst du dich gewaltig, mein Mädchen, glaub mir!«
»Dann erlös mich doch von einer so unerträglichen Situation! Gezwungen sein, dich um Zustimmung zu bitten –! Es muss etwas geschehen! Das muss doch möglich sein! Mein ganzes Vermögen gebunden – Taschengeld – Guter Gott, wie konnte mich Papa nur so behandeln? Wirst du das Kuratorium auf meinen Vetter übertragen? Willst du das tun?«
»Armer Teufel, nein! Selbst wenn ich könnte, will ich nicht! Du würdest ihn so einschüchtern, dass er dir seine Zustimmung zur Heirat mit dem erstbesten Mistkerl gibt, der dir einen Antrag macht, nur um das Kuratorium loszuwerden! Nun, mich kannst du nicht einschüchtern, also gewöhne dich an den Gedanken, Serena!«
Sie wandte sich abrupt von ihm ab, nahm ihr ruheloses Herumwandern wieder auf, und Tränen der Wut strömten über ihre Wangen. Fanny ging auf sie zu, legte ihr die Hand auf den Arm und sagte flehend: »Serena! Liebste Serena!«
Sie blieb stocksteif stehen und schluckte. »Fanny, rühr mich nicht an! Ich kann nicht für mich einstehen!«
Fanny fühlte sich ohne Umstände beiseitegeschoben. Rotherham, der hinter Serena getreten war, packte ihre Handgelenke und hielt sie eisern umklammert. »Du hast uns nun genug Theater aufgeführt!«, sagte er grob. »Etwas mehr Beherrschung würde dir besser anstehen! Sei ruhig, Serena, und denk daran, was für eine Figur du machst!«
Es entstand eine Pause. Fanny, selbst sehr entsetzt, zitterte, wie das ausgehen würde. Die wütenden Augen, die sich von Rotherhams dunklem Gesicht abwandten, fanden die ihren. Die Glut verschwand aus ihnen. Ein schluchzender Seufzer entrang sich Serena; sie sagte: »Oh Fanny, bitte um Entschuldigung! Ich habe dir doch nicht wehgetan, nein?«
»Nein, nein, bestimmt nicht!«, rief Fanny.
Unbewusst begann Serena ihre Handgelenke zu reiben, die Rotherham losgelassen hatte. Sie blickte sich im Zimmer um und lachte hysterisch auf. »Es tut mir wirklich leid! Ich benehme mich so schlecht und habe euch alle in Verlegenheit gebracht! Ich bitte euch, entschuldigt! Rotherham, ich muss dich sprechen, bevor du Milverley verlässt – willst du, bitte, in den Kleinen Salon kommen?«
»Sofort, wenn du wünschst.«
»Oh nein! Ich bin immer noch in Aufruhr. Du musst mir Zeit lassen, meine Fassung wiederzugewinnen, wenn ich nicht wieder in unziemliche Hitze geraten soll!«
Sie verließ schnell das Zimmer und winkte Fanny, die sie begleiten wollte, mit einer Geste und einem schnellen Kopfschütteln ab.
Ihr Abgang entfesselte die Zungen ihrer Verwandten; Mr. Eaglesham bedauerte ein so rabiates Temperament und zitierte verschiedene Aussprüche seiner Frau zu dem Thema. Fanny brauste auf und verteidigte Serena; Dorrington gab Rotherhams aufreizendem Benehmen die Schuld an dem Ausbruch; und Spenborough wiederholte seinen Entschluss, die Klausel annullieren zu lassen. Das führte unverzüglich zu weiteren Debatten, denn Dorrington, der zwar zustimmte, dass die Klausel aufgehoben werden sollte, passte es nicht, dass sich Spenborough Autorität anmaßte; und Mr. Eaglesham war prinzipiell gegen alles, was von Dorrington ausging. Sogar Claypole wurde, sehr gegen seinen Willen, hineingezogen und sollte seine Meinung äußern. Aber Mr. Perrott, der mit eisiger Ruhe auf den Schluss der Debatte wartete, begegnete allen Appellen unverbindlich abweisend; und Rotherham, der mit verschränkten Armen an der Tür lehnte, einen Fuß lässig über den anderen geschlagen, schien sich als Zuschauer einer Posse zu fühlen, die ihn gleichzeitig langweilte und leicht amüsierte. Aber schließlich dauerte sie ihm zu lange, und daher setzte er ihr rücksichtslos ein Ende, indem er Dorrington unterbrach und sagte: »Keiner von euch wird die Klausel anfechten, und keiner von euch ist von ihr betroffen, also könnt ihr endlich damit aufhören, Narren aus euch zu machen!«
»Sir, Sie sind beleidigend!«, erklärte Mr. Eaglesham und starrte ihn wütend an. »Ich scheue mich nicht, es Ihnen ins Gesicht zu sagen!«
»Warum solltest du? Ich hinwieder zögere nicht, dir zu erklären, dass du ein Schafskopf bist. Ich nehme an, du bildest dir ein, Serenas Tante wäre die geeignetste Person, über ihre Hand und ihr Vermögen zu verfügen. Du würdest ziemlich dumm dreinschauen, wenn es dir gelänge, diese Aufgabe Lady Theresa zuzuschieben! Die würde dir schön kommen, bei Gott!«
Lord Dorrington brach in polterndes Lachen aus und musste sofort husten und keuchen. Mr. Eaglesham, der sehr verletzt war, öffnete den Mund zu einer Erwiderung, aber als ihm die schreckliche Wahrheit von Rotherhams Worten dämmerte, schloss er ihn wieder und kochte schweigend vor Wut. Rotherham betrachtete ihn einen Augenblick lang höhnisch, nickte dann dem Anwalt zu und sagte: »Sie können uns jetzt den Rest dieses originellen Dokumentes vorlesen!«
Mr. Perrott verbeugte sich und setzte den Kneifer wieder auf die Nase. Das Testament enthielt keine weiteren Überraschungen und wurde schweigend angehört. Erst am Ende der Verlesung gab Rotherham seine Stellung auf, schlenderte zum Schreibtisch und streckte herrisch die Hand aus. Mr. Perrott legte das Testament hinein; der Marquis überflog die steifen Bogen; stirnrunzelnd und schweigend studierte er die fatale Klausel. Dann warf er das Dokument auf den Schreibtisch, sagte: »Mist!«, und verließ das Zimmer.
Sein Abgang war das Zeichen zum Aufbruch für die ganze Gesellschaft. Mr. Perrott lehnte Fannys höfliche Einladung ab und ging als Erster. Der neue Earl begleitete ihn hinaus, da er noch Aufklärung über verschiedene Punkte wünschte, und Mr. Eaglesham folgte ihm gleich darauf, weil er sich mit Freunden in Gloucester verabredet hatte, den Abend bei ihnen zu verbringen; dann ging auch Lord Dorrington, der in weiser Voraussicht in einem seiner Lieblingsrasthäuser ein Abendessen bestellt hatte und es ja nicht verderben lassen wollte. Fanny war bald mit ihrem Vater allein, der wie Spenborough bis zum nächsten Morgen in Milverley bleiben sollte.
Sie wartete mit Herzklopfen auf seine ersten Worte, aber die waren, wie zu erwarten, nicht ihren, sondern Serenas Angelegenheiten gewidmet. »Eine peinliche Geschichte!«, sagte Sir William. »Vollkommen unverständlich! Ein seltsamer Mensch, dieser Spenborough!«
Sie stimmte nur schwach zu.
»Man kann die Aufregung deiner Stieftochter verstehen, aber ich möchte denn doch einen derartigen Ausbruch nicht bei einer meiner Töchter erleben!«
»Oh bitte, Papa, denk nicht mehr daran! Sonst ist sie doch so gut! Aber das Ganze, gerade in einem solchen Augenblick, wenn sie so großen Kummer hat und sich so großartig hält –! Und dann die peinlichen Umstände – ihre seinerzeitige Verlobung mit Rotherham – und die höchst ungezogene Sprache, die er führte! Man muss es ihr verzeihen. Sie ist so gut!«
»Ich bin erstaunt über dich! Deine Mama neigte sehr dazu, sie durchaus nicht für das Richtige zu halten. Sie beträgt sich zuweilen höchst sonderbar! Na ja, aber diese großen Damen glauben, sie können sich benehmen, wie es ihnen passt! Die würde auch nicht davor zurückschrecken, sich in aller Öffentlichkeit das Strumpfband zu richten, wie man so sagt!«
»Oh nein, nein! Du beurteilst sie wirklich falsch, Papa! Wenn sie für eine junge Dame etwas ungewöhnlich ist, so halte ich ihr zugute, dass sie für Lord Spenborough mehr ein Sohn als eine Tochter war.«
»Nun ja, es ist eben ein Unglück für ein Mädchen, die Mutter zu verlieren! Sie war damals erst zwölf, nicht wahr? Na ja. Du hast sehr recht, meine Liebe, man muss Nachsicht mit ihr haben. Ich habe alles Verständnis dafür, besonders jetzt, wo ich nichts sehnlicher gewünscht hätte, als dir deine Mutter mitbringen zu können!«
Fanny war viel zu erstaunt, dass er ihre Meinung akzeptierte, um mehr als eine verwirrte Zustimmung zu murmeln.
»Es ist ein unglückliches Zusammentreffen, dass sie gerade im Wochenbett liegen muss, wenn dir ihre Gegenwart ein Trost gewesen wäre.«
»O ja! Ich meine – das heißt, es war so lieb von ihr, dass sie meinethalben darauf verzichtete, dich an ihrer Seite zu haben!«
»Das ist doch selbstverständlich! Ich habe es noch nie erlebt, dass deine Mama irgendwelchen solchen Grillen nachgegeben hätte. Außerdem weißt du, ein zehntes Wochenbett ist durchaus keine solche Affäre wie das erste. Davon macht man kein Aufhebens mehr. Sie wird nur schwer enttäuscht sein, dass ich ihr keine besseren Nachrichten über dich mitbringen kann. Nicht, dass ich große Hoffnungen gehegt hätte. Nach bloßen drei Jahren war es kaum anders zu erwarten. Jedenfalls ein großer Jammer!« Sie ließ den Kopf hängen, errötete tief, und er fügte hastig hinzu: »Das sollen keine Vorwürfe sein, meine Liebe, so sehr ich wünschen muss, es wäre anders gekommen. Spenborough muss es nahegegangen sein, wie?«
Sie antwortete mit so erstickter Stimme, dass nur die Worte »immer so rücksichtsvoll« zu hören waren.
»Es freut mich, das zu hören. Es ist kein angenehmes Gefühl, zu wissen, dass das, was man besitzt, in die Hände irgendeines nichtssagenden Vetters übergeht – nicht viel dran an dem neuen Earl, wie? –, aber meiner Meinung nach ist er ebenso schuld daran wie du. Wie grotesk – sich eine Lungenentzündung zu holen, solange die Erbfolge noch nicht gesichert war! So eine Unvorsichtigkeit habe ich noch nie erlebt!« Es klang empört, aber er besann sich sofort, zu wem er sprach, und entschuldigte sich. »Es hat keinen Sinn, darauf herumzureiten. Um deinetwillen ist es freilich sehr zu bedauern. Dein Rang muss zwar immer respektiert werden, aber wärst du die Mutter eines Sohnes geworden, hätte sich deine Stellung unvergleichlich gebessert und deine Zukunft wäre gesichert gewesen. Wie die Dinge jetzt liegen, ist das anders. Ich weiß nicht, Fanny, ob du in dieser Beziehung schon bestimmte Vorstellungen hast?«
Sie sammelte alle Kraft und antwortete ziemlich fest: »Doch, Papa. Ich habe vor, mich in das Witwenhaus zurückzuziehen; mit Serena zusammen.«
Er war verblüfft: »Mit Lady Serena!«
»Ich bin überzeugt, dass es genau das ist, was Lord Spenborough von mir gewünscht hätte. Sie darf nicht im Stich gelassen werden.«
»Davon kann doch wohl keine Rede sein! Sie hat schließlich ihren Onkel und diese Tante, die sie in die Gesellschaft eingeführt hat! Auch Spenborough sagte mir eben heute Morgen, er und seine Frau hoffen, dass sie Milverley weiterhin als ihr Heim betrachtet. Ich muss sagen, ich finde das sehr schön von ihm. Sich ein Pulverfass in die eigene Familie zu setzen, wäre ja nicht gerade nach meinem Geschmack.«
»Hartley und Jane – das heißt Lord und Lady Spenborough – sind äußerst gütig; Serena ist sich dessen durchaus bewusst, aber sie weiß, es ginge nicht. Bitte, Papa, ich halte es für meine Pflicht, mich um Serena zu kümmern!«
»Ausgerechnet du dich um sie kümmern!«, brachte er lachend heraus. »Das möchte ich ja gerne miterleben!«
Sie wurde rot, sagte aber: »Stimmt, sie hat sich um mich gekümmert, aber ich bin ihre Stiefmutter und daher die geeignetste Person, als ihre Anstandsdame zu fungieren.«
Er überlegte das und stimmte dann widerstrebend zu. »Das hat wirklich was für sich, aber in deinem Alter – ich weiß nicht, was deine Mama dazu sagen wird! Außerdem wird die junge Dame, mit dem Vermögen im Hintergrund, sehr bald weggeschnappt sein, Charakter hin, Charakter her!«
»Sie hat einen zu klaren Kopf, um sich überrumpeln zu lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie bald heiraten wird, Papa.«
»Sehr wahr! Mindestens vor einem Jahr kommt so etwas gar nicht in Betracht. Du wirst natürlich die Trauer streng einhalten. Deine Mama war dafür, dass du für die Dauer dieser Zeit nach Hartland zurückkehrst, denn wenn du auch die Gräfinwitwe bist, so ist nicht zu leugnen, dass du viel zu jung bist, um allein zu leben. Wenn das Trauerjahr vorbei ist und du zweifellos daran denkst, einen eigenen Haushalt einzurichten, haben wir uns vorgestellt, dass du eine deiner Schwestern bei dir aufnimmst. Aber das bedeutet denn doch auf lange Sicht planen, und ich will dir durchaus nichts diktieren! Schließlich ist an deinem Plan wirklich etwas dran. Du warst es gewöhnt, die Herrin eines großen Hauses zu sein, meine Liebe, und es gefiele dir sicher nicht, wieder wie früher in Hartland leben zu müssen. Nein, ich neige stark zu der Meinung, dass du wirklich genau das Richtige getroffen hast, um alles in Ordnung zu bringen! Das heißt, wenn du glaubst, es mit Lady Serena aushalten zu können.«
»Oh ja! Sogar sehr gut!«
»Also, das hätte ich wirklich nie geglaubt! Ich kann nur hoffen, dass sie nichts anstellt. Dafür würde man nämlich dann dich verantwortlich machen. Sie ist unbeständig: Das hat sich gezeigt, als sie Rotherham sitzenließ und sich damit zum Stadtgespräch machte! Du warst damals noch ein Schulmädchen, aber ich kann mich gut erinnern, was für eine Aufregung das gegeben hat! Ich glaube, die Einladungen zur Hochzeit waren sogar schon ausgeschickt!«
»Das war schlimm, aber Papa, ich schätze sie nur umso höher, weil sie sich entschlossen hatte, sich zurückzuziehen, bevor es zu spät war! Lord Spenborough wünschte diese Verbindung, aber ich bin überzeugt, man hätte nichts Schlimmeres wünschen können! Er hatte Rotherham gern, weil er ein so großer Sportsmann ist und ein so blendender Jagdreiter, und es ist Lord Spenborough nie eingegangen, dass er ein grässlich grober und unangenehmer Gatte geworden wäre! Er hätte Serena so unglücklich gemacht! Er ist ein hassenswerter Mensch, und es macht ihm das größte Vergnügen, wenn er sie ärgern kann! Du musst es ja gehört haben, wie er mit ihr spricht – die Dinge, die er ihr bedenkenlos sagt!«
»Oh ja! Aber ich habe auch sie gehört! Sie wendet ihm gegenüber einen sehr ungehörigen Ton an! Ich sage dir, Fanny, ihr gewagtes Benehmen ist ziemlich unpassend! Sie drückt sich mit einem Freimut aus, den ich bei meinen Töchtern nicht dulden würde.«
»Sie kennt ihn von Kindheit an – sie war nie auf formellem Fuß mit ihm. Wenn sie sich manchmal zu unziemlicher Hitze hinreißen lässt, ist er selbst daran schuld, weil er sie dazu so unfreundlich provoziert! Und was ihr heftiges Naturell betrifft, so bin ich überzeugt, dass seines viel schlimmer ist, als es ihres je sein könnte!«
»Nun, man sieht, dass du ihr sehr zugetan bist, meine Liebe«, sagte er nachsichtig. »Ich jedenfalls möchte momentan nicht um alles in der Welt in Rotherhams Haut stecken! Er kann froh sein, wenn er ohne ein zerkratztes Gesicht davonkommt, das kann ich dir nur sagen!«
Aber als Rotherham zu Serena in den Kleinen Salon kam, fand er sie völlig beherrscht. Er sagte, während er die Tür schloss: »Was kommt jetzt? Werde ich angefleht oder beschimpft werden?«
Sie biss sich auf die Lippen, sagte aber nur: »Beides würde dich kaum rühren, nehme ich an.«
»Nicht im geringsten, aber ich stehe ganz zu deiner Verfügung, wenn du mit mir weiterstreiten willst.«
»Ich bin fest entschlossen, es nicht zu tun.«
Er lächelte. »Dieser Entschluss wird sehr bald geändert sein! Was also willst du von mir, Serena?«
»Dass du dich niedersetzt! Ivo, was kann man machen?«
»Nichts.«
»Du kannst doch nicht im Ernst das Kuratorium annehmen wollen?«
»Warum nicht?«
»Guter Gott, wenn du auch nur einen Augenblick darüber nachdenkst, musst du einsehen, wie unerträglich das wäre – für uns beide!«
»Ich kann verstehen, warum es dir unerträglich wäre, aber warum soll es das mir sein?«
»Da du nicht Vernunft annehmen willst, nehme ich an, du versuchst, mich zu reizen. Ist dir nicht klar, dass diese Geschichte innerhalb einer Woche zum Stadtklatsch wird? Dafür wird schon Onkel Dorrington sorgen! Alle werden darüber reden und sich lustig machen!«
»Das ist ja etwas ganz Neues an dir, Serena!«, sagte er bewundernd. »Du hast doch noch nie einen Pfifferling darauf gegeben, was man über dich spricht!«
Sie wurde rot und wandte den Blick ab. »Du irrst. Auf jeden Fall wäre es abscheulich, wenn uns jedermann beobachten wollte!«
»Lass sie aufpassen! Bis du die Trauer ablegst, werden sie es müde geworden sein, und bis dahin – mich wird’s nicht kümmern!«
»Jedermann Vermutungen anstellen zu sehen?«
»Himmel, Serena, ich bin seit zwölf Jahren Gegenstand von Vermutungen! Darunter sind sogar einige recht gute Geschichten über mich zusammengebraut worden.«
Sie schaute ihn verzweifelt an. »Ich kenne diese Stimmung an dir zu gut, um anzunehmen, dass es auch nur im geringsten etwas nutzte, weiterzureden. Du willst mich hinhalten, indem du so tust, als verstündest du mich nicht.«
»Nein, das will ich nicht. Ich verstehe dich sehr gut, aber du legst dem zu viel Bedeutung bei. Es ist gar nichts Besonderes dabei, dass ich zu deinem Kurator ernannt wurde: jedermann weiß, dass ich der beste Freund deines Vaters war, und es wird niemanden überraschen, dass er es vorgezogen hat, lieber mich als den alten Narren Dorrington oder den Windbeutel, den deine Tante geheiratet hat, zu ernennen!«
»Nein – wenn nicht jene unglückselige Verlobung gewesen wäre!«, sagte sie freimütig. »Das ist es, was es so unerträglich macht. Papas Absicht ist – ist zu offenkundig!«
»Du kannst dich damit trösten, dass ich es bin und nicht du, über den der Mob lachen wird«, sagte er grimmig.
»Wie kannst du nur so etwas sagen? Ich versichere dir, ich will dich nicht in eine solche Lage bringen!«
»Verschwende nicht den leisesten Gedanken daran! Dagegen bin ich abgehärtet!«
»Oh, wie widerlich du bist!«, rief sie mit unterdrückter Heftigkeit aus.
»Das klingt schon eher nach dir!«, sagte er herzlich. »Ich habe mir ja gedacht, dass es nicht lang dauern wird!«
Sie beherrschte sich mit einer Anstrengung, die ihm nicht entging, verschlang die Hände in ihrem Schoß fest ineinander und biss sich auf die Lippen.
»Vorsicht, Serena, du wirst Gallenkrämpfe kriegen, wenn du so viel hinunterschluckst!«
Lächerlichkeit begriff sie immer schnell, und so holte sie tief Luft. Zwar blitzte sie ihn herausfordernd an, aber ihr Humor siegte über die Wut, und sie brach in Lachen aus. »Oh –! Gib wenigstens zu, dass du imstande bist, selbst einen Heiligen zu provozieren!«
»Das habe ich noch nie probiert. Eine Heilige bist du ja gerade nicht!«
»Nein, leider!« seufzte sie. »Schau, zieh mich nicht auf, Ivo, ich bitte dich! Gibt es wirklich keinen Weg, wie man dieses schändliche Testament nichtig machen könnte?«
»Ich nehme an, nein. Aber ich bin kein Rechtsanwalt. Berate dich mit dem Anwalt deines Vaters! Lass dir jedoch gesagt sein, er hat deinen Onkeln keine sehr ermutigende Antwort gegeben, als sie sich an ihn wandten. Ich vermute, dass es rückgängig gemacht werden könnte, wenn ich das Kuratorium nicht annähme, aber das werde ich nicht tun.«
»Wenn du dich weigerst, als Kurator zu handeln –?«
»Auch das werde ich nicht tun. Selbst wenn ich es täte, könntest du nicht über dein Vermögen verfügen, und das möchtest du doch in erster Linie, nicht?«
»Natürlich! Mein Vater hat mir 250 Pfund jährlich als Taschengeld gegeben, und das genügte vollauf, als er noch lebte, aber wie zum Teufel soll ich von einer solchen Summe leben?«
»Versuche ja nicht, mich einzuwickeln, Mädchen! Das Vermögen deiner Mutter wurde dir überschrieben.«
»Zehntausend Pfund, in Fonds gebunden! Mein Einkommen wird insgesamt keine 700 Pfund betragen. Guter Gott, Ivo, ich bin überzeugt, so viel hat mein Vater allein für meine Jagdpferde ausgegeben!«
»Oh, mehr! Er hat allein tausend Guineen für den Apfelschimmel ausgegeben, der dich in der vergangenen Jagdsaison so gut getragen hat. Aber jetzt wirst du ja wohl schwerlich an Jagden teilnehmen!«
»In diesem Jahr, nein. Aber soll ich mein ganzes Leben lang der Armut ausgeliefert sein?«, fragte sie. »Was, wenn ich eine alte Jungfer bleibe? Ist für diese Möglichkeit etwas vorgesehen?«
»Nein, nichts. Ich habe mir das Testament eigens daraufhin durchgesehen, um sicherzugehen«, antwortete er. »Eine verdammte, schlecht arrangierte Sache – aber ich nehme an, er dachte, dass in dieser Beziehung nichts zu fürchten sei.«
»Er hat jedenfalls sein Bestes getan, um mich zu einer Ehe mit dem ersten Mann zu zwingen, der so zuvorkommend ist, um mich anzuhalten!«, sagte sie bitter.
»Du vergisst eines, Geliebteste!«
Sie schaute ihn misstrauisch an. »Oh nein, deine Zustimmung ist Bedingung!«
»Genau das! Aber beruhige dich! Ich werde sie nicht aus unvernünftigen Gründen zurückhalten.«
»Mir zum Trotz würdest du alles tun!«
»Nun, wenn ich das tue, hast du einen guten Grund gegen mich und wirst zweifellos imstande sein, das Kuratorium aufheben zu lassen. Bis dahin aber lass mich dir einen guten Rat geben: Wenn du der Welt keinen Stoff für Klatsch liefern willst, tu wenigstens so, als wärst du einverstanden! Wie du dich zu einem solchen Narren machen konntest, damit alle diese Idioten etwas zu glotzen hatten, verstehe ich nicht! Zieh meinetwegen über mich her, wenn wir allein sind, aber benimm dich in der Öffentlichkeit so, dass die Leute, die sich dafür interessieren, annehmen müssen, du wärest mit dem Arrangement sehr einverstanden und sähest nichts darin, was nicht ganz natürlich und für dich sogar bequem wäre.«
Sie musste einsehen, dass dieser Rat vernünftig war. »Aber alles Übrige –! Wie soll ich durchkommen? Kann ich denn von so wenig leben, Ivo?«
»Du könntest von noch viel weniger leben, aber wie ich dich kenne, kannst du das nicht. Aber was soll dieses ganze Gerede von Durchkommen? Du wirst doch nicht einen eigenen Haushalt aufziehen wollen, oder? Das hat dein Vater nie beabsichtigt!«
»Nein, tue ich auch nicht – aber wenn, könntest du mich auch nicht daran hindern! Wenigstens brauche ich deine widerliche Zustimmung nur zu einer Heirat!«
»Stimmt, aber wenn du so einen Blödsinn machen wolltest, würden dich deine Schulden sehr bald lehren, wie unklug es ist, meinen Rat in den Wind zu schlagen«, gab er zurück.
Sie atmete schwer, sagte aber nichts.
»Nun, was also hast du wirklich vor?«, fragte er.
»Ich werde bei Lady Spenborough leben«, antwortete sie kalt. Sie entdeckte, dass er die Stirn runzelte, und zog die Brauen hoch. »Bitte sehr, hast du etwas dagegen?«
»Nein. Nein, ich habe nichts dagegen. Du wirst dich jedenfalls nicht beengt fühlen, solange du unter ihrem Dach lebst, und für sie wurde ja so schön vorgesorgt, dass sie dich sehr gut mit erhalten kann. Aber – hier?«
»Im Witwenhaus. Ich sehe, dass dir das nicht passt! Wenn du aber auch nur einen plausiblen Grund für deine Missbilligung findest, musst du wirklich ein Genie sein!«
»Mir missfällt es nicht, ich bin nicht dagegen, und wenn du schon wieder grundlos streitlustig wirst, kannst du es erleben, dass du geohrfeigt wirst, zum ersten Mal in deinem Leben – leider Gottes!«, sagte er wild. »Leb, wo es dir passt! Mir ist das vollkommen egal. Hast du noch etwas zu sagen?«
»Nein, ich habe nichts mehr zu sagen, und ich wäre sehr froh, wenn ich mir vorstellen dürfte, dass ich nie mehr auch nur ein einziges Wort mit dir wechseln müsste, solange ich lebe – und außerdem existiert nichts in der Welt – aber schon gar nichts! –, was so abscheulich und verächtlich und feig und unfein ist wie Leute, die ein Zimmer verlassen, solange man noch zu ihnen spricht!«
Er hatte schon die Tür geöffnet, aber daraufhin brach er in Lachen aus und schloss sie wieder. »Sehr gut! Aber ich warne dich, ich gebe Schlag um Schlag zurück!«
»Das brauchst du mir nicht erst zu sagen! Wenn du einverstanden bist, warum hast du dann so finster dreingeschaut?«
»Mein gewohnter Ausdruck, möglicherweise. Es war unbeabsichtigt, versichere ich dir. Ich dachte bloß, dass es für dich besser wäre, aus dieser Umgebung fortzuziehen. Im Dower House leben kann für dich nur schmerzlich sein, Serena, glaube mir!«
Impulsiv sagte sie: »Oh, verzeih mir! Aber wie konnte ich auch ahnen, dass du nur etwas Freundliches damit im Sinn hattest?«
»Der Hieb sitzt!«, warf er ein.
»Nein, nein, so habe ich das nicht gemeint! Nur, im Allgemeinen – ach was! Ich weiß, es wird weh tun, wenn ich hierbleibe, aber ich glaube, diese Empfindlichkeit sollte ich überwinden können. Und weißt du, Ivo, mein Vetter hat das Ganze nicht so richtig heraus!«
»Das kann ich mir vorstellen.«
»Er ist in seiner Art ein sehr guter Mensch, und er will alles so machen, wie es sein soll, aber obwohl er immer dem Gesetz nach als Erbe galt, wurde er nicht dazu erzogen, der Nachfolger Papas zu sein, und ich stelle mir vor, er hat nie erwartet, dass es soweit kommen würde, und daher, und auch weil Papa ihn gar nicht gut leiden konnte, wurde er nie darin eingeführt, wie die Dinge hier laufen, und – kurz gesagt, er ist einfach nicht imstande, es zu machen!«
»Was hat das mit der Sache zu tun?«
»Ja, siehst du es denn nicht? Ich werde ihm in tausend Dingen helfen können und ihn ein bisschen schulen und darauf sehen, dass alles so läuft, wie es laufen soll!«
»Guter Gott! Serena, ich schwöre dir, du wärst schlecht beraten, wolltest du wirklich dergleichen unternehmen!«
»Nein, du irrst, Ivo! Mein Vetter hat es selbst vorgeschlagen. Er sagte mir, er hoffe, dass ich in Milverley bleibe und ihn einführe. Natürlich würde ich das nie tun – in Milverley selbst bleiben –, aber ich war doch sehr gerührt, und ich zweifle nicht, dass ich ihm genauso nützlich sein kann, wenn ich bei Fanny im Dower House lebe.«
»Ich auch nicht!«, sagte er mit der Spur eines schiefen Lächelns. »Aber wenn dein Vetter Auskunft braucht, soll er sie sich doch beim Verwalter deines Vaters holen!«
»Das wird er ja auch, aber obwohl Mr. Morley ein ausgezeichneter Mensch ist, wurde er doch nicht hier erzogen wie ich! Milverley ist nicht ein Stück von ihm selbst! Oh –! Ich drücke mich so ungeschickt aus, aber du musst doch verstehen, was ich meine!«
»Und ob!«, sagte er. »Genau das habe ich gemeint, als ich dir riet, aus dieser Umgebung fortzugehen!«
Kapitel 3
Sowohl Fanny wie Serena wünschten das große Haus so bald wie möglich nach dem Begräbnis zu verlassen; es vergingen jedoch mehrere Wochen, bevor sie sich endlich im Dower House eingerichtet sahen. Dieses Haus, am Rand des Parks und nicht weit von der kleinen Stadt Quenbury gelegen, war ein hübsches, altmodisches Gebäude, das noch vor fünfzehn Monaten von Serenas alter verwitweter Tante bewohnt worden war. Nach dem Tod dieser Dame hatte nur ein alter Diener darin gehaust, da die verschiedenen Pläne dieses und jenes entfernt Verwandten, es zu beziehen, gescheitert waren. Nun stellte es sich heraus, dass doch einige Reparaturen und Renovierungen nötig waren, um es entsprechend wohnlich zu machen. Serena ordnete an, diese unverzüglich durchzuführen, und übersah dabei ganz, dass sich ihre Stellung in Milverley geändert hatte. Ihr Vetter traf sie in dem ausgeräumten Salon im Dower House bei einer Besprechung mit dem Gutsschreiner an, und sie zuckte zusammen, als der neue Herr auf Milverley sagte: »Ich freue mich, dass du Staines deine Anordnungen gegeben hast. Wenn ich gestern nicht so beschäftigt gewesen wäre, hätte ich ihm aufgetragen, dich aufzusuchen und zu tun, was immer du von ihm verlangst.«
Sie hielt den Atem an, als hätte sie einen Schlag ins Gesicht bekommen. »Entschuldige, bitte!«
Er versicherte ihr sehr freundlich, dass sie sich durchaus nicht zu entschuldigen brauche, aber sie war tief betroffen, da sie sich bewusst war, einen Fehler gemacht zu haben, der sehr wahrscheinlich zu einer Verstimmung führen würde. Sie bemühte sich noch weiter, den Fauxpas gutzumachen; er sagte, er verstehe vollkommen, wiederholte seine Bitte, Milverley stets als ihr Heim zu betrachten, hinterließ in ihr jedoch nur den verstärkten Wunsch, die Vorbereitungen für ihren Auszug noch mehr zu beschleunigen.