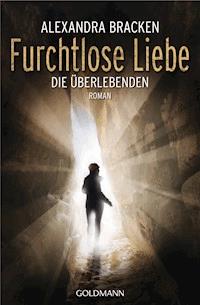Silver in the Bone. Brich den Fluch, bevor der Fluch dich bricht (Die Hollower-Saga 1) E-Book
Alexandra Bracken
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Der Auftakt von Bestsellerautorin Alexandra Brackens neuem Fantasyepos, inspiriert von der Artuslegende und voller Action, Verrat und Liebe Ohne die Fähigkeit, Magie zu sehen, gilt Tamsin als Außenseiterin unter den Hollowern. Das hindert sie jedoch nicht daran, wie die anderen Mitglieder der Gilde die ganze Welt nach legendären Artefakten zu durchkämmen. Als der Auftrag einer Zauberin sie auf die Spur eines Gegenstandes führt, der den Fluch ihres Bruders brechen könnte, beginnt für Tamsin ein Wettlauf gegen die Zeit. Andere Hollower sind ebenfalls hinter dem Artefakt her, darunter auch ihr Rivale Emrys. Ihre Suche führt sie direkt nach Avalon, den Ursprung aller Magie. Aber mit ihrem Auftauchen wecken sie eine uralte Gefahr. Denn auch auf dem magischen Land liegt ein dunkler Fluch … und diese Dunkelheit bedroht bald auch ihre eigene Welt. Eine zynische Außenseiterin, ihr verfluchter Bruder, der arrogante Goldjunge der Schatzjägergilde und eine naive Zauberin - sie alle haben unterschiedliche Ziele. Doch nur gemeinsam können sie Avalon und ihre eigene Welt retten. Voller Magie, Gefahr, Liebe und Herzschmerz. Brackens Geschichten stürzen Leser*innen in eine Welt voller Legenden, die man nie mehr verlassen möchte. Leigh Bardugo, Bestsellerautorin der Grisha-Verse-Romane Weitere Titel der Autorin beim Arena Verlag: LORE. Die Spiele haben begonnen. Sie kämpft um ihr Leben
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 685
Ähnliche
Weitere Bücher von Alexandra Bracken im Arena Verlag:Lore. Die Spiele haben begonnen. Sie kämpft um ihr Leben
ALEXANDRA BRACKEN
ist in Arizona geboren und aufgewachsen, wo sie heute auch wieder mit ihrem Hund Tennyson lebt. Nach einem Studium in Geschichte und Englisch und einem Job im Verlagswesen schreibt sie inzwischen in Vollzeit. Sie ist unter anderem bekannt für ihre Reihe »The Darkest Minds«, die verfilmt wurde. Mit »LORE« eroberte sie zuletzt die Spiegel-Bestsellerlisten. Besuche die Autorin unter www.alexandrabracken.com und auf Twitter und Instagram unter @alexbracken.
SABINE SCHILASKY
hat Anglistik, Amerikanistik und Germanistik studiert und ist seit über zwanzig Jahren mit großer Begeisterung freie Übersetzerin. Sie hat drei mittlerweile erwachsene Kinder und lebt mit Mann, Hund und Katze in Hamburg. Neben dem Übersetzen kocht und backt sie leidenschaftlich gern und weiß zu schätzen, dass ihr Hund sie regelmäßig vor die Tür scheucht.
Ein Verlag in der Westermann Gruppe
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel
»Silver in the Bone« bei Alfred A. Knopf, ein Imprint von
Random House Children’s Books, New York.
1. Auflage 2023
© 2023 Arena Verlag GmbH
Rottendorfer Straße 16, 97074 Würzburg
Alle Rechte vorbehalten
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Published by Arrangement with Alexandra Cayley Bracken
Aus dem Amerikanischen von Sabine Schilasky
Text: Alexandra Bracken
Lektorat: Laura Held
Umschlaggestaltung: Filip Hodas
Titelgestaltung: Carolin Liepins
Karte: Virginia Allyn
Vignetten für Innengestaltung: Shutterstock.com/Murhena,
Shutterstock.com/Niko28
Layout und Satz: Malte Ritter, Berlin
E-Book-ISBN 978-3-401-81063-8
Besuche den Arena Verlag im Netz:
www.arena-verlag.de
@arena_verlag
@arena_verlag_kids
HINWEIS
Diese Geschichte spielt zum Großteil in einer harten Welt und ist stellenweise sehr düster. Zudem enthält sie explizite Gewaltdarstellungen und andere sensible Inhalte. Weiteres dazu findest du am Ende des Buches.
Achtung: Diese Hinweise enthalten Spoiler!
Wir wünschen dir das bestmögliche Leseerlebnis.
DER, DER WAGT, DIESES BUCH ZU UNRECHT SEIN EIGEN ZU NENNEN,
MÖGE IM HERZEN DIE WORTE DER SCHWESTERNSCHAFT KENNEN:
NIMMT ER DIES BUCH, DESSEN WAHRER BESITZER ER NICHT IST,
TRIFFT IHN EIN FLUCH, DER SICH IN UNENDLICHEN QUALEN MISST.
ER WIRD AUF SEINE FINST’REN AUGEN FALLEN,
DIE LIEBE ZUM LESEN WIRD VERHALLEN,
SO WEISS WIE SCHNEE WIRD FORTAN JEDE SEITE SEIN
UND DER DIEB IN EWIGEM LEIDEN FÜR IMMER ALLEIN.
Für meine Schwester Stephanie
Lancashire, England
Das Erste, was man als Hollower lernte, war, niemals seinen Augen zu trauen.
Natürlich drückte Nash es anders aus: Alle Zauberei ist zur Hälfte Illusion. Die andere Hälfte war leider blutgetränkter Horror.
Doch in diesem Moment hatte ich keine Angst. Ich war wütend wie eine fauchende Katze.
Sie hatten mich zurückgelassen. Mal wieder.
Ich stützte die Hände zu beiden Seiten des Schuppentürrahmens ab und lehnte mich so nahe zu dem magischen Korridor vor, wie ich konnte, ohne hindurchzuschreiten. Hollower nannten diese dunklen Tunnel »Adern«; sie brachten einen binnen eines Augenblicks von einem Ort zum anderen. In diesem Fall zur Gruft einer längst verstorbenen Zauberin, in der sich ihr kostbarster Besitz befand.
Ich schaute auf dem gesprungenen Display von Nashs uraltem Mobiltelefon nach der Zeit. Achtundvierzig Minuten waren vergangen, seit ich sie in die Ader verschwinden sah. Ich konnte nicht schnell genug laufen, um sie einzuholen, und sollten sie mein Rufen gehört haben, hatten sie es ignoriert.
Das Display wurde schwarz, als der Akku schließlich aufgab.
»Hallo?«, rief ich und griff nach dem Schlüssel, den sie im Schloss gelassen hatten – ein Fingerknochen der Zauberin, in ein wenig von ihrem Blut getaucht. »Ich gehe nicht zurück ins Lager, also könnt ihr mir genauso gut gleich verraten, wann es sicher ist reinzukommen! Hört ihr mich?«
Einzig der Korridor antwortete, indem er ein Schneegestöber ausspie. Super. Die Zauberin Edda hatte beschlossen, ihre Reliquiensammlung irgendwo unterzubringen, wo es noch kälter als im winterlichen England war.
Die Tatsache, dass Cabell und Nash nicht antworteten, bescherte mir ein mulmiges Gefühl. Doch Nash hatte sich noch nie von Gefahr abschrecken lassen, und er sollte feststellen, dass ich mich auch von niemandem abhalten ließ, am allerwenigsten von dem Mistkerl, der mein Vormund war.
»Cabell?«, fragte ich lauter. Die Kälte packte meine Worte und machte sie zu weißen Wolken in der Luft. Ein Schauer durchfuhr mich. »Ist alles in Ordnung? Ich komme rein, ob ihr wollt oder nicht!«
Selbstverständlich hatte Nash Cabell mitgenommen. Cabell war ihm nützlich. Aber wenn ich nicht dort war, passte niemand auf, dass mein Bruder nicht verletzt wurde, oder Schlimmeres.
Die Sonne war von silbernen Wolken verhüllt. Hinter mir wachte ein verlassenes Cottage über die nahen Felder. Es war still, was mich immer nervös machte. Ich hielt den Atem an und horchte angestrengt. Kein Verkehrsbrummen, kein Dröhnen von Flugzeugen, nicht mal ein Vogelzwitschern. Es war, als hätten alle anderen Wesen es für klüger gehalten, nicht an diesen verfluchten Ort zu kommen, und Nash wäre der einzige Idiot, der blöd und gierig genug war, es zu riskieren.
Einen Moment später trug mir ein frischer Schneeschwall Cabells Stimme zu.
»Tamsin?« Immerhin klang er aufgeregt. »Pass auf deinen Kopf auf, wenn du reinkommst!«
Ich tauchte in die desorientierende Dunkelheit der Ader. Die Kälte draußen war nichts verglichen mit der beißenden hier, die in meine Haut stach, bis ich kaum noch Luft bekam.
Nach zwei Schritten schälte sich der runde Durchgang am anderen Ende der Ader aus der Schwärze. Nach dreien wurde er zu einer pulsierenden Wand aus gespenstischem Licht. Blau, beinahe wie …
Ich schaute nach unten zu den abgebrochenen Eisklumpen, die um die Öffnung verstreut lagen und in denen Fluchsigillen wirbelten. Ich drehte mich um, suchte nach Cabell, als mich eine Hand packte.
»Ich habe dir gesagt, du sollst im Lager bleiben.« Da seine Stirnlampe eingeschaltet war, lag Nashs Gesicht im Schatten, doch ich fühlte die Wut von ihm abstrahlen wie Körperwärme. »Darüber unterhalten wir uns noch, Tamsin.«
»Was willst du machen? Mir Hausarrest erteilen?«, fragte ich, berauscht von meinem Sieg.
»Werde ich vielleicht, du kleine Närrin«, antwortete er. »Tu nichts, ohne den Preis zu kennen.«
Das Licht seiner Stirnlampe tanzte über mich hinweg, bevor es nach oben schwang. Ich folgte dem Strahl mit meinem Blick.
Eiszapfen hingen von der Decke. Hunderte, allesamt mit rasiermesserscharfen Stahlspitzen versehen, die jeden Moment herunterfallen könnten. Die Wände, der Boden und die Decke waren aus festem Eis.
Sogar in der Dunkelheit war Cabell in seiner löchrigen gelben Windjacke leicht auszumachen. Erleichtert ging ich auf seine Seite des Raums und bückte mich, um ihm zu helfen, unbenutzte Kristalle aufzusammeln. Mit den Steinen absorbierte er die Magie der Flüche um die Eingänge herum. Sobald die Flüche entkräftet waren, hatte Nash mit seiner Axt auf die Sigillen eingeschlagen.
Alle Hollower konnten Flüche brechen – aber nur mit Werkzeugen, die sie von Zauberinnen gekauft hatten.
Selbst unter den magisch begabten Hollowern war Cabell besonders. Er war der erste Expeller seit Jahrhunderten – jemand, der die Magie eines Fluchs von einer Quelle in eine andere übertragen und ihn so umlenken konnte.
Der einzige Fluch, den Cabell anscheinend nicht brechen konnte, war sein eigener.
»Was für ein Fluch war das, Tamsin?«, fragte Nash und zeigte mit seinen Stahlkappenstiefeln auf ein Sigill in einer Eisscherbe. Auf meinen Blick hin ergänzte er: »Du hast gesagt, dass du lernen willst.«
Sigillen waren Symbole, mit denen Zauberinnen Magie formten und so an einen Ort oder ein Objekt banden. Nash hatte sich dämliche Namen für alle möglichen Fluchzeichen ausgedacht.
»Geisterschatten«, sagte ich und verdrehte die Augen. »Ein Geist wäre uns durch die Gruft gefolgt, hätte uns gefoltert und uns die Haut abgezogen.«
»Und dieser?« Nash schob ein Steinstück in meine Richtung, in das etwas eingemeißelt war.
»Weißauge«, antwortete ich. »Wer die Schwelle überquert, wird geblendet und irrt in der Höhle herum, bis er erfriert.«
»Wahrscheinlich würde man gepfählt, bevor man erfriert«, sagte Cabell munter und wies zu einem anderen Sigill. Cabells blasse Haut war rosa vor Kälte oder Aufregung, und er schien die Eisflocken in seinem schwarzen Haar nicht wahrzunehmen.
»Richtig. Sehr gut«, sagte Nash, worauf mein Bruder strahlte.
Um uns atmeten die Wände kalte Luft aus. Ein fremdartiger Gesang durchzog das Eis, knarzend und klingend wie ein alter Baum, mit dem der Wind spielte. Von hier aus führte nur ein enger Gang rechts von uns weiter.
Fröstelnd rieb ich mir die Arme. »Können wir bitte deinen blöden Dolch finden und gehen?«
Cabell holte neue Kristalle für die Flüche entlang des Gangs hervor. Ich beobachtete ihn aufmerksam, jede seiner Bewegungen. Doch Nash hielt mich mit seiner verhüllten Hand an der Schulter zurück, als ich Cabell folgen wollte.
Er schnalzte mit der Zunge. »Hast du nicht etwas vergessen?«
Genervt blies ich mir eine blonde Haarsträhne aus dem Gesicht. »Den brauche ich nicht.«
»Und ich brauche diese Einstellung bei einem Wicht von einem Mädchen nicht, also bitte«, erwiderte Nash und kramte in meiner Tasche nach einem violetten Seidenbündel. Er wickelte es auf und hielt mir die Totenhand hin.
Ich besaß keine Allsicht, woran mich Cabell und Nash bei jeder verfluchten Gelegenheit erinnerten. Im Gegensatz zu ihnen hatte ich keine eigene Magie. Eine Totenhand konnte jede Tür öffnen, auch solche, die durch einen Knochenknauf geschützt waren. Ihr Hauptzweck aber, zumindest für mich, war der, die Magie zu enthüllen, die dem menschlichen Auge verborgen blieb.
Ich hasste es, anders zu sein. Dadurch war ich ein Problem, das Nash lösen musste.
»Puh, er ist ein bisschen schorfig, was?«, fragte Nash, während er die dunklen Dochte an den Fingerspitzen nach und nach entzündete.
»Du bist dran, ihn zu baden«, sagte ich. Das Letzte, was ich wollte, war, noch einen Abend damit zu verbringen, eine frische Schicht menschliches Fett in die abgetrennte Hand eines Mörders aus dem achtzehnten Jahrhundert zu massieren, der für das Auslöschen von gleich vier Familien gehängt worden war.
»Aufwachen, Ignatius«, befahl ich. Nash hatte ihn unten an einem eisernen Kerzenhalter befestigt, was es jedoch kein bisschen angenehmer machte, die Hand zu tragen.
Ich drehte Ignatius mit der Handfläche zu mir. Das hellblaue Auge in der wächsernen Haut öffnete sich blinzelnd und verengte sich gleich wieder vor Enttäuschung.
»Jap«, sagte ich. »Ich lebe immer noch.«
Das Auge verdrehte sich.
»Das beruht auf Gegenseitigkeit, du unverschämtes Stück Pökelfleisch«, murmelte ich und richtete knackend die steifen, gekrümmten Finger.
»Guten Tag, Schöner«, säuselte Nash. »Übrigens hilft ein bisschen Süße bei allem, Tamsy.«
Ich sah ihn wütend an.
»Du wolltest herkommen«, sagte er. »Denk nächstes Mal vorher an den Preis, ja?«
Ich roch brennendes Haar. Rasch nahm ich Ignatius in meine linke Hand. Meine Sicht flackerte, als sein Licht sich über der Eisfläche ausbreitete und sie in einen surrealen Schimmer tauchte. Ich rang nach Luft.
Die Fluchsigillen waren überall – auf dem Boden, an den Wänden, an der Decke. Sie wirbelten durcheinander.
Cabell kniete vorn an dem Tunneleingang. Schweißperlen standen auf seiner Stirn, als er sich abmühte, die Flüche in die Kristalle abzuleiten, die er langsam vor sich auslegte.
»Cab braucht eine Pause«, sagte ich zu Nash.
»Er schafft das«, entgegnete er.
Cabell nickte und streckte die Schultern nach hinten. »Mir geht es gut. Ich kann weitermachen.«
Ein Tropfen brennendes Fett versengte mir den Daumen. Ich fauchte Ignatius an und erwiderte seinen boshaften Blick.
»Nein«, sagte ich streng zu ihm. Ich würde ihn nicht neben Cabell abstellen, wie er es wollte. Erstens, weil ich mir von einer abgetrennten Hand überhaupt nichts sagen lassen musste. Und genau genommen war gar kein weiterer Grund nötig.
Um die unverschämte Hand zu ärgern, hielt ich Ignatius vor die Wand rechts von mir und schob sein Auge immer näher an die gefrorene Oberfläche. Ich war kein so guter Mensch, dass mir das Zittern in seinen steifen Gelenken ein schlechtes Gewissen gemacht hätte.
Die Hitze seiner Flammen schnitt durch den dicken Frostmantel der Wand, und als Tropfen für Tropfen geschmolzenes Eis nach unten rann, kam ein dunkler Umriss auf der anderen Seite zum Vorschein.
Mir entfuhr ein Keuchen, und die Sohle meines Turnschuhs rutschte auf dem Eis, als ich rückwärtsstolperte. Ehe ich auch nur begriff, was geschah, fiel ich.
Nash schoss nach vorn und packte meinen Arm mit eisernem Griff. Mein Herz hämmerte, und mir tat die Lunge von der Kälte weh, als ich nach Luft rang, während Nash mich aufrichtete. Cabell kam zu mir geeilt, umfing meine Schultern und vergewisserte sich, dass ich nicht verletzt war. Ich erkannte den Moment, in dem er sah, was ich durch das Eis erblickt hatte. Er wurde kreidebleich und vor Angst schloss er die Hände fester um meine Schultern.
Dort war ein Mann im Eis, monströs verzerrt im Tod. Wie es aussah, hatte ihm der Druck des Eises den Kiefer gebrochen, sodass sein Mund unnatürlich weit aufgerissen war – wie in einem letzten, lautlosen Schrei. Weißes Haar umrahmte seine frostverbrannten Wangen, und sein Rücken war auf scheußliche Art verbogen.
»Ah, Woodrow. Ich habe mich schon gefragt, was aus ihm geworden ist«, sagte Nash, der einen Schritt vortrat, um die Leiche zu betrachten. »Armer Mistkerl.«
Cabell umfasste mein Handgelenk und drehte Ignatius’ Licht zurück zu dem Tunnelgang vorn. Dunkle Schatten befleckten das schimmernde Eis wie Blutergüsse. Eine schaurige Leichengalerie.
Bei dreizehn hörte ich auf zu zählen.
Mein Bruder zitterte heftig genug, dass seine Zähne klapperten. Er sah mich mit seinen dunklen Augen an. »Da sind … es sind so viele …«
Ich nahm ihn in die Arme. »Ist schon okay … ist okay …«
Doch seine Furcht war zu groß; sie hatte seinen Fluch geweckt. Dunkle Borsten sprossen aus der Haut an seinem Hals, und seine Gesichtsknochen verformten sich eklig knackend, um die Form eines angsteinflößenden Hundes anzunehmen.
»Cabell«, sagte Nash ruhig und leise. »Wo wurde König Artus’ Dolch geschmiedet?«
»Er …« Cabells Stimme klang befremdlich zischend durch die sich verlängernden Zähne. »Er wurde …«
»Was machst …?«, begann ich, verstummte jedoch gleich, als Nash mir einen Blick zuwarf. Das Eis um uns herum ächzte. Ich hielt Cabell fester und fühlte, wie sich sein Rücken krümmte.
»Er wurde in …« Cabell verengte die Augen vor Konzentration, als er zu Nash schaute. »Avalon … geschmiedet.«
»Richtig. Zusammen mit Excalibur.« Nash kniete vor uns und Cabells Körper beruhigte sich. Das Fell, das ihm gesprossen war, zog sich wieder zurück, wobei es Stellen hinterließ, die wie ein Ausschlag anmuteten. »Erinnerst du dich an den anderen Namen der Avalonier für ihre Insel?«
Cabells Gesicht begann, sich wieder zurückzuformen, und er verzog es vor Schmerz. Doch sein Blick blieb starr auf Nash gerichtet. »Ynys … Ynys Afallach.«
»Auf Anhieb, natürlich«, sagte Nash und stand wieder auf. Er legte uns beiden je eine Hand auf die Schulter. »Du hast den Großteil der Flüche schon beseitigt, mein Junge. Jetzt kannst du mit Tamsin hier warten, bis ich wieder zurück bin.«
»Nein«, widersprach Cabell. Er wischte sich mit dem Ärmel über die Augen. »Ich will mitkommen.«
Und ich würde ihn nicht ohne mich mitgehen lassen.
Nash nickte und wandte sich zum Gang. Er gab Cabell die Laterne und leuchtete mit seiner Stirnlampe die lange Strecke von Leichen hinunter. »Das erinnert mich an ein Märchen …«
»Was tut das nicht?«, murmelte ich. Sah er denn nicht, dass Cabell immer noch erschüttert war? Er tat bloß tapfer, aber das genügte Nash ja von jeher.
»Vor langer Zeit herrschte in einem längst vergessenen Königreich ein König namens Artus über die Menschen wie auch über das Feenvolk«, begann Nash, der vorsichtig um die Kristalle herumschritt. Im Vorbeigehen kratzte er die Fluchsigillen mit seiner Axt weg. »Doch um ihn soll es jetzt nicht gehen, sondern um die Insel Avalon. Ein Ort, an dem Äpfel wuchsen, die alle Beschwerden heilten, und wo Priesterinnen für die sorgten, die in den heiligen Hainen lebten. Eine Zeit lang gehörte Artus’ eigene Halbschwester Morgana ihrem Orden an. Sie diente ihm als weise und faire Beraterin, egal wie anders die viktorianischen Bauerntölpel sie später dargestellt haben.«
Diese Geschichte hatte er uns schon erzählt. Hunderte Male an hundert verschiedenen Lagerfeuern. Als würden uns König Artus und seine Ritter bei all unseren Jobs begleiten. Doch die Geschichte war auf gute Weise vertraut.
Ich konzentrierte mich auf den Klang von Nashs warmer, tiefer Stimme anstatt auf die entsetzlichen Gesichter um uns herum, deren Blut zu grotesken Heiligenscheinen gefroren war.
»Die Priesterinnen ehrten die Göttin, die das Land schuf, über das Artus herrschen sollte. Manch einer behauptet, sie hätte es aus ihrem eigenen Herzen geformt.«
»Das ist Blödsinn«, flüsterte ich. Meine Stimme zitterte nur ein klein wenig. Cabell griff nach hinten und umfing meine Hand fest.
Nash schnaubte verächtlich. »Für dich vielleicht, Mädchen, aber für sie sind diese Geschichten so real wie du oder ich. Die Insel war einst Teil unserer Welt, wo heute stolz Glastonbury Tor aufragt. Doch vor vielen Jahrhunderten, als die neuen Religionen aufkamen und die Menschen anfingen, Magie zu fürchten und zu hassen, wurde Avalon abgespalten und zu einer der Anderswelten. Dort waren die Priesterinnen, die Druiden und das Feenvolk sicher vor den Gefahren der Sterblichenwelt und lebten in Frieden …«
»Bis die Zauberinnen rebellierten«, sagte Cabell. Er riskierte, sich umzublicken, und klang jetzt sicherer.
»Ja, bis die Zauberinnen rebellierten«, stimmte Nash ihm zu. »Die Zauberinnen, die wir heute kennen, sind die Nachfahrinnen jener, die aus Avalon verbannt wurden, nachdem sie sich der schwarzen Magie zugewandt hatten …«
Ich konzentrierte mich auf das Gefühl von Cabells Hand und seinen festen Fingern, als wir an der letzten Leiche vorbeikamen und durch einen steinernen Türbogen schritten. Dahinter führte der glitschige Eisweg nach unten. Wir blieben stehen, als Cabell ein Fluchsigill unter uns fühlte, noch bevor er es sehen konnte.
»Warum willst du diesen doofen Dolch eigentlich so dringend finden?«, fragte ich und schlang die Arme um meinen Oberkörper, um mich warm zu halten.
Nash suchte schon seit einem Jahr nach ihm und wimmelte deshalb bezahlte Aufträge und leichtere Funde ab. Ich hatte die Spur zu dieser Gruft entdeckt … nicht, dass Nash jemals all meine Recherche anerkennen würde.
»Meinst du nicht, eine legendäre Reliquie zu finden, ist Grund genug?«, entgegnete er und wischte sich die gerötete Nasenspitze mit dem Ärmel ab. »Wenn man etwas möchte, muss man mit allen Mitteln darum kämpfen oder gar nicht.«
»Der Weg ist frei«, sagte Cabell, der sich wieder aufrichtete. »Wir können weiter.«
Nash ging erneut voraus. »Denkt dran, meine Kleinen, die Zauberin Edda war berüchtigt für ihre Liebe zu Tricksereien. Es wird nicht alles so sein, wie es auf den ersten Blick scheint.«
Was er meinte, wurde nach wenigen Schritten offensichtlich.
Es begann mit einer Kerosinlaterne, die achtlos neben einer in Eis erstarrten Leiche zurückgelassen worden war, als hätte der Schatzjäger sie lediglich abgestellt, sich zur gefrierenden Oberfläche vorgeneigt und wäre im Ganzen von ihr verschlungen worden.
Wir passierten die Laterne, ohne sie eines zweiten Blickes zu würdigen.
Als Nächstes kam eine Leiter, die einen sicheren Abstieg zu der unteren Ebene anzubieten schien.
Wir benutzten unsere Seile.
Dann, als die Temperaturen weiter auf eine mörderische Frostkälte fielen, folgte ein makelloser weißer Pelzmantel. So weich und warm und genau von der Sorte, die eine gedankenversunkene Zauberin dalassen würde, drapiert über einer nicht minder verlockenden Kiste voller Gläser mit Essen.
Benutzt uns, raunten sie.
Und zahlt den Preis mit eurem Blut.
Ignatius’ Licht deckte die Wahrheit auf. Die Rasierklingen und rostigen Nägel, die im Mantelinnern lauerten. Die Spinnen, die in den Gläsern warteten. Die Leitersprossen, von denen bis auf eine alle fehlten. Und die Laterne war mit »Erstickende Mutter« gefüllt, einem Dampf, der die Lunge zusammenpresste, bis Atmen unmöglich wurde; er war gefertigt aus dem Blut einer Mutter, die ihre Kinder ermordet hatte. Wer das Glas öffnete, um den Docht zu entzünden, starb sofort.
Wir passierten all das, und Cabell leitete die Fluchmagie der einzelnen Fallen um. Schließlich, nach gefühlten Stunden, erreichten wir die innere Kammer der Gruft. Die runde Kammer lag im selben blassen, eisigen Licht. In der Mitte befand sich ein Altar, und dort auf einem Samtkissen lag ein Dolch mit einem elfenbeinfarbenen Griff.
Und Nash, der nie um Worte verlegen war, blieb stumm. Nicht vor Glück, wie ich erwartet hätte. Er rieb sich auch nicht triumphierend die Hände, als Cabell die letzten Schutzflüche brach.
»Was ist mit dir?«, fragte ich verärgert. »Sag nicht, dass es der falsche Dolch ist.«
»Nein, ist er nicht«, antwortete Nash, seine Stimme klang auf einmal komisch. Cabell trat einen Schritt von dem Altar zurück, damit Nash an ihm vorbeikonnte.
»Na«, hauchte er. Er ließ seine Hand einen Moment lang über dem Dolchgriff schweben, bevor er ihn umschloss. »Hallo.«
»Was jetzt?«, fragte Cabell, der den Dolch ansah.
Eine bessere Frage war vielleicht, an wen Nash ihn verkaufen wollte. Vielleicht könnten wir uns dann ausnahmsweise mal eine anständige Unterkunft und Essen leisten.
»Jetzt«, sagte Nash leise und hielt die Klinge ins Licht. »Fahren wir nach Tintagel und holen uns den wahren Preis.«
Wir reisten per Zug nach Cornwall, wo bei unserer Ankunft ein heftiges Gewitter von den Klippen heranzog und die dunkle Ruine von Tintagel Castle in sein bizarres Licht und grollenden Donner hüllte. Nachdem wir im peitschenden Regen mühsam unser Zelt aufgebaut hatten, fiel ich in einen tiefen Schlaf. In meinen Träumen warteten die Leichen im Eis auf mich, nur waren sie jetzt keine Hollower, sondern König Artus und seine Ritter.
Nash stand vor ihnen, den Rücken zu mir gewandt, und beobachtete die Eisfläche, die sich wie Wasser wellte. Ich öffnete den Mund, um etwas zu sagen, aber es kam kein Laut heraus. Nicht einmal ein Schrei, als er durch das Eis trat, als wollte er sich zu ihnen gesellen.
Ich schrak aus dem Schlaf und wühlte mich hektisch aus meinem Schlafsack. Das erste bisschen Licht ließ die rote Zeltplane schwach leuchten.
Genug, um zu erkennen, dass ich allein war.
Sie sind weg.
Statisches Rauschen ertönte in meinen Ohren. Meine Finger waren zu taub, um den Reißverschluss der Zeltklappe zu greifen.
Sie sind weg.
Ich konnte nicht atmen. Hab ich’s doch gewusst. Hab ich’s doch gewusst. Hab ich’s doch gewusst. Wieder hatten sie mich zurückgelassen.
Mit einem frustrierten Schrei riss ich den Reißverschluss und die Zeltklappe auf, um hinauszustürzen.
Es goss und stürmte draußen, sodass mein Haar sofort durchnässt war und meine nackten Füße im Schlamm versanken, während ich mich umschaute. Ein dichter Dunst umwaberte mich und verschleierte die Hügel, was mir das Gefühl gab, hier allein gefangen zu sein.
»Cabell?«, brüllte ich. »Cabell, wo bist du?«
Ich rannte in den Dunst. Steine, Heidekraut und Disteln stachen mir in die Zehen, aber nichts davon spürte ich. Da war nur der Schrei, der sich brennend in meiner Brust aufbaute.
»Cabell!«, wiederholte ich. »Nash!«
Mein Fuß verfing sich in etwas. Ich fiel hin und rollte über die Erde, bis ich gegen einen anderen Stein prallte und mir die Luft wegblieb. Ich konnte nicht mehr atmen. Alles tat weh.
Nun brach der Schrei heraus und veränderte sich.
»Cabell«, schluchzte ich. Meine heißen Tränen vermischten sich mit dem Regen, der mir ins Gesicht klatschte.
Wie kannst du uns etwas bringen?
»Bitte«, flehte ich und rollte mich zusammen. Das Meer brüllte zurück, indem es auf das felsige Ufer schmetterte. »Bitte … ich kann nützlich sein … bitte …«
Lasst mich nicht hier.
»Tam…sin…?«
Zuerst dachte ich, ich würde es mir einbilden.
»Tamsin?« Seine Stimme war dünn und wurde beinahe vom Regen verschluckt.
Ich stemmte mich hoch, kämpfte gegen das Gras und den Schlamm, die an mir sogen, und suchte nach ihm.
Für einen Moment lichtete sich der Dunst oben auf dem Hügel, und dort war er, gespenstisch bleich. Sein schwarzes Haar klebte ihm am Kopf, und der Blick seiner fast schwarzen Augen war leer.
Mühsam arbeitete ich mich den glitschigen Hang hinauf, zog mich an Grasbüscheln und Steinen nach oben, bis ich bei ihm war. Dann nahm ich ihn in die Arme. »Alles okay? Cab, geht es dir gut? Was ist passiert? Wo seid ihr gewesen?«
»Er ist weg.« Cabell klang ganz schwach. Seine Haut fühlte sich eiskalt an, und ich sah, dass seine Lippen blau waren. »Ich bin aufgewacht, und er war nicht mehr da. Er hat seine Sachen nicht mitgenommen … Ich habe ihn gesucht, aber er ist …«
Fort.
Doch Cabell war hier. Ich umarmte ihn fester, und er klammerte sich an mich. Seine Tränen wurden zu Regen auf meiner Schulter. Nie hatte ich Nash mehr gehasst, weil er alles bestätigt hatte, was ich über ihn dachte.
Ein Feigling. Ein Dieb. Ein Lügner.
»E-er kommt doch wieder, oder?«, flüsterte Cabell. »Vielleicht h-h-hat er nur vergessen zu sagen, wohin er wollte.«
Da ich Cabell niemals belügen wollte, sagte ich gar nichts.
»W-wir müssen zurück u-und warten …«
Wir würden ewig warten. Das spürte ich tief in mir. Nash hatte sich endlich von seinem Ballast befreit. Er würde nie mehr wiederkommen. Die einzige Gnade war, dass er Cabell nicht mitgenommen hatte.
»Es ist okay«, flüsterte ich. »Es ist okay. Mehr als uns brauchen wir nicht. Es ist okay …«
Nash sagte, manche Zauber müssten dreimal gesprochen werden, um zu wirken, aber ich war nicht so blöd, es zu glauben. Ich war keines der Mädchen aus den Märchenbüchern. Ich hatte keine magischen Kräfte.
Nur Cabell.
Die dunklen Borsten sprossen wieder aus seiner Haut, und ich fühlte, wie sich die Knochen an seinem Rücken veränderten, sich neu zu ordnen drohten. Ängstlich hielt ich ihn fester in den Armen. Es war immer Nash gewesen, der Cabell zurück zu sich selbst holen konnte, sogar wenn er sich vollständig verwandelt hatte.
Jetzt hatte Cabell nur noch mich.
Ich schluckte, schirmte ihn vor dem peitschenden Regen und Wind ab. Und dann begann ich zu sprechen: »Vor langer Zeit, in einem längst vergessenen Königreich, herrschte ein König namens Artus über die Menschen wie auch über das Feenvolk …«
Ganz gleich, was sie sagen oder wie sehr sie sich selbst belügen, Menschen wollen die Wahrheit nicht wissen.
Sie wollen die Geschichte hören, die bereits in ihnen lebt, tief im Mark ihrer Knochen vergraben. Die Hoffnung steht ihnen in einer Sprache ins Gesicht geschrieben, die nur wenige lesen können.
Zum Glück für mich konnte ich es.
Der Trick bestand natürlich darin, ihnen das Gefühl zu geben, ich hätte gar nichts gesehen. Dass ich nicht einschätzen konnte, wer Liebeskummer hatte, wer dringend Geld brauchte oder wer eine Krankheit überwinden wollte, die er nie loswerden würde. Alles führte letztlich auf einen simplen Wunsch zurück, der so vorhersehbar wie schmerzlich menschlich war: die eigenen Wünsche von jemand anderem ausgesprochen zu hören – als läge darin die Macht, sie wahr werden zu lassen.
Magie.
Aber Wünsche waren nichts weiter als vergeudeter Atem, der in der Luft verpuffte, und Magie nahm stets mehr, als sie gab.
Niemand wollte die Wahrheit hören, und das war in Ordnung für mich. Die Lügen wurden besser bezahlt; nackte Wahrheiten hingegen, wie meine Chefin Myrtle – die Mystic Maven von Mystic Maven Tarot – einmal sagte, brachten mir bloß wütende Internetbewertungen ein.
Ich rieb mir die Arme unter Myrtles Häkelschal und blickte zu dem digitalen Timer rechts von mir: 0:30 … 0:29 … 0:28 …
»Ich spüre … ja, ich spüre, dass du noch eine Frage hast«, sagte ich und presste mir dabei zwei Finger an die Stirn. »Eine, die der wahre Grund ist, weshalb du hier bist.«
Hinter mir gurgelte der Aromaölzerstäuber. Dessen Patschuli- und Rosmarinduft war machtlos gegen den Geruch von frittierten Calamari, der durch die alten Bodendielen nach oben zog, oder den ranzigen Gestank der Müllcontainer hinten. Der vollgestellte dunkle Raum verengte sich um mich herum, als ich durch den Mund atmete.
Mystic Maven war schon seit Jahrzehnten in dem Raum über Bostons Faneuil Hall und hatte eine ganze Reihe von schmierigen Fischrestaurants miterlebt, die sich im Erdgeschoss der Markthalle ablösten. Seit Neuestem war es Lobster Larry’s, aus dem es ganz besonders stank.
»Ich …«, begann mein Kunde und blickte sich zu der abblätternden Tapete, den kleinen Statuen von Buddha und Isis um und dann zurück zu den Karten, die ich vor uns auf dem Tisch ausgelegt hatte. »Na ja …«
»Irgendetwas?«, versuchte ich es wieder. »Wie du bei deinen Abschlussprüfungen abschneidest? Deine künftige Karriere? Die Hurricane-Saison? Ob es in deiner Wohnung spukt?«
Mein Handy erreichte das Ende der Playlist mit harmonischem Regen und Windspielen. Ich griff hin, um sie neu zu starten. In der darauffolgenden Stille flackerten die batteriebetriebenen Kerzen auf den Regalen um uns herum. Die Finsternis zwischen ihnen verbarg einigermaßen, wie schäbig das Zimmer war.
Komm schon, dachte ich halb verzweifelt.
Schon seit sechs langen Stunden lauschte ich in den Pausen zwischen den wenigen Kunden Entspannungsmusik und ordnete gedankenverloren die Kristalle auf den Regalen. Cabell müsste inzwischen den Schlüssel haben, und wenn diese Legung vorbei war, könnte ich weg zu meinem richtigen Gig.
»Ich verstehe nur nicht, was sie in ihm sieht …«, begann Franklin, wurde jedoch direkt vom Heulen meines Timers unterbrochen.
Bevor ich reagieren konnte, flog die Tür auf und ein Mädchen stürmte herein.
»Endlich!«, sagte sie und teilte den billigen Perlenvorhang mit einem dramatischen Handschwenk. »Ich bin dran!«
Franklin drehte sich um und starrte sie an. Seine über die Störung verärgerte Miene veränderte sich schlagartig, als er sie mit unverhohlenem Interesse musterte. Ihre braune Haut schimmerte leicht, wahrscheinlich von der Creme, die sie benutzte und die nach Honig und Vanille roch. Ihre Braids waren zu zwei hohen Knoten hinten aufgesteckt, und sie hatte ihre Lippen dunkelviolett geschminkt.
Nachdem sie Franklin einmal kurz von oben bis unten abgecheckt hatte, grinste sie mir zu. In ihrer Hand hielt sie den allgegenwärtigen tragbaren CD-Player und schaumstoffgepolsterte Kopfhörer; Relikte aus der technologischen Vergangenheit. Als jemand, der unfähig war, irgendetwas wegzuwerfen, war ich neidisch und verzaubert zugleich.
Das »verzaubert« hatte sich aber schnell erledigt, denn sie zog eine pinke Bauchtasche an ihrem Gürtel nach vorn, in der sie beides verstaute. Auf der Tasche waren fluoreszierende Katzen abgebildet. Über ihnen prangten in reflektierendem Grün die Worte I’M MEOW-GICAL.
»Neve.« Ich versuchte, nicht zu stöhnen. »Mir war nicht klar, dass wir heute einen Termin haben.«
Ihr Lächeln war blendend, als sie die Botschaft auf der Tür vorlas: »Laufkundschaft willkommen!«
»Ich wollte noch fragen, wann Olivia und ich wieder zusammenkommen«, sagte Franklin empört.
»Wir müssen uns doch etwas fürs nächste Mal aufsparen, nicht?«, fragte ich süßlich.
Er griff unsicher nach seinem Rucksack. »Du … Du erzählst doch keinem, dass ich hier gewesen bin, oder?«
Ich wies zu dem Schild über meiner rechten Schulter, Alle Legungen sind vertraulich, dann zu dem direkt darunter: Wir übernehmen keine Haftung für Entscheidungen, die Sie auf Grundlage der Legungen treffen. Dieses Schild war drei kleine Klagen zu spät angebracht worden.
»Bis zum nächsten Mal«, sagte ich mit einem Winken, von dem ich hoffte, dass es nicht halb so bedrohlich aussah, wie es sich anfühlte.
Neve übernahm Franklins Stuhl und stützte die Ellbogen auf den Tisch. Sie legte ihr Kinn in die Hand und schaute mich erwartungsvoll an.
»Na?«, sagte sie. »Wie läuft’s so? Irgendwelche interessanten Aufträge in letzter Zeit? Irgendwelche schauuurigen Flüche, die du entwirren musstest?«
Entsetzt blickte ich zur Tür, doch Franklin war schon außer Hörweite.
»Welche Fragen sollen dir die Karten heute beantworten?«, fragte ich streng.
Versehentlich hatte ich meine Arbeitshandschuhe vor zwei Wochen aus meiner Tasche hängen lassen, die aus einer speziellen Reptilienhaut namens Drachenschuppen waren. Neve hatte sie erkannt und leider die Verbindung zu meinem richtigen Job hergestellt.
Dass sie über Hollower und Magie Bescheid wusste, legte nahe, dass sie zum Cunningfolk gehörte – Menschen mit magischer Gabe. Obwohl ich sie nie an den üblichen Treffpunkten gesehen hatte.
Sie griff in die Tasche ihres zotteligen schwarzen Pelzmantels und drückte einen zerknüllten Zwanzig-Dollar-Schein auf den Tisch zwischen uns. Genug für fünfzehn Minuten.
Eine weitere Viertelstunde würde ich schaffen.
»Dein Leben ist so aufregend«, sagte Neve mit einem verträumten Seufzer, als malte sie sich aus, an meiner Stelle zu sein. »Ich habe neulich erst etwas über die Zauberin Hilde gelesen. Hatte sie ihre Zähne wirklich abgeschliffen, bis sie so scharf wie die einer Katze waren? Das kommt mir schmerzhaft vor. Wie isst man, wenn sich dauernd innen auf die Wange oder Zunge beißt?«
Ich bemühte mich, nicht genervt zu wirken, als ich mich zurücklehnte und den Timer stellte. Fünfzehn Minuten. Mehr nicht.
»Deine Frage?«, drängte ich und wickelte Myrtles Häkelschal fester um meine Schultern.
Tatsächlich bedeutete das Leben als Hollower zu achtundneunzig Prozent langweilige Recherche und zu zwei Prozent tödliche Missgeschicke, wenn man versuchte, in das Grab einer Zauberin einzudringen. Es auf leichten, verklärten Tratsch zu reduzieren, widerstrebte jeder Faser von mir.
Neve zupfte an ihrem schwarzen Shirt, sodass der darauf abgebildete pinke Brustkorb verzerrt wurde. Ihre Jeans war stellenweise eingerissen, und durch die Risse sah man die violette Strumpfhose, die sie darunter trug. »Nicht sehr gesprächig, was, Tamsin Lark? Okay, meinetwegen. Ich habe dieselbe Frage wie immer: Werde ich finden, was ich suche?«
Ich blickte wütend auf die Karten, während ich sie mischte, und konzentrierte mich auf das Gefühl, wie sie durch meine Finger glitten, anstatt auf Neves intensives Starren. So unbekümmert und redselig sie auch auftrat, waren ihre Augen doch wie dunkle Seen, die ständig drohten einen mit ihren goldenen Fäden tief nach unten zu ziehen. Sie erinnerten mich an die Tigeraugenkristalle meines Bruders, und unwillkürlich fragte ich mich, ob sie mit ihrer magischen Gabe zusammenhingen. Was mich natürlich nicht genug interessierte, dass ich es jemals ansprechen würde.
Nach siebenfachem Mischen begann ich, die erste Karte zu ziehen, aber Neve hielt meine Hand fest.
»Darf ich heute ziehen?«, fragte sie.
»Na ja … wenn du willst«, sagte ich und fächerte die Karten mit dem Bild nach unten auf dem Tisch auf. »Such dir drei aus.«
Sie ließ sich Zeit bei der Auswahl und summte leise eine Melodie vor sich hin, die ich nicht erkannte. »Was glaubst du, was die Leute tun würden, sollten sie von den Zauberinnen erfahren?«
»Was sie immer getan haben, wenn sie Hexen unter sich vermuteten«, antwortete ich trocken.
»Ich weiß ja nicht.« Neves Finger schwebten abwechselnd über jeder Karte. »Ich denke, sie würden deren Kräfte für ihre eigenen Zwecke nutzen wollen. Zauberinnen können die Zukunft genauer vorhersagen als Tarot, oder? Und Sachen finden …«
Und sie kennen tödliche Flüche, dachte ich und schaute zum Timer. Der Teil von mir, der den Verdacht hegte, dass diese Besuche der Einschätzung dienten, ob ich mich für einen potenziellen Auftrag eignete, regte sich wieder. Meistens erledigten Cabell und ich als Hollower Auftragsarbeiten, gingen in Grüfte, um nach verlorenen oder gestohlenen Familienerbstücken und Ähnlichem zu suchen.
Neve legte zwei Reihen mit je drei Karten aus und lehnte sich mit einem zufriedenen Nicken zurück.
»Ich brauche bloß eine Reihe«, widersprach ich, verstummte aber gleich wieder. Es spielte keine Rolle, womit ich diese letzten zehn Minuten totschlug. Ich schob die restlichen Karten zu einem ordentlichen Stapel zusammen. »Dann los, dreh sie um.«
Neve drehte die untere Reihe um. Das umgekehrte Rad des Schicksals, Fünf der Stäbe, Drei der Schwerter. Genervt verzog sie das Gesicht.
»Ich lese die drei Positionen als Situation, Handeln und Ergebnis«, erklärte ich, obwohl sie das bereits wusste. »Das umgekehrte Rad des Schicksals sagt, dass du in eine Situation gebracht worden bist, die du nicht kontrollieren kannst, und dass du dich mehr anstrengen musst, um deine Suche durchzuziehen. Fünf der Stäbe raten dir, die Situation auszusitzen und dich in nichts hineinzustürzen, wenn du nicht musst. Und das Ergebnis, Drei der Schwerter, ist gewöhnlich eine Enttäuschung. Also würde ich sagen, du wirst nicht finden, wonach du suchst, was aber nicht deine Schuld ist.«
Ich drehte den Kartenstapel in meiner Hand um. »Die unterste Karte – die Wurzel der Situation – ist der umgekehrte Bube der Stäbe.«
Beinahe hätte ich gelacht. Diese Karte erschien immer bei ihren Legungen; sie stand für Ungeduld und Naivität. Würde ich tatsächlich an diesen Quatsch glauben, wäre ziemlich klar, dass das Universum ihr eine Botschaft zu schicken versuchte.
»Tja, das ist nur die Meinung der Karten«, sagte Neve. »Was nicht heißen muss, dass es wahr ist. Und außerdem wäre das Leben nur halb so spaßig, könnten wir anderen nicht beweisen, dass sie falschliegen.«
»Klar«, stimmte ich zu. Die Frage brannte mir auf der Zunge: Wonach genau suchst du?
»Jetzt machen wir dich«, meinte Neve und drehte die zweite Kartenreihe um. »Mal sehen, was dir durch den Kopf gegangen ist.«
»Nein, das ist …«
Aber sie legte die Karten bereits aus: der Narr, der Turm und die Sieben der Schwerter.
»Ooooh«, sagte sie dramatisch, als sie meine Hände ergriff. »Ein unvorhergesehenes Ereignis wird dir ermöglichen, einen neuen Weg zu erkunden, aber du musst auf eine Person achtgeben, die dich betrügen will! Welche Frage ist dir denn durch den Kopf gegangen, hmm?«
»Keine Frage«, antwortete ich und zog meine Hände zurück. »Außer der, was ich heute Abend essen will.«
Lachend schob Neve ihren Stuhl zurück. Ich sah wieder zum Timer.
»Du hast noch fünf Minuten«, sagte ich.
»Schon gut. Ich habe, was ich wollte.« Sie holte ihren CD-Player aus der scheußlichen Bauchtasche und hängte sich ihre Kopfhörer um den Hals. »Hey, was hast du morgen Abend vor?«
Geld war Geld. Resigniert nahm ich das ledergebundene Buch neben mir auf. »Ich trage dich für einen Termin ein. Welche Zeit?«
»Nein, ich meine, zum Abhängen.« Als sie meinen verständnislosen Blick sah, fügte Neve hinzu: »Abhängen ist ein allgemein gängiger Ausdruck dafür, dass Leute zusammen was essen, einen Film gucken oder irgendwas anderes tun, was Spaß macht.«
Ich erstarrte. Möglicherweise hatte ich die Situation vollkommen falsch gedeutet. Meine Worte waren unbeholfen, als ich sie endlich herausbrachte. »Oh … tut mir leid … ich stehe nicht auf Frauen.«
Neves Lachen war glockenhell. »Tragisch für dich, aber du bist nicht mein Typ. Ich meinte, als Freundinnen.«
Unter dem Samttischtuch ballte ich die Fäuste. »Ich darf mich nicht mit Kunden anfreunden.«
Ihr Lächeln schwächelte für einen Moment, und ich wusste, dass sie die Lüge durchschaute. »Okay, kein Problem.«
Sie setzte sich die Kopfhörer richtig auf, als sie sich zum Gehen wandte. Der Schaumstoff verhinderte nicht, dass der wummernde Bass und das Heulen der melancholischen Gitarren nach außen drangen. Das kosmische Klagen einer Frau floss ins Zimmer, untermalt von einem zitternden Trommelschlag.
»Was für einen Höllenlärm hörst du dir da an?«, fragte ich, ehe ich mich bremsen konnte.
»Cocteau Twins«, antwortete Neve und schob ihre Kopfhörer nach oben. Ihre Augen funkelten aufgeregt. »Kennst du die? Sie sind fantastisch! Jeder Song ist wie ein Traum.«
»So fantastisch können sie nicht sein, wenn ich nie von ihnen gehört habe«, erwiderte ich. »Du solltest das leiser drehen, sonst wirst du taub.«
Sie ignorierte meinen Rat.
»Ihre Songs sind wie andere Welten.« Neve wand das Kopfhörerkabel um den CD-Player. »Ich weiß, es ist albern, aber wenn ich sie höre, ist alles andere weg. Nichts ist mehr wichtig. Man muss nichts fühlen außer der Musik. Sorry, das interessiert dich sicher nicht.«
Tat es nicht, trotzdem bekam ich ein schlechtes Gewissen. Neve ging zur Tür, gerade als Cabell sie öffnete. Er blinzelte, als sie an ihm vorbeirauschte.
»Bye!«, rief Neve, die bereits die Treppe hinunterlief. »Bis zum nächsten Mal, Orakel!«
»Eine weitere zufriedene Kundin?« Mein Bruder blieb an der Tür stehen, zog die Augenbrauen hoch und fuhr sich mit der Hand durch sein schulterlanges schwarzes Haar.
»Ja, selbstverständlich«, antwortete ich und warf Myrtles Schal ab. Nachdem ich mein wirres Haar zu einem Pferdeschwanz zurückgebunden hatte, stapelte ich die Karten säuberlich auf, schnappte mir den kleinen Samtbeutel, in dem ich sie aufbewahrte, hielt jedoch inne, als ich sah, welche obenauf war.
Die Mondkarte hatte ich noch nie gemocht. Ich konnte nicht mal erklären, warum, und deswegen hasste ich sie umso mehr. Jedes Mal, wenn ich sie sah, war es, als würde ich mir eine längst verschüttete Erinnerung wieder ins Gedächtnis rufen wollen, und dabei hatte ich noch nie irgendetwas vergessen.
Ich schaute mir die Karte näher an. Es war unmöglich zu sagen, ob das leuchtende Gesicht des Monds schlief oder nur den langen Weg unter ihm betrachtete. In der Ferne warteten neblig blaue Berge mit zwei steinernen Türmen gleich stummen Wächtern über welche Wahrheit auch immer, die hinter dem Horizont lag.
Ein Wolf und ein Hund, in Angst verbrüdert, einer wild, der andere zahm, heulten die Kugel am Himmel an. Nahe ihren Füßen krabbelte ein Flusskrebs ans Ufer.
Mein Blick fiel erneut auf den dunklen Hund, und mein Bauch verkrampfte sich.
»Wie war es heute?«, fragte Cabell, womit er meine Aufmerksamkeit wieder auf sich lenkte.
Nachdem ich mir meinen Anteil der heutigen Einnahmen genommen und den Rest im Safe eingeschlossen hatte, hielt ich zwei Hundert-Dollar-Scheine in die Höhe.
»Hey, hey! Wie es aussieht, spendierst du heute das Abendessen«, sagte er. »Ich hätte gerne den sagenhaften Lobster Larry’s Unlimited Seafood Tower.«
Mein Bruder war sehr groß, schlaksig und hatte kaum etwas auf den Rippen, schien sich aber in der üblichen Hollower-Kluft aus langen braunen Hosen und einem Gürtel voll mit den Werkzeugen, die der Job erforderte, total wohlzufühlen. Zu besagten Werkzeugen zählten unter anderem ein Handbeil, Kristalle und Phiolen mit schnell wirkenden Giften und Gegengiften.
Was man eben alles brauchte, wenn man die Gruft einer Zauberin um die Schätze erleichtern wollte, die sie dort über Jahrhunderte gehortet hatte, und einem Leib und Leben teuer waren.
»Wieso futterst du nicht gleich den Müll aus den Containern hinten?«, fragte ich. »Das Geschmackserlebnis dürfte dasselbe sein.«
»Soll das heißen, dass du noch zur Bibliothek willst und bei einigen möglichen Kunden vorbei, ehe wir uns den zehnten Abend in Folge Pizza bestellen?«
»Was ist mit dem Schlüssel für den Job von Zauberin Gaia?«, fragte ich und nahm meine Tasche auf. »Gab es da eine Entsprechung in der Bibliothekssammlung, oder musstest du doch zum Knochenschneider gehen?«
Um eine versiegelte Ader zu öffnen, einen der magischen Pfade, die Zauberinnen für sich geschaffen hatten, brauchten wir Knochen und Blut von einer, die an der Konstruktion beteiligt war, oder von einer ihrer Nachfahrinnen. Diese würde der Knochenschneider auftreiben.
»Ich musste ihn fragen«, sagte er und gab mir den Schlüssel. Er sah aus wie zwei Fingerknochen, die mit einer Goldnaht zusammengeschmolzen worden waren. »Wir können das Grab am Wochenende öffnen.«
»O Mann«, murmelte ich. »Was hat uns der Schlüssel gekostet?«
»Nur das Übliche«, antwortete er mit einem Schulterzucken. »Einen Gefallen.«
»Wir können nicht immer weiter Gefallen verteilen«, sagte ich angespannt und schaltete schnell die Musik und die LED-Kerzen aus.
»Warum nicht?« Er lehnte sich an den Türrahmen.
Die kleinen Bewegungen und sein gleichgültiger Ton erschreckten mich. Noch nie hatte er mich mehr an Nash erinnert, den Betrüger, der uns widerwillig aufgenommen und in seinen Beruf reingezogen hatte, um uns dann mit gerade mal zehn Jahren im Stich zu lassen.
Cabell blickte sich im Raum um. »Du musst diesen Bullshit hier aufgeben, wenn du den Knochenschneider nächstes Mal in barer Münze bezahlen willst.«
Irgendwie waren wir schon wieder bei diesem nervigen Thema gelandet. »Dieser ›Bullshit‹ kauft uns Essen und zahlt unser Dach über dem Kopf. Du könntest ja um mehr Schichten im Tattoo-Studio bitten.«
»Du weißt, dass ich das nicht meine.« Cabell stieß ein ärgerliches Schnauben aus. »Wären wir nur hinter legendäre Reli…«
»Würden wir einfach ein Einhorn finden«, fiel ich ihm ins Wort. »Würden wir nur eine versunkene Piratenschatztruhe finden. Könnten wir nur einen fallenden Stern einfangen und in die Tasche stecken …«
»Schon gut«, sagte Cabell und sein Lächeln verblasste. »Es reicht. Ich hab’s verstanden.«
Wir waren nicht wie die anderen Hollower und Nash, wir jagten keine Träume. Klar, ein legendäres Objekt auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen, konnte Tausende einbringen, wenn nicht Millionen, aber es kostete jahrelanges Suchen nach einer sich stetig verringernden Zahl von Reliquien. Die Magienutzer aus anderen Teilen der Welt hatten sich ihre Schätze gesichert, sodass nur noch Europa zu haben war. Und wir hatten sowieso nicht die richtigen Ressourcen für einen großen Fund.
»Echtes Geld kommt von echten Jobs«, erinnerte ich Cabell. Und, ob es mir gefiel oder nicht, Mystic Maven war ein richtiger Job, mit flexiblen Arbeitszeiten und fairem Lohn, der unter der Hand gezahlt wurde. Wir brauchten ihn, um uns die Auftragsarbeit leisten zu können, die wir am Schwarzen Brett in der Bibliothek der Gilde fanden, zumal die Angebote da immer dünner wurden und die Kunden immer weniger Finderlohn bezahlen wollten.
Mystic Maven mochte eine Touristenfalle mit fischig riechendem Esoterikunsinn sein, aber der Laden gab uns das, was wir noch niemals zuvor gehabt hatten: Stabilität.
Nash hatte uns nie an einer Schule angemeldet. Er hatte uns auch nie falsche Papiere machen lassen – den beiden Waisen, die er an unterschiedlichen Enden der Welt eingesammelt hatte, als wären wir nur zwei weitere Ergänzungen seines blöden Sammelsuriums. Was wir hatten, war die verborgene Welt der Hollower und Zauberinnen. Wir waren auf dem Schoß der Missgunst aufgewachsen, gefüttert von der Hand des Neids und geborgen unter dem Dach der Gier.
Nash hatte uns nicht nur beide in diese Welt gezwungen – er hatte uns zu ihren Gefangenen gemacht.
Mir gefiel das Leben, das wir uns selbst eingerichtet hatten, dieses kleine Maß an Stabilität, das wir uns zusammenkratzten, weil wir jetzt älter waren und für uns selbst sorgen konnten.
Leider wollte Cabell, was Nash hatte: die Möglichkeiten, den Ruhm, den Rausch eines Funds.
Er kniff den Mund zusammen und kratzte sich am Handgelenk. »Nash hat immer gesagt …«
»Nein«, warnte ich ihn. »Komm mir nicht damit!«
Cabell zuckte zusammen, und ausnahmsweise war es mir gleich.
»Warum machst du das immer?«, fragte er. »Du fährst mir über den Mund, sobald ich ihn erwähne.«
»Weil er den Atem nicht verdient, den es kostet, seinen Namen zu nennen«, entgegnete ich.
Ich hängte mir meine Ledertasche über und rang mir ein Lächeln ab. »Komm, wir schauen kurz nach Arbeit in der Bibliothek, und danach gehen wir bei Zauberin Madrigal vorbei, um ihr die Brosche zu geben.«
Cabell erschauderte, als ich den Namen der Zauberin nannte. Der Fairness halber musste man sagen, sie war bei unserem Gespräch derart auf ihn fixiert gewesen, dass es uns beiden Angst gemacht hatte, und das noch bevor sie beschloss, einen Schweißtropfen von seiner Wange zu lecken.
Ich schloss ab und folgte Cabell die knarzende Treppe hinab und nach draußen in den belebten Abend. Überall waren Touristen, fröhlich und mit geröteten Wangen von der frischen Frühherbstluft.
Etliche Male vermied ich es gerade so, mit mehreren von ihnen zusammenzurempeln, als sie die Hälse reckten, um am Quincy-Market-Gebäude hinaufzuglotzen. Was für ein Anblick, wie sie sich für Fotos vor Restaurants zusammenlehnten, Apple-Cider-Donuts aßen und Buggys mit schlafenden Kindern übers Kopfsteinpflaster in Richtung ihrer Hotels schoben!
Es war die Vision von einem Leben, das ich nie gekannt hatte und nie kennen würde.
Schallendes Gelächter empfing uns, als wir das Atrium unserer Gildebibliothek betraten, worauf meine Haut so kalt wie die Marmorwände wurde.
Feiern der Hollower gingen nie gut aus, vor allem nicht so nahe an Mitternacht, wenn die Flüche heftiger wurden und das Urteilsvermögen von Alkohol getrübt war.
Jetzt wünschte ich mir, wir wären irgendwo essen gegangen und nicht zum Beacon Hill gewandert, wo die Bibliothek in einem unauffälligen Stadthaus untergebracht war.
»Mist«, sagte ich. »Perfektes Timing.«
»Du hast echt ein Gespür dafür, immer auf die Leute zu treffen, die du am wenigsten sehen willst«, kommentierte Cabell. »Es ist, als wollte dir die Bibliothek etwas mitteilen.«
»Dass ich einen Weg finden muss, ihnen die Schlüssel zu stehlen, damit sie nicht wieder reinkommen?«
Cabell schüttelte den Kopf. »Wann siehst du ein, dass Leute wegzustoßen, immer nur auf eine Art endet? Damit, dass du allein bist.«
»Du meinst, glücklich bis ans Ende meiner Tage?«, konterte ich und vergewisserte mich, dass die Tür hinter mir fest verschlossen war.
Die Allwegetür war vor über hundert Jahren aus der Gruft einer mächtigen Zauberin entfernt und hier eingesetzt worden, als unsere Hollower-Gilde gegründet wurde. Anders als die Knochenknäufe, die benutzt wurden, um ein Ende einer bestimmten Ader mit einem anderen zu verbinden, erlaubte die Allwegetür den Zugang zu einer endlosen Zahl von temporären Pfaden. Sie brachte einen zu jedem Ort, den man sich ausmalen konnte, solange man eine Kopie des zu ihr gehörenden Messingschlüssels besaß.
Cabell und ich hatten unseren Mitgliedsschlüssel von Nash geerbt, der ihn bekam, als er nicht gerade mit offenen Armen in der Gilde aufgenommen wurde. Seine erforderliche Spende – das Schild des Aeneas – war jedoch eine hinreichend beachtliche Reliquie, sodass die anderen Gildemitglieder gewillt waren, seinen zwielichtigen Ruf zu übersehen.
Das Problem mit der Allwegetür war, dass die Bibliothek zum Zwangsstopp wurde, egal wohin man wollte. Wir könnten natürlich zur Bibliothek gehen und warten, dass Bibliothekar auf uns aufmerksam wurde und uns die geheime Tür öffnete. Aber einfacher war es, wie es die meisten Mitglieder handhabten – die Allwegetür zu nutzen. Da musste man nur seinen Mitgliedsschlüssel in irgendein Schloss in der Nähe stecken, die Tür öffnen und binnen Sekunden war man dort. Wir nutzten meist das Schloss am Wäscheschrank in unserer North-End-Wohnung. Waren wir erst in der Bibliothek, konnten wir den Schlüssel an der Allwegetür nutzen und wieder auf dieselbe Weise weiter, wohin auch immer wir wollten.
Wir würden auf dem Rückweg wieder hierdurch kommen, und mir wurde jetzt schon schlecht bei dem Gedanken, noch mal auf diese Versammlung zu treffen.
Die Anspannung in Cabells Gesicht löste sich ein wenig, als er sich zurücklehnte und zu dem langen, polierten Korridor blickte, der zum Hauptsaal der Bibliothek führte. Der warme Kerzenschein war wie eine Einladung und ließ die weißen Flecken im Steinboden wie eine Sternenspur leuchten.
»Es ist doch nicht Freitag, oder?«, fragte ich. Freitags abends tranken die Hollower und prahlten mit den Reliquien, die sie gefunden, und den Grüften, die sie überlebt hatten. Meine Hoffnung, kurz Hallo zu Bibliothekar zu sagen, bevor wir gingen, zerrann wie Sandkörner durch die Finger.
»Dienstag. Aber wie es aussieht, sind Endymion Dye und seine Crew von ihrer Expedition zurück«, bemerkte Cabell.
Ich hasste mich für meine selbstzerstörerische Neugier, trotzdem blickte ich kurz hin. Und tatsächlich stand dort Endymion Dye an einem der Arbeitstische, umgeben von lauter schnatternden Gildemitgliedern, die sich überschlugen, ihn zu loben. Sein reinweißes Haar verblüffte mich immer wieder, egal wie oft ich ihn sah. Vor drei Jahren war es das Abschiedsgeschenk eines Fluchs gewesen.
Mein Kiefer verkrampfte sich. Da war etwas Beunruhigendes an ihm, und es hatte nichts mit seinem obszönen Reichtum oder dem Umstand zu tun, dass seine Familie die Gilde gegründet hatte und er deshalb die Regeln bestimmte; nicht einmal mit den stechenden grauen Augen, die direkt in einen hineinzusehen schienen. Er strahlte eine Unnahbarkeit aus, als verdiente keiner von uns das Privileg, seine wahren Gefühle oder Absichten zu kennen.
Sogar Nash, der jede Katastrophe weggelacht hatte, machte einen großen Bogen um Endymion. Der Typ hat irgendeine üble Scheiße am Laufen, Tamsy, hatte er gesagt, als wir Endymion auf dem Weg zu dem einzigen Gildetreffen begegneten, das Nash je mit seiner Anwesenheit beehrte. Halt dich fern von ihm, verstanden?
Die wenigen Male, die ich Endymion gesehen hatte, war er immer so makellos aufgetreten, dass es beinahe surreal war, ihn jetzt voller Staub und Schmutz von einer kürzlichen Expedition zu erleben.
Allerdings war er nicht halb so nervig wie sein Sohn Emrys. Wenn der jüngere Dye nicht gerade das Erbe verpulverte, das kein Siebzehnjähriger verdiente, oder damit angab, welche Reliquie er und sein Vater gefunden hatten, schien sein einziger Existenzgrund der zu sein, mich in den Wahnsinn zu treiben.
»Trustfund siehst du nicht, oder?«, fragte ich.
Cabell lehnte sich wieder in den Korridor. »Nein. Hm.«
»Hm was?«
»Komisch, dass sein Vater ihn nicht mitgenommen hat«, meinte Cabell. »Und ich habe ihn schon seit Wochen nicht mehr hier gesehen. Vielleicht ist er wieder auf irgendeinem Schickimicki-Internat.«
»Wäre zu schön, um wahr zu sein.« Es bestand null Chance, dass Emrys die Jagd nach Reliquien auch nur zeitweise aufgeben würde.
Endymion ignorierte das Geplapper der Hollower, und sein Blick war von der Feuerspiegelung auf seinen Brillengläsern verborgen.
Cabell legte eine Hand auf meinen Kopf und sagte: »Warte hier. Ich hole die Auftragsangebote, dann musst du dich nicht mit denen rumschlagen.«
Ich griff nach der Tasche, die Cabell sich über die Schulter gehängt hatte, und war unendlich erleichtert. »Danke. Mir sind für heute die schlagfertigen Erwiderungen ausgegangen.«
Dann lehnte ich mich an die kalte Steinwand und hörte zu, wie die anderen Cabell so überschwänglich begrüßten, als wäre er ihr verlorener Sohn. Kaum hatten sie sich mit seinen Tattoos und seiner Einsamer-Wolf-Ausstrahlung arrangiert, hatten sie Cabell herzlich aufgenommen. Sein tiefes Lachen und die fesselnde Art, Geschichten zu erzählen, die er von Nash gelernt hatte, überwogen fast seine bedauernswerte Nähe zur Lark-Familie.
Doch jedes Mal, wenn er zu den Treffen ging, musste ich mir auf die Zunge beißen, um ihn nicht daran zu erinnern, dass sie uns hinter unserem Rücken immer noch die Larcenies nannten – Diebe.
Was mich eventuell beleidigt hätte, wäre es tatsächlich eine einfallsreiche Kränkung gewesen.
Sie respektierten ihn nicht, und ihnen war völlig egal, ob er lebte oder starb. War es schon immer gewesen. Als wir Kinder waren und Hilfe brauchten, war von dem sogenannten Zusammenhalt der Gilde nichts zu spüren gewesen.
Das war die erste Lektion, die Nash mich gelehrt hatte: Die Leute kümmerten sich nur um sich selbst, und wollte man überleben, musste man es genauso tun. Zumindest in dieser Hinsicht waren die Zauberinnen ehrlich und gaben nicht vor, sich für irgendjemand anderen zu interessieren außer sich selbst.
Cabell kam zu mir zurückgelaufen und hielt drei Auftragsangebote in der Hand, alle in der smaragdgrünen Tinte von Bibliothekar geschrieben. »Ein paar gute, glaube ich.«
Ich nahm alle drei und schaute nach den Namen derer, die Sachen zurückgeholt haben wollten. Die meisten schienen Cunningfolk zu sein. Gut. Wir brauchten eine Pause von Zauberinnen.
Eine neue Welle von Jubel bewirkte, dass ich wieder zum Saal schaute.
Endymion wickelte seinen Fund extralangsam aus. Mit einem dramatischen Schwenk, dem diese Leute schlicht nicht widerstehen konnten, obwohl er bedeutete, grob mit unbezahlbaren Artefakten umzugehen, ließ er die Reliquie auf den Tisch fallen. Der Knall hallte durch die Bibliothek.
Das große Buch war ledergebunden und der Einband rissig von Alter und Hitze. Die dicken Seiten mit Silberrand sahen aus, als hätten sie die letzten paar Jahrhunderte mit Fluchtversuchen verbracht. Einzig ein schweres Metallschloss mit dem Baumsymbol Avalons hielt alles zusammen.
Ein bohrender Neid regte sich in mir, den ich höllisch hasste.
»Die Unvergänglichkeit von Callwen …«, sagte ich. Eine Sammlung der Erinnerungen einer Zauberin, bei ihrem Tod in ihrem Blut niedergeschrieben. Zwar war es heute allgemein üblich, dass Zauberinnen diese Memoiren verfassten, aber die hier waren angeblich die ältesten.
Die Bibliothekskatzen, die sich in den oberen Regalen versteckten, fauchten, als sie die in den Wälzer eingewobenen Flüche spürten. Es klang wie das Zischen von Regentropfen, die auf ein heißes Blechdach fielen.
Die anderen Hollower schlugen mit den Fäusten auf die Tische. Mein Puls war schneller als der wilde Takt, als ich zur Allwegetür schaute.
»Na gut«, sagte ich und steckte unseren Schlüssel in das Schloss. »Wohin zuerst?«
Nach einem stundenlangen Zickzack zwischen Boston, Savannah, Salem und St. Augustine hatten wir alle drei Jobs gestrichen. Zwei waren von einem anderen Hollower aus einer anderen Gilde erledigt worden, und bei dem dritten hatte die Kundin gehofft, uns mit ihrer umfangreichen Knopfsammlung bezahlen zu können.
Nun blieb nur noch, unseren Auftrag von der Zauberin Madrigal abzuschließen.
»Ich meine ja bloß, dass diese Perlenknöpfe ziemlich hübsch waren«, fuhr Cabell fort, der den abendlichen Menschenströmen im French Quarter von New Orleans auswich.
»Die waren wie Sterne geformt«, erwiderte ich mit einem Naserümpfen.
»Stimmt, ich nehme alles zurück«, sagte Cabell. »Sie waren nicht hübsch, sondern bezaubernd. Ich denke, sie würden dir gut stehen …«
Ich rempelte ihn mit der Schulter an und verdrehte die Augen. »Jetzt weiß ich, was ich dir zu Weihnachten schenke.«
»Aha.« Cabell blickte zu den gusseisernen Balkongeländern über uns. Ein schmaler Mond beleuchtete New Orleans in all seiner Pracht und schien tiefer als sonst zu hängen.
»Warum wohnen wir nicht hier?« Er seufzte glücklich.
Ich könnte ein Dutzend Gründe nennen, aber nur einer zählte: Boston war unser Zuhause; das einzige, das wir jemals gehabt hatten.
Instinktiv wurden wir beide langsamer, als wir uns einer unscheinbaren Seitenstraße näherten. Ein efeuberanktes schwarzes Haus erwartete uns am Ende der Gasse, direkt hinter dem letzten bernsteingelben Lichtkegel einer Straßenlaterne.
Das schwarze Tor von Rook House öffnete sich quietschend von allein, als wir näher kamen. Weißdornbeeren lagen auf dem gewundenen Weg zur vorderen Veranda verstreut. Ich hielt den Atem an, doch ihr fauliger Gestank kroch mir trotzdem in die Nase und blieb dort.
Das schmerzhafte Pochen meines Herzens an meinen Rippen weckte die Erinnerung daran, wie ich vor anderen Häusern wie diesem gewartet hatte, Cabells kleine Hand fest umklammernd und betend, dass Nash, der drinnen mit der Zauberin verhandelte, sich nicht umbringen ließ.
»Bist du sicher, dass du die Brosche hast?«, fragte Cabell, obwohl er es wusste.
»Mir passiert nichts«, antwortete ich.
»Ich kann echt mitkommen«, sagte er und blickte ungewöhnlich nervös zu dem Haus.
Ich zog ein schwarzes Ledernotizbuch aus meiner Arbeitstasche und drückte den abgegriffenen Einband an seine Brust. »Probier ein paar mögliche Schlüsselwörter, solange du wartest.«
Nashs Notizbuch, das er zurückgelassen hatte, enthielt ein chaotisches Durcheinander aus Geschichten und Notizen über Reliquien, Legenden und die Magienutzer, die im Laufe der Jahre seinen Weg gekreuzt hatten. Da er wahrscheinlich wusste, dass seine jungen Schützlinge es lesen würden, hatte er einige Einträge in einem Code verfasst. Wir hatten das Schlüsselwort geknackt, um die meisten Einträge zu entziffern, aber der letzte, den er kurz vor seinem Verschwinden geschrieben hatte, war uns seit Jahren ein Rätsel.
Cabell nahm das Buch, war jedoch immer noch beunruhigt.
»Ich bin dran«, sagte ich. Wenn wir Sachen an Zauberinnen auslieferten, blieb stets einer von uns draußen, für den Fall, dass der andere drinnen mit einer Kundin gefangen war, die sich zu zahlen weigerte. Ich drückte seinen Arm. »Ich beeil mich, versprochen. Hab dich lieb.«
»Stirb nicht«, entgegnete er und lehnte sich mit einem letzten Seufzer an den Zaun.
Das Haus der Zauberin Madrigal schien unter seiner eigenen Kälte zu frösteln. Die Fensterscheiben klapperten wie Zähne in ihren Rahmen, und die Knochen aus rissigem Marmor und Eisen ächzten im Wind.
Ich musterte die Front des alten Hauses, als ich auf die durchhängende Veranda zuging.
»Na gut«, flüsterte ich und straffte die Schultern. »Bloß eine Lieferung. Die Bezahlung holen und raus da.«
Ich recherchierte grundsätzlich zu unseren Kunden, bevor ich mich mit ihnen traf, denn auf diese Weise erhöhte ich unsere Chance erheblich, einen Job zu bekommen und es lebend aus dem Treffen zu schaffen. Doch in der Gildebibliothek war so gut wie nichts über Madrigal zu finden gewesen, und auch Nashs Notizbuch war nur wenig hilfreich gewesen.
Madrigal – Älteste, Meisterin der Elemente. Keine bekannte Verwandtschaft. Nie eine Einladung zum Dinner annehmen.
Ihr Auftrag hatte monatelang unangerührt am Schwarzen Brett in der Gilde gehangen, bis ich den Mut aufbrachte, ihn anzunehmen.
Meine Faust schloss sich fester um die Brosche in ihrem Samtbeutel. Die Verhandlungen zu diesem Job hatten mich beinahe die Nerven verlieren lassen, und jetzt war ich wieder angespannt, als ich alle Möglichkeiten durchging, sollte etwas schiefgehen. Die gruselige Wahrheit war, dass wir herzlich wenig tun könnten, sollte Madrigal sich weigern, unseren Vertrag einzuhalten und zu bezahlen. So war es eben, wenn man mit mächtigeren Wesen zusammenarbeitete; ihre Launen waren so unberechenbar wie Feuer, und man musste immer auf die nächste Verbrennung gefasst sein.
Die Tür ging auf, ehe ich die Hand heben und läuten konnte.
»Guten Abend, Miss.«
Der Gefährte der Zauberin füllte den großen Türrahmen fast vollständig aus. Er war unglaublich groß und seine Schultern waren so breit wie die Straße. »Dearie« nannte sie ihn, und ich hielt es für sicherer, nicht zu fragen, ob es sein richtiger oder ein Kosename war.
Er verneigte sich, als ich näher trat. Seine Züge waren so unlesbar wie bei meinem ersten Besuch. Eine Ledermaske bedeckte seine obere Gesichtshälfte wie die Haube eines Falken, beschattete seine Augen, und er hatte seinen massigen Körper in eine edle, altmodische Butler-Uniform gezwängt.
»Wenn Sie so freundlich wären, mir zu folgen, Miss.« Sein Akzent war eigenartig, auf eine Weise melodisch, die nicht ganz menschlich klang und es vermutlich auch nicht war. Obwohl sie heute in unserer Welt selten waren, banden Zauberinnen oft magische Kreaturen für ihr Leben an sich, um ihnen zu dienen.
Der Gefährte trat zurück in den Schatten hinter ihm. Der Geruch von warmem Wachs und Kerzenrauch waberte mir entgegen, als ich an ihm vorbeiging. Die goldene Anstecknadel an seinem Revers, eine Schachfigur mit einem gehörnten Mond darüber – das Zeichen der Zauberin Madrigal –, funkelte im Licht eines nahen Armleuchters.