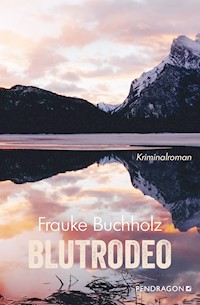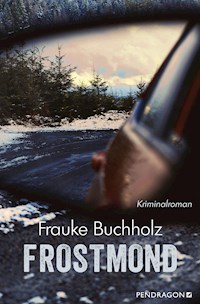Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pendragon
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Nach »Frostmond« und »Blutrodeo« nun der dritte Teil der preisgekrönten Trilogie um Ted Garner. Nachdem ihn sein letzter Fall beinahe das Leben kostete, beschließt der kanadische Profiler Ted Garner den Polizeidienst zu quittieren und eine psychotherapeutische Praxis zu eröffnen. Bei einem Therapeutenkongress lernt er Dr. Hofstätter kennen und lässt sich von ihr zu einer nächtlichen Zeremonie mit einem indigenen Medizinmann überreden. Nach einem Horrortrip erwacht Garner in einem einsamen Tipi. Neben ihm eine skalpierte Leiche, in seiner Hand ein blutiges Messer. Anstatt sich zu stellen, lassen ihn Zweifel und Misstrauen selbst ermitteln. Die Spur führt ihn immer tiefer in die kanadische Wildnis von British Columbia und die indigene Welt. Doch die Polizei ist ihm dicht auf den Fersen. Ted Garner, ein geachteter Profiler der Royal Canadian Police, ermittelt in Mordfällen, die ihn von großen Metropolen, durch ungezähmte Wildnis, bis in die Reservate der indigenen Stämme führen. Dabei muss er sich nicht nur mit Kriminellen auseinandersetzen, sondern auch mit seinen eigenen Abgründen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frauke Buchholz
SKALPJAGD
PENDRAGON
Das Leben ist nur ein Traum und der Tod das Große Erwachen
Arthur Schopenhauer
Inhalt
Prolog
Ted Garner: 21. September, Vancouver
Frank Lombardi: 22. September, Vancouver
Ted Garner: 22. September, Vancouver
Frank Lombardi: 25. September, Vancouver
Ted Garner: 26. September, Vancouver
Frank Lombardi: 27. September, Vancouver
Ted Garner: 27. September, Vancouver Island
Frank Lombardi: 28. September, Vancouver
Ted Garner: 28. September, Tofino
Frank Lombardi: 28. September, Vancouver
Ted Garner: 28. September, Meares Island
Frank Lombardi: 29. September, Vancouver
2018: Golanhöhen bei Khan Arnabah, Syrien
Frank Lombardi: 29. September, Vancouver
Ted Garner: 29. September, Fraser River in der Nähe von Chilliwack
Frank Lombardi: 29. September, Meares Island
Ted Garner: 29. September, Lucky Star Indian Casino
2018: Ziv Medical Center Safed, Israel
Ted Garner: 30. September, Stó:lo Indian Reservation
Frank Lombardi: 30. September, Tofino
Indian Summer: East Hastings Street Vancouver
Ted Garner: 30. September, Stó:lo Indian Reservation
Frank Lombardi: 3. Oktober, Mount St. Josephs Hospital Vancouver
Epilog
Prolog
Das grelle Flimmern und elektronische Geplärre der Slotmaschinen und einarmigen Banditen geht ihm auf die Nerven. Razor Shark, Book of Ra, Eye of Horus. Ab und an das aufreizende Geklimpere von Münzen, die ausgespien werden wie Steine eines eruptierenden Vulkans. Kristalllüster aus rotem Glas tauchen den Raum in ein lasziv wirkendes Halbdunkel, und der weiche Teppich verschluckt seine Schritte. An den Blackjack-, Poker- und Roulettetischen sitzen Gruppen von Spielern, die so konzentriert auf die mit grünem Filz belegten Tischplatten starren, als hinge ihr Leben davon ab. Ein dunkelhäutiger Croupier in weißem Hemd, Fliege und roter Seidenweste fegt mit einem filigranen Schieber Jetons zusammen, um sie gleich wieder an die Zocker, die wie hungrige Raubtiere nach den bunten Plastikchips greifen, zu verteilen. Fiebriges Setzen, das Drehen des Kreisels schwindelerregend wie der Rock eines tanzenden Derwisches. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Obwohl er die Kapuze tief ins Gesicht gezogen hat und wie immer eine Sonnenbrille trägt, hat er das Gefühl, dass alle ihn anstarren.
Etwas explodiert, explodiert in seinem Kopf, rasender Schmerz, dunkel, alles dunkel. Es schreit aus ihm heraus, spitz, schrill, Schreie, die nichts Menschliches haben. Ein metallischer Geschmack im Mund. Sein Mund? Wo ist sein Mund? Hände, die ihn wegzerren. Rot schwarz rot schwarz. Blut und Staub. Russisches Roulette. Razor Shark, Book of Ra, Eye of Horus. Sein Leben am seidenen Faden. Etwas rattert. Motorenlärm. Die Ladefläche eines Jeeps. Unerträglich. Dieser Schmerz. Lasst mich sterben. Bitte.
Er durchquert den Raum wie ein feindliches Minenfeld, die Hand an der entsicherten Glock. Vor ihm zwei Türen. Toiletten und Privat. Zutritt verboten. Er blickt zurück über die Schulter. Niemand hat ihn bemerkt. Er ist ein Zombie. Sie nennen ihn Il Bracco. Der Spürhund, der lautlos Witterung aufnimmt und das Terrain erkundet. Im Auftrag der 6. Familie. Er drückt die Klinke der zweiten Tür hinunter. Ein Gang, Neonröhren unter der Decke, weiß getünchte Wände.
Das Licht zu grell. Weiße Gestalten, die lautlos umherhuschen. Hände, die ihn sanft berühren. Weißer Mull. Gaze so fein wie ein Leichentuch. Dann wieder dunkel. Bin ich gestorben? Wo bin ich?
Er folgt dem Gang, bis er zu einer weiteren Tür gelangt. Er hält die Glock im Anschlag und tritt ein, ohne zu klopfen. Ein Mann sitzt hinter einem Schreibtisch und starrt auf einen Monitor. Er sieht fremdländisch aus, schwarzes Haar, olivfarbene Haut, geschmeidig, fast wie Rocco, kantiges Gesicht. Anfang vierzig. Zu jung zum Sterben. Der Mann hebt den Blick und sieht ihn an. Augen wie Pfeile. Nicht die Spur von Angst.
„Wer bist du?“
Notaufnahme Ziv Medical Center Safed. Blank geputzte Liegen. Kinder ohne Arme und Beine. Blinde Männer auf Krücken. Durchsiebte Körper. Fassbomben. Streumunition. Das israelische Militär hat ihn auf der syrischen Seite des Grenzzauns gefunden. Sie haben ihn abgelegt wie eine tote Katze. Die Behandlung ist kostenlos. Der Pfleger heißt David. Niemand fragt, wer er ist.
Er richtet die Glock auf das Gesicht des Mannes. Bei einer M16 oder einer Kalaschnikow reicht ein Schuss. Nase, Mund. Alles weg. Er kennt sich aus. Der Mann blickt so ungerührt wie die Sphinx. Ein Spiegel ohne Regung. Scheint unbewaffnet. Er senkt die Glock und verzieht die ledrigen Lippen zu einer Art Lächeln. Es schmerzt noch immer. Das Gewebe aus seinem Oberschenkel geschnitten.
„Mein Boss will dir ein Angebot machen.“
Sie operieren die Kugeln aus den Resten seines Gesichts. Nur die Augen sind noch heil. Alle Spiegel abgehängt. Miriam wickelt die Mullbinden ab. Es gibt plastische Chirurgie, sagt sie. Er hat kein Geld. Miriam ist Ärztin. Sie ist schön. Er wird nie mehr eine Frau küssen. Er ist erst achtundzwanzig.
„Wer ist dein Boss?“
„Er hat keinen Namen. Du solltest sein Angebot nicht ablehnen.“
„Ich bin mein eigener Boss.“
„Du täuschst dich.“ Er legt den Umschlag auf den Tisch. „Ich komme wieder.“
„Fuck off.“
Schwarzer Hass, blinde Wut. Dunkel, alles dunkel. Wagner zahlt keine Entschädigung für seine Söldner. Er hat zwei Jahre in Syrien gekämpft. Für oder gegen was ist egal. Töten für Geld. Der Preis zu hoch. Seine Mutter tot, seinen Vater kennt er nicht. Tel Aviv – New York. Am Flughafen endlose Passkontrollen. Erschrockene Blicke. Wie er sie hasst. Die Bruchbude in der Bronx. Spieglein, Spieglein an der Wand. Ein Scheusal blickt zurück.
Er hebt die Glock und zielt. Er verspürt eine unbändige Lust, mitten in das Gesicht zu schießen. Diese scheiß dunklen Augen, noch immer ohne Angst. Unergründlich. Speere, die ihn in das Zeitloch stoßen. Alles, was er ist, verdankt er Rocco und der 6. Familie. Sie haben ihn aufgelesen wie einen streunenden Hund. Sie haben seinen Wert erkannt. Seine Skrupellosigkeit, seinen Hass, seine Grausamkeit. Sie bezahlen seine OPs. Er ist ein Söldner in ihren Diensten, und er ist loyal, solange er sein Geld erhält.
Er reißt sich zusammen und wendet sich zum Gehen. Er hat seinen Auftrag fürs Erste erledigt. Doch man sieht sich stets zweimal, und die 6. Familie schließt dich in ihre Arme oder vernichtet dich.
Ted Garner
21. September
Vancouver
„Lassen Sie mich meinen Vortrag mit einem Zitat des berühmten amerikanischen Psychotherapeuten Peter Levine beginnen: ‚Ein Trauma ist eine innere Zwangsjacke, die so überwältigend und verheerend ist, dass die Person innerlich erstarrt und diesen Augenblick sozusagen einfriert und mit sich trägt.‘“ Dr. Claudia Hofstätter machte eine bedeutungsschwangere Pause und blickte ernst ins Publikum. Garner hatte das seltsame Gefühl, dass ihre Augen hinter den Brillengläsern genau in seine tauchten, bevor sie mit ihren Ausführungen fortfuhr. „Wenn Menschen sich so bedroht fühlen, dass sie überwältigt sind, erstarren sie in Angst. Dabei ist die Dissoziation ein typisches Merkmal von Traumata. Gedanken, Gefühle, Empfindungen, Erinnerungen oder Handlungen, die üblicherweise miteinander verbunden sind, werden abgespalten und …“
Wie so oft in den letzten Wochen, drifteten Garners Gedanken ab, und er fiel in eine Leere, die so abgrundtief war wie der Tod. Auf der Beerdigung seines Vaters vor fünf Wochen hatte er Pat hoch und heilig versprochen, endgültig aus dem Polizeidienst auszusteigen, obwohl er einer der erfolgreichsten Profiler der Royal Canadian Mounted Police war. Doch die vernarbten Brandwunden an seinem Körper erzählten ihre eigene Geschichte. Bei seinem letzten Fall wäre er beinahe draufgegangen. Er und sein Vater waren in die Hände zweier gefährlicher Psychopathen geraten, und obgleich Garner sein Leben riskiert hatte, um ihn zu retten, war der Colonel im Hospital seinen schweren Verletzungen erlegen, ohne noch einmal das Bewusstsein erlangt zu haben. Pat hatte recht. Er trug Verantwortung für seine Frau und die beiden Söhne. Er würde seine tiefenpsychologischen Kenntnisse auffrischen und in Regina eine eigene Praxis eröffnen. Der internationale Therapeuten-Kongress in Vancouver hatte hochkarätige Koryphäen aus aller Welt angezogen, und Garner zwang sich, die dunklen Erinnerungen beiseitezuschieben und dem Vortrag zu folgen.
„Das Trauma unterdrückt die Entfaltung des Lebens und erstickt unsere Versuche, mit unserem Leben voranzuschreiten. Es unterbricht die Verbindung zu uns selbst, zu anderen Menschen, zur Natur und zu unserer geistigen Quelle.“
Dr. Hofstätters sanfte Stimme mit dem leichten österreichischen Akzent lullte Garner ein, und er verspürte wieder die bleierne Müdigkeit. Er war seit drei Tagen in Vancouver. Tagsüber versuchte er, sich auf die Präsentationen der Referenten zu konzentrieren, doch bereits nach kurzer Zeit überfiel ihn stets eine dumpfe Trägheit, die sein Hirn lahmzulegen schien. Wenn er am späten Nachmittag in sein Hotelzimmer zurückkehrte, starrte er stundenlang aus dem Fenster der siebten Etage. Ein nebelgrauer Himmel, aus dem ein ständiger Nieselregen in hauchdünnen Strichen fiel. Westküstenwetter. Obwohl es erst Spätsommer war, regnete es seit seiner Ankunft unaufhörlich. Tief unten der hellbraune Sand des Kitsilano Beach mit seinen im Wind flatternden Volleyballnetzen und verlassenen Deckchairs, hinter der sanft gekräuselten Wasserfläche des Pazifiks die sattgrüne Kette der Coast Mountains. Ein Bilderbuchpanorama. Eigentlich. Doch Garners Blick ging ins Leere und verlor sich in den unterschiedlichen Schattierungen von Himmel und Meer, bis das Grau in ein dunkles Anthrazit überging, und er in seinem einsamen Bett einer weiteren schlaflosen Nacht entgegensah. Viel quälender als die frisch verheilten Brandwunden an seinem Körper war der bohrende Zweifel, ob und wenn ja welche Schuld sein Vater auf sich geladen hatte, doch er würde es nie mehr erfahren.
Der aufbrausende Applaus im Saal holte Garner mit einem Ruck zurück in die Wirklichkeit. Dr. Hofstätter lächelte, packte ihre Papiere zusammen und verließ das Rednerpult. Auch dieser Vortrag war an ihm vorbeigerauscht. Seine Seele war eine hohle Schale. Garner beschloss, sie heute Abend mit Whiskey zu füllen.
Während er inmitten einer dichten Menschentraube aus dem Saal Richtung Treppenhaus strömte, fühlte er sich wie ein Lemming vor dem Abgrund. Er musste sich zusammenreißen und auf den Neustart seines Lebens konzentrieren. Nach vorne blicken. Positiv denken. Die unheilvollen Gedankenketten durchbrechen. Therapierte er sich gerade selbst? Die Vortragsräume lagen im Erdgeschoss des Kongresshotels, und während Garner, eingezwängt zwischen angeregt schwatzenden Teilnehmergrüppchen, auf den Lift nach oben wartete, beschloss er, aus seinem einsamen Zimmerkäfig auszubrechen und den Abend in der Hotelbar zu verbringen. Unter die Leute gehen. Partylöwe Ted Garner. Haha. Dabei war er eher der Typ ‚Einsamer Wolf ‘. Doch als zukünftiger Psychotherapeut musste er empathisch sein. Kommunikativ. Aufgeschlossen. Garner grinste wieder. Bei seinem Neustart würde er sich selbst neu erfinden müssen. Konnte man das? Allem Anfang liegt ein Zauber inne … Bisher hatte sich der Zauber allerdings noch nicht eingestellt. Die Erinnerungen an seine Zeit als Therapeut in der forensischen Klinik in North Battleford waren nicht gerade ermutigend. Im Grunde seines Herzens war Garner ein Jäger, und das Adrenalin bei der Jagd auf Verbrecher hatte ihn deutlich mehr beflügelt als der mühsame und meist vergebliche Versuch, sie zu heilen. Endlich ergatterte er einen Platz in dem völlig überfüllten Lift und unterdrückte seine Klaustrophobie, während sie langsam nach oben glitten. Er folgte einem endlosen Flur, bis er vor Zimmer Nr. 758 stand, und hielt die Schlüsselkarte vor das Türschloss. Das elektrische Licht ging automatisch an, und Garner betrat seine kleine Box, die ihn in ihrer anonymen Uniformität an eine Gefängniszelle denken ließ. Bett, Schrank, Tisch, Stuhl. Das Zimmerfenster zog ihn an wie ein Magnet, doch er zwang sich, den grauen Anzug auszuziehen, frische Unterwäsche und ein sauberes weißes Hemd aus dem Koffer zu fischen und ins Bad zu gehen. Während er in die Dusche stieg und sich einseifte, dachte er an Sophie LeRoux. Auch wenn er es sich nicht eingestehen wollte, vermisste er sie. Ihr Lachen, ihre Intelligenz, ihre gemeinsame Begeisterung für die Philosophie Arthur Schopenhauers. Sie war die Frau eines Kollegen aus Montreal, und obwohl sie einander bei ihren kurzen Treffen während eines Falls im letzten November nicht ein einziges Mal auch nur geküsst hatten, verfolgte Garner das Gefühl, dass sie die Einzige war, die ihn wirklich verstand. Nach der unguten Sache mit seinem Vater hatte er sie aus dem Krankenhaus angerufen, und sie hatten über eine Stunde lang miteinander geredet. Danach hatte er sich seltsam leicht und frei gefühlt. Doch Montreal war viereinhalbtausend Kilometer entfernt. Sie waren beide verheiratet. Wahrscheinlich würden sie sich nie mehr wiedersehen. Es war besser, sie zu vergessen.
Garner ließ das warme Wasser lange über seinen nackten Körper rieseln, dann stieg er aus der Dusche und trocknete sich ab. Der dunkle Schatten hatte sich erneut über sein Gemüt gelegt. Er versuchte gewaltsam, den Gedanken an Sophie LeRoux abzuschütteln und zog sich hastig an. Er brauchte dringend einen Whiskey. Das Jackett seines grauen Anzugs war zerknittert und roch leicht nach Schweiß, doch die Reinigung würde bis morgen warten müssen. Er zog die Tür hinter sich zu und nahm erneut den Aufzug nach unten.
Die Hotelbar war bereits gut gefüllt. Dezente Jazz-Musik, Sitzgruppen aus schwarzem Leder, gedämpftes Licht. Kongressteilnehmer standen in lockeren Cliquen mit einem Aperitif in der Hand um Stehtische, lächelnd und Köpfe nickend in Small Talk verstrickt. Garner hasste Small Talk. Er ging zu dem Tresen aus blank poliertem Mahagoni und setzte sich auf einen der letzten freien Barhocker. Er bestellte einen Royal Canadian und leerte ihn in einem Zug. Während sich die ölige Flüssigkeit mit dem leicht rauchigen Geschmack in Kehle und Magen ausbreitete, überschwemmten ihn Erinnerungen an den Colonel und die wenigen gemeinsamen Abende auf der Veranda des einsamen Ranchhauses in den Foothills der Rocky Mountains. Auch wenn sie einander nie nahe gestanden hatten, vermisste Garner seinen Vater auf eine seltsam schmerzhafte Art.
„Pardon.“ Jemand drängte sich an den Tresen, und ein schwerer, orientalisch anmutender Parfümduft stieg ihm in die Nase. Garner drehte sich zur Seite und sah direkt in die Augen einer attraktiven Enddreißigerin. Sie trug ein weit geschnittenes, kaftanähnliches Kleid aus einem geblümten Stoff und silberne Hängeohrringe, an denen tropfenförmige Türkise baumelten. Das lange blonde Haar war locker zu zwei Zöpfen geflochten. Sie lächelte ihn so glückselig an, als habe sie gerade Shangri-La entdeckt.
„Hi. Ich bin Claudia. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht.“ Wieder dieser einlullende Akzent. Dr. Hofstätter. In ihrem hippymäßigen Outfit und ohne die dunkle Brille hätte er sie beinahe nicht erkannt. Garner gab sich einen Ruck. „Ted Garner“, sagte er und lächelte ebenfalls. „Ihr Vortrag heute war sehr interessant.“ Er hoffte inständig, sie würde nicht mit ihm über Peter Levines Traumatherapie diskutieren wollen, denn da müsste er leider passen. Er würde ihr nur sehr ungern gestehen, dass ihre Samtstimme ihn beinahe in den Tiefschlaf versetzt hatte.
„Erlauben Sie, Ted?“ Ohne seine Antwort abzuwarten, zwängte Dr. Hofstätter sich auf den Barhocker neben ihn und orderte einen Buddha-Tea. Der Barkeeper sah sie verständnislos an und zuckte bedauernd mit den Schultern. Ihre kirschrot geschminkten Lippen verzogen sich zu einem Schmollmund, während sie auf Earl Grey umschwenkte. Garner bestellte einen zweiten Whiskey.
„Prosit“, sagte sie auf Deutsch. Ihr Gesicht hatte sich wieder in ein seliges Lächeln verwandelt, und sie stieß mit ihrem Teeglas an seinen Whiskeytumbler als wäre es Champagner. Ihre Finger waren lang und feingliedrig wie die einer Pianistin. Einen Ehering trug sie nicht. Während Claudia an ihrem Glas nippte, blickte sie ihm tief in die Augen.
„Sind Sie Psychotherapeut, Ted?“, fragte sie.
„Ja“, antwortete er der Einfachheit halber. Garner gehörte nicht zu den Menschen, die an der Bar eine Lebensbeichte ablegen. Genau genommen weder an der Bar noch anderswo. Claudia Hofstätters Blick war von einer seltsamen Intensität, und sie beugte sich so nahe zu ihm hinüber, dass ihr blumiger Duft ihn ein wenig benebelte.
„Lieben Sie Ihre Arbeit?“ Die braunen Augen mit den honigfarbenen Einsprengseln tauchten fragend in die seinen.
„Ja“, log Garner und nahm einen großen Schluck von seinem Whiskey. Sein Kopf begann bereits zu schwimmen. Ihre Nähe war angenehm betörend.
„Ich habe eine eigene Praxis in Wien“, sagte Claudia. „Es gibt keine schönere Arbeit. Menschen mit einer kranken Seele zu helfen, ist eine Berufung.“
Garner dachte, dass ihm die meisten Menschen herzlich egal waren. Während seiner Zeit in der forensischen Klinik hatte er genug kranke Seelen für den Rest seines Lebens gesehen, und er hatte ihnen nicht helfen können. Claudia rührte langsam in ihrem Teeglas und lächelte so geheimnisvoll wie die Mona Lisa. Sie gehörte zu der Sorte Frau, die um ihre Attraktivität wusste und es meisterhaft verstand, Menschen, insbesondere die männlichen Exemplare, zu bezirzen, doch verströmte sie auch eine seltene Wärme und Empathie, der sich selbst Garner nicht zu entziehen vermochte. Er konnte sich sehr gut vorstellen, wie sie ihre Klienten mit ihrem Charme und ihrem weichen österreichischen Akzent einlullte, sodass sie sich auf der Stelle geheilt fühlten und wie Lazarus von der Therapiecouch sprangen, um in ihr rosarotes neues Leben zu tanzen.
Claudia hob wieder gekonnt den Blick und fixierte ihn so, als wolle sie ihn hypnotisieren.
„Ich bin Spezialistin für Traumatherapie“, sagte sie. „Viele Menschen sind traumatisiert, ohne es überhaupt zu wissen. Sie sind innerlich tot, abgespalten von ihren Gefühlen und jeglicher Lebensfreude. Die Ursache ist oft ein schweres Geburtstrauma oder verdrängte frühkindliche Verlusterfahrungen, beispielsweise der Tod eines Elternteils.“
Garner schwieg, während Claudia ihn so forschend betrachtete, als sei er ein seltenes Insekt, das sich gerade in ihrem Schmetterlingsnetz verfangen hatte. Er wäre aufgrund einer Nabelschnurumschlingung bei seiner Geburt beinahe erstickt, und seine Mutter war an einer Fruchtwasserembolie gestorben, doch das würde er ihr nicht auf die Nase binden.
„Haben Sie schon einmal von Aura-Lesung gehört?“, fragte Claudia. Garner zeigte keine Reaktion, doch sie fuhr unbeirrt fort. „Die Aura ist das Energiefeld, das jeden Menschen umgibt. Eine Art Schwingung, die man in das Universum aussendet.“
Garner schwieg weiter. Dieser Esoterik-Kram war kompletter Schwachsinn. Dennoch fühlte er sich auf eine merkwürdige Weise berührt.
„Sie haben eine seltsame Aura“, sagte Claudia. „Dunkel. Ihre Seele trauert.“
Sie ließ ihre Hand leicht wie eine Feder auf seinen Unterarm gleiten. Die Berührung fühlte sich warm und vertraut an.
„Ich versuche, neue Wege zu gehen in der Therapie.“ Claudia Hofstätters Stimme klang jetzt so verheißungsvoll, als verkünde sie ihm das Nahen des Messias. „Holistisch. Spirituell.“
Garner leerte seinen zweiten Whiskey und orderte entgegen seiner Gewohnheit einen dritten. Irgendetwas an der Frau zog ihn an. War es ihre Schönheit? Ihre warmherzige, feminine Ausstrahlung? Hatten die drei Abende in seinem einsamen Zimmerkäfig ihn doch nach Gesellschaft hungern lassen? Oder war ihm der Alkohol bereits zu Kopf gestiegen?
„Was fühlen Sie gerade, Ted?“, fragte Claudia. Ihre Hand lag noch immer auf seinem Arm. Und sie fühlte sich noch immer ziemlich gut an.
„Nichts“, antwortete Ted. „Ich bin Autist.“
Sie neigte ein wenig den Kopf und blickte ihn prüfend an. „Warum sagen Sie das, Ted? Haben Sie Angst vor Ihren Gefühlen?“
Garner antwortete nicht. Es reichte. Er hatte keine Lust auf eine Therapiestunde bei Dr. Hofstätter. Er würde den Whiskey austrinken und zurück in sein Zimmer gehen. Er machte dem Barkeeper ein Zeichen, dass er zahlen wollte.
„Wenn Sie vor Ihren eigenen Dämonen davonrennen, wird Ihre Seele niemals frei werden“, sagte Claudia. Ihr Blick versank so tief in seinem, dass ihm schwindelte. „Eine dunkle Aura bedeutet, dass Sie von der spirituellen Quelle abgeschnitten sind.“ Claudias Stimme wurde zu einem geheimnisvollen Flüstern. „Ich kenne jemanden, der Sie heilen kann. Der Ihre gefangenen Gefühle befreit und Sie wieder mit dem Universum verbindet.“
„Ich glaube, ich muss gehen“, sagte Garner.
Claudia lächelte. Ihr Lächeln war wirklich bezaubernd. „Haben Sie schon einmal von der Peyote-Zeremonie gehört?“
„Nein“, sagte Garner. Er nahm einen großen Schluck von seinem Whiskey und warf dem Barkeeper einen Zwanzig-Dollar-Schein hin.
„Haben Sie Lust auf ein kleines Abenteuer?“
Garners Kopf drehte sich. Wollte Claudia Hofstätter ihn etwa verführen? Er hatte Pat noch nie betrogen, und er hatte nicht vor, es heute Nacht zu tun. Claudia Hofstätter schaute auf ihre Uhr und leerte in kleinen, hastigen Schlucken ihren Tee.
„Ich muss ebenfalls los“, sagte sie. „Die Peyote-Zeremonie ist ein indigenes Ritual, bei dem wir Zugang zu unserem Unterbewusstsein und zu verschütteten Emotionen bekommen und uns mit dem Göttlichen vereinen. Neurowissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass circa 95% unserer Denkleistungen und Entscheidungen unbewusst ablaufen. Vernon Sun Dog, der Medizinmann, der die Zeremonie durchführt, ist ein guter Freund von mir. Wir haben uns letzten Sommer in Österreich kennengelernt. Er hat dort Seminare über indigene Spiritualität abgehalten und Schwitzhüttenzeremonien zur inneren Reinigung geleitet. Ein wunderbarer Mann.“
Claudia lächelte so hingebungsvoll, dass Garner hätte schwören können, dass Vernon Sun Dog sie nicht nur in der Schwitzhütte zum Schwitzen gebracht hatte.
„Ich muss in einer knappen Stunde da sein. Wenn Sie möchten, können Sie mitkommen. Sie werden es mit Sicherheit nicht bereuen. Es ist eine einzigartige Erfahrung, seinem wahren Selbst zu begegnen. Vernon ist ein großer Philosoph und Heiler.“
Später würde Garner sich fragen, was ihn an diesem Abend geritten hatte, anstatt im Lift auf den Knopf nach oben in die 7. Etage zu drücken, mit Claudia Hofstätter in die Tiefgarage des Kongresshotels zu gleiten, in ihren Leihwagen zu steigen und mit ihr zu dem abgelegenen Holzhaus am Ufer des Fraser River zu fahren. Eine mysteriöse Mischung aus Patschuli und Royal Canadian, Sehnsucht, Neugierde und Langeweile. Vielleicht. Vielleicht war es aber auch einer jener schicksalhaften Momente, die einfach so passieren, und die über den ganzen Rest deines Lebens entscheiden. Während sie den Marine Drive Richtung Südosten entlangfuhren, verspürte Garner eine leichte Übelkeit. Er ließ die Fensterscheibe herunter und atmete in tiefen Zügen die frische Abendluft ein. Die Lichter der City glitzerten und warfen bunte Reflexionen auf die dunkle Wasserfläche des Flusses. Claudia plapperte munter auf ihn ein, und das sanfte Auf und Ab ihrer Stimme wiegte ihn erneut in einen angenehmen Dämmerzustand, aus dem ihn erst das plötzliche Anhalten des Wagens herausriss. In der unbeleuchteten Einfahrt eines Hauses parkten zwei Pickup-Trucks. Claudia quetschte sich an den Rand dahinter und sie stiegen aus. Die Fenster des Hauses waren dunkel, und es war niemand zu sehen. Durch die leicht im Wind wogenden Äste einer Gruppe von Douglasfichten schimmerte das Wasser des Fraser River so silbrig wie flüssiges Blei.
„Keiner hier“, sagte Garner. Die Gegend war einsam. Die Walther Q5 lag im Safe seines Hotelzimmers. Vielleicht sollten sie besser umkehren. Claudia Hofstätter schaute unschlüssig auf ihr Handy. „66 Maple Ridge. Die Adresse stimmt“, sagte sie.
„Schon mal von Indian time gehört?“, meinte Garner. „Diese Indsmen sind nie pünktlich.“
Claudia warf ihm einen strafenden Blick zu.
„Schauen wir unten am Flussufer“, sagte sie und stapfte mit energischen kleinen Schritten durch das Gebüsch Richtung Fraser River. Garner fluchte innerlich, während er sich mit seinen dünnen Lederslippern durch kniehohe Farne, Hartriegel und Schachtelhalme vorankämpfte. Es war stockdunkel, der Boden feucht und schlüpfrig, und der noch immer anhaltende Nieselregen durchnässte die Schultern seines Jacketts. Irgendwo rief ein Vogel. Das Rauschen der Strömung wurde stärker, und für einen kurzen Moment durchbrach ein blasser Mond die Wolkendecke. Er erkannte Claudia Hofstätters schmale Silhouette auf einem Trampelpfad, der das Flussufer entlangführte. Garner beschleunigte seine Schritte. Er war ein Idiot gewesen, mitzukommen, doch er konnte Claudia Hofstätter unmöglich in dieser gottverlassenen Gegend alleinlassen. Er verspürte eine leise Genugtuung, dass dieser Vernon Sun Dog sie anscheinend versetzt hatte. Sie würden zurückfahren und in der Hotelbar einen Absacker trinken. Claudia war nur noch gut 50 Meter vor ihm, als sie plötzlich innehielt. Zwischen dem Gestrüpp war ein schwacher Lichtschimmer zu sehen, und Garner meinte, leise Trommelschläge zu vernehmen. Bevor er zu ihr aufschließen konnte, war sie im Ufergebüsch verschwunden. Garner hastete hinterher. Das Geräusch der Trommel war jetzt deutlich zu hören, begleitet von einem schrillen, hohen Gesang, der ihm das Blut in den Adern gefrieren ließ. Er zwängte sich durch eine dichte Hecke aus Brombeersträuchern, Kriechspindeln und hüfthohem Wasserschierling, bis er auf einer platt getretenen, feuchten Wiese stand. In der Mitte war ein indianisches Tipi aufgebaut. Durch die Zeltbahnen aus weißem Segeltuch sah man dunkle Silhouetten und das Flackern eines Feuers. Eine dünne graue Fahne stieg durch die Rauchklappe zwischen den Holzstangen in den nachtschwarzen Himmel auf. Es sah aus wie in einem Traum oder einem Westernmovie. Claudia Hofstätter war nicht zu sehen. Vielleicht war sie bereits in das Zelt gegangen. Für einen kurzen Moment schoss der Gedanke, umzukehren, durch Garners Hirn. Falls es hier Handyempfang gab, könnte er sich ein Taxi rufen. 66 Maple Ridge. Doch zuerst würde er sich vergewissern, dass Claudia wirklich in dem Tipi war. Er ging auf den Eingang zu und klappte die Plane zur Seite. Im Halbdunkel des geräumigen Innenraums saßen etwa 15 bis 20 Personen in einem großen Kreis um ein Feuer, das in der Mitte des Tipis brannte, teils auf dem mit Fichtenreisig ausgelegten Boden, teils auf Plastikstühlen. Claudia Hofstätter hockte im Schneidersitz neben einem jungen Typen in Jeans und Sweatshirt, dessen langes Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden war, und der mit rhythmischen Schlägen auf eine Trommel einklopfte und dabei das Kriegsgeheul von sich gab, das Garner schon von Ferne gehört hatte. Ein älterer indigener Mann mit einem verlebten Gesicht und grauen Zöpfen schüttelte eine mit Lederschnüren und Türkisen verzierte Rassel und wedelte mit der freien Hand einen Fächer aus Adlerfedern vor seiner Nase herum, als wolle er Fliegen verscheuchen. Als Garner an ihm vorbeiging, schlug er leicht mit der Rassel gegen seinen Arm und wies mit dem Kinn auf einen Teller, der vor ihm stand und vor Dollarscheinen überquoll. Der Hokuspokus kostete auch noch Eintritt! Garner zückte seine Brieftasche und warf einen Zwanziger auf den Teller. Die Luft war rauchig, und es roch nach Dope, Zigaretten und irgendwelchen Kräutern. Anscheinend hatte die Zeremonie bereits begonnen. Claudia machte Garner ein hektisches Zeichen, sich neben sie zu setzen und rückte ein wenig zur Seite. Während er sich widerwillig in seinem grauen Anzug auf dem Fichtenreisig niederließ, schaute Garner in die Runde. Von den 17 Leuten im Zelt waren 12 weiblich, die meisten jenseits der Menopause. Fast alle waren Weiße, soweit er das sehen konnte, auch wenn sie sich mit allerhand indigenen Accessoires wie Türkisschmuck, perlenbestickten Mokassins und Federohrringen ausstaffiert hatten. Unwillkürlich musste Garner grinsen. In was für einen esoterischen Zirkus war er hier hineingeraten! Die Augen der Frauen klebten wie gebannt an dem Mann, der mit unbewegtem Gesicht auf einem Klappstuhl neben dem Feuer saß und mit einem Eisenhaken in den Holzscheiten herumstocherte. Vernon Sun Dog. Er war gut aussehend auf diese männlich-melancholische Art, auf die Frauen flogen. Ein kantiges Gesicht mit ausgeprägten Wangenknochen, einem entschlossenen Mund und schweren Lidern. Es war schwierig, sein Alter zu schätzen, Garner tippte auf irgendwo zwischen 40 und 50. Das dunkle Haar war zu Zöpfen geflochten, und er trug Jeans und ein Westernhemd. Obwohl er von allen Anwesenden am Schlichtesten gekleidet war und ganz auf indigenes Styling verzichtet hatte, erinnerte sein Gesicht an ein Häuptlingsporträt auf einem alten Gemälde von Georg Catlin oder einer Fotografie von Edward Curtis. Vernon warf mit einer lässigen Bewegung ein neues Scheit in die Flammen, und die aufstiebenden Funken umtanzten ihn wie einen Magier. Er verströmte eine aufreizende Ruhe und Selbstsicherheit, die schon fast an Arroganz grenzte. Als er aufsah, trafen seine Augen genau die Garners. Falkenaugen, schwarz und unergründlich, und es war, als schaue Vernon Sun Dog bis in die Tiefen seiner Seele. Garner senkte den Blick. Vernon Sun Dog zog jetzt etwas so behutsam aus einem Lederbeutel hervor, als wäre es ein rohes Ei und stimmte dabei einen gutturalen Gesang an. Seine Stimme war tief und kräftig, und er schien ganz in sich selbst zu versinken, während alle wie verzaubert auf ihn starrten. In seiner Hand ruhte eine blassgrüne Pflanze, anscheinend ein Kaktus, und Vernon brach nach und nach Stücke, die wie Knöpfe aussahen, aus ihr heraus, und legte sie in eine Holzschale. Er kramte ein Päckchen Tabak aus der Hosentasche seiner Jeans und warf eine Handvoll Krumen in das Feuer. Ein süßlich-würziger Geruch verbreitete sich in dem Tipi. Als sein Lied zu Ende war, senkte er den Kopf und murmelte etwas in einer fremden Sprache, deren sanftes Auf und Ab an das Rascheln von Blättern im Wind erinnerte. Anscheinend betete er zum Großen Manitu. Dann begann erneut das monotone Trommeln und Geheule der beiden indigenen Musiker. Vernon Sun Dog hob ganz leicht die Hand wie ein routinierter Dirigent, und ein vielstimmiges, zunächst zögerndes, dann enthusiastisch anschwellendes Heya heya ho setzte ein. Garner bewegte stumm die Lippen. Der Gesang nahm kein Ende. Alle saßen im Kreis, wiegten sich rhythmisch hin und her und stierten abwechselnd auf Sun Dog und ins Feuer, ansonsten schien nicht viel zu passieren. Garners unterkreuzte Beine schliefen ein, die Fichtennadeln stachen durch den dünnen Stoff seiner Anzughose, und die ungewohnte Haltung verursachte ihm Rückenschmerzen. Hoffentlich war der ganze Zinnober bald vorbei. Erneut überfiel ihn die bleierne Müdigkeit der letzten Tage, und er verlor jegliches Zeitgefühl. Er musste eingenickt sein, als ihn ein jäher Ellbogenstoß aus seinem Dämmerzustand herausriss. Claudia Hofstätter reichte ihm die Holzschale mit den Kaktusstücken. Anscheinend hatte sie bereits die Runde gemacht, denn als er aufblickte, sah er überall halb offene Münder, die andächtig irgendetwas kauten. Ohne zu überlegen, steckte auch er einen der grünlich-grauen Kaktusknöpfe in den Mund. Das Zeug schmeckte bitter, und er hätte es am liebsten wieder ausgespuckt, doch die merkwürdigen dunklen Augen Vernon Sun Dogs waren auf ihn gerichtet wie Pfeile und schienen ihn zu durchbohren. Garner kaute und schluckte. Schlimmstenfalls würde er ein wenig high werden. Erinnerungen an seine Studentenzeit und sporadische Joints auf Wohnheimpartys stiegen in ihm hoch, und er musste grinsen. Vielleicht tat ihm die kleine Abwechslung ganz gut. Er warf einen Seitenblick auf Claudia. Sie wandte sich ihm zu und lächelte wieder ihr entrücktes Shangri La-Lächeln. In ihren Augen lag ein seltsamer Glanz. Eine lange nicht gespürte Leichtigkeit erfasste Garner, sodass er zu schweben meinte. Der Gesang ging weiter. Die Trommel dröhnte lauter, ein dumpfes bum bum bum, das genauso klang wie sein eigener Herzschlag, und die Rassel in der Hand des indianischen Musikers wirbelte hin und her wie das Pendel eines Hypnotiseurs. Bunte Lichter tanzten vor Garners Augen, und sein Leben glitt wie ein Film an ihm vorbei. Seine einsame Kindheit im Militärinternat, die Gleichgültigkeit in den kalten Augen des Colonels. Sein Studium der Philosophie und Psychologie, die Zeit als Therapeut in der forensischen Klinik in North Battleford, die Heirat mit Pat, die Geburt der beiden Söhne. Die Begegnung mit Sophie LeRoux. Verschüttete Emotionen überschwemmten ihn wie eine Sturmflut, und er spürte, wie Tränen in seine Augen stiegen und seine Wangen hinunterrannen. Ohne dass er sich dagegen wehren konnte, versetzten heftige Schluchzer seinen Körper in ein hilfloses Beben. Es war, als bräche ein Damm. Niemand schien ihn zu beachten. Als die Holzschale erneut bei ihm ankam, griff er wie in Trance hinein und schluckte den bitteren Kaktus-Knopf, als hinge sein Leben davon ab. Irgendwann ebbten die Weinkrämpfe ab. Gegenstände und Menschen verloren mehr und mehr ihre Konturen, und er tauchte ein in eine Welt ohne Grenzen. Alles leuchtete in einem überirdischen Licht. Sein Selbst schien sich auszudehnen und verschmolz mit dem unendlichen Raum jenseits der Zeit. Er thronte gottgleich über den Dingen in einer nie gefühlten unbeschreiblichen Seligkeit, in der er alles durchdrang, fühlte, schaute und verstand, und sich auf magische Weise eins damit fühlte. Das strahlende Licht umgab ihn wie ein Meer aus Diamanten, und er hatte das Gefühl, sich darin aufzulösen. Doch plötzlich tauchte eine riesige Schlange aus dem Lichtmeer auf. Ihre Haut war schuppig, ihre Augen glitzerten böse, und als sie sich vor ihm aufbäumte, erfasste ihn Todesangst. Er wollte schreien, doch sie ringelte sich um seinen Hals und seinen Oberkörper und drückte ihm die Luft ab. Etwas in ihm zerbrach mit einem grässlichen Geräusch, und er verspürte einen unsäglichen Schmerz. Seine Lungen zerbarsten. Er würde sterben. Da erschien wie aus dem Nichts eine dunkle Gestalt mit einem grauenhaft entstellten Gesicht. Namenloses Entsetzen erfasste ihn, doch die Gestalt reichte ihm ein Schwert, von dem ein rot glühender Feuerring auszugehen schien. Er packte den Griff und hieb mit letzter Kraft zu. Der Kopf der Schlange fiel ins Wasser und verschwand in einem blutig-schleimigen Strudel, der auch ihn in die Tiefe zu ziehen drohte. Er versuchte verzweifelt, gegen den tödlichen Sog anzukämpfen, doch etwas zog ihn in das unergründliche Wasserloch und verschlang ihn. Das Letzte was er vernahm, war das höhnische Gelächter der finsteren Gestalt.
Als er aufwachte, spürte er etwas Kaltes in seiner Hand. Seine Finger umklammerten ein Jagdmesser. Ihm war speiübel, und er erbrach sich auf das Fichtenreisig. Er zitterte am ganzen Körper, und er fühlte sich so schwach wie nach einer langen Krankheit. Das Feuer in der Mitte des Tipis war ausgegangen. Von draußen drang das zittrig-feine Zirpen eines Rotkehlchens an sein Ohr. Sein Kopf dröhnte. Die Morgendämmerung tauchte das Innere des Zeltes in ein diffuses Licht. Das Tipi war leer, bis auf eine einsame Gestalt, die neben ihm auf dem Boden lag. Claudia Hofstätter. Ihr Kleid war hochgerutscht, und er sah ihre gebräunten, nackten Beine. Er beugte sich über sie, um sie wach zu rütteln. Das Kleid war nass und dunkel, die blonden Zöpfe blutverklebt. Der vordere Oberkopf war kahl wie bei einem gehäuteten Tier. Die Kopfschwarte war entfernt worden. Garner musste erneut würgen. Dr. Claudia Hofstätter war tot. Jemand hatte sie erstochen und skalpiert. Garner packte das Messer und stürzte aus dem Tipi.
Frank Lombardi
22. September
Vancouver
In seinen 28 Dienstjahren hatte Frank Lombardi schon so viele Tote gesehen, dass er aufgehört hatte sie zu zählen. Erschlagen, erstochen, erschossen, ertränkt, zu Tode gefoltert. Vergiftet, erhängt, verblutet, zerschmettert beim Sturz von Gebäuden und Brücken. Mordopfer, Selbstmörder, Junkies. Wenn ihm die Gesichter der Toten in manchen Nächten wie die Fratzen eines Hieronymus-Bosch-Gemäldes durch den Kopf spukten und den Schlaf raubten, ertränkte er sie in Martinis und Fernet Branca am Tresen des Papa Razzi, das trotz des hochtrabenden Namens nur eine bessere Spelunke südlich der East Hastings Street war und dessen Besitzer – ein Italiener namens Enzo – ihn Commissario nannte, obwohl er nur ein einfacher Inspector war. Doch seit der Sache mit Gina waren seine Besuche im Papa Razzi häufiger geworden und die Anzahl der geleerten Gläser war exponentiell gewachsen. Es war Freitagabend, ein grauer Septembertag mit Nieselregen, und er hatte Bereitschaftsdienst, doch Frank kippte bereits den zweiten Drink, als sein Handy vibrierte. Zunächst dachte er, es sei das Kribbeln in seinen Händen, die fahrig auf seinen Oberschenkeln hin und her rutschten – ein Tick?, eine frühe Form von Delirium tremens? –, doch als das Vibrieren nicht aufhörte, zog er es hastig aus der Hosentasche. Sein Herz pochte bis zum Hals, und er verspürte einen vertrauten Adrenalinstoß aus Hoffnung und Panik, – Gina? –, Tracey?, doch dann Nora Jacksons raue Nikotinstimme, die ihm sagte, dass unten am Fraser River eine skalpierte weiße Frau in einem Indianertipi gefunden worden sei und er sofort kommen müsse. Zuerst glaubte er an einen blöden Scherz, doch als sie ihm eine Adresse gab und die Stelle beschrieb, dachte er bloß noch Scheiße! Er hatte zu viel Promille im Blut, um sich selbst hinters Steuer zu setzen, also blieb ihm nichts anderes übrig, als Nora Jackson zu bitten, ihn am Papa Razzi abzuholen, was sie mit einem Grunzen quittierte, das seiner Erfahrung nach nichts Gutes verhieß. Zum Glück war die Meldung gerade erst reingekommen und Nora noch nicht am Tatort. Während er auf sie wartete, kippte er vorsorglich einen letzten Fernet Branca, um sich gegen das Gespenst, das am Ufer des Fraser River auf ihn wartete, zu wappnen, dann zahlte er und ging vor die Tür. Er stellte sich in den Hauseingang und zündete eine Zigarette an. Der Regen fiel in feinen, dünnen Strichen. Es war 18:23 Uhr, und im schwindenden Tageslicht spiegelten sich die roten Lichter der vorbeifahrenden Autos in den schlierigen Pfützen auf dem Asphalt der Straße. Ein Gefühl von Trostlosigkeit sprang ihn an, und er kämpfte gegen den Drang, zurück zum Tresen zu gehen und sich sinnlos volllaufen zu lassen. Eine Zigarettenlänge später hielt der Polizeiwagen mit quietschenden Reifen, Frank riss die Tür auf, sprang auf den Beifahrersitz, und Nora Jackson raste los. Sie hatte das Martinshorn eingestellt, und das schrille Geheule der Sirene ersparte ihm ihr Genörgel. Nicht dass es ihn sonderlich beeindruckt hätte. In den zwölf Jahren seiner Ehe hatte Frank Lombardi gelernt, sich gegen weibliches Genörgel zu immunisieren. Es hatte viele infektiöse Steine des Anstoßes gegeben: Zu wenig Geld, zu wenig Zeit – Wochenenddienste, Nachtschichten, Überstunden – zu wenig Rücksicht, zu wenig Feingefühl. Zu wenig Fantasie im Bett. Zu wenig Urlaub. Zu wenig Spaß. Alles seine Schuld. Dann hatte Tracey die Scheidung eingereicht und war mit Gina in das Kaff im Okanagon Valley gezogen, aus dem sie stammte. Hin und zurück acht Stunden Fahrt von Vancouver. Gina war neun, sie wurde scheu und abweisend, – Frank war sicher, dass Tracey das ihrige tat, um sie ihm zu entfremden – seine Besuche wurden seltener, irgendwann brach der Kontakt ab. Bis zu jenem Tag vor drei Monaten …
„Kannst du noch geradeaus gehen?“, Nora Jacksons böser Blick. Anscheinend waren sie angekommen. Nora hatte den Dienstwagen am Straßenrand vor einem grau gestrichenen Holzhaus geparkt und hievte ihre gut 120 Kilo aus dem Sitz. Die Gegend war einsam, die Fenster des Hauses dunkel. In der Einfahrt parkte ein schwarzer Toyota Minivan. Niemand war zu sehen.
„Ich versuch’s mal“, sagte Frank. „Sonst musst du mich tragen.“ Nora schnaubte durch die Nase. Er hielt ihr seine Packung Marlboro entgegen, sie griff zu und er gab ihr Feuer. Ein Friedensangebot. Dann zündete er sich selbst eine an, und sie nahmen ein paar tiefe Lungenzüge und beobachteten den Rauch, der in den anthrazitfarbenen Himmel aufstieg, während der Regen unablässig durch die Bäume tropfte. Er arbeitete jetzt seit sieben Jahren mit Nora Jackson zusammen. Sie waren ein gutes Team, und trotz oder gerade wegen ihrer schroffen Art mochte er sie.
„Pass bloß auf, dass du kein Alkoholproblem bekommst, Frank“, sagte sie.
„Aye, aye, Ma’am“. Frank legte in einer theatralischen Geste die Hand aufs Herz.