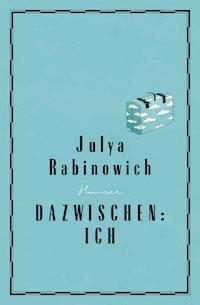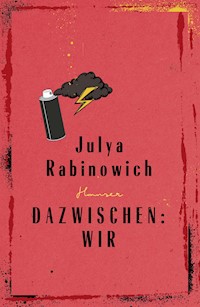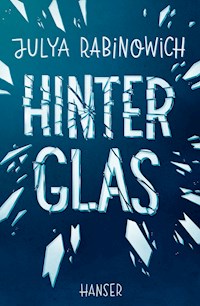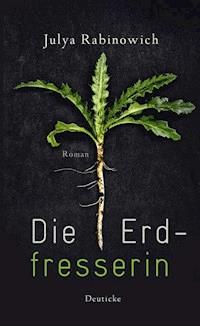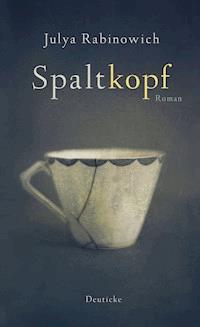
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zsolnay, Paul
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Mischka wurde in Leningrad, dem heutigen St. Petersburg, in einer russisch-jüdischen Großfamilie geboren. Als sie sieben Jahre alt ist, erzählen ihr ihre Eltern, dass sie Urlaub in Litauen machen. Doch das Flugzeug landet in Wien. Mischka muss sich, gespalten zwischen den Mythen ihrer Kindheit und den Verheißungen des Westens, im Exil einen eigenen Weg suchen. Rabinowich überzeugt nicht nur durch ihren Sinn für Komik, sondern auch mit ihrem eigenständigen Stil: Nüchtern und überzeichnend zugleich beschreibt sie das Vakuum zwischen den Kulturen, in das einen die Emigration zu treiben vermag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Deuticke eBook
Julya Rabinowich
Spaltkopf
Roman
Deuticke
Der Roman Spaltkopf erschien erstmals 2008 in der edition exil, Wien. Die Verfasserin wurde unterstützt durch das Wiener Autorenstipendium der Stadt Wien.
ISBN 978-3-552-06180-4
© Deuticke im Paul Zsolnay Verlag Wien 2011
Alle Rechte vorbehalten
Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
www.julya-rabinowich.com
Für Naïma
mit Dank an Edith und Horst
Abgebissen, nicht abgerissen
Lektion 3
Sprung. Satz. Schnitt.
Galliges Grün überall: Wasser, Himmel, Küstenstreifen, farblich darauf abgestimmt: ich, die sich recht cool findet. Ich mache eine Reise. Ich befinde mich an Bord einer Fähre, die soeben Irland Richtung Schottland verlässt. Ich bin schwanger und glaube fest, dass ich draufgängerisch aussehe.
Ich mache wieder einmal einen Sprung, mein Spiel ist das Tempelhüpfen von Land zu Land. Danebentreten wäre unklug: dann scheidet man aus. Der Rest der Mitspieler sitzt noch im Out: Sie sind in Russland und warten auf ihre Ausreise nach Israel, einige ahnen zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts von ihrem Glück, andere wissen nicht, dass sie auch diesem Zielland einmal den Rücken kehren werden: ab nach Hause, husch, husch ins Körbchen.
Im Out ist es langweilig. Man schaut zu und kommentiert die Bewegungen des Spielers, der gerade dran ist. Das lenkt ihn ab und bereitet mehr Abwechslung. Mein Vater ist raus, und ich bin an der Reihe.
Ich mache also eine Reise. Ich bin eigentlich nie angekommen, weder bei meiner ersten noch nach der zweiten. Die Reise nimmt kein Ende, und der Urlaub ist lang. Ich werde mich weigern, die Reisespesen zu begleichen.
Abgebissen wirkt der Küstenstreifen, man kann die Schichten seines Fleisches gut erkennen. Abgebissen fühle ich mich auch, denn das Land, aus dem ich kam, hängt nicht an mir, und ich nicht an ihm. Keine Fasern verbinden mich mehr damit.
Diese Reise wird mich in Folge nach Schottland, Holland, Wien und durch die Geburt meiner Tochter führen. Zwischen Glasgow und Amsterdam spüre ich, wie mein Kind die ersten Schritte in meinem Bauch setzt. Es versetzt mich in Panik. Auch meine Tochter hat bereits eine Reise angetreten. So sind wir beide unterwegs.
Lektion 1
Wer jetzt verrückt wird, wird es lange bleiben.
Wird lesen, wandern, lange Briefe schreiben.
Ich sitze mit meinen Eltern, meiner Großmutter Ada und meiner Puppe im Flugzeug. Alle Beteiligten sind erstarrt (im Stand-by-Modus). Die Mozartkugel in meiner Hand schmilzt, aber das bunte Papier erscheint mir zu wertvoll, um es aufzureißen, ich habe so etwas noch nie gesehen.
Ich bin überzeugt von der Richtungsangabe meiner Eltern: Wir befinden uns auf einer Urlaubsfahrt Richtung Litauen. Kurz vor der Landung entstehen darüber Meinungsverschiedenheiten: Ein anderes Kind ist nicht von der fixen Idee abzubringen, dass wir nach Wien fliegen. Ich soll unrecht behalten.
Das Klo ist ein Palast und die Kaugummiautomaten Versprechen einer neuen schönen Welt. Wir leben zu viert in einem Hotelzimmer, das sich in einem Bordell zu befinden scheint. Ich habe deswegen Einzelhaft und darf nicht hinaus.
Mein Vater und ich bekommen einen Nervenzusammenbruch, weil er mir im Laufe eines einzigen Abends drei Jahre Kommunismussozialisation austreiben will und ich es nicht fassen kann, dass Lenin, der Freund aller Kinder, dessen Anstecker noch immer an meinem Kleid prangt (im Reisefieber untergegangen), ein Arschloch sein soll.
Was mein Vater nicht schafft, bewirkt der Anblick einer Barbiepuppe. In fünf Minuten. Ich bin vom Westen überzeugt. Ich soll es lange bleiben.
Jahre später noch kann ich mich kaum daran erinnern, nicht hier geboren worden zu sein. Ich bin bereit, ein besseres Deutsch zu sprechen als meine Klassenkollegen. Ich bin bereit, freiwillig in den katholischen Religionsunterricht zu gehen, während die türkischen Kinder früher heimgehen können. Ich bin bereit, Gebete, deren Worte mir anfangs nicht klar sind, nachzuäffen. Später werden es andere Dogmen sein. Ich bin bereit, für den Rückhalt in einer Gruppe – so sie nicht zu groß ist – auch Teufels Großmutter aufzusuchen, und sei es nur auf LSD. Ich bin bereit, das Doppelte meiner Einnahmen für eigenwillige Kleidung auszugeben, um mich anschließend bei meiner Arbeit von quälenden Geldsorgen stören zu lassen.
Das Anrüchige einer kleinen Immigrantin ist nicht mal mit Chanel abzuwaschen. Ein Verlust ist sofort – instant – wiedergutzumachen. Die Leere darf nicht einen wahrnehmbaren Moment lang aufklaffen.
Ich kaufe ein, als mein Vater stirbt.
Ich kaufe ein, als ich mich von meinem ersten Freund trenne.
Lektion 2
Reisende soll man nicht aufhalten.
Mein Vater tritt eine finale Reise an und hinterlässt mir als Mitbringsel lähmende Angst vor Ausflügen aller Art. Ich mutiere kurzfristig zu einer Gemischtwarenhandlung sämtlicher Neurosen: Ich habe Flugangst, Platzangst, Angst vor Tunneln, Zügen, Beziehungskisten und dem Tod. Meines Bewegungsradius beraubt, beginne ich, mir eigene Spiralen zurechtzulegen:
Ich bin oft krank.
Ich schreibe.
Ich führe endlos komplizierte Liebschaften.
Ihre Wege sind so verschlungen wie die, die mir versagt sind.
Die Welt ist rund.
Wenn man einmal losgeht, kann man nicht mehr innehalten. Schon hat es einen über den Rand und weiter gezogen. Als Stehaufmännchen schreitet man voran. Es gibt kaum eine Neigung, die einen zum Erliegen bringen würde. Sehnsucht kommt auf nach der schönen alten Zeit mit ihren Schildkröten und Elefanten, die die Weltenscheibe stützten! So einfach wäre es gewesen: einmal angepirscht, darüber gelugt und heimgegangen. Aber unsereins sitzt im Karussell, obwohl schon dem Erbrechen nahe.
Ich bin unterwegs zu mir mit Drogen, Analyse, Arbeitsanfällen. Ich bin ein bulimisches Perpetuum mobile, schubweise geplagt von Einverleibenwollen und Nichtbehaltenkönnen.
Kurzum: Ich habe mich angepasst.
Die Welt ist rund.
Lektion 4
fast forward
Ich stehe auf einem Bergvorsprung und sehe in die Tiefe: Zu meinen Füßen schlängelt sich die Rhône. Links ist Frankreich, rechts der Abgrund.
Der Wind ist warm, erster Anflug des Frühlings überall.
Die Wasser meines Flusses sind träge. Gelb und gallig wälzen sie sich dahin.
Wenn ich die Wahl zwischen zwei Stühlen habe, nehme ich das Nagelbrett.
Ich bin müde.
Ich bin nicht daheim.
Ich bin angekommen.
Die Hunde von Ostia
1
Als meine Mutter mit mir schwanger war, saß sie oft vor ihrem Schminktischchen, sah lange in den Spiegel und stellte sich ihr Kind vor. Vor ihr lag ein Buch. Ein abgegriffener Stoff, darauf eingestanzt in goldenen Lettern »Russische Märchen«. Ihre Hand, klein und elegant, ruht auf einer aufgeschlagenen Seite unterhalb der Überschrift »Herrin des Kupferbergs«. Es gibt viele Geschichten von ihr, alle eröffnet mit feierlich großen Schnörkelbuchstaben. Kyrillisch. Auf der anderen Seite eine Illustration hinter einem knisternden Blatt Schonpapier. Durch den matten Schleier lassen sich die Farben nur erahnen. Das Bild zeigt eine Frau mit langem schwarzem Zopf, die sich an eine Malachitwand lehnt. Ihr Kleid, ihre Augen, die aufmerksam und streng wirken, der gemaserte Stein, das Malachitkollier um den blassen Hals: Alles ist farbident. Sie versinkt in einem Meer von Grün, löst sich darin auf. Meine Mutter blickt sie an und wünscht sich ein Mädchen, mit einer Haut so weiß wie Schnee und einem Mund rot wie Blut.
Das Feuer lodert im Kamin, der mit alten wegbrechenden Marmorplatten getäfelt ist. Auf dem breiten Steinsims darüber stehen Vaters Fundstücke, beim Trödler erworben oder aus dem Mist gebuddelt. Schwere Kerzenleuchter aus Gusseisen, kleine Statuetten, Kupferkannen, liebevoll arrangiert und jedes Stück gut geeignet, meine neugierige Nase zu brechen, wenn ich es schaffe, es vom Sims zu stoßen. Das verzerrte Abbild meiner Augen, das sich im Messingrand der Feuerstelle spiegelt, lenkt mich ab. Unheimliche Flecken, die meinen Bewegungen folgen, bis ich ausrutsche und den Halt verliere. Ein Fuß schlittert ins Dunkel hinter der Absperrung. Ich hangelemich vorsichtig hoch und am Kaminrand entlang, die Preziosen wieder im Blick, angriffsbereit, die Hausschuhe nun mit Asche bestaubt.
Links von mir ragt der hohe, geschnitzte Sessel meines Vaters Lev empor. Wie jeder Stammesgründer hat auch er seinen Thron. Bei einem seiner Ausflüge auf den Mistplatz hat er ihn unter unzähligen Schichten Dreck entdeckt, befreit und zu neuem Glanz poliert. Die dunkelbraunen Löwenköpfe an den Lehnen fletschen mich warnend an.
Vater sitzt im Zentrum des großen Tisches, um den sich die Verwandtschaft versammelt. Sie sind in ihr Abschiedsfest vertieft, schwingen geschliffene Gläser, belegte Brote und Käsegebäck, das meine Mutter mutig in der Gemeinschaftsküche der Kommunalwohnung gebacken hat, nachdem sie einen der beiden Herde dem feindlichen Ansturm der Mitbewohner abtrutzen konnte.
Ich bin eine Prinzessin! König und Königin sind auf meiner Seite, mir kann nichts geschehen. Wackelig vollführe ich eine Pirouette um den schweren Tisch herum. Dieser ist so vollgestellt, dass die Gäste keinen Platz mehr haben für Ellbogen und Hände. Da gibt es Hering im Pelz, dessen strahlend weiße Sauerrahmhülle nach innen hin ein zartes Rosa entwickelt, dort, wo sich die purpurnen Scheiben der roten Rüben und der daruntergeschichteten Kartoffeln mit dem eingelegten Fisch berühren. Mit Zwiebelringen verziert, eine Winterlandschaft, hie und da mit einem grünen Zweiglein Petersilie geschmückt. Die unberührte Speise wirkt sanft gerundet wie ein Federkissen. Nur seiner Schönheit wegen nehme ich mir immer ein großes Stück davon, das ich dann nach den ersten Bissen stehenlasse. Da gibt es ein Schälchen mit rotem und daneben noch eins mit schwarzem Kaviar. Es gibt Salatschüsseln, Plätzchen, Torten, rote und helle Karaffen mit Wein. Eisig beschlagene Wodkaflaschen.In einer Ecke, auf einem kleinen Extratischchen, steht ein geschwungener, rostiger Samowar, der elektrisch betrieben wird, daneben die traditionell den Tee begleitenden Schälchen dünnflüssiger Marmelade mit ganzen Fruchtstückchen darin.
Draußen ist es beißend kalt, der Himmel verdunkelt sich gegen drei Uhr nachmittags. Meine sportliche Großmutter Ada, die Mutter meiner schönen Mutter Laura, schleppt mich fluchend auf einer Rodel durch die Straßen St. Petersburgs, die man im Schneetreiben unter den ungeheuren Schneemassen auf Dächern und Gehsteigen kaum noch erkennen kann. Über unseren Winterschuhen tragen wir zusätzliche Stiefel aus schwarzem Walk, und darüber Gummislipper, die nordische Variante der Gummistiefel, genannt Walenki.
Wie die geballte Urmaterie vor dem Big Bang konzentriert sich die Familie jetzt um den riesigen Piratentisch: Die einen werden nach Amerika fliegen, die anderen nach Israel versprengt werden, manche nach Südafrika und Japan, und wir werden bald unsere Galaxie um die sich stetig drehende Sonne Österreichs bilden, bis irgendwann einmal die Hitze auf unseren Himmelskörpern sinkt und lebensfreundlichere Bedingungen auf unseren Oberflächen herrschen.
Alle Zweige der Verwandtschaft sind da. Die grobe Einteilung der Gäste ergibt Mathematiker, Maler und ehemalige Maler, Architekten und ehemalige Architekten und deren Angehörige, im ungefähren Verhältnis fünfzig zu fünfzig. Eduard, der Bruder meiner Mutter, seine Frau Olga mit ihren beiden Kindern Adrian und Anastasija, einem dünnen Jungen mit Brille und der graziösen achtjährigen Primaballerina.
Mit Onkel Eduard habe ich innerlich ein Hühnchen zu rupfen. Zu oft spüre ich seinen missbilligenden Blick auf mir und meinem untrainierten, fülligen Körper, während seine Tochterin anmutiger Schönheit mit langem schwarzem Zopf durchs Zimmer schwebt. Ich trage den verhassten Pagenkopf, den Fluch der Familie. Meine Großmutter Ada trägt ihn in Hellrot, meine Mutter rabenschwarz. Sie schminken sich beide mit dunklem breitem Lidstrich, Ada verwendet auch Lippenstift. Sie wirken elegant. Ein Vergehen im sozialistischen Russland.
Missmutig versuche ich die dünnen Federn an meinem Nackenansatz mit weißen Riesenmaschen zu bändigen. Wir haben keine Gummiringe fürs Haar, nur meterlange Streifen aus halbdurchsichtigem Nylon. Die Kunst besteht darin, sie besonders bauschig zu einem Gesteck zu winden. Der Trost meiner Unvollkommenheit ist Adrian. Er hat abstehende Ohren und wirkt auch nicht glücklich über seine superb glutäugige Schwester. Ich werfe ihm einen mitleidigen Blick zu. Er streckt mir die lange, gemaserte Zunge heraus, die gut mit seiner Nase harmoniert. Später wird er schlanke Glastürme in New York errichten.
Es klingelt an der Eingangstür unserer Kommunalwohnung. Meine Mutter geht öffnen. Die Nachbarin, Tante Musja, stolpert im Crimplene-Morgenmantel auf den Gang und schimpft hinter ihr her. Sie möchte schlafen, nicht unseren Gelagen lauschen. Ihr Zimmerchen befindet sich direkt neben unseren Räumen, es sind schon zwei Gäste unerwartet und ohne zu klopfen bei ihr eingedrungen, weil sie die Orientierung verloren haben. Die Wände sind papierdünn. Die Gänge verwinkelt und lang.
In einem Schwall merkwürdig scharfsüßen Parfums erscheint Ljuba, die Schwester meines Vaters, mit ihren beiden Töchtern Ninotschka und Lenotschka. Der Raum wirkt augenblicklich überfüllt. Jede von ihnen bringt gut neunzig Kilo auf die Waage. Sie ziehen feierlich im Gänsemarsch hintereinander ein, je ein überladenes Tablett in ihren samtweichen Armen.Alle drei lächeln verführerisch und lüpfen die breiten Stoffservietten. Ein Raunen geht durch den Raum. Ich bin angenehm berührt. Einerseits gibt es jetzt leckere Bäckereien, andererseits bin ich nicht länger das fetteste Kind der Runde.
Tante Ljuba wuchtet sich auf Mutters eleganten Biedermeierstuhl. Sein Aufächzen geht im Gelächter und Geschrei unter. Lubov heißt sie, was auf Russisch Liebe bedeutet, kurz Ljuba. Davon sollte es genug für alle geben. Sie ordnet ihren bunten Seidenschal um die vollen Schultern, küsst Lev, ihren Bruder. Ihr hübsches Gesicht verschwindet in den Doppelkinnen. Wie zwei Putti kleben sich Ninotschka und Lenotschka an sie. Eine ausladende weibliche Laokoongruppe. Fast hätte ich mich dazugeschmiegt. Der angeekelte Blick der Ballerina hält mich gerade noch davon ab. Ich halte inne und gucke ebenfalls abfällig. Fast vierzig Kilo trennen uns.
Gegenüber meinem Vater Lev haben Nathanael, sein jüngster Bruder, und seine Frau Vera Platz genommen. Die beiden sehen aus wie eine misslungene Kopie meiner Eltern. Da Nathanael meinem Vater in allem nacheifert, hat auch er sich einen Bart stehenlassen. Auch er ist Architekt, wie Lev. Wie in der Geschichte vom Hasen und vom Igel ist Nathanael dazu verdammt, hinter seinem Bruder herzuhinken. Was immer er tut, Lev ist schon vorher da gewesen. Seine Lebensgefährtin Vera hat er offenbar nach dem Vorbild meiner Mutter gewählt. Da sitzen beide Frauen jetzt und lächeln einander in ihren violetten, ähnlich geschnittenen Kleidern unter ihren dunklen Stirnfransen hervor gequält an. Nathanael legt mit Besitzerstolz den Arm um Veras schmale Schulter, während Lauras schmale Schulter sich an den groben Strickpullover meines Vaters lehnt.
Salomon, Levs mittlerer Bruder, schwenkt gerade sein Wodkaglas so heftig, dass die Hälfte des Inhalts über das Tischtuch und den grauen Rock seiner unscheinbaren Gefährtin Lidaschwappt. Sie sieht ihn über ihren Brillenrand hinweg kränklich an. Ein Macho ist er. Großnasig ist er und ungewohnt hellhäutig. Der einzige Blonde der ganzen Runde. Seine Augen, so türkisblau wie die meines Vaters, schielen leicht auf seine Nase. Den riesigen Höcker darauf hat er Lev zu verdanken, der vor nun gut fünfunddreißig Jahren in kindlichem Ungestüm mit einer Zeichenschere auf ihn eingedroschen hat. Vermutlich wollte er deshalb weder Architekt noch Maler werden. Er ist Installateur.
Über dem Kamin hängt eine abgegriffene Schwarzweißfotografie im Lackrahmen. Sie zeigt einen gutmütig und blöde lächelnden Mann mit Glatze und Schnapsnase in Armeeuniform. Das ist Onkel Wanja, ein Kriegsveteran, unser Pseudo-Großvater, den die verstorbene Urgroßmutter Riwka im Krieg aufgelesen hat. Er hat meinen Onkel Eduard, meine Mutter und mich großgezogen. Eine versehrte Kriegswaise. Riwkas angeblich nie praktizierte Liebe. Ein Schrapnellstück sitzt, auch auf der grobkörnigen Aufnahme noch gut erkennbar, im Schläfenbereich seines Schädels, halb überzogen von Haut. Seine letzten vierzig Jahre verbrachte er in Frührente, die er, abgesehen von Quartalbesäufnissen mit unserem armenischen WG-Alkoholiker, hauptsächlich in das aktuell zu erziehende Kind der Familie investierte. Er ist schon ein Jahr tot. Um mich zu schonen, hat man mich aber bis jetzt noch nicht davon in Kenntnis gesetzt. Ich bin immer noch empört über seine lange Abwesenheit, die sich in akutem Schokolademangel niederschlägt.
Es wird gefeiert. Sie lachen, weil sie nicht weinen wollen. Sie wissen etwas, das ich nicht weiß. Ich weiß nicht, dass sie wissen, was ich nicht weiß. Dafür weiß ich, was sie nicht wissen: Aus Wut über mangelnde Aufmerksamkeit habe ich noch in der Küche in die große Porzellanschale mit dem Russischen Salat, der mir ohnehin nicht schmeckt, hineingespuckt und sehe nungebannt zu, wer dem benetzten Teil des Inhalts am nächsten kommt. Der Plattenspieler versorgt alle mit Jazz und Mozart, draußen tobt der Schnee. Drinnen toben die Kinder, die zwangsweise im Zimmer meiner Großmutter ins Bett gesteckt werden sollen.
Längst ist Ljuba, in ihren Pelz gehüllt, mit den dick vermummten Zwillingen im letzten gelben Trolleybus nach Hause gefahren. Wir sollen ins Bett, sonst, droht meine Mutter mit erhobener Stimme und Zeigefinger:
»Sonst kommt der Spaltkopf.«
Adrian lacht, Anastasija und ich wechseln unruhige Blicke. Großmutter Ada legt noch nach: Angeblich kann sie ihn bereits gangaufwärts hören.
»Er ist schon bald da. Wenn ihr nicht unter der Decke verschwindet, dann schwebt er über euch und frisst eure Gedanken.«
»Er saugt euch die Seelen aus!« Ada öffnet einladend die Tür.
So schnell bin ich noch nie im Nebenzimmer gewesen. Auf meiner Skala des Furchterregenden überholt der Spaltkopf die Baba Yaga, Bewohnerin des Häuschens auf Hühnerbeinen. Ist die russische Hexe im Märchen manchmal auch gut und hilfsbereit, so kann man das vom Spaltkopf nicht behaupten.
Meine Großmutter Ada sagt, er ist ein Geist. Ein im besten Falle unbeteiligter Geist.
Das Abgehobene hat einen besonderen Platz in der russischen Mythologie. Beide können fliegen, die Baba Yaga und der Spaltkopf. Sie verwendet einen Kessel, in dem sie hockt und mit einer Kelle sozusagen in ihrem eigenen Saft umrührt, um so den Flug zu steuern.
Der Spaltkopf braucht dazu nichts als menschliche Energie.
»Er hat keinen Körper«, flüsterte mir meine Mutter letztenWinter über die knisternde Kerze am Nachtkästchen zu, während der Widerschein ihre Züge zu etwas anderem, Unbekanntem verzerrte. Sobald die Flamme sich beruhigte, da kein warmer Atem sie zum Tanzen brachte, kehrte auch ihr Gesicht zu vertrautem Ausdruck zurück und machte mir keine Angst mehr.
»Er ist unsichtbar.« Ihre Augen leuchteten.
»Er ist einfach nur ein großer, schwebender Kopf, der sich über die Menschen stülpt. Und dann … saugt er sie aus. Wenn sie nicht aufpassen.«
Ich winde mich vor Anspannung.
»Kann man denn nichts, gar nichts gegen ihn tun?«, hauche ich.
»Doch, Mischka, doch!«, sagt meine Mutter. »Du musst ihn sehen. Wenn du ihn sehen kannst, hat er keine Macht mehr über dich.«
Meine ungeliebten Cousins werden auf einem knarrenden Metallklappbett untergebracht, mit einer Decke aus rauhem, mit Bauernzierschnüren bestickten Filzstoff zugedeckt, die aus Onkel Wanjas Soldatenmantel gefertigt wurde. Ekelerregend brav, wie sie nun mal sind, schlafen sie auch nach kurzem Protest tatsächlich ein.
Ich liege wach und versuche angestrengt, Gesprächsfetzen aus dem Nebenraum zu erhaschen. Wir bewohnen nur zwei Räume, im großen leben meine Eltern und ich, im kleineren Ada. Die hohe Flügeltür, die uns trennt, ist leicht geöffnet, durch den Spalt fällt ein schmaler Streifen Licht herein. Während ich horche, verklebe ich meine Wimpern mit Speichel. Nun bin ich ein augenloser Molch, der in der Tiefe seiner unterirdischen Seen keinen Sonnenstrahl kennt und sich nur durch sein Gehör orientiert. Anschließend lasse ich mich vom geöffneten Spalt des Interieurs inspirieren und onaniere gelangweilt. Kurz bevorich endgültig in einen winterlichen Traum absinke, höre ich noch die donnergleiche Stimme meiner Großmutter, die fordernd verkündet: »Wer diese Torte nicht isst, spuckt in meine Seele!«, und das daraufhin sofort einsetzende Scharren der Löffel auf den Tellern.
Während die einen schlafen und die anderen träumen,
vergeht die Nacht, der Morgen, der folgende Tag.
Sie belügen sich, und das Kind belügen sie auch.
Ich bin davon ungerührt.
Sie halten mich am Leben.
Der Schoß voller Blut, die frischen Spermaflecken auf der Haut.
Das ist die Tinte, mit der ich, ihr Chronist, ihre Leben festhalte.
Sie will vergessen und nicht verzeihen.
Ich vergesse nichts und verzeihe nichts.
Igor. Nicht Israil.
Die Zahl und das Wort und das Wissen.
Vorbei an den Zollbeamten führt mich mein Weg. Mit rotgoldenen Abzeichen und Orden behangen und großflächig grün, erwecken sie feierliche Neujahrsgefühle bei mir. Hinter die Absperrung in Nasenhöhe, in den langen Gang hinein. Wir befinden uns mitten in der Abreise Richtung Westeuropa, nach damaligem Wissensstand des durchschnittlichen russischen Bürgers also an der Grenze zwischen UdSSR und Mond. In unseren Koffern, die ein paar Tage später verlorengehen werden, lagern neben dem üblichen absurden Emigrationskram mehrere kiloschwere Säcke mit Buchweizen, die uns unsere eigentlich antisemitischen Nachbarn aus Georgien in patriotischer Sorge, dass wir in Österreich verhungern könnten, als Abschiedsgabe zugedacht haben. Meine Eltern, begleitetvon Großmutter Ada, haben die Wiedergeburt schon hinter sich. Sie stehen in der Halle, die zum Terminal der Flugzeuge führt.
Ich trete in den Gang, an dessen Anfang die heulenden Familienmitglieder versammelt sind, die der Sowjetunion erhalten bleiben. An dessen Ende scheint das Licht einer neuen Welt.
Ich habe von alldem keine Ahnung. Der Teufel reitet mich, an diesem Punkt des Weges kehrtzumachen. Hinter dem Markierungsstreifen bleibt Baba Sara, die kleine Mutter meines Vaters, zurück. Sie steht verkrampft dort, die Finger um die Packung starker Zigaretten geballt, die sie in der üppig mit Rosen bedruckten Tasche ihres Kaftans versteckt hält. Den hüftlangen, immer noch dichten Zopf hat Sara um die Brust drapiert. Mit der anderen Hand versucht sie, die Tränen in ihren violettblauen Augenringen zu verteilen, während sie lächelt, lächelt, lächelt und mir ab und zu mit nassen Fingern fröhlich zuwinkt.
Ich möchte sie ein letztes Mal umarmen. Baba Sara ist mir so ähnlich, dass ich bereits mit sieben Jahren weiß, wie ich mit fünfundsechzig aussehen werde. Kurz nähert sich die Vergangenheit der Zukunft an, wandern ich als ihre Erinnerung, sie als mein Zukunftsbild aufeinander zu. Die Zeit flirrt. Wenn wir uns berühren, löschen wir uns wie zwei einander entgegenrollende Wellen aus. Es erklingt ein vielstimmiges Aufjaulen auf beiden Seiten. Durchbreche ich die Absperrung, so drohen mir die Beamten den Rückweg vom Himmel zur Erde an.
Ich bremse unter lautem Verwandtengeschrei kurz vor dem Drehkreuz.
Wende mich ab von Baba Sara, gehe langsam wieder zum Ausgang.
Ich blicke nicht zurück.
Ich werde nicht mehr zurückblicken.
Unser Flugzeug hebt ab. Meine siebenjährige Vergangenheit schrumpft hinter mir zur Unkenntlichkeit zusammen, wie Mutters geliebtes selbstgehäkeltes Wollkleid, das unabsichtlich ins Kochprogramm geriet. Wenn ich Glück habe, können meine Puppen beides tragen.
Der elefantengraue Betonverhau des Palasts der Pioniere. Mein Geburtshaus auf der Wassiljewski-Insel, deren Newa-Brücken nachts für die durchreisenden großen Schiffe gehoben werden, um ihre Metallzähne in den frühen Morgenstunden wieder ineinanderzubeißen, urtümliche Dinosaurierhälse gegen den dauerrosigen Weißenachthimmel. Verwirrend weitläufige Verwandtschaft. Die Staatshymne im Kindergarten. Wir spielen »Lenin kehrt heim« und verteilen Pappmachéblumen. Die schwarzbraune Schuluniform, deren Ähnlichkeit zum bourgeoisen Gouvernantenkostüm mir erst nach langer Zeit in Wien bewusst wird. Das Abzeichen des Oktoberkindes steckt noch an meinem Pullover. Die roten Sträuße für die Paraden und die leergefegten Läden, unsere Kommunalwohnung mit ihren mannigfaltigen Bewohnern, Schenya, meine erste Liebe, dessen Nase ich noch vor kurzem aus Eifersucht an einem Baum blutig gestoßen habe. Die Geschichten, mit denen ich gewachsen bin, die mich Abend für Abend in die Zukunft begleitet haben:
Die Herrin des Kupferbergs, die sich in eine Eidechse verwandeln kann und gute Menschen mit Edelsteinen reich beschenkt, während sie üble zwischen den Steinmassiven ihrer Berge zermalmt. Grünäugig ist sie und geheimnisvoll. Die Baba Yaga, die mit ihrem Häuschen auf Hühnerbeinen durch die Sümpfe zieht. Mal hilft sie den Menschen, die sie aufsuchen, weil ihnen nichts anderes übrigbleibt, mal frisst sie sie, je nach Laune, auf. Der Spaltkopf, der sich von den Gedanken und Gefühlen anderer ernährt, ein teilnahmsloser Vampir, aufmerksam,unsichtbar, bedrohlich, hat jedoch etwas unangenehm Persönliches, ein privates Ungeheuer, auf meine Familie angesetzt, maßgeschneidert.
Meine Tante Ljuba erzählt ihren Kindern, im Keller des Hauses stehe eine große Flasche mit einem Höllenhund darin. Nun meidet meine Cousine sogar den Kellerabgang, aus Angst, der Hall ihrer Schritte könnte das Monstrum wecken. In ihrem Keller lagern aber nur mehrere Paletten Selbstgebrannter, unter alten Zeitungen versteckt. Dieser Höllenhund – allzeit bereit, aus den Flaschen zu fahren – ist in nahezu jeder Kommunalwohnung zu finden. Man hegt und pflegt ihn.
Freund und Feind – alles zerstiebt hinter dem Röhren der Turbinen, das mich langsam in den Schlaf wiegt. Ich bin überzeugt von den elterlichen Reiseangaben: Wir fahren auf Urlaub nach Litauen. Der tränenreiche Abschied am Flughafen erscheint deshalb ein wenig überzogen. Im Flugzeug befindet sich ein gleichaltriges Mädchen. Mit ihm gerate ich in wilde Streitigkeiten, weil es sich erdreistet, mir ins Gesicht zu lügen. »Wir fliegen nicht nach Wien!«, sage ich.
Ich soll unrecht behalten.
Das goldene Papier der im Flugzeug gereichten Mozartkugel ist zu schön zum Zerstören. Die vollendete Form in meiner Hand schmilzt, während ich sie bewundere. Ich werde meine Heimat später hartnäckig suchen, wie ein blöder Hund, den man kilometerweit abtransportiert hat und der beharrlich in die falsche Richtung zurücklaufen möchte.
Zur Übung lassen mich meine Eltern bereits Wochen vor der Abreise im Finstern tappen. Während sich die Kartons um mich herum zu türmen beginnen, ist von einem Umbau der Wohnung die Rede. Ich wandle in ihren Schatten wie am Fuße des Turmes zu Babel. Bis heute macht mich der Anblick von unausgepackten Kisten unruhig, sie scheinen ein bösartiges Versprechen zu beherbergen. Bei jedem Umzug häufe ich sie hasserfüllt in unübersichtliche Ecken.
Die Lüge hat einen simplen, gutgemeinten Hintergrund. Ein Täuschungsmanöver für die weniger vertrauenswürdigen Bekannten und für mich, den unberechenbaren Faktor Kind, der in seiner Ahnungslosigkeit bereits einiges Unheil angerichtet hat: Meine Großmutter Ada, die ein paar westliche Austauschstudentinnen unterrichtet, wird von ihrer Lieblingsschülerin hin und wieder zu Hause besucht. Bei einem dieser Anlässe fällt für mich ein Spielzeug made in USA aus echtem Fell ab. Noch in der folgenden Stunde breche ich Judas das Versprechen, den Mund zu halten. Überwältigt von dieser Gabe des aggressiven Kapitalismus, brüste ich mich vor versammeltem dankbarem Publikum damit.
Wochenlanger Schrecken für die Familie ist die Folge. Die riskanten Privatkontakte zu Ausländern bringen schnell den Verdacht der Kollaboration mit sich. Mit einem solchen Vermerk verringern sich die Chancen, eine Ausreisebewilligung zu ergattern gegen null. Unsere Wohnung, bestückt mit einem Spionoberst in Reserve mit Pensionsschock, ist zudem ein fruchtbarer Boden für absurdeste Meldungen an die Ämter. Von lähmender Sinnlosigkeit gequält, hockt dieser Held der Arbeit stundenlang vor dem einzigen WG-Telefon und stenografiert alle Gespräche, die ungerührt vor seiner Nase geführt werden, in ein eigens dafür angelegtes Dossier. Er sitzt dort im Halbdunkel und schwitzt moralische Verpflichtung dem Vaterland gegenüber aus jeder glänzenden Pore.
Unsere Wohngemeinschaft beherbergt nicht nur Wahnsinnige, Alkoholiker und brave Leute, aus deren Mitte meine Freundin Lenka und ich stammen, sondern auch eine alternde Geheimprostituierte, Tante Musja, die offiziell die Koordination der Universitätsaktmodelle innehat. Ihr gehört das Zimmerchenneben den zwei Räumen, in denen unsere Familie untergebracht ist. Kinderlos und einsam, stillt sie ihre Bedürftigkeit, indem sie uns Kinder immer wieder einlädt und Naschereien an uns verteilt, gewohnt, ihren Besuchern das Leben zu versüßen. Immer betreten wir ihr Reich mit einer leisen Vorahnung von Hänsel und Gretel. Wir spüren, dass sie eine Ausnahmestellung in der sozialen Rangordnung einnimmt. Gerade noch geduldet, obwohl sie doch sehr freundlich agiert. Das kann man von vielen anderen Mitbewohnern nicht behaupten.
Mal wirft die Manisch-Depressive im letzten Korridorzimmer brüllend ihr gesamtes Mobiliar durch das Gangfenster auf die Straße und alle tragen es in stoischer Ruhe am nächsten Tag gemeinsam wieder hinauf. Mal prügelt die Alkoholikerin im küchenseitig gelegenen Kabinett ihren Sohn und wird daraufhin, der Hackordnung folgend, von ihrem Mann geprügelt, um sie wieder zur Räson zu bringen. Und oft auch, weil die letzte Weinflasche leer ist. Im besenkammergroßen Raum unseres Armeniers finden wilde Schnapsgelage statt, zu denen sie wegen ihres schrillen Organs nicht eingeladen wird. Deswegen wird in der Gemeinschaftsküche oft über Zugezogene hergezogen. Wir fünf WG-Kinder fallen weit vom Stamm und lieben ihn heiß, den Armenier, weniger für seinen schwankenden Gang und seine schwankenden Stimmungen, auch nicht dafür, dass man ihn weit gangaufwärts am Geruch erkennen kann. Er arbeitet in einer Spielzeugfabrik. Jeder Skandalrausch wird in den nächsten Tagen reuevoll von einer Geschenkflut an uns Kinder begleitet. Die Aufmerksamsten unter uns lungern oft beim Eingang herum, um ihn gleich bei der Tür abzufangen und zu kontrollieren, ob er mit Wodkaflaschen beladen ist. So lässt sich der Zeitpunkt der Bescherung besser vorherbestimmen.Ganz zu schweigen vom verbotenen Ort, den drei Zimmern, die unser pensionierter Spion mit seiner schönen, dicken Frau in sowjetischem Luxus bewohnt und die von allen anderen in seltener Einträchtigkeit und großem Bogen gemieden werden.
Tante Musjas Zimmerchen dagegen ist eine rauschige Nippeshöhle, bis an die Decke vollgestopft mit Geschenken ihrer Kavaliere, von einer kleinbürgerlichen Behaglichkeit, die uns fremd ist. Ein Sesam-öffne-dich, hinter dessen Pforten Kristalldöschen, mit Bonbons gefüllt, auf pastellfarbenen Plastikschüsselchen unbekannten Inhalts getürmt stehen.
Mit acrylseidenen Zierkissen im Himmelbett voller weicher Daunendecken. Mit Häkelfetzen an jeder erdenklichen Ecke, mit unzähligen Porzellanfiguren, mit einem echten, kuscheligen Pelzteppich, auf den sie besonders stolz ist und den wir nie betreten dürfen.
Eines verhängnisvollen Tages überkommt uns die Anarchie. Vom kalten Regen überrascht und von den mit Überleben beschäftigten Erwachsenen uns selbst überlassen, stürmen wir unbemerkt Tante Musjas Reich, an dessen Schloss wir schwitzend vor Aufregung über eine Stunde herumgewerkt haben.
Mit einem widerspenstigen Klicken der Tür ergibt sich uns der Raum, den wir, verwundert über die eigene Kühnheit, schaudernd betreten.
Alles das, was uns nur zum andächtigen, grifflosen Bestaunen geboten wurde, ist jetzt unser! Anfangs noch zögerlich, überkommt uns bald die Raserei. Wir öffnen Döschen, Lädchen, Konfektschachteln, deren Inhalt wir, bald übersättigt, auf Bett und Boden verstreuen. Kückengelbe Zuckerbällchen rollen über Rüschenleintücher. Wir türmen fliederfarbene Polyamidunterwäsche am Boden auf. Wir werfen eine Schäferin mit Schäfer um und schieben den Scherbenhaufen unters Bett.
Mit dem Bersten des Porzellans öffnen sich die Tore der Hölle:
Wo wir gerade noch bewundert haben, wollen wir vernichten.
Mit Geschrei und ohne jede Vorsicht wälzen wir uns nun im Bett, werfen die Kissen durcheinander, dass die Federn nur so stieben, springen auf der knarrenden Matratze bis zum Plastikluster hoch.