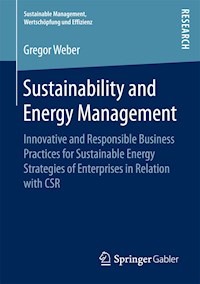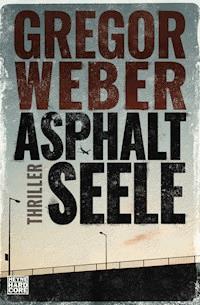11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Ein Roman über Freundschaft, Liebe und die pure Lust am Essen
Endlich: Erfolgsautor Gregor Weber („Kochen ist Krieg“) kehrt zurück in die Küche, aber anders als gedacht! In seinem neuen Roman, einer rasanten Mischung aus Retro-Science-Fiction à la Jules Verne, Steampunk und märchenhafter Parallelwelt, erzählt er mit überbordender Fantasie von Intrigen und Gaunereien in einer Welt, in der Kochen eigentlich verboten ist, Köche aber mit Gold aufgewogen werden. Atemlos verfolgt der Leser die Abenteuer von Carl Juniper, der sich nach einem Schiffsbruch vor Kap Hoorn in einer fremden Welt wiederfindet…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 439
Ähnliche
Inhalt
Carl Juniper ist Koch auf einem Luxusdampfer. Als er bei einem Landgang in den Armen einer schönen Hure die Zeit vergisst, verpasst er sein Schiff und muss auf einem heruntergekommenen Frachter anheuern, der im Jahr 1913 vor Kap Hoorn Schiffbruch erleidet. Carl verliert das Bewusstsein – und erwacht in einer seltsamen, düsteren Welt, in der sich die Menschen gesund, aber ausschließlich von Pillen ernähren. Nur noch wenige wissen, welchen Genuss wirkliches Essen bedeutet, doch sie müssen ihrer Leidenschaft heimlich frönen. In dieser Schattenwelt sind Köche wie Carl eine gesuchte Spezies. Ausgerechnet in diesem Milieu findet er seine große Liebe Polly, gerät aber schon bald in den Machtkampf rivalisierender Banden.
In seinem neuen Roman, einer rasanten Mischung aus Jules Verne und Steampunk, kehrt Erfolgsautor und Koch Gregor Weber zurück zu seinem Lieblingsthema. Mit überbordender Fantasie erzählt er von den Intrigen und Gaunereien in einer Welt, in der Kochen eigentlich verboten ist und Köche deshalb mit Gold aufgewogen werden.
Autor
Gregor Weber, 1968 in Saarbrücken geboren, ist mit der Seefahrt und dem Handwerk des Kochens bestens vertraut. Nach einem Jahr bei der Marine, nach Studium und Erfolgen als Schauspieler ging er bei Kolja Kleeberg vom Sternerestaurant VAU in Berlin in die Lehre. Seine Erfahrung in den Küchen verschiedener Spitzenrestaurants verarbeitete er in seinem Bestseller »Kochen ist Krieg«. Bei Knaus erschienen von ihm die Kriminalromane mit Kommissar Grewe. Gregor Weber lebt mit seiner Familie in der Nähe von München.
ROMAN
Knaus
1. AuflageCopyright © 2015 beim Albrecht Knaus Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbHUmschlaggestaltung und -illustration: Sabine Kwauka unter Verwendung von shutterstock-MotivenSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-16586-4www.knaus-verlag.de
Nun bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei.Die Liebe aber ist die Größte unter ihnen.
Yorkshire 1915
Dass er jemals wieder die sanfte Wärme eines Frühlingstages auf der Haut spüren, mit geschlossenen Augen lächeln und nichts als den Augenblick fühlen würde, hatte er sich lange Zeit nicht vorstellen können.
Nach der Dunkelheit. Nach dem Rauch und dem Feuer. Nach der eisigen See. Nach der Angst. Nach dem Schmerz.
Nachdem sein Herz gebrochen war.
Aber hier war er.
Saß auf der grün gestrichenen Holzbank, hinter sich die hohe Feldsteinmauer, vor sich Beete mit Kohlrabi, Spinat, Radieschen, Kopfsalat und jungen Kräutern. In den nächsten Tagen würden sie die ersten Erdbeeren ernten können. Er roch Erde, die Wildblumen, die am Fuß der Mauer sprossen.
Kaum ein Lufthauch. Stille.
Nur leise verwehte das Klappern von Geschirr. In der Küche wurde der Nachmittagstee vorbereitet.
Im Garten hatte er seit Ende des Winters oft geholfen. Das tat ihm gut. Ab und zu kochte er jetzt auch wieder. Doktor Blakesley, der eigentlich Major Blakesley war, wertete das als großen Fortschritt.
»Willkommen zurück im Leben, Petty Officer Mulrooney«, hatte er lächelnd gesagt und dabei die Hand auf seine Schulter gelegt, »Koch ist doch ein schöner Beruf. Ich wünschte, ich könnte vernünftig kochen. Oder besser gesagt, meine Frau wünscht sich das.«
Sein Lächeln war noch breiter geworden. Der akkurat getrimmte Schnurrbart, rot mit ersten weißen Haaren, hatte sich links und rechts der Nase nach oben gebogen.
Er hatte genickt. Ja. Ein schöner Beruf.
Das fand er noch nicht so lange.
Viele Jahre lang hatte er gar nicht darüber nachgedacht. Es war einfach das, was er tat. Hier, im Wharncliffe War Hospital, wurde man von Doktor Blakesley und anderen Ärzten immer wieder mal gefragt, was einem zu Begriffen als Erstes einfiel. Vor ein oder zwei Jahren – vielleicht auch vor einem halben Jahr, dass er das nicht so genau sagen konnte, war ein Teil dessen, was ihn hierhergebracht hatte – wären ihm zu dem Wort »Koch« zuerst die vielen Prügel eingefallen, die Schnittwunden und Verbrennungen. Der schmerzende Rücken beim Putzen am Abend.
Heute dachte er an betörende Düfte aus Töpfen und Pfannen. An die Gesichter der Gäste, wenn das Essen zum Tisch kam. An die wilde Freude, mit der sie zu sich nahmen, was eigentlich gar nicht existieren durfte.
Würde einer der Ärzte ihn jetzt fragen, was ihm als Erstes einfiele, würde er so etwas sagen müssen.
Aber er würde es niemals sagen.
Weil es zwei sehr unterschiedliche Auffassungen darüber gab, was zwischen den beiden Schiffbrüchen geschehen war. Tatsächlich konnte es überhaupt nur einen der beiden Schiffbrüche gegeben haben. Entweder den ersten, dann war seine Erinnerung richtig, so unglaubhaft sie auch erschien. Oder den zweiten, dann hatte die Royal Navy recht.
Dann war er Petty Officer Harold P. Mulrooney, Kochsmaat auf HMS »Good Hope«. Überlebender des Seegefechts bei Coronel, bei dem die Royal Navy am 1. November 1914 eine vernichtende Niederlage gegen die Kaiserliche Deutsche Marine erlitten hatte.
Über all das wusste er nichts.
Das hieß aber nicht, dass er ohne Erinnerung war. Er war zum Platzen voll mit Erinnerungen. An das Leben vor dem Tag, an dem er zuerst in eisiger See versank, um dann vom Himmel zu fallen. An einen Ort, an Menschen, an Ereignisse, so rätselhaft und fremd, dass sie gut ein Fiebertraum sein konnten, ein flirrendes, trügerisches Bild. Aber die Erinnerung daran war so stark und lebendig, und sein Herz sehnte sich so sehr, dorthin zurückzukehren, dass es doch wahr sein musste. Er träumte Tag und Nacht von diesem Ort, den es nach Meinung aller anderen nicht gab, nicht geben konnte.
Aber wenn es diesen Ort doch gab, wenn er dieser Mann war, dann war der Tag, von dem alle hier sagten, dass es doch sein glücklichster sein musste, in Wahrheit der unglücklichste. Weil sein Leben an diesem Tag jede Bedeutung eingebüßt hatte, jeden Sinn. Und weil er sich selbst vollständig verloren hatte.
Der Navy galt er als vom Schicksal erkorener Überlebender, der Einzige von mehr als tausendsiebenhundert Männern, der gerettet wurde. Er selbst sah sich jedoch als in dunkler See treibend, blind, hoffnungslos. Er wusste, wer er war, wie es schließlich jeder gesunde Mensch wusste, aber alle Welt wollte ihm beweisen, dass er sich irrte. Und erklärte ihm, jemand zu sein, den er nicht kannte.
Er kannte Harold P. Mulrooney nicht.
Er kannte nur Carl Juniper.
Untergehen
Carl Juniper war kein Decksmann. Keiner, der bei brüllendem Sturm steifgefrorene Leinen bändigte oder mit eiserner Hand das Ruder gegen wütend schlagende Brecher hielt. Er war auch kein Heizer, der in brennender Hitze unermüdlich Kohlen schaufelte oder mit fauchendem Schweißbrenner Dampfkessel flickte. Juniper war kein Wachoffizier, der mit eisblauem Blick den Himmel und die See las. Und er war kein Steuermann, der mit dem Sextanten die Gestirne maß und die Position und den richtigen Kurs bestimmte.
Carl Juniper war Schiffskoch.
Aber er fuhr lange genug zur See, um zu wissen, dass es mit der »SS Birmingham«, einem bald zwanzig Jahre alten, völlig heruntergekommenen Dampfer, zu Ende ging. Weil sie nur noch vom Rost zusammengehalten wurde. Weil ihre Spanten nicht ächzten, sondern sterbend schrien. Weil der Kapitän ein rotpockiger Säufer war, der jetzt totenbleich aus dem Ruderhaus in die gischtige Hölle starrte, das Maul bis zum Herz aufgerissen, aber kein Ton kam heraus. Weil Tiny Tam, der narbengesichtige Rudergänger, seine Lippe blutig gebissen hatte, während seine Adern zum Platzen geschwollen waren. Weil Juniper am Schott zum Kesselraum gesehen hatte, wie der zweite Ingenieur seine Leute mit einem Eisenrohr den Niedergang herunter und zurück auf Station prügelte. Sie trugen schon Korkwesten, und ihre Augen rollten wirr. Die Heizer kamen immer als Letzte aus sinkenden Schiffen. Und wenn das Schiff schnell sank, meistens gar nicht.
Die »Birmingham« würde sinken wie ein Stein. Ihre Laderäume waren voll Getreide. In Valparaiso sollten sie Guano aufnehmen. Pinguinscheiße. Um in Europa Getreidefelder zu düngen. Ein Kreislauf, an dem die Existenz von jämmerlichen Reedereien wie der »Clapham & Wilkes Steamboat Company« hing. Und die der armen Schweine, die auf ihren schwindsüchtigen Kähnen die Weltmeere befuhren.
Valparaiso war noch weit weg. Hinter Kap Hoorn. Juniper wusste nicht genau, wo sie jetzt waren. Irgendwo zwischen South Georgia und den Falklands. Traurige, karge Felsen im kalten Südatlantik. Aber bewohnt. Mit Häusern und warmen Öfen. Unsinkbar. Man saß in der Stube und ließ den Sturm über die Dächer jagen. Dachte mit leisem Schaudern an die Schiffe draußen im Ozean.
Das Vorschiff der »Birmingham« hob sich wieder in den grellgrauen Himmel, das Wasser verschwand. Juniper krallte sich in die Messingleiste, die unter den Seitenfenstern des Ruderhauses entlanglief. Der Kapitän stöhnte laut. Sealgrave, der am Maschinentelegrafen stand, stierte auf den Messinghebel, und Tiny Tam am Ruder sog seine blutende Unterlippe wieder zwischen die noch verbliebenen Zähne.
Als die »Birmingham« den Kamm der Dünung erreicht hatte, die Füße der Seeleute nicht mehr vom Aufwärtsflug auf die Decks gepresst wurden, alles zu schweben schien, hörte Juniper trotz des brüllenden Sturms, des knarrenden Holzes und des ächzenden Stahls hinter sich Stiefeltritte, Atem, das Knarzen von Ölzeug.
Seeleute drängten sich im Längsgang unter der Brücke und schoben sich die Stufen des Niedergangs herauf. Auch sie trugen Korkwesten. Ihre Augen waren weißblinkende Fenster der Furcht. Sogar die der Chinesen, die sonst immer so geheimnisvoll schmal und unleserlich schatteten.
Die »Birmingham« verlor das Wasser unter sich, das Deck schwand unter den Füßen der Besatzung, und das dreieinhalbtausend Tonen große Schiff stürzte zu Tal. So schnell, so jäh, dass die Männer auf dem Niedergang, dem Fall des Schiffes gehorchend, durch das schmale Schott nach oben flogen und Juniper mit sich rissen.
Die arme »Birmingham« wollte zurück in die See, aufschwimmen und sich retten, neigte dazu ihren Bug nach unten, dem höllischen Grau und Weiß entgegen. Der Kapitän, Tiny Tam und Sealgrave stemmten ihre Seestiefel gegen den Fall, lehnten sich hintüber, während Carl Juniper und weitere vier Mann ineinander verkrallt nach vorn kugelten. Carl warf seine Arme in beide Richtungen und fasste nach Halt, den er am Schott zur Steuerbordnock auch fand. Die Schiffskameraden stürzten schreiend vorbei, und zwei schlugen so heftig auf eine Frontscheibe des Ruderhauses, dass diese zersprang.
Die »Birmingham« stürzte, die wütende See stieg. Der Rumpf zitterte, der Stahl weinte, als aus dem freien Fall mehr und mehr ein Gleiten wurde. Die See sog die »Birmingham« wieder an sich und hinab ins Dunkle. Gischt und grünes Sturmwasser schossen durch das zersprungene Glas.
Juniper wurde von der hereinbrechenden Woge aus der Brücke gespült und stürzte den Niedergang hinunter. Das Letzte, was er hörte, bevor seine Welt schwarz wurde, war der Schrei des Kapitäns.
»Alle Mann von Bord. Rette sich, wer kann.«
Carl Juniper schlief stets traumlos und tief. Dafür ging sein Geist am Tag auf Reisen, was ihm in den ersten Jahren manche Backpfeife von älteren Köchen eingebracht hatte.
Dieser Schlaf war anders. Er war voller verschwommener Bilder, wirrer Laute, starker Gerüche. Die Rohrleitungen an der Schiffsdecke, der tanzende Orkanhimmel. Nasser Filz und brettsteife Leinwand. Holz und ein zarter Duft von Rum. Nasse Hanftaue. Und immer wieder kaltes Salzwasser. Vielleicht war das der Übergang der Seemannsseele in die andere Welt. Juniper glaubte zu lächeln, während er sich vorstellte, in der sanfthügeligen Heide bei Bristol zu erwachen, wo er aufgewachsen war. Oder an einem Südseestrand, inmitten dunkelbrauner Mädchen.
Tatsächlich sah Juniper dann das verzerrte Gesicht von Billy Bunkston, dem Ersten Offizier. Was Bunkston brüllte, konnte Juniper nicht verstehen, der Sturm war lauter, das Geschrei der anderen Seeleute. Aber Juniper merkte, dass er festgebunden war. Bunkston brüllte weiter, nickte und stierte wild, dann wurde das, worauf Juniper lag, hochgehoben und über Bord geworfen. Juniper schrie jetzt auch, dachte aber zugleich, dass es wenig Sinnloseres geben könnte, als gegen einen außer sich geratenen Ozean anzuschreien.
Die kochende See schlug salzig über ihm zusammen, er glitt wieder zurück in die seltsamen Träume, die jetzt nur noch aus Gluckern und Rauschen bestanden, aus heulendem Wind und eiskaltem Wasser. Und leiser wurden. Und grauer. Und dann Dunkelheit.
Und dann nichts mehr.
Als Carl Juniper dann doch noch erwachte, war die See fast glatt. Der Wind wisperte nur noch. Die Sonne schwebte über dem Horizont, doch Juniper konnte nicht sofort sagen, ob sie gerade auf- oder unterging. Ihre Strahlen waren unendlich weit weg und wärmten nicht.
Er lag auf einem der Rettungsflöße, die an Deck der »Birmingham« verzurrt gewesen waren. Die Kameraden hatten ihn wohl festgebunden, damit keine Welle den Ohnmächtigen einfach mit sich reißen konnte. Die Kameraden.
Wo waren sie?
Juniper drehte den Kopf von links nach rechts. Nur Wasser. Leicht steigend und fallend, von sanftem Wind bewegt. Er konnte nur in zwei Richtungen sehen, daher bewegte er Arme und Beine, wand den ganzen Körper und befreite sich von den rettenden Tauen. Kauerte sich auf angezogene Knie und nahm Rundumblick.
Niemand. Nichts. Nur Ozean.
Er war allein.
Die Flöße hatten an Oberdeck gelegen, um bei schnellem Sinken des Schiffes aufzuschwimmen. Warum man ihn mit dem Floß schon vorher in die See geworfen hatte, wusste Juniper nicht, und so wie die Dinge lagen, würde er das auch nicht herausbekommen. Ob noch Kameraden auf dieses Floß gelangt und dann heruntergespült worden waren oder ob er von Beginn an einsam und alleine durch den Südatlantik getrieben war – nur Neptun konnte diese Frage beantworten. Und Neptun kannte Juniper bloß von den Äquatortaufen, wo er meistens vom Bootsmann dargestellt wurde.
Juniper wusste nicht annähernd, wo er war und wie die Strömungen liefen. Und wenn, hätte es ihm ja auch nichts genützt, denn das Floß verfügte weder über Ruder noch Segel. Er war ganz den Launen von See und Wind ausgesetzt und einem Schicksal, das ihn vielleicht bei Tageslicht in Sichtweite eines anderen Schiffes treiben ließ.
Mit einem Wort, Carl Juniper war so gut wie verloren.
Das Floß war eine einfache Konstruktion. Leere Fässer, zusammengebunden und mit Holzbrettern umbaut. Aber in der Mitte des Decks befand sich eine kleine Klappe, wohl abgedichtet und mit einem Messingriegel verschlossen. Darunter war ein Hohlraum, in dem ein kleines Fass Frischwasser, ein Vorrat Schiffszwieback und eine Flasche Rum bewahrt wurden. Billy Bunkston, ihr Erster Offizier, war im Chilenischen Bürgerkrieg auf einem Schmuggler gefahren und hatte dort die Vorzüge der Flöße gegenüber den nur schwer und oft zu langsam zu Wasser zu bringenden Booten kennengelernt.
Bunkston. Ein guter Offizier. Davon gab es Junipers Erfahrung nach nicht viele und jetzt wohl wieder einen weniger.
Juniper trank etwas Wasser und schöpfte dadurch die Kraft, nicht gleich das ganze Fass auszusaufen. Obwohl es vermutlich gleichgültig war, wie gut er sich das Wasser einteilte. Entweder würde er in den nächsten zwei Tagen gefunden oder sterben. Wenn nicht verdursten, dann erfrieren, von Haien gefressen werden, ertrinken. Was auch immer.
Es gab keinen Zweifel mehr, die Sonne ging unter.
Er hob die Rumflasche gegen das schwindende Licht. Echter Jamaika. Braungolden. Genau das Richtige, um sich die letzten Stunden zu versüßen. Wenn er dann wissen würde, dass es die letzten waren.
Rum hatte ihn überhaupt erst auf die »Birmingham« gebracht. Und Absinth. Und Lagerbier. Und Isobel aus dem »Madame Abigail’s«. Sie hatte sich in der dunkelplüschigen Ecke an ihn geschmiegt, seine Hand genommen und an den Träger ihres Kleids gelegt.
»Mach schon, Carl Juniper, und schau genau hin.«
Er hatte den leichten Stoff von ihrer Schulter geschoben, die heiße Haut gestreift und sich darübergebeugt.
Eine Rosenranke schlang sich um Isobels helle Brust. Zartgrün der Zweig, so rot die Blüten.
»Willst du sehen, wo sie wächst?«, hatte sie ihm ins Ohr gelispelt und dabei seinen Schenkel gestreichelt.
Und Carl Juniper hatte den nicht unbeträchtlichen Rest seiner letzten Heuer auf den Tisch des Etablissements gelegt, um auf Isobels Haut zu lesen und Champagner aus ihrem Mund zu trinken.
Was sollte er auch mit dem Geld? Am nächsten Morgen würde er als Chef Entremetier auf dem nagelneuen Passagierdampfer »SS City of Rio de Janeiro«, dem Stolz der »British American Atlantic Line«, in See stechen und schon in New York wieder doppelt so viel Geld besitzen, als ihn dieses Vergnügen kostete. Und das würde nur der erste Hafen einer langen Reise sein.
Weil Isobels Arme so weich und die Bilder auf ihrer Haut so schillernd und schön waren, weil auch die zweite Flasche Champagner so kühl war und vielleicht auch, weil Juniper sich von Isobel ein Pfeifchen Opium aufschwatzen ließ – aus all diesen Gründen lief die »City of Rio de Janeiro« am 15. Februar 1913 mit seinem Seesack und seiner feschen Uniform für den Landgang, aber ohne den neuen Chef Entremetier aus Liverpool aus.
Und Carl Juniper musste, um bei der Reederei die Strafe für sein Fernbleiben zu zahlen und überhaupt ganz allgemein wieder über Geld zu verfügen, die erste Heuer annehmen, die man ihm bot.
Und so fuhr er nicht mit zwei Dutzend anderen Köchen auf einem schwimmenden Luxushotel, wo sie erlesene Menüs für verwöhnte Gaumen bereiteten, sondern als einziger Smutje auf der armen verrosteten »Birmingham«, wo er für rund fünfzig hart arbeitende und fluchende Seeleute versuchte, aus miesem Proviant nicht ganz so mieses Essen zusammenzurühren.
In Santos hatten sie Frischwasser, Kohle und neuen schlechten Proviant aufgenommen, dann waren sie Richtung Kap Hoorn gedampft. Es war nicht die allerschlimmste Jahreszeit für eine Umrundung, und mit dem Dampfer war es wohl weit weniger grauenhaft als auf einem Segler, aber dennoch hatten alle Seeleute Respekt vor dem Kap und seinen Stürmen.
Und nun hatte es die »Birmingham« noch nicht mal bis dorthin geschafft.
Dunkelheit fiel über das unendliche Wasser. Juniper fror erbärmlich. Er aß zwei Stück Schiffszwieback und fand, dies sei ein guter Moment, um zu weinen. Doch es wollte keine Träne kommen. Er konnte sich den Tod nicht vorstellen, genauso wenig seine Rettung. Er sah sich auf ewig treiben und mit sich selbst reden. Die Sonne würde aufgehen und untergehen, ebenso der Mond. In jeder Dunkelheit würde der südliche Sternenhimmel über ihm erstrahlen, den er nicht lesen konnte, was er jetzt sehr bedauerte. Juniper hatte sich nie für Nautik interessiert. Immer nur für die Freiheit der Seefahrt, den frischen Wind und die in Schnaps und wilde Küsse getränkten Häfen.
Immerhin. Liverpool war ein würdiger Abschied gewesen, auch wenn Juniper damals natürlich gedacht hatte, es würde noch Hunderte solcher Nächte geben. Juniper fühlte ein Lächeln, doch es ließ sich nicht zeigen, sein Gesicht war zu eisig. Es wäre in tausend Stücke zersprungen. Er sicherte sich wieder – so gut es eben ging – mit den Tauen und wollte sich von der See in den Schlaf wiegen lassen. Seine Augenlider wurden schwer, er war dankbar. Bitte, wer auch immer da oben, lass mich schlafen. Weck mich mit der Sonne oder gar nicht. Amen.
Juniper schlief ein, nicht tief, dann tauchte er wieder knapp über die dünne Oberfläche, nahm den Ozean wahr. Und sank wieder zurück. So ging es eine Weile, schließlich sank er tief und tiefer und blieb am Grunde seiner Seele.
Und schreckte hoch, ohne zu wissen, wovon. Lauschte angestrengt. Die See sang ein neues Lied. Wo sie seit Stunden in kurzer Dünung gekabbelt hatte, rauschte sie jetzt geschwind an Junipers Floß entlang. Wind war aufgekommen. Juniper löste seinen Oberkörper aus dem Tauwerk, drehte sich auf den Bauch und schlang seine Unterschenkel fester in die Seile.
Er hatte keinen Anhaltspunkt für seinen Blick, konnte keine Peilung nehmen, wie die Decksleute immer sagten. Dennoch war er sich nach einigen Minuten sicher: Eine Strömung hatte sein Floß erfasst. Und sie wurde schneller. Die See trieb oder zog ihn. Der Mond war noch nicht aufgegangen und der Himmel von Wolken verhangen. Nur ein schwacher Widerschein der Sterne glomm hie und da kalt auf den Wellen.
Eine Strömung auf offener See, bei wenig Wind, das musste doch Land bedeuten, oder? Juniper verfluchte, dass er in zehn Jahren auf See nichts über diese Dinge gelernt hatte.
Aber er spürte es genau. Ja. Das Floß trieb nicht mehr, es fuhr.
Juniper kniff die Augen zusammen und spähte nach vorn. Jeder Kamerad wäre ihm in dieser gottverlassenen Einsamkeit lieb gewesen, aber Jeremiah Olsson wäre jetzt fraglos der beste Mann an seiner Seite. Jerry Olsson konnte mit seinen eisblauen Augen bis über den Horizont schauen. »Der sieht schon am Tag vorm Einlaufen, wie die Weiber im Puff aussehen«, hatte Tiny Tam gepoltert und Olsson dabei so auf die Schulter gehauen, dass es krachte. Olsson war eigentlich Walfänger und aus ähnlichen Gründen wie Juniper auf der »Birmingham« gelandet.
Olsson könnte jetzt sehen, was vor ihnen lag, gleich wie schwarz der Himmel war.
Juniper schnüffelte in die Luft, Land konnte man manchmal riechen. Aber da war nur Salz. Schade, dass es Nacht war, am Tag würden Möwen und Schwalben nahes Land ankündigen.
Das Floß wurde schneller und schneller. Und dann drang Rauschen an Junipers Ohren. Brandung. Ja. Das musste die Brandung sein. Dort voraus schlug der kalte Atlantik an Felsen oder feinen Sand. Was genau es war, war Juniper gleichgültig, er würde sich mit Händen und Zähnen daran klammern, wenn die See ihn dagegenwarf.
Juniper lachte laut in den Wind und dem Zischen und Brodeln entgegen. Er stemmte sich so hoch hinaus, wie er nur wagte. Dann sah er es.
Gischt. Aufwogende See. Nicht mehr weit. Gar nicht mehr weit.
Aber …
Wo war das Land?
Wo die schroffen Felsen, an denen die See zerschellte?
Wo der sanfte Strand, auf den der Ozean mit Wucht brandete, um schließlich vor den Dünen leise auszurollen?
Wo?
Da war nichts außer Wasser.
Das Wasser schlug an nichts als sich selbst. Es kochte und wogte nur in sich.
Ein Strudel.
Das Floß begann, sich um sich selbst zu drehen, und Junipers Lachen erstarb. Eine Welle schlug über das Floß, und Juniper bekam noch gerade eben ein Tau zu fassen. Er kroch unter das Seilgeflecht, wand seine Arme und Beine hinein. Nur nicht das Floß verlieren, nur nicht in die See stürzen.
Juniper starrte ins graue Dunkel, Streifen von Gischt brachen weiß heraus, das Floß drehte sich schneller um sich selbst und um eine brüllende Finsternis, die er nur hörte, aber nicht sah. Welle um Welle raste über ihn, prügelte seinen Körper auf das dünne Deck, kroch eiskalt in ihn hinein. Wind und Wasser verstopften seine Ohren, nur ein Rauschen und Gurgeln blieb. Salzige See krachte in seinen Mund, strömte in seine Nase. Immer weniger Luft erreichte Junipers Lungen, und Lichtblitze hinter den Augen kündigten die kommende Schwärze an. Und bevor der Schiffskoch Carl Juniper irgendwo im Südatlantik das Bewusstsein verlor, merkte er, dass er weinte.
Fallen
Dunkelheit.
Das Toben der See hat Carl Juniper in seinen eisigen Krallen und dreht und zerrt und schlägt ihn. Ist er noch bewusstlos? Das muss er wohl sein, denn er ist unfähig, sich zu bewegen, seine Augen zu öffnen. Wie lange geht das schon so? Ist er schon tot? Wo ist er?
Sein Unterleib fühlt den Fall, den Sog in die Tiefe, aber die Finsternis, die in seinen Augen beginnt und sich unendlich dehnt, gibt nicht preis, woher er fällt und wohin.
Juniper kennt die Ohnmacht. Sie stand schon am Ende so vieler Räusche. Und immer liebte er sie, ohne zu wissen, warum. Jetzt weiß er es. Ihre gnädige Leere verschlingt Furcht und Schuld.
Denn das ist das Schrecklichste – so in Dunkelheit und Kälte und wütender See zu treiben, zu stürzen und jeden Augenblick zu leben. Jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde, jeden Tag, jedes Jahr, jedes Jahrhundert, die das hier dauern wird, wird Juniper nichts um sich haben als Dunkelheit, Kälte, wütende See.
Er sehnt sich zurück. Noch vor wie langer Zeit – einer Minute? Einer Stunde? Einem Tag? – wollte er verzweifeln angesichts der Unendlichkeit von Himmel und See? Aber jetzt, in diesem Höllenstrom, scheint ihm dieses sanfte Dahintreiben ein Paradies.
Und plötzlich Stille. Kein tobendes Wasser mehr. Für einen Augenblick schwebt Juniper im düsteren Nichts. Dann spürt er einen Sog, jäh reißt es ihn nach unten. Er will die Augen öffnen, will schreien, um sich schlagen, sich irgendwo festhalten. Aber er bleibt stumm. Regungslos. In seinem Herz wächst das Grauen, wächst die Furcht, steigt in seinen Kopf. Er wird den Verstand verlieren.
Das ist es. Er verliert den Verstand. Das wird der letzte klare Gedanke sein, den er je haben wird. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Und dann …
… packte etwas Carl Juniper aus dem rasenden Fall, riss ihn heraus in klare Nachtluft. Juniper öffnete die Augen und schrie. Seine Glieder flogen wie die einer Puppe in alle Richtungen, er sah einen Sternenhimmel unter sich, eine dunkelblau schimmernde Wiese, dann wieder die Sterne, schließlich raste die Erde auf ihn zu, und Carl Juniper, der Seemann, der Schiffskoch, der irgendwo im Südatlantik in die abgrundtiefen Schlünde der See geschleudert worden war, schlug mit krachenden Knochen auf nasses Gras, überschlug sich noch ein paar Mal und blieb schließlich mit ausgepumpten Lungen auf dem Rücken liegen.
Stierte mit weit offenen Augen in den nächtlichen Himmel, der jetzt endlich dort blieb, wo er hingehörte, nämlich über ihm, und fürchtete für einen grauenhaften Moment, dass er so sterben würde. Endlich an Land gespuckt würde er ersticken und nicht verstehen, warum.
Doch da löste sich der Fels, der scheinbar auf seiner zerschlagenen Brust gelegen hatte, in Staub auf, und Junipers Kehle riss köstliche Nachtluft in sich. Seine Brust hob, sein Bauch blähte sich, und er atmete.
So lag er eine Weile. Sah in den leuchtend dunklen Himmel und atmete. Spürte das Gras unter sich, die nasse Kleidung. Fror ein wenig, aber nahm das als geringen Preis dafür, hier friedlich zu liegen. An Land. Welches auch immer. Irgendwann würde die Sonne aufgehen und seine Kleidung trocknen. Er würde Menschen finden und Essen und Wasser und vielleicht einen guten Schluck Branntwein. Oder Rum. Oder Whisky. Was immer sie hier tranken, wenn sie froren oder schwitzten oder traurig waren oder vor Freude nicht wussten, wohin mit sich. Und er würde sagen: »Mein Name ist Carl Juniper, ich stamme aus Bristol und bin Untertan Seiner Königlichen Hoheit, King George V., Gott schütze den König. Ich bin achtundzwanzig Jahre alt und war Koch auf der ›SS Birmingham‹ mit Heimathafen Liverpool. Wir sind am 17. März auf der Reise nach Valparaiso in einem wütenden Orkan zwischen South Georgia und den Falklands gesunken. Ich fürchte, außer mir hat keiner an Bord überlebt.«
Und sie würden ihn bedauernd ansehen und ihm den Weg zur nächsten Hafenstadt weisen. Dort würde er entweder einen britischen Konsul oder Botschafter, auf jeden Fall aber einen Reedereiagenten finden, und so käme er schon bald wieder auf ein Schiff.
Sein Seemannsbuch hatte er stets bei sich. In einem schmalen Beutel aus Ölzeug, der an einer geteerten Schnur um seinen Hals hing. Das hatte er auf seiner ersten Reise von einem alten Seemann gelernt. »Das darfst du nie verlieren, Junge. Hörst du? Damit kannst du auf der ganzen verdammten Welt beweisen, dass du ein anständiger britischer Seemann bist.«
Carl Juniper fasste auf seine nasskalte Brust und spürte das kleine Päckchen unter der Jacke. Ja. Alles würde gut werden. Alles.
Sein Verstand sagte ihm, dass er aufstehen und sich einen geschützten Ort für den Rest der Nacht suchen sollte. Vielleicht konnte er sogar Lichter irgendwo sehen, Häuser. Aber er war dafür gleichermaßen zu erschöpft und zu erleichtert. An das Frieren hatte Juniper sich jetzt gewöhnt, es war nicht allzu schlimm. Er drehte sich mühsam auf die Seite, rollte sich ein wenig zusammen. Dann fielen seine Augen zu. Und endlich, endlich kam das Nichts über seine Seele.
»Wach auf.«
Ein Traum.
»Hey. Wach auf. Du zitterst am ganzen Leib.«
Im Traum wurde Juniper geschüttelt und gerüttelt.
»Du. Verreck mir hier nicht. Wach auf, verdammt.«
Immer wilder wurde Juniper geschüttelt, was zum Teufel sollte das? Schließlich fasste der Klabautermann oder Nachtalb oder was immer das für ein scheußlicher Kerl war, ihm sogar ins Gesicht, quetschte seine Backen zusammen und schlenkerte Junipers Kopf von rechts nach links und wieder zurück, als wollte er ihn vom Hals abdrehen.
Ob Traum oder Wirklichkeit – das ging jetzt zu weit, Juniper war kein dünner Tampen, sondern ein ordentlicher Klotz von Schiffskoch. Er schlug nach dem Störenfried, traf aber in Traum oder Wirklichkeit nur Luft. Der Klabautermann lachte und ließ Juniper los.
»Hey. Da ist also doch noch Leben in dem nassen Sack.«
Juniper beschloss, seine Augen zu öffnen.
Es war immer noch dunkel, aber ein Dämmerstreif erhellte den Himmel schon ein wenig. Ein Mann grinste auf ihn herab. Carl Juniper stemmte sich mit Mühe hoch, dann streckte der Mann ihm seine Hand entgegen. Juniper nahm sie, und mit einer Kraft, die er dem eher schmalen Kerl nicht zugetraut hätte, zog der ihn auf die Füße.
Der Mann war nicht nur schmaler, sondern auch kleiner als Juniper. Soweit er bei dem noch fahlen Licht sehen konnte, war er fraglos jünger als er selbst und von bleicher Gesichtsfarbe. Breite Koteletten und ein sichtbarer Bartschatten zeigten, dass er unter seiner Schirmmütze offenbar dichtes, sehr dunkles Haar hatte. Helle Augen und freundliche, aber leicht ausgezehrte Züge. Er trug einen altmodisch geschnittenen Rock aus grobem Stoff, eine Tweedweste, ein dickes Baumwollhemd und derbe Arbeitshosen. Dazu festes Schuhwerk.
»Ich bin Bren. Was ist denn mit dir passiert? Zu viel Ale kann es ja wohl kaum sein.«
Der Mann lachte.
Wieso denn nicht?, fragte sich Juniper, der aus genau diesem Grund schon sehr häufig an Orten aufgewacht war, die zu betreten er sich nicht hatte erinnern können.
»Carl Juniper mein Name. Wie ich genau hierhergekommen bin, weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Noch weniger, wo ich hier bin. Mein Schiff ist untergegangen, die ›Birmingham‹. Von Liverpool nach Valparaiso. Ich war auf einem Rettungsfloß, das trieb in der See und geriet in einen riesigen Strudel. Da sind mir die Lichter ausgegangen, und irgendwann krachte ich hier auf den Strand. Tja. Das ist alles, was ich weiß.«
Bren hatte ihm mit wachsendem Erstaunen zugehört. Als Juniper fertig war, sah der junge Mann ihn ernst an. Zog eine Augenbraue hoch. Schüttelte dann den Kopf und fasste Carl an der Schulter.
»Hör zu, es geht mich nichts an, wer du bist und woher du kommst. Bislang habe ich keinen Grund, etwas anderes zu denken, als dass du ein anständiger Kerl bist. Aber mit dieser Geschichte wirst du eine Menge Ärger kriegen, mein Freund. Die Tanned Necks lassen sich nicht gerne für blöd verkaufen.«
Juniper wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Alles an Brens Rede stieß ihn in tiefste Verwirrung. Wer oder was waren Tanned Necks?
Wo verdammt noch mal war er hier gelandet?
»Ich versichere dir, dass ich …«
»Schschscht«, Bren legte den Zeigefinger auf seine Lippen, »du hast sicher gute Gründe, dich hinter so einer Geschichte zu verstecken. Da bist du hier nicht der Einzige, bei allen alten Königen, wirklich nicht. Aber schau dich doch mal um.«
Er wischte mit dem Arm unbestimmt über die Umgebung. Juniper folgte mit dem Blick.
Wiese. Rechter Hand, etwas entfernt, eine Baumgruppe. Ein Weg. Eine Gaslaterne. Sie waren in einer Art Park. Wenn Juniper sich weiter umdrehte, sah er Lichter. Eine Stadt. Zwar waren nur wenige Fenster erleuchtet, aber man konnte sofort erkennen, dass die Stadt riesig war und ihre Wohnhäuser höher als alles, was er bisher gesehen hatte.
Kein Strand.
Kein Meer.
Nichts.
Wie zur Hölle war er hierhergekommen?
»Ich kann mir das nicht erklären«, flüsterte er vor sich hin. »Das alles hier.«
Er sah Bren hilflos an. Der redete sanft weiter.
»Gut. Wie auch immer. Stellt sich nur eine Frage: Hast du ein Quartier?«
Carl schüttelte den Kopf.
Bren schnaufte schwer, dachte nach. Dann streckte er plötzlich seinen Rücken durch.
»Ich hab das noch nie gemacht. Unterschlupf gewähren.«
Er sah Juniper aus seinen hellen Augen offen und doch skeptisch an.
»Es ist gefährlich. Ist dir das klar?«
Carl wollte ja sagen, aber das wäre eine Lüge gewesen.
»Mir ist gar nichts klar. Ich weiß nicht mal, wo ich hier bin. Ich begreife nichts.«
»Hast du einen Quartierschein? Eine Arbeitskarte? Irgendwas vom High Council?«
Juniper griff nach der geteerten Schnur um seinen Hals, zog den Ölzeugbeutel hervor und entnahm ihm sein Seefahrtsbuch.
»Hier.«
Bren nahm das salzfleckige Buch, las den Umschlag. Guckte Carl an, las wieder. Schlug das Buch auf, blätterte darin. Schüttelte wieder und wieder den Kopf. Schlug das Buch zu und gab es zurück.
»Was, bitte schön, soll die British Merchant Navy sein? Und King George V.? Und all diese Länder? Das ist doch völlig verrückt. Wenn du das einer Patrouille zeigst, werden die Tanned Necks dir kommentarlos den Gewehrkolben unters Kinn donnern, und du wachst im Dead Man’s Inn auf. Zwei Tage später tanzt du mit der Seilerstochter auf dem Tower Hill.«
Carl starrte Bren an, sein Seemannsbuch in beiden Händen.
»Bren. Um Himmels willen, wo bin ich hier?«
»Wo du bist? Meine Güte. Du bist in London. Das ist der Greenwich Park. Da drüben fließt die Themse, es ist die Mitte der zweiten Stunde im ersten Kreis am Fünftag der siebten Woche im Jahr dreihundertsiebenundvierzig des High Council, falls du es genau wissen willst.«
Why can’t we have the sea in London – Warum kann London nicht am Meer liegen? Das war letztes Jahr ein Gassenhauer in allen Music Halls von Liverpool bis Brighton gewesen. Die verwehte Melodie berührte für einen Augenblick Junipers Herz, dann wurde ihm eiskalt.
Carl Juniper hatte eine harte und kurze Kindheit gehabt. Er war im Pub eines entfernten Verwandten seiner früh verstorbenen Mutter aufgewachsen und mit zwölf Jahren dort in die Kochlehre gegangen. Sein Vater hatte in der Royal Navy in kleinen und großen Seekriegen des Empires auf der ganzen Welt gedient, und wenn er mal in Bristol war, um das Kostgeld zu bezahlen, soff er den Laden des Verwandten leer. Juniper hatte nichts von ihm geerbt außer der Liebe zum Meer und einer eisenharten Konstitution. Er war von älteren Köchen grün und blau geschlagen worden, er hatte auf See Stürme erlebt und nun einen Schiffsuntergang. Straßenräuber in Singapur hatten ihm ein Messer in den Rücken gerammt, in San Francisco war er angeschossen worden. Er hatte Opium geraucht und Schnäpse gesoffen, die einem den Magen verbrannten und wüste Halluzinationen heraufbeschworen. Ein durchgedrehter Bootsmannsmaat hatte ihn im Streit um Spielschulden beinahe erwürgt, und in Port Elizabeth war er um ein Haar von Russen shanghait worden.
Juniper hatte also schon einiges erlebt und das meiste davon eher ungerührt über sich ergehen lassen. Aber was Bren ihm da gerade gesagt hatte, ließ sein Mark gefrieren. Er begann zu schlottern, seine Zähne klapperten, und sein Gehirn schien sich in rasender Geschwindigkeit um sich selbst zu drehen.
Bren sah ihn mitleidig an.
»Komm jetzt. Ich kenne die Schleichwege. Eines nur musst du mir versprechen: Wenn ich sage ›renn‹, dann rennst du. Und wenn sie dich kriegen, hast du mich nie im Leben gesehen. Ist das klar?«
Carl Juniper zwängte einen heraufkriechenden Klumpen aus Angst wieder die Kehle hinab, blinzelte die ersten Tränen weg und nickte.
»Gut, dann komm.«
Bren drehte sich um und ging los. Nach ein paar Metern wandte er den Kopf und rief noch mal.
»Komm jetzt.«
Bei Junipers ersten Schritten schwappte Wasser aus den Seestiefeln.
Die Stadt
Sie waren keine fünf Minuten über feuchte Wiesen und gekieste Pfade gelaufen, als sie ein Tor erreichten. Oder das, was davon übrig war. Einer der schmiedeeisernen Flügel fehlte ganz, der andere hing nur noch in der unteren Angel.
Eine breite Sandstraße führte an dem Tor vorbei, auf der gegenüberliegenden Seite war eine hohe Backsteinmauer.
»Meine Güte«, Juniper war schon außer Atem, »warum rennen wir denn so?«
»Weil wir den nächsten Dampfgleiter nicht verpassen wollen.« Bren zeigte auf die Mauer. »Sonst müssen wir nämlich eine Stunde warten. Oder laufen. Und bei deinem Tempo kommen wir dann nie im Quartier an.«
Dampfgleiter?
Bren schwenkte nach links und lief wieder schneller. Der Mond kam gerade hinter den Wolken hervor, und Juniper versuchte, sich zu orientieren.
Er kannte sich in London nicht sehr gut aus, und wenn, dann eher in den Pubs, Music Halls und Bordellen von Whitechapel oder Soho. Mit Greenwich Park aber verband er die vielleicht einzige schöne Erinnerung an seinen Vater.
Der zehnjährige Carl war mit seiner Tante Hetty von Bristol nach London gereist, weil das Schiff seines Vaters, die HMS »Rodney«, dort für eine Woche vor Anker lag. Seaman Gunner Ian Juniper diente auf dem Schlachtschiff als Kanonier in einem der riesigen Geschütztürme. Sie durften nicht an Bord, aber sein Vater, der ausnahmsweise nüchtern und guter Laune war, trug ihn auf dem Arm an der Pier entlang und erzählte über das Schiff und die mächtigen Kanonen, mit denen er die Feinde des Empires »in den Grund bohrte«. Die »Rodney« lag damals direkt vor dem Royal Naval College, und dahinter war der Greenwich Park mit dem Observatorium. Sie waren zu dritt durch den Park spaziert, wie eine richtige Familie. Junipers Vater in seiner Ausgehuniform mit Orden, seinen Sohn an der Hand. Ian Juniper hatte ihm erklärt, was es mit dem Zeitball auf dem Mast des Observatoriums auf sich hatte. Wenn Carl später mit einem Schiff in London eingelaufen war, was selten genug vorkam, hatte er immer die Gelegenheit genutzt, um ein Uhr mittags dabei zu sein, wenn der Wachoffizier den Schiffschronometer nach dem am Mast herabfallenden Lederball stellte, damit er wieder exakte Greenwich-Time zeigte. Dann dachte er an diesen einen schönen Tag mit seinem armen Vater.
Er wollte sich gerne umdrehen, um zu schauen, ob er das Observatorium im Mondlicht sehen konnte, aber Bren lief jetzt so schnell, dass Carl fürchtete, dabei auf die Nase zu fallen.
Am Ende der Straße bogen sie nach rechts ab. Auch die Backsteinmauer lief hier entlang. Und gut einhundert Yards voraus konnte man die Themse sehen. Juniper wusste nun, dass sie in nördlicher Richtung liefen, fast genau auf die Pier zu, an dem ihn seinerzeit sein Vater stolz vor der »Rodney« hin und her getragen hatte. Links ein überdachtes Marktgebäude, an das er sich noch dunkel erinnerte. Aber dann müsste rechts, hinter dieser Mauer, die Anlage des Naval College sein.
Plötzlich zog Bren eine Uhr aus seiner Tasche und verlangsamte nach einem Blick darauf das Tempo.
»Gut. Wir haben jetzt Zeit. Pass auf«, er steckte die Uhr zurück und fingerte eine Münze aus der linken Westentasche, »da sind gleich zwei Durchgänge. Du nimmst den rechten und kaufst dir am Schalter ein Billett nach Stepney Green. Kannst du dir das merken?«
Carl nickte.
»Ich habe eine Arbeitskarte und gehe damit durch den linken Gang.«
Bren drückte Carl die Münze in die Hand.
»Du kriegst noch was raus, nicht verlieren.«
Jetzt sah Carl ein Tor in der Backsteinmauer. Und Menschen, die hindurchgingen. Männer und Frauen in eher praktischer, derber Kleidung, so wie Bren. Manche hatten schwere Taschen umgehängt.
Bren schien etwas zu überlegen, dann hielt er Carl kurz am Arm fest.
»Falls der Beamte am Schalter fragt, warum du nicht mit deiner Arbeitskarte fährst, sagst du, du hättest deinem schusseligen Quartierbruder seinen Kabinettschlüssel in die Fabrik nachgetragen. Wellstone & Sykes«, er wies nach Westen, »drüben am Deptford Creek. Das ist eine Waffenfabrik. Nur für dich, die kennt jeder.«
Carl sah Bren verständnislos an. Der zählte an seinen Fingern auf.
»Deinem Quartierbruder den Kabinettschlüssel zu Wellstone & Sykes am Deptford Creek. Und du willst nach Stepney Green.«
Er hob den Zeigefinger vor Carls Nase.
»Nicht vergessen. Und jetzt los.«
Sie reihten sich in den rasch dichter werdenden Menschenstrom ein. Ums Haar wäre Carl in die linke Reihe geraten, aber Bren schob ihn rechtzeitig durch das andere Eisengatter.
In diesem Durchgang war nicht viel Publikum. Carl mühte sich, die durcheinanderwirbelnden Fetzen zu klaren Gedanken zu formen. Mit einer Arbeitskarte konnte man offenbar einen »Gleiter« benutzen. Er hatte keine Arbeitskarte, also musste er blechen. Das könnte nun allerdings einem Beamten auffallen. Was wiederum hieß, dass mitten in der Nacht normalerweise nur Leute mit Arbeitskarten unterwegs waren. Aha. Das ergab einen Sinn.
»Wohin, Trödelmatz?«, blaffte eine ungeduldige Stimme. »Du bist nicht der Einzige, der den Gleiter erwischen will.«
In einem kleinen eisernen Verschlag saß ein älterer Mann mit gewaltigem Backenbart und schwarzer Uniform. Auf dem Kopf trug er eine Schirmmütze mit einem Messingemblem und blitzende Knöpfe an der Jacke.
»Äh. Stepney Green. Bitte.«
Carl schob seine Hand gerade so weit durch die Öffnung, dass er die Münze vor den Beamten legen konnte. Der sah ihn an, dann auf die Münze. Carl wiederholte sich stumm und panisch noch einmal die Ausrede. Quartierbruder. Schlüssel. Kabinett. Wolesley & Sykes. Nein, Wellstone & Sykes.
»Der Nächste. Husch.«
Der Beamte machte eine unwirsche Handbewegung.
Carl wollte schon weitergehen, da sah er gerade noch das kleine Billett aus Pappe auf dem Tresen liegen. Er griff danach und auch nach den zwei kupfernen Münzen daneben und ging weiter.
Hinter einem zweiten Tor lag ein großer Hof, von dem zwei eiserne Treppen nach oben führten. Beide endeten jeweils an einer langen Plattform.
»Hey, nicht einschlafen. Weiter geht’s.«
Bren zog ihn am Arm vorwärts.
Die vielen Füße erzeugten gewaltigen Lärm auf der Treppe. Juniper wurde übel, er merkte jetzt, wie erschöpft und hungrig er war. Als sein linkes Bein einknickte, bekam Bren ihn gerade noch zu fassen.
»Vorsicht, Mann.«
Die Plattform war eine Art Bahnsteig. Aber wo waren die Gleise? Am Rand der Plattform war ein Geländer, mit mehreren schmalen Toren. Vor dem Geländer war nur Abgrund. Auf der anderen Seite des Abgrunds eine identische Plattform, auf der sich aber nur sehr wenige Leute befanden.
Die Menschen auf der Plattform standen teilnahmslos herum. Manche redeten miteinander, aber so leise, dass man sie schon wenige Schritte entfernt nicht mehr verstehen konnte.