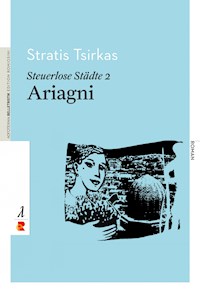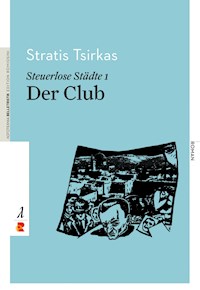
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Belletristik
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Jerusalem, Kairo und Alexandria, drei Städte im Kriegszustand, sind die Schauplätze der drei Romane Der Club, Ariagni, Die Fledermaus, die zu den wichtigsten Werken der neugriechischen Literatur des 20. Jahrhunderts gehören. Das Zeitfenster der Handlung beträgt 23 Monate, von Juni 1942 bis Mai 1944, als die Revolte der griechischen Exilstreitkräfte in Ägypten und Palästina, die am Ende des zweiten Weltkriegs die Errichtung einer Regierung der nationalen Einheit anstrebten und gegen die griechische und englische royalistische Militärführung revoltierten, endgültig scheiterte. Mit seinem als work in progress verfassten Hauptwerk verfolgte Tsirkas das Ziel, das historische Versagen der Revolte von April 1944 zu verteidigen, auf die "die freie Welt keinen Grund hat, stolz zu sein, und die Historiker gerne vertuschen" (René Etiemble). Im Zentrum der Trilogie steht Manos Simonidis, ein griechischer Offizier und jungintellektueller Schriftsteller. Mitten im Krieg und im kulturellen und ideologischen Schmelztiegel des Nahen Ostens versucht er, der Dekadenz der Vorkriegswelt zu entgehen und sich von der ideologischen Starre seiner Parteifreunde zu distanzieren. Zweifel, Verluste, Freundschaft und Abneigung sowie die Liebe zu zwei Frauen begleiten seinen Weg bis in den griechische Bürgerkrieg hinein. Die drei Romane vermitteln die europäische Moderne nach Griechenland. Zugleich steht Tsirkas' Trilogie in intertextuellem Dialog mit der Poesie von Kavafis und Seferis. Er erschafft einen polyphonen narrativen Kosmos, ein System vielfältiger Stimmen und Perspektiven.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 463
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
VORWORT von Joachim Sartorius: »So viele Essenzen wie möglich« Zu Stratis Tsirkas und seiner Trilogie Steuerlose Städte
ERSTES KAPITEL
ZWEITES KAPITEL
DRITTES KAPITEL
VIERTES KAPITEL
FÜNFTES KAPITEL
SECHSTES KAPITEL
SIEBTES KAPITEL
ACHTES KAPITEL
NEUNTES KAPITEL
ZEHNTES KAPITEL
ELFTES KAPITEL
ZWÖLFTES KAPITEL
DREIZEHNTES KAPITEL
VIERZEHNTES KAPITEL
FÜNFZEHNTES KAPITEL
SECHZEHNTES KAPITEL
SIEBZEHNTES KAPITEL
ACHTZEHNTES KAPITEL
NEUNZEHNTES KAPITEL
ZWANZIGSTES KAPITEL
ANHANG: Der historische Hintergrund der Trilogie von Stratis Tsirkas
ANHANG: Anmerkungen/Glossar
Stratis Tsirkas
Steuerlose Städte 1Der Club
Roman
Übersetzung aus dem Griechischen von Gerhard Blümlein
Mit einem Vorwort von Joachim Sartorius
und einem Anhang mit historischen Erläuterungen,
Anmerkungen und Glossar
Die Übersetzung der Trilogie wurde gefördert durch die A und A Kulturstiftung.
Foto: Mario Pontero
Originaltitel: Ακυβέρνητες Πολιτείες: Η λέσχη (2005 [1961]) Kedros-Verlag, Athen
Aus dem Griechischen übersetzt von Gerhard Blümlein
Lektorat: Andrea Schellinger
© 2015 Edition Romiosini/CeMoG, Freie Universität Berlin
Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung und Verwertung der Texte, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für das Herstellen und Verbreiten von Kopien auf Papier, Datenträgern oder im Internet sowie Übersetzungen.
Vertrieb und Gesamtherstellung: Epubli (www.epubli.de)
Satz und E-Book-Umsetzung: Kostas Kosmas, Bart Soethaert, Nikos Kaissas
Umschlaggestaltung: Freie Universität Berlin, Center für Digitale Systeme
E-Book ISBN 978-3-946142-04-1
Auch in gedruckter Form erhältlich: ISBN 978-3-946142-01-0
Made in Germany
Online-Bibliothek der Edition Romiosini:
www.edition-romiosini.de
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort von Joachim Sartorius
Steuerlose Städte 1 - Der Club
Historischer Hintergrund
Anmerkungen/Glossar
Stratis Tsirkas
(eigentlicher Name: Jannis Chatziandreas) studierte Wirtschaft in Kairo und arbeitete ab 1929 als Buchhalter in Baumwollfabriken in Oberägypten, später als Chef einer Fabrik für Lederverarbeitung in Alexandria, wo er Konstantinos Kavafis kennenlernte. Er gehörte der kommunistischen Bewegung an und nahm aktiv teil am antifaschistischen Widerstand der griechischen Linken von Ägypten. 1963 ließ er sich in Athen nieder und starb dort 1980. Sein Hauptwerk, die Trilogie Steuerlose Städte, verfasste er teils in Alexandria, teils in Athen und beendete sie im August 1965.
»So viele Essenzen wie möglich«Zu Stratis Tsirkas und seiner Trilogie Steuerlose Städte
Ein Vorwort von Joachim Sartorius
1
DiegriechischeGemeinde Ägyptens hat im 20. Jahrhundert zwei großeSchriftsteller hervorgebracht, den Dichter Konstantinos Kavafis und den Romanautor Stratis Tsirkas. Tsirkas war neunzehn Jahre alt, ein junger Mann von gewinnendem Aussehen, wenn man den Fotografien traut, als er Kavafis in Alexandria kennenlernte. Geboren 1911, aufgewachsen in Kairo, verbrachte Tsirkas mit seiner Familie die Sommer in Alexandria, bis er 1939 ganz nach Alexandria zog, um die Geschäfte der Gerberei »Halkousis« zu führen. 1930, in dem Jahr, in dem er Kavafis zum ersten Mal traf, war dieser schon ein alter Dichter, unter den literati der Hafenstadt berühmt, ansonsten eher ein Geheimtipp. Seine Gedichte zirkulierten auf losen Blättern bei seinen Freunden und Bewunderern. Erst 1935 erschien in Athen die erste gebundene Ausgabe seiner Gedichte, und es sollte noch einmal drei Jahrzehnte dauern, bis seine Poesie einen Siegeszug rund um die Welt antrat.StratisTsirkashatte 1930 erste Gedichte veröffentlicht undbewunderteKavafis.Erversuchte,sooftwiemöglichvonKairo nach Alexandria zu kommen, um ihn zu sehen. Zwischen beiden Männern entstand eine Freundschaft, die bis zum Tod des Meisters im Jahre 1933 anhalten sollte. Im Kavafis-Museum in Alexandria, der ehemaligen Wohnung des Dichters in der Sharm-el-Sheikh-Straße 4, ist eines der fünf Zimmer Stratis Tsirkas gewidmet, mit Fotografien, Autographen und den Erstausgaben seiner Bücher, darunter dem großen Essay »Kavafis und seine Zeit« (1958) und seinem Hauptwerk, der Romantrilogie Steuerlose Städte, die zwischen 1960 und 1965 in Athen erschien und vor dem Hintergrund griechischer Bedrängnisse im Nahen Osten während des zweiten Weltkriegs die großen Fragen nach der Verantwortung und der Freiheit des Intellektuellen in Zeiten ideologischer Umbrüche stellt.
1971 erhielt diese Trilogie in Frankreich den »Prix du meilleur livre étranger«. 1974 erschien sie bei Alfred A. Knopf, einem der angesehensten literarischen Verlage der USA, unter begeistertem Zuspruch der Kritik. In Griechenland gehört das Werk inzwischen zum Literaturkanon der Moderne. Bei uns hat es aus unerfindlichen Gründen ein halbes Jahrhundert gedauert, bis dieser gewaltige Roman nun endlich in deutscher Übersetzung vorliegt.
2
Die steuerlosen Städte dieser mitreißenden Trilogie sind Jerusalem, Kairo und Alexandria. Sie bilden jeweils den Hintergrund der drei Romane Der Club (Jerusalem), Ariagni (Kairo) und Die Fledermaus (Alexandria). Das in der Trilogie entfesselte Drama umfasst die Menschen und die Politik, die Leidenschaften und die Intrigen eines Nahen Ostens, der durch den Zweiten Weltkrieg in Flammen steht – vom Sommer 1942, knapp ein Jahr nach der Kapitulation Griechenlands und der Besetzung Athens durch die deutsche Wehrmacht, bis zur Vernichtung der griechischen antifaschistischen Brigaden und Marineeinheiten auf Geheiß der Briten im April 1944.
Es ist die Saga von drei Städten, die steuerlos dem Chaos entgegentreiben, ihrer historischen Bestimmung. Es ist die Geschichte von Griechen, Engländern, Flüchtlingen aus Mittel- und Osteuropa, palästinensischen Juden und ägyptischen Arabern, die zu Verschwörern, Helden, Feiglingen, Spitzeln, Idealisten werden, oder sich auch nur über Wasser halten, während ihr Leben durch die politischen und kriegerischen Umstürze total umgekrempelt wird.
Die zentrale Figur ist Manos Simonidis – ein Dichter und Intellektueller, Held des griechischen Widerstandes gegen die italienische Invasion, dann Deserteur, der sich nach der Kapitulation der illegal operierenden linken Bewegung im Ausland anschließt und an Einsätzen gegen griechische Faschisten und Royalisten teilnimmt. Dieses Engagement führt ihn von Stadt zu Stadt, in geheime Unterschlüpfe, in endlose Debatten mit seinen Genossen um den ›richtigen‹ politischen Kurs und gleichzeitig in ein Wechselbad gefährlicher, schwankender, auch erotischer Beziehungen: mit Anna Feldmann, einer deutschen Jüdin, die in Jerusalem eine schäbige Pension betreibt, in der die Geschichte beginnt (und in der Manos unter falschem Namen in einer Dachmansarde lebt); mit Emmy Bobretzberg, der Frau eines früheren österreichischen Ministers, die schön, lüstern, ihren Trieben unterworfen und zugleich von Angst erfüllt ist, dass ihr Gatte als Strohmann benutzt und beschädigt wird; mit Robby, einem homosexuellen Gelehrten und hellenophilen britischen Agenten; mit Fanis, dem Sekretär der kommunistischen Partei Griechenlands in Ägypten, Humanist und Untergrundkämpfer; mit Michelle Rapescu, der Witwe eines von der faschistischen »Eisernen Garde« getöteten Rumänen, einer ehemaligen Prostituierten und nun Geheimagentin im Dienste der »Freien »Franzosen«; mit dem ›Wicht‹, einem selbstgerechten und zynischen Dogmatiker − zugleich Vorgesetzter von Manos in der Parteihierarchie und dessen Feind und Widersacher. Wie ein Hexenmeister führt Stratis Tsirkas mehr als vierzig Einzelschicksalezusammen, von der Griechin Ariagni mitten im Labyrinth der Altstadt von Kairo zu dem arabischen Knaben Naboulion, von der liebeshungrigen Jüdin Allegra zu Nancy, Lady Campbell, die Manos liebt und für die Untergrundzeitung der griechischen Kommunisten zu arbeiten beginnt. Tsirkas mischt Zeiten und Perspektiven und wechselt meisterhaft die Erzählform, mal Ich-Erzählung, mal innerer Monolog, mal Bericht in der dritten Person. Viele seiner Figuren halten der Gewalt, dem Krieg, dem Verhängnis stand, andere sind nur noch Überlebende oder Untergehende.
Dem dritten Buch Die Fledermaus stellt Tsirkas ein Zitat von Friedrich Engels als Motto voran: »es sind also unzählige einander durchkreuzende Kräfte, eine unendliche Gruppe von Kräfteparallelogrammen, daraus eine Resultante – das geschichtliche Ergebnis – hervorgeht, die selbst wieder als das Produkt einer als Ganzes bewusstlos und willenlos wirkendenMacht angesehen werden kann. Denn was jeder Einzelne will, wird von jedem anderen verhindert, und was herauskommt, ist etwas, das keiner gewollt hat.« Diese Stelle aus einem Brief von Engels an J. Bloch vom 21. September 1890 liest sich wie ein abstraktes Résumé der Trilogie. Trotz allem heroischen Engagement, trotz dem glühenden Glauben an ein freies Griechenland und eine bessere Zukunft regiert letztlich blindes Schicksal. Das Ende des Buches ist trostlos. Fanis wird ermordet, Manos Simonidis von einer Handgranate zerfetzt, der ›Wicht‹ nach Gefangenschaft erschossen. Die griechischen Kämpfer werden von den Briten in ›Käfige‹ eingesperrt und interniert. Aber vor diesem bitteren Ende liegt eine unendliche Geschichte – die vielen klandestinen Missionen von Manos, seine schwere Kopfverwundung an der Front bei Bengasi während der Verfolgung des Afrika-Corps von Rommel durch die 8. Britische Armee, Krankenhausaufenthalte in Tobruk und Alexandria, Unterschlupf in Kairo bei Ariagni, schließlich der historische Marsch der griechischen Brigaden von Aleppo durch die syrische Wüste bis an die Ufer des Euphrat. Immer wenn sich das Netz von Intrige und Verschwörung enger zusammenzieht – wenn Griechen Griechen bekämpfen, rivalisierende linke Gruppierungen sich gegenseitig unterminieren, wenn die Briten versuchen, alles zu manipulieren und alle gegen alle auszuspielen – befindet sich Manos im Zentrum des klassischen Dilemmas des Intellektuellen im 20. Jahrhundert: zu wählen zwischen den Impulsen des Humanismus und dem brutalen Diktat der ideologischen Orthodoxie. Manos ist nicht im Reinen mit sich selbst.Der›Wicht‹ wirft ihm »Schwankungenim Kampfgeist, Intellektuellensehnsüchte,kleinbürgerlicheVorurteile,Subjektivismus« vor.Vondenvielen in der Trilogie verstreuten Porträts von Manos ist vielleicht das eindringlichsteundtreffendstedasvonAnna,derBetreiberinderPension in Jerusalem, erzählt als Bewusstseinsstrom: »Er hat einige der acht Gaben die unserem Freund Mister Eliot zufolge den Humanisten ausmachen. Er zieht den gesunden Menschenverstand der Logik vor. Tolerant keineswegs fanatisch auch nicht bigott oder borniert. (...) Und noch etwas was Mister Eliot vielleicht vergessen hat. Gerechtigkeitssinn in schönster Ausprägung. Barmherzigkeit Mitleid.« Manos ist, wie der Autor, ein unorthodoxer Kommunist. Verzweifelt versucht er, in den ideologischen Richtungskämpfen und den kriegerischenAuseinandersetzungenVerantwortung zuübernehmen und docher selbstzubleiben.
Es ist eine der großen Künste von Tsirkas, zu zeigen, was Krieg und Gewalt in den Menschen anrichten. Beschattet, denunziert, von den jeweiligen Gegnern als Pfand oder Spielball benutzt, ändern sich die Menschen. Tsirkas zeigt, dass Zeiten des Krieges alles freisetzen können – Instinkte, doppelte Loyalitäten, Fintenreichtum, Hang zum Denunzieren. Auch die privatesten Beziehungen werden vom Kampf beeinflusst, Umgangsformen nur noch mühsam aufrechterhalten. So ist fast jede der Figuren von Tsirkas in komplizierte Loyalitätsverhältnisse verstrickt, befindet sich in einem Schlamassel. »Und die Welt ist bisweilen ein Korb voll lebender Krabben. Wir beißen unseren Nächsten, der beißt uns auch, und in diesem Durcheinander beißen wir uns selbst.«, sagt Anna, die Wirtin, zu Manos und will ihm damit ein Bild von ihrer Pension und ihren Gästen vermitteln, es ist zugleich ein Bild von dem, was in Jerusalem 1942 vor sich geht. In einem Gespräch mit der von ihm angebeteten Emmy Bobretzberg vergleicht Manos Jerusalem und das Spiel der Geheimdienste mit dem Turm von Babel: »[…] so ein Wirrwarr. Alle spionieren. Alle verraten.« Und an anderer Stelle heißt es: »So viele Menschen, Wracks des Sturms, der über die Welt hinwegfegt; statt dass die Not sie vereint, wirkt sie trennend.«
3
Wenn Stratis Tsirkas dem dritten Teil seiner Trilogie den ›Hinweis‹ vorausstellt, sie sei »keinhistorischer Roman im engeren Sinn«, so stimmt dies insofern, als sein Werk weit mehr ist als ein großer historischer oder politischer Roman. Das gewiss auch, aber die Trilogie besticht ebenso sehr durch die dichte Beschreibung des Nahen Ostens, durch die genaue Erfassung und Vergegenwärtigung von Städten und Landschaften und ihrer Bewohner. Ganz im Gegensatz zu Lawrence Durrell und auch zu E. M. Forster schreibt Tsirkas ohne jeden ›Orientalismus‹. Er hat ein hoch entwickeltes Sensorium für die Ägypter und einen akuten Sinn für all das, was das östliche Mittelmeer ausmacht: Licht, Farben, Gerüche, die Architektur der alten Städte, die selbstverständliche Gastfreundschaft in den Cafés, auch arabisches Laisser-faire, Bedächtigkeit im Vergleich zur ›griechischen Hektik‹. Als Manos sich mit zwei Genossen zu einem geheimen Unterschlupf am Rande von Alexandria begibt, nimmt er, während die beiden sich mit dem verrosteten Schloss abmühen, die Umgebung wahr: »Der Wind brachte von der nassen Erde den Geruch von Zuckerrohr und Zimt, süßlich und aufreizend. Weit entfernt brannten Lichter, Lux-Lampen, und waren Stimmen und Instrumente zu hören. Irgendeine Feier, Hochzeit oder ein Beschneidungsfest. Wir waren am Ufer zu einer anderen Welt. Jenseits der Bahnlinie lag das ländliche Ägypten, das unerschütterliche, das sich herzlich wenig um unseren Krieg kümmerte.« Tsirkas dreht hier die Perspektive um, der Betrachter wird zum Fluchtpunkt. Ein anderes, uraltes, stoisches Ägypten, das mit europäischen Wahrnehmungsmustern nicht zu verstehen ist, taucht vor uns auf und zugleich erahnen wir bei Manos eine Freigebigkeit des Geistes, welche die Selbstaufopferung als unerheblich erkennen wird und die Vergeblichkeit aller militärischen Aktionen voraussieht. An anderer Stelle spricht ein alter griechischer Fischer von den Beduinen: »Sie sagen, ihr Griechen, Engländer, Juden, Fellachen und Syrer seid alle nur vorübergehend hier. Uns bekümmert nicht, was in euren Besitzurkunden steht. Wir sind das Land, und wir haben es seit Urzeiten auf unsere Sippschaften verteilt.«Und Ariagni, nach einem Gespräch mit ihrem Mann über die Spaltung von Einheimischen und Europäern in den Gewerkschaften, warnt davor, die Ägypter schlecht zu behandeln, und spricht die prophetischen Worte: »Warum grabt ihr einen Graben und sondert euch ab? Wohin wird euch so eine Denkweise noch bringen? [...] Meine Augen sollen das nicht sehen. Der Tag wird kommen. Ich sehe, wie sich Leute an den Kais drängen, um sie herum bergehoch die Koffer und die Bündel und die Matratzen.«
Ariagni ahnt im Jahre 1942 den Exodus der Europäer voraus, der ab 1961 – im Gefolge der Nationalisierung der Industrie durch Nasser – massiv einsetzt. Tsirkas legt in den Mund der Griechin Ariagni die eigenen späteren Erfahrungen. Nach der Verstaatlichung der Gerberei wird er 1963 zur Emigration gezwungen, muss Alexandria, die Stadt, in der er vierundzwanzig Jahre ohne Unterbrechung gelebt hatte, verlassen und verbringt die letzten sechzehn Jahre seines Lebens in Athen. Athen ist für ihn Exil, er vermisst Ägypten. Er beschwört meisterhaft in den Redewendungen seiner Protagonisten die Mehrsprachigkeit der Levante. Durch kleine sprachliche Besonderheiten lässt er den Kosmopolitismus ›seiner‹ Stadt aufscheinen, ja aufklingen. Und er schiebt in die Handlungskapitel des dritten Bandes, also des Romans, der in Alexandria spielt, immer wieder Rückblenden, funkelnde Erinnerungskapitel, in denen Manos seine Kindheit am Meer, vor den Toren Alexandrias, bei seinem Großvater heraufholt. Es sind die unbeschwertesten Passagen der ganzen Trilogie, durchtränkt von Lichtern, Gerüchen, Sonnen, ersten Liebschaften, erstem Kummer. Eindringlich sind auch die Porträts der anderen Städte seiner Trilogie, zum Beispiel Jerusalem 1942 nach dem Eintreffen der ersten Flüchtlinge aus Ägypten: »Leute jeden Schlages: Männer in Samtanzügen, gepudert tänzelnd, Mädchen mit grellen Halstüchern und eng anliegenden Hosen oder alte Frauen mit Pelzen im Hochsommer, um den Hals bunte Terrakottaketten, besetzten von morgens bis spät abends die kleinen Tische im Alaska und Astoria […]. Später konnte man sie in der großen Halle des King David Hotels finden, wo sie Whisky tranken und tanzten, auf Tuchfühlung mit den höheren Offizieren der Alliierten. Reiche Levantinerinnen fuhren in riesigen Limousinen vor und hatten dafür Sorge getragen, dass ihr Liebhaber am Steuer saß statt eines Fahrers. Paare, die ihre Verbindung lange verborgen gehalten hatten, zeigten diese nun offen vor, Freundeskreise tauschten endgültig und offiziell ihre Frauen oder Männer untereinander, [...]. Niemals hätte man geglaubt, dass so viele und so exaltierte Menschen eine Rechnung mit Hitler zu begleichen hatten.«
Diese Passage rückt Tsirkas in die Nähe der farbenreichen, zugleich opulenten und knappen Schilderungen Odessas in den Erzählungen Isaak Babels, der Porträts persischer Städte in den Reisebüchern Nicolas Bouviers und natürlich der immer leicht aufgeregten Schilderung Alexandrias in Lawrence Durrells gleichnamigen »Quartett«. Als Justine, der erste Band der Tetralogie, 1957 in London erschien, hatte Tsirkas sein Romanprojekt schon im Kopf und die Menschen in der Jerusalemer Pension skizziert. Er besorgte sich die griechische Ausgabe der Justine und machte nach Lektüre die folgende Notiz: »Das sind meine Themen. Durrell hat sie mir geklaut. Ich muss sofort mit meinem Roman beginnen. Werde es ihm zeigen.«
Das Spezifische der Annäherung Tsirkas’ an seine drei Städte ist, dass er diese nahöstliche Welt nicht, wie Durrell, mit den ästhetischen Kriterien des Westens beschreibt. Das mag ganz einfach damit zusammenhängen, dass er ein ägyptischer Grieche ist, ein später Nachfahre der Ptolemäer, und in Kairo und Alexandria den größten Teil seines Lebens verbracht hat. Mit dieser Erfahrung schafft er eine bis in Sprache und Syntax hineinwirkende kulturelle, geographische und zeitliche Vertrautheit, die für den Leser fast physisch nachvollziehbar ist. Beispiele dafür finden sich überall in der Trilogie. In der Mitte von Ariagni, dem zweiten der drei Bücher und damit an zentraler Stelle der gesamten Trilogie, verirrt sich Manos Simonidis in einem Elendsviertel in der Altstadt von Kairo, wo sich das heruntergekommene Haus befindet, in dem Ariagni mit ihrem Mann wohnt und in dem sie den am Kopf schwer verletzten Manos aufgenommen hat. Nach einem Rendezvous mit Michelle Rapescu verirrt sich Manos auf der Suche nach diesem Haus in den engen Pfaden und Sackgassen des Viertels: »Ich kam zu einem runden »Platz«,nicht größer als ein geöffneter Fallschirm. In der Mitte stand, unerwartet, ein kurzer Stumpf einer Palme, kopflos. Aber die Häuser drum herum drängten sich eng aneinander und ließen keine Passage. [...]. Die Sackgasse. Ich kehrte um. [...]. Begab mich nach Westen und ramponierte meine Jacke an den Wänden. Um durch den Spalt zu kommen. Richtig. Der kleine Weg verlief gerade und bog später ab, später wieder.[...]. Ich drehte mich um und nahm die anschließende Passage. Ich kam bei derselben Wand heraus. Wieder zurück. Die Gasse war kaum drei Finger breiter als die anderen, der Erdboden ebenso uneben, nur sorgfältiger gekehrt. So lange war ich umhergeirrt, aber jetzt hatte ich das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein.« Aber Manos täuscht sich, er ist nicht auf dem richtigen Weg, und er findet aus dem Labyrinth nicht heraus, unfähig, dessen Anlage und Struktur zu erkennen. Doch nur für den Fremden ist »das Labyrinth« ein Labyrinth, für die europäische Imagination, nicht für die Araber, die darin wohnen, und auch nicht für diejenigen wie Ariagni, die in Kairo leben und in diesem Viertel ihr Zuhause haben. So ist es schließlich auch Ariagni, die Reinste aus Naxos, auch Ariadne genannt, jene mit dem Faden, oder die Shakespearesche Ariachne, die Manos herausführen wird: »An jenem Nachmittag holte mich Ariagni aus dem Labyrinth. Der akustische Telegraf des Viertels war wie das Tam-tam des afrikanischen Dschungels und informierte sie, dass ihr Gast, der mit der Narbe, seit Stunden versucht, sich durch die Gassen zu kämpfen.« Durch die Kunst von Stratis Tsirkas entfaltet das Labyrinth eine beklemmende physische Präsenz und wird zugleich zum Sinnbild für die Irrungen und Wirrungen von Manos, für seine emotionalen und politischen Unzulänglichkeiten.
4
Tsirkas war selbst politischer Kämpfer und Aktivist. Auf der Grundlage seiner Erfahrungen hat er einen großen politischen Roman geschrieben. Intimer Kenner der Schauplätze, breitet er vor uns das östliche Mittelmeer »mit so vielen erregenden Essenzen wie möglich« (Kavafis) aus. Zugleich war Tsirkas ein Intellektueller, bewandert in Literatur und Dichtung, wie sein Held Manos. Auf Dichter, besonders auf Hölderlin, Gongora, Baudelaire, Kavafis, T.S. Eliot (jenen Mr. Eliot in Annas Porträt von Manos), wird immer wieder angespielt, Manos zitiert sie. Zu »den vielen erregenden Essenzen« gehört die Liebe in allen ihren Formen und der Furor der Begierde. Tsirkas’ politischer, historischer, levantinischer Roman ist auch ein großer erotischer Roman. Ein langer Zug von Frauen – Ehefrauen und Ehebrecherinnen, Müßiggängerinnen, Agentinnen, Prostituierte – gibt dem griechischen Kampf im Untergrund, den britischen Militäraktionen und den diplomatischen Winkelzügen das Geleit. Manos ist − neben allem anderen − ›un homme couvert de femmes‹. »War es der Krieg oder war es mein Schicksal, immer auf Frauen zu stoßen, die keinen Widerstand leisteten. Michelle, Nina, Allegra. Und Emmy. Ach, Emmy«, spricht Manos zu sich selbst, am Ufer des Nils, auf dem Weg zu dem Restaurant »Die Tauben«, wo er Fanis und den Genossen Garelas treffen wird. Ihre politischen Gespräche werden unterbrochen. Ein Boot legt an, Musiker, eine Tänzerin und die Leute vom Boot, »gut gekleidet, mit Stehkragen, Fezen, Kneifern«, begeben sich ans Ufer. Einer zieht seinen Schlips aus und gibt ihn der Künstlerin. Sie bindet ihn fest um ihr Becken und beginnt zu tanzen: »Eine Wellenbewegung ging durch ihren Körper von den Fersen bis zum Kopf; als die Bewegung nach unten ging, ließ sie sie an der Hüfte anhalten; ihre Hinterbacken gingen wie die Kruppe der Stute hin und her und blieben dann schräg stehen. ›Ja amar!‹ keuchten die Männer.« Manos denkt an die »Judennutte« Allegra, die ihm Ariagni zugeführt hat, während ihm Garelas erzählt, dass Emmy einen Sohn geboren hat. Tsirkas lässt Manos das ungerührt zu Kenntnis nehmen. Es scheint, als fielen Manos die Frauen zu und lösten sich auch wieder. Er will sich nicht binden, er unterdrückt seine Eifersucht, er ist zerrissen zwischen den Erfordernissen der politischen Aktion – Untergrund, Versteck, Anonymität – und der Suche, seine Einsamkeit aufzubrechen, Gefühl und Verlangen zur Deckung zu bringen, und sei es in der Wollust. Es gibt wenige Schriftsteller, die über die physische Liebe so schreiben können wie Tsirkas. Nach einer Liebesnacht mit Nancy: »und auf dem Boden die nächtliche, zappelnde Ernte: Gold, Rubine. An Nans Händen, Brüsten, den Ohren haben sie Spuren hinterlassen. Der Bauchnabel und der Schoß, abgrundtief: eherne Eileitern; fünfarmige Seesterne; kristallklare Springbrunnen. [...] Nan sieht ihren Schenkel angewinkelt, glatt, fest, und wohlgeformt. An seinem oberen Ende etwas Farbe, vielleicht das Rosa der Scham? Die Knie haben sich aufgeschunden, als sich am Ende die Welt verdrehte und sie sich in stürmischem Rhythmus auf dem rauen Baumwollstoff abmühten, und er eingeklemmt hin- und hergeworfen wurde und zwischen dem Dunkel und dem Licht schrie.« Tsirkas findet immer wieder unerhörte, so noch nicht vernommene Bilder für Begierde, körperliche Umklammerung oder komplizierte Eifersucht. Die Paradoxa der Liebe sind eines seiner Hauptthemen. »Bald begannen Halbmonde auf meinen Rücken zu fallen. Schlitzten mich auf vom Scheitel bis zur Sohle«, erinnert sich Manos an die erste Liebesnacht mit Allegra in Kairo, während vor ihrem Zimmer ein Straßenfest tobt: »Sie hatte ihren Rhythmus von der entfesselten Handtrommel übernommen, und ihr Atem keuchte jetzt zusammen mit dem sich wiegenden Gekeuche der Straße. Wir begannen zu schreien. ›Weiter, weiter, weiter‹ klagte sie. ›Emmy, Emmy‹, stöhnte ich und tauchte noch tiefer ein.« Auch wenn der Taumel, das nackte Verlangen in den Liebesbeziehungen oft im Vordergrund stehen, ist Tsirkas auch Meister der erotischen Zwischentöne.
In einer Szene im dritten Band bringt Nancy Fanis zum Aufzug, kommt zurück, knipst das Licht aus und umarmt Manos: »Den Kimono zog sie ein wenig beiseite und entblößte mein Schlüsselbein, heftete ihre Lippen darauf und war wie ein Vogel, der seinen Durst in einer Pfütze löscht. ›Ich weiß‹, sagte sie, ›dass du mir eines Tages sehr weh tun wirst. Du bist strohtrocken wie alle Fanatiker.‹«
Nancy durchschaut Manos, seine Skrupel, seine Labilität. Tsirkas lässt uns an keiner Stelle seiner Trilogie vergessen: Es ist Krieg, und alle Beziehungen werden von seinen Schatten überlagert.
5
Ein Jahr nach Erscheinen von Der Club (1960), dem ersten Roman der Trilogie, wird Tsirkas aus der Ortsgruppe Alexandria der Kommunistischen Partei Griechenlands ausgeschlossen. Schon früh, schon zu der Zeit, als er Kavafis kennen lernte, war Tsirkas von den politischen Zielen der Linken angezogen. Wenig später trat er der KP bei. Das hinderte ihn nicht daran, stalinistische Auswüchse zu kritisieren, wofür er von der Partei immer wieder gemaßregelt wurde. Die Ausbreitung ideologischer Debatten in dem Roman Der Club war den Genossen dann zu viel. Sie vermissten Linientreue, und der Roman war ihnen ein weiterer Beweis dafür. Tsirkas wurde zur Persona non grata erklärt. Viel von diesem Konflikt zwischen Parteidisziplin und freier eigener Entscheidung, zwischen dem ›Kreuzzug‹ für ein abstraktes Ideal und konkreter Menschlichkeit blitzt in den die Trilogie durchziehenden Debatten der griechischen Untergrundkämpfer auf. Dabei umgeht Tsirkas die alte, fatale Alternative von Ästhetik und Engagement. Sein Held Manos ist Ästhet und ist engagiert, woher seine Gewissensbisse herrühren, seine Verlassenheit, seine Scheu vor Bindungen und auch die sehr unterschiedliche Wahrnehmung durch seine Weggefährten und Geliebten.Gerade in seinem Dilemma ist Manos – wie übrigens auch Ariagni − ein Beispiel für die Würde menschlicher Existenz. Damit steht die Trilogie in einer bestimmten Tradition großer politischer Romane. Wir denken sofort an Jean-Paul Sartre und seine Trilogie Wege der Freiheit (1946-1949), an Roger Vaillands Seltsames Spiel (1945), an Ernest Hemingways Roman aus dem Spanischen Bürgerkrieg Wem die Stunde schlägt (1940) oder André Malraux‹ So lebt der Mensch (1933) und Die Hoffnung (1937). Die Nähe zu Malraux fällt besonders auf. Dessen Helden werden von Hoffnung und Angst zu gemeinsamen Aktionen getrieben. Aber sie haben Verantwortung nur sich selbst gegenüber, und nicht gegenüber einer Sache. Malraux, wie nach ihm auch Sartre und Tsirkas, sieht einen scharfen Widerspruch zwischen Moral und Politik, in dem Sinne, dass es keine ›gerechte‹ Politik und auch keine ›gerechte‹ Partei gibt. Man kann vielleicht so weit gehen zu sagen, dass Stratis Tsirkas, ganz wie André Malraux, von der Energie und der Aktionsbereitschaft der Kommunistischen Partei fasziniert war, er aber den internen Zwang und die ideologische Disziplin ablehnte. Für Manos sind militärische Gefechte, revolutionäre Aktionen und erotische Abenteuer letztlich nur Ersatzlösungen, um aus seinen tragischen Daseinsstrukturen herauszukommen. Immer wieder will er sich von allem ›befreien‹, von der Politik, von seiner Vergangenheit, von den Frauen. Obwohl er wegen seiner Verwundung vom militärischen Einsatz ›freigestellt‹ ist, beschließt er, sich dem Marsch der griechischen Brigaden durch die syrische Wüste nach Rakka, am anderen Ufer des Euphrat, anzuschließen. Das ist seine letzte große Befreiungsaktion. Dieser Marsch wird zum Trauermarsch, zum Todesmarsch. Er überlebt die unsäglichen Strapazen, um wenig später von einer explodierenden Handgranate getötet zu werden.
6
Tsirkas’ Hauptwerk erschien vor einem halben Jahrhundert. Ist das Buch gut gealtert? Nach einer so langen Periode des Friedens und der Sattheit in Europa mag es für den deutschen Leser schwierig sein, sich mit den Problemen der griechischen Widerstandsgruppen im Nahen Osten während des zweiten Weltkrieges zu identifizieren. Aber wenn wir an den Kosovo denken, an Syrien, Irak oder den Sudan, dann haben sich die Widerstandsbewegungen und das außerordentlich komplizierte Leben im Untergrund nicht grundsätzlich verändert, sind vielmehr strukturell bis heute gleich geblieben. Zum historischen Hintergrund des Romans genügt es zu wissen, dass Griechenland im April 1941 vor der deutschen Wehrmacht kapitulierte und der griechische König und sein Kabinett − nach einer Zwischenstation auf Kreta − nach Ägypten flüchteten. Der Hafen von Alexandria wird zur Zufluchtsstätte für flüchtende griechische Marineeinheiten und Handelsschiffe. Parallel zu den wechselnden Exilregierungen in Kairo bilden sich antifaschistische und demokratische Splittergruppen innerhalb der griechischen Bodentruppen und auch innerhalb der griechischen Zivilisten heraus, die in Ägypten leben. Alle diese Fraktionen kämpfen mit den Briten gegen Rommel und gegen die von den Briten unterstützten griechischen reaktionären Politiker, befehden sich aber auch untereinander. Der Sieg der Briten in El Alamein am 24. Oktober 1942 und die deutsche Niederlage in Stalingrad drei Monate später bringen den Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg. Churchill hält zu dem griechischen König, bezeichnet den griechischen Widerstand als »einen Haufen Banditen« und wirft den griechischen Brigaden Feigheit vor dem Feind vor. Im Juni 1943 werden die beiden Brigaden zu einem Marsch durch die syrische Wüste gezwungen, den viele Kämpfer nicht überleben. Nach einer Revolte im Hafen von Alexandria und ihrer Niederschlagung mit britischer Hilfe ergibt sich im April 1944 die griechische Flotte mit der Erklärung: »Wir sind im Krieg gegen Hitler, nicht gegen unsere Alliierten.« Auch die erste griechische Brigade, festgehalten in der libyschen Wüste, ergibt sich den britischen Truppen. In Moskau beschließen Churchill und Stalin, dass Griechenland britische Einflusszone auch nach Kriegsende bleiben soll. Nach der Befreiung Athens und Piräus’ bricht zwischen Royalisten und linken Gruppierungen in Athen ein langer Bürgerkrieg aus.
Diesistingroben Zügen die historische Bühne, auf der Tsirkas’ Romanfigurenagieren. Das Kriegsgeschehen grundiert ihre Handlungen und Gefühle wie ein Basso continuo. »Ein volles Haus hatte der Krieg geleert. Niemals mehr würde es so sein wie vorher«, heißt es gegen Ende des Romans. Aber das erzählerische Genie von Tsirkas stattet seine Figuren mit solcher Dringlichkeit aus, dass das zeitverhaftete Grundgerüst immer wieder transzendiert wird. Die Steuerlosen Städte gehen uns alle an. Sie vermitteln mehr als eine Ahnung von den Kämpfen um Freiheit in finsteren Zeiten und auch von der Vergeblichkeit dieses Kampfes. Wenn wir die Trilogie zu Ende gelesen haben, wissen wir sehr viel mehr über das Verhältnis von Widerstand und Repression, von Liebe und Krieg, von Hoffnung wider alle Hoffnung.
Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, dann soll mir die rechte Hand verdorren. Die Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich an dich nicht mehr denke, wenn ich Jerusalem nicht zu meiner höchsten Freude erhebe.
Psalm 137.5,6
Jerusalem, steuerlose Stadt,
Jerusalem, Stadt der Flüchtlinge.
Jorgos Seferis
(»Stratis Thalassinos auf dem Toten Meer«, aus: Logbuch III)
ERSTES KAPITEL
Mit der nach Pinien duftenden Brise drang Geflüster wie eine raunende Frühlingseuphorie durchs Fenster und eine Stimme aus alten Zeiten ließ wissen, dass sich über dem Fluss der Wohlgeruch einer goldenen Lilie verbreite.
Seit Jahren hatte Emmy so etwas nicht mehr verspürt. Welch ein Segen! Sie hatte das Gefühl, Gelenke, Nerven und ihre Seele seien aus geweihten Wassern aufgetaucht. Der entspannende und aufbauende Schlaf wich zurück, und ihr Körper, bäuchlings auf dem Bettlaken hingeräkelt, legte lustvoll am Strand eines neuen Lebens an.
Ein Schrankflügel ächzte, und ein metallenes Kofferschloss erteilte einen einsilbigen Befehl.
Ihre Nase ruhte auf einem feuchten Fleck. Seit Jahren war ihr kein Speichel mehr im Schlaf aus dem Mund geflossen. Immerhin war der Kissenbezug aus echtem Leinen.
»Guten Morgen, Hans! Wo sind wir eigentlich?«
Sie befänden sich in der Pension von Frau Rosenthal-Feldmann, sagte Hans, aber in einem so gleichgültigen Ton, als wäre er mit den Gedanken woanders. Auch stand er mit dem Rücken zu ihr. Emmy jedoch verspürte keine Lust, sich zu rühren.
»Oh, schön. Aber wo denn?«
»Ich verstehe dich nicht, Frau Bobretzberg!«
»Komm schon, Hans, sag’s mir: In Afrika oder Europa?«
»Aber … in Asien natürlich.«
Gleich würde er sich über sie beugen: Eingefallene Wangen, Silberbrille, graue Haare, Bürstenschnitt. Der typische Wiener Christsoziale.
»Frau Emmy Bobretzberg«, sagte er nun ernst zu ihr, »entschuldige, dass ich dich tadle, aber es ist unanständig, wie du daliegst. Dieses deutsche Viertel befindet sich in Jerusalem, klar?«
Ihr Negligé war hochgerutscht – zerknüllter, hellblauer Tüll fast bis zur Mitte des Rückens. Ihr ganzer Körper war makellos. Kein Härchen, nicht ein einziges Pickelchen. Feste, glatte Haut wie vergoldetes Porzellan. Und diese Rundungen … Im Kastanienwäldchen des Praters hatte Hans in einer Sommernacht den ersten erotischen Vorstoß gewagt. »Ich wollte es gern wissen«, hatte er gemeint. »Es gibt Frauen, die einer Birne ähneln. Du bist ein Apfel …«
Emmy zog das Negligé nach unten, drehte sich um, wobei sie mit dem rechten Arm ihre langen, kupferroten Haare aus der Stirn strich; sie bedeckte sich mit dem Bettlaken, das von einer fein gestickten Bordüre umsäumt war.
Das Zimmer war länglich und weiß gestrichen; durch das kleine Fenster im Hintergrund drang grünliches Licht. Die Mauern waren so dick, dass der Fenstersims als Ablagebord diente. Die Deckenbalken, kastanienbraun gestrichen, verliefen schräg, so dass die Wand rechts niedriger war. »Die Decke«, ging ihr durch den Kopf, »wir sind wieder unter einem richtigen Ziegeldach«. In der Ecke stand ein Tischchen, wohl eher ein poliertes Buchenbrett, das auf einem Dreifuß aus Nickel ruhte; darauf lag ein großes Akkordeon mit Tasten aus Perlmutt und Ebenholz. An der Wand darüber hing ein Holzschnitt von Dürer in einem schwarzen Rähmchen. In der anderen Ecke stand ein moderner Ledersessel: eine zu zwei liegenden Achten verschlungene Röhre aus blitzendem Chrom, auf der sich, parallel mit Senkeln angebracht, das zigarrenfarbene Leder mitgenommen und einladend beulte. Außerdem gab es zwei Rohrstühle mit hohem Rücken und einen Schrank, auch er aus Buchenholz, mit kubistischen Motiven, aber ohne Spiegel. Und ihre Koffer offen auf dem Boden, der ganz von einem Beduinenteppich aus Ziegenhaar bedeckt war. Draußen zwitscherten Vögel.
»Den wievielten Juni haben wir eigentlich, Hans?«
»Na … den siebten, Sonntag, den siebten.«
Er hatte seinen Stehkragen noch nicht angelegt und war unrasiert.
»In genau einem Jahr ist seit Hölderlins Tod ein Jahrhundert vergangen«, sagte Emmy.
»Da irrst du dich, glaube ich.«
»Ich mich irren? Er ist 1843 gestorben, am siebten Juni, um vier Uhr in der Früh. Schon wieder habe ich geträumt, dass er mit mir sprach. So herrlich habe ich geschlafen.«
Hans nahm vorsichtig seine Hemden aus dem Koffer und legte sie in ein Schrankfach.
»Ich nicht so gut. Dabei hätte ich bei dieser Müdigkeit durchschlafen müssen. Ich habe die Züge gehört. Güterwagen stießen aneinander, das Geräusch pflanzte sich fort; ich hörte es zwanzig, dreißig Mal, anschließend verebbte es; dann ging’s wieder los: die Lokomotive pfiff; jemand rief etwas; der Heizer ließ Dampf ab … Am frühen Morgen war mir im Halbschlaf, als hätte man mich an die Gleise gekreuzigt …«
Schon wieder hatte ihn die Panik fest im Griff.
Als der Mann vom Hotel sie gestern am Bahnhof abholte, sagte er ihnen, er habe ein Zimmer in einer Pension reserviert, weil im Astoria die Reisenden sogar in den Korridoren schlafen müssten. Er griff sich den großen Koffer und lief festen Schritts durch das Dunkel, während sie beide über wildfremdes Kiesgelände stolperten und sich mit der Rechten durch die Nacht tasteten. »Oh, schön kühl«, seufzte sie aufatmend. Kein Wunder bei dieser Höhe: siebenhundert Meter über dem Meeresspiegel ist doch was ganz anderes als jenes übel riechende Tiefland der Pharaonen! So lange sie in Alexandria wohnten, hatte sie sich ständig beklagt: »Ich habe einen Kloß im Hals, Hans, und das wird einfach nicht besser.« »Du hast ganz einfach Angst und willst es nicht eingestehen«, erwiderte er. Und fügte hinzu: »Irgendwo im Hals steckt der Selbsterhaltungstrieb. Wenn du plötzlich ein Krachen hinter dir hörst, was machst du dann?« Aber das war’s nicht, denn sie stürzte immer auf den Balkon, wenn die Sirenen heulten, um das Spektakel nicht zu verpassen. Hans dagegen suchte im Dunkeln nach dem Schuhlöffel und der Aktenmappe … »Ah, was für ein Duft«, hatte er gestern gesagt. »Es riecht nach Eukalyptusbäumen und Pinien.« »Und Platanen«, fügte der Mann vom Hotel auf Deutsch hinzu. Jetzt leuchtete er ihnen mit einer blau verglasten Taschenlampe, damit sie den Pfad zwischen den Büschen und Kalksteinhaufen erkennen konnten. »Sollen wir nicht lieber ein Taxi nehmen?«, fragte Hans. »Nicht nötig. Noch zweihundert Meter, und wir sind da.« »Zweihundert Meter vom Bahnhof? Aber der ist doch ein strategisches Ziel!«, sagte Hans und verstummte plötzlich. Dann hörten sie Musik, eine Frau kreischte hinter den Bäumen, bis sie von einer Maschinengewehrsalve zum Schweigen gebracht wurde. Der Mann vom Hotel blieb stehen: »In Ihrem Viertel gibt es sogar ein Freilichtkino. Sehr mondän.« Seine Stimme hatte etwas Vertrauliches.
Emmysetztesich im Bett auf. Vor dem Fenster grünte der Wipfel eines Eukalyptusbaums. Die Blätter glänzten vom morgendlichen Tau.
»Mir kommt alles wie ein Märchen vor. Irgendetwas sagt mir, dass die Rückreise bereits begonnen hat. Ich rieche Europa. Die Lage kann unmöglich so dramatisch sein.«
»Dein Instinkt, Emmy?«, meinte Hans, wobei er streng ihr Dekolleté musterte. »Sollte der amerikanische Oberst für nichts und wieder nichts ganz Kairo nach mir abgesucht haben? Die Engländer wollen es nicht zugeben, sie fühlen sich sogar auf den Schlips getreten. Aber die Yankees verstehen keinen Spaß. Du hast ja gesehen, wie schnell sich Sitze im Militärzug fanden. Einen Schlafwagen hätten wir gewiss nicht auch noch verlangen können!«
»Dieser Neuseeländer verschlang mich geradezu mit seinen Blicken … Mein Gott, sagte ich mir, lass mein Gesicht frisch bleiben … Und du tatest so, als verstündest du kein Englisch! Ich wollte dich nicht bloßstellen.«
Ihr Mann sagte ungeduldig:
»Hier ist nicht Europa, Frau Bobretzberg; begreif das endlich. Hier ist der Orient. Wenn du die Altstadt siehst und vom Hass und den Intrigen erfährst, die diese steuerlose Stadt zerfleischen, spürst du, wie weise …«
Der Papst! Sie waren wie gehetztes Wild im Vatikan angekommen. Ein löchriger Beutel war ihr Herz, und das Hirn nichts als ein schwarzer Vorhang. Elf Monate hatten sie sich in einem Tiroler Chalet versteckt, bis sie die Grenze überqueren konnten. Zehn Minuten Audienz gewährte ihnen der just gewählte Papst Pius XII. Mit zusammengepresstem Kiefer hörte er zu, zehn Minuten lang. Dann sagte er etwas auf Lateinisch: In den kommenden Jahren der großen Prüfung sei Schweigen die vornehmste Christenpflicht. Es war ein Satz wie die Maria-Theresientaler, von denen man in der Schule sagte, sie würden immer ihren Wert behalten, allerorts und zu allen Zeiten. Und Hans hatte das geschluckt. Wie konnte man nur so naiv sein!
»All das kommt mir ziemlich unwahrscheinlich vor«, sagte Emmy wieder. »Wenn die Amerikaner so besorgt sind, weil sie Rommel bereits in Alexandria einmarschieren sehen, hätten sie uns nach Südafrika oder noch weiter weg schicken müssen.«
»Aber das hier geht doch auf meinen Wunsch zurück, Emmy!« rief Hans gereizt. »Meine Position erfordert Anwesenheit in Frontnähe. JohannesburgoderWashingtonwärenwieExilfüruns,wieeine Strafe.«
Seine Position! Der letzte Minister Österreichs! Dieses Durcheinander und die Panik. Die Stiefel der Nazis auf der Ringstraße, die sattgrünen Kastanienbäume und der Kanzler, der nicht mehr wusste, sich nicht erinnerte, welches Ressort er ihm gegeben hatte, Erziehung oder Soziales.
»Hier kann ich mich nützlich machen«, sagte Hans. »Ich werde die Radiosendungen der Freien Österreicher leiten. Und wenn es kritisch wird, sind wir in zwei Stunden mit einem Taxi auf dem Flughafen von Lydda. Jetzt, wo ich mit den Amerikanern in Verbindung stehe, wird alles leichter.«
Wieder Feilschen, Aufschübe, Demütigungen …
Und dann war unten auf der Gasse eine Fahrradklingel zu hören. Ein Kind pries mit melodischer Stimme Joghurt an. Sofort knarrte eine Bohle vor ihrer Zimmertür. Schritte. Jemand eilte die Holztreppe hinunter. Hans riss die Augen weit auf und wies mit dem Kopf zur Tür. Sie zuckte gleichgültig mit den Schultern. Die Zauberwelt, die sie beim Erwachen umfangen hatte, war weg. Trotzdem versuchte sie sie zurückzuholen.
»Ich glaube, ich weiß, warum ich so gut geschlafen habe«, sagte sie. »Drei Jahre haben wir nicht mehr im selben Bett gelegen. Seit Rom. Ich hasse diese Flüchtlingspritschen! Du hast mir zwar die ganze Nacht den Rücken zugedreht, aber wenn ich meinen kleinen Zeh bewegte, konnte ich dich berühren.«
»Ich bitte dich, Emmy, das geht zu weit!«, unterbrach sie Hans.
Gleich darauf waren wieder Schritte zu vernehmen; die Bohle knarrte. Jemand klopfte an die Tür.
»Herr Bobretzberg. Exzellenz!«
»Frau Anna«, sagte Hans leise, »deck dich zu!« Und laut: »Ja, Frau Feldmann, was gibt’s?«
»Entschuldigen Sie, Exzellenz. Wenn Sie heute duschen wollen, müssen Sie sofort herunterkommen. Ich passe auf das Bad auf, dass ja kein anderer hineingeht. Gerade habe ich gewischt.«
»Ich komme, gnädige Frau, vielen Dank.« Und zu Emmy: »Sehr komfortabel! Immerhin muss man nicht runter in den Garten.«
»Es ist so schön hier«, sagte Emmy.
Hans griff nach dem Rasierbeutel, einem weiteren, in dem die Pantoffeln steckten, und nahm sich ein Handtuch aus dem Schrank. Er öffnete die Tür, stockte dann aber kurz.
»Schließ hinter mir ab, sicher ist sicher«, sagte er.
»Geh schon, ich schließe ab«, meinte Emmy lachend.
Wenig später jedoch klopfte Frau Feldman wieder: »Guten Tag, Frau Bobretzberg, darf ich?« Ohne die Antwort abzuwarten, kam sie herein. Sie steuerte geradewegs auf das Tischchen zu, nahm das Akkordeon und legte es auf den Fenstersims. Der gelbe Morgenmantel aus festem Seidendamast – ein wahrhaft fürstlicher Stoff – ließ sie noch größer und dünner erscheinen; doch ihre Haare, in Löckchen ums längliche Gesicht gelegt, waren von einer undefinierbaren Farbe zwischen karotten-und strohgelb; eingedrehte Fransen bedeckten eine schmale Stirn; von hinten gesehen, sah sie einem neuen Spinnenfeger ähnlich, von vorn einer gefallsüchtigen, unbefriedigten Frau mittleren Alters.
»Herrliches Wetter! Ich komme wegen des Frühstücks«, sagte sie.
Eine Art Zaudern und eine gewisse Steifheit verliehen ihren Bewegungen etwas Unbeholfenes und Militärisches.
»Warum nehmen Exzellenz morgens noch nicht einmal Wasser zu sich?«, fuhr sie fort. »Wenn er es aus Sparsamkeit tut, schadet er sich selbst, das versichere ich Ihnen. Allein die beiden Eier kosten mich fünfzig Mils, soviel, wie ich für das ganze Frühstück berechne.«
Ihre wimpernlosen Lidränder waren rot, ihre Augen zwei ruhelose blaue Knöpfe. Sie schielte leicht, was sie überspannt aussehen ließ.
»Das ist nicht der Grund«, sagte Emmy und wurde rot. »Er ist seit Jahren gewohnt, sein Frühstück spät einzunehmen, und zwar außerhalb.«
Hans ging jeden Morgen zur Kommunion, aber einer Andersgläubigen gegenüber brauchte er keine Erklärungen abzugeben. Wenn sie Menschenkenntnis besaß, merkte sie das von selbst.
»Wie Sie möchten«, sagte Frau Anna barsch. »Angemerkt sei nur, dass ich dem vereinbarten Preis fünfzig Mils hinzufüge, also ein Frühstück.«
Plötzlich hob sie die Arme und entblößte ihre spitzen Ellbogen:
»Oh, Allmächtiger«, sagte sie, »wie schön Sie sind! Was für Augen, was für Haare, was für eine Haut!«
Emmy wurde wieder rot. Sie zog das Laken noch ein Stück höher.
»Dankeschön«, sagte sie, »ich habe wunderbar geschlafen.«
»Nicht wahr?«, bemerkte Frau Feldmann triumphierend. »Das liegt an der Matratze, wissen Sie. Hier schlafe ich, wenn ich keine Gäste habe. So nenne ich sie. »Kunden« klingt ordinär. Wo waren wir gerade? Ah, das Geheimnis des Schlafs liegt in einer guten Matratze. Auch das der Liebe natürlich, wenn’s gestattet ist. Die hier hat mein armer Mann entworfen. Er hat die Höhe überschlagen, die Breite und die Kissen, und auch das Material ausgewählt. Haben Sie bemerkt, dass sie am Fußende erhöht ist? Andere Leute schieben dort was darunter, damit’s ein wenig höher wird. Korrekt ist aber, das Fußteil separat anfertigen zu lassen. Auch alle Möbel, die Sie hier sehen, sind von ihm entworfen. Dann noch Silberbesteck und Geschirr, alles in Deutschland hergestellt. Ich habe mitgenommen, was ich konnte.«
Als Rheinländerin sprach sie sehr schnell und geriet bisweilen ins Stottern. Sie tippte sich gegen die Stirn:
»Oh Gott, jetzt hab ich mich aber ablenken lassen. Ich muss mich ja auch um die anderen kümmern. Gleich bringe ich Ihnen das Frühstück, ja? Duschen können Sie später, seine Exzellenz sagte mir, Sie hätten es nicht eilig mit dem Ausgang. Lassen Sie erst mal die anderen rein. Leider haben wir ja nur ein Badezimmer für die beiden Stockwerke.«
»Ich würde gern ein warmes Bad nehmen … wenn möglich«, sagte Emmy, das Terrain auslotend.
»Wir haben auch einen Badeofen, der mit Torf geheizt wird. Fünfzig Mils das Päckchen, zwei Päckchen hundert Mills. Doch würde ich Ihnen nicht empfehlen, sich in die Badewanne zu setzen. Ich mache sie sauber, desinfiziere sie, aber ich da habe so meine Befürchtungen. Unten wohnen alle möglichen Leute. Kann man da wissen, was für Krankheiten die einschleppen? Ich habe einen Holzrost, den lege ich in die Badewanne, stelle mich drauf und mache die Dusche an. Im Winter warm, im Sommer kalt. Ich lege Ihnen meinen Rost hinein.«
»Danke, Frau Feldmann. Wissen Sie, ob es weit ist von hier zur deutschen Kirche?«
»Zur deutschen Kirche?« sagte die andere, als hätte man sie nach dem Akkordeon im Zimmer gefragt. »Hier, vom Fenster aus zu sehen … Ach, der Eukalyptus ist schon wieder gewuchert! Das Rote, da hinter den Bäumen, ist das Dach.«
Aber Emmy machte keine Anstalten aufzustehen. Die Feldmann verbeugte sich, das Zimmer füllte sich mit dem goldenen Widerschein ihres Morgenrocks; Locken und Arme schüttelnd, um zu zeigen, wieviel Verantwortung auf ihr lastete, entfernte sie sich mit großen Schritten, wobei sie ihrem Kehlkopf ein neckisches Kichern entlockte.
Sofort sprang Emmy aus dem Bett und schloss ab, zog ihr Negligé aus und ließ es auf den wollenen Kelim gleiten. Diese Brise voller Düfte … Im Zimmer gab es keinen Spiegel. Und wieder jenes Vorgefühl … Ein neues Leben, erfüllt, aber auch einfach zu schultern. Sie holte einen kleinen Spiegel aus ihrer Tasche »Was für Haare, was für Augen, was für eine Haut!« hatte die Frau gesagt. »Eine Haut wie Schlagobers im Café am Graben!« Sie setzte sich in den Sessel und betrachtete sich. »Mizzi, Mizzi, das stammt von dir. Gemeint war deine Haut …«
Sie kannten sich von der Schule, wurden aber erst im Jahr von Emmys Verlobung richtige Freundinnen. Mizzi arbeitete im Schuhgeschäft Bally, gegenüber ihrer Wohnung im Karl-Marx-Hof, einem Gemeindebau in Heiligenstadt. Die Umstände brachten es mit sich, dass sie beide zu einer Basketballmannschaft für Mädchen gehörten, einer roten natürlich. Eines Samstagnachmittags streichelte ihr Mizzi in den Umkleideräumen den nackten Rücken, von zahlreichen Pubertätspickeln verunstaltet. »Mensch«, sagte sie, »diese Akne ruiniert dich noch. Warum tust du nichts dagegen?« »Was zum Beispiel? Salben, Therapien, alles habe ich schon ausprobiert. Der Arzt meint, mit den Jahren gingen sie weg.« Damals lachte Mizzi ihr kristallenes Lachen. »Warum fragst du nicht deinen Parteisekretär nach seiner Meinung?« empfahl sie ihr. Was ihr Sekretär denn damit zu tun habe, fragte Emmy. Der habe doch andere Zuständigkeiten. Mizzi umfasste ihre Taille. Die anderen Mädchen begannen mit den Sticheleien. Aber Mizzi führte Emmy zu einer mit Ölfarbe blendend weiß gestrichenen Bank. »Lass sie nur«, sagte sie, »die haben bald genug und verschwinden.« Tatsächlich gingen sie gleich und sangen dabei das »Lied vom traurigen Sonntag«; die Wasserhähne und Duschen hatten sie laufen lassen. »Ehrlich«, sagte sie, »der mit dem Stehkragen, der dich immer abholt, seid ihr schon verlobt oder noch nicht? Ich mache dir keinen Vorwurf, dass du ihn mir nicht vorgestellt hast, ich verstehe das schon. Uns trennt die Politik. Darin bist du neutral. Ist auch dein gutes Recht. Aber sag mal, was macht ihr eigentlich abends, wenn ihr ausgeht?« Emmy antwortete ihr ausweichend. Aber Mizzi hatte ihre spielerische Miene jetzt aufgegeben. Beharrlich und indiskret wollte sie es wissen und schließlich erfuhr sie es: »Nichts Besonderes«, war die Auskunft. Und dann unternahm sie’s, der Freundin die »Blüten der Jugend« zu erklären, wobei sie Chemie, Biologie und Hygiene miteinander vermengte. Und was die Hormone mit einer schönen Frauenhaut zu tun haben. Die Stimme weiter senkend, aber jetzt ganz sachlich, ohne gleichwohl mit dem Streicheln ihres Rückens aufzuhören, legte sie ihr dar, wie sie es anstellen müsse, damit ihr kein einziger Tropfen verloren ginge. Emmy wurde puterrot. Sie verging vor Scham, doch eine wilde Freude ließ ihr Herz hüpfen und sie gab keinen Mucks von sich. Mizzi stand auf, ging unter die Dusche und pfiff eine Weise. »Weißt du, was das ist?« »Klar, aus der Zauberflöte von Mozart«, sagte Emmy sogleich. Die andere betrachtete sie schelmisch. Plötzlich begriff Emmy und wurde wieder rot bis über beide Ohren. »Oh Mizzi …« sagte sie enttäuscht, gleichsam vorwurfsvoll. Mizzi brach als erste in Gelächter aus. Und dann packte beide ein solcher Lachanfall, dass sie sich auf die nassen Fliesen setzen mussten und kreischten … Die Putzfrau kam im blütenweißen Kittelkleid herbeigelaufen, ein Lorgnon auf der Nase; man nannte sie Frau Doktor. »Was ist los, Mädchen? Kommt schon, sagt’s mir doch auch«. Mizzi, Mizzi …
Hans drehte ungeduldig den Türknauf. »Einen Moment«, sagte sie. Ihr Morgenrock hing seit gestern Abend im Schrank. Natürlich kein Vergleich mit dem fürstlichen der Feldmann.
»Du musst dir mal anschauen, was da unten vor sich geht«, sagte Hans angewidert. »Der reinste Turm von Babel. In jedem der vier Zimmer wohnt eine ganze Familie. Kinder, alte Frauen, Soldaten, Flüchtlinge. Sie haben mit Frau Anna nichts zu tun, unten vermietet man die Zimmer vermutlich getrennt. Überleg mal: Wir alle, unten und oben, haben nur ein einziges Bad und keine Küche! Die Feldmann scheint mit ihnen zerstritten zu sein. Sie behandelt sie sehr grob. Keine Frage der Religion, weil die unten auch Juden sind. Und was soll diese Geschichte mit dem Frühstück? Gestern hatten wir uns auf vierhundert Mils pro Zimmer mit Frühstück geeinigt.«
»Egal, Hans«, sagte Emmy und zog ihren Morgenmantel aus. »Es ist doch so billig … Nicht mal die Hälfte von dem, was man uns in Kairo abgeknöpft hat.«
»Willst du das Shepherd’s Hotel mit dieser Arche Noah vergleichen? Daserübrigtsichwohl! Unddannauchnoch: ›WielangegedenkenSie zubleiben,Exzellenz?‹›EinpaarTageschon,höchstenseineWoche‹, sageichzuihr.›Oh,nur?‹,erwidert sie.›HerrAndreanuhattegesagt, Sie blieben über einen Monat, und ich habe ihm selbstverständlich die entsprechende Provision im Voraus bezahlt‹. Selbstverständlich. Kaum angekommen, haben wir es wieder mit den Juden zu tun, das istschonmalklar! Und willst du nicht wissen, wer Herr Andreanu ist?«
»Doch, Hans!«
»Der uns vom Bahnhof abgeholt hat. Der Maître d’hôtel des Astoria. Und dazu noch unser Nachbar! Er hat ein Zimmer genau unter uns. Ich habe ihn gesehen, wie er geschniegelt und gebügelt hinausging. Und diese Verbeugung! Ich habe auch seine Frau gesehen, so eine zierliche, katzenhaft lethargische.«
»Du dramatisierst, lass das. Mir macht es nichts aus, länger hier zu bleiben. Immerhin herrscht eine häusliche Atmosphäre. Nachmittags trinken wir Tee zusammen, und sollte einer krank werden …«
»Bitte, Emmy! Vergiss nicht: hier sind wir Flüchtlinge!«
»Aber wir sind ja der Welt völlig abhanden gekommen, Hans. So viele Jahre allein, ohne Freunde, ohne menschliche Wärme.«
Ihre Augen hatten sich mit Tränen gefüllt. Hans beeilte sich mit dem Anziehen.
»Darüber reden wir nochmal«, sagte er. »Ich gehe jetzt und versuche die Verwaltung ausfindig zu machen. Wo wollen wir uns gegen zwei zum Essen treffen? Es ist schon lästig, dass diese Pension nicht mal ein Telefon hat.«
ZWEITES KAPITEL
Ich wusste nicht, dass man die Einsamkeit schlückenweise trinkt. Ebenso wenig, dass sie so bitter ist. Jeden Tag einen Krug davon. Mein Mund will sich nicht daran gewöhnen. Auch steigt sie mir zu Kopf. Menschen gestikulieren, halten schulmeisterliche Reden. In meiner Mansarde liegend oder sitzend, höre ich sie ohne Ende reden – wie die Rumpflosen Köpfe. Immer wieder das Gleiche; alle Wörter aus derselben Gussform.
Die Sonne dreht sich langsam, wie das Rad eines türkischen Karrens, und lässt die gotische Mütze des kleinen Kirchendaches erglühen. Über meinem Kopf dreht sich die Wetterfahne – ein Fuchs aus Zink mit steifem Schweif – und jammert verhalten.
Am schwierigsten ist die Dämmerung abends. Ich habe Angst davor, den ganzen Tag erwarte ich sie, und wenn sie da ist, achte ich reglos auf meine Nerven, fühle den Puls meiner Ausdauer. Sobald die Kirchenglocke ertönt und die Sonne hinter den grauen Felsbergen versinkt, davor die rötliche Erde um Ölbäume und die Straße nach Jaffa, die sich von Bergrücken zu Bergrücken schlängelt, beginnt mich der Teufel zu reiten. Nur raus hier! Dichtes Dunkel flutet ins Blattwerk der Bäume. Hoch oben ist aber noch Tag, und die Hügelspitzen im Osten färben sich veilchenblau. Sofort rauszugehen wäre unbesonnen. Vielleicht nicht gleich am ersten Tag, und wenn ich mich daran gewöhnte, dann würde ich sicher irgendwann den Preis dafür zahlen.
Mir fällt gerade nicht ein, wer den Einbruch der Nacht hierzulande mit dem gemächlichen Gang eines Mädchens verglichen hat, das barfuß in Ruhe von der Quelle zurückkehrt. Stimmungssache. Als ich hierher kam, schien auch mir die Nacht etwas Biblisches an sich zu haben. Aber damals hatte die Untätigkeit mein Gespür noch nicht abgestumpft. Jetzt erinnert sie mich an eine gefallsüchtige Künstlerin, die hinter den Kulissen ihren Auftritt hinauszögert.
Wenn es richtig dunkel geworden ist, gehe ich runter; mein Kopf schwirrt vom Gewinsel des Fuchses (»al-lein, al-lein«). Ich stampfe fest auf die dumpf hallende Erde des Wegs, um mir die Beine zu vertreten. Rundum Finsternis. Dieses Viertel besteht nur aus Villen und Gärten; die wenigen Bewohner folgen gehorsam dem Verdunklungsbefehl des Hauptquartiers. Wenn auch entwurzelt, sind sie gleichwohl brave Deutsche geblieben. Ich kenne den Weg und brauche meine Taschenlampe nicht anzuknipsen. Aber meistens weiß ich gar nicht, wohin ich gehen soll.
Ich richte es so ein, dass ich zuerst am Häuslein der Alten vorbeikomme, wie einer, der zur Arbeit geht. Stehen die Fensterläden des Schlafzimmers halb offen, gibt’s kein Problem. Ich esse was, wir trinken auch mal einen Schnaps zusammen, reden Griechisch, es sind ja Landsleute, und so vergeht die Zeit. Wenn sie dann schlafen wollen, ziehe ich zu Fuß los in die Altstadt. Ich treibe mich in den Mauern von Jerusalem herum, schlendere spät unter zahllosen Gewölben durch die dunklen Gassen. Am meisten reizt mich das arabische Viertel. Mitternacht mag zwar vorbei sein, aber in den überdachten Ladengassen finde ich noch hell erleuchtete Geschäfte, es riecht nach Mensch, Gewürzen und Grillfleisch, und ich sehe mich satt an Seidenstoffen und Gerätschaften aus Kupfer. In einem kleinen Café, das nachts mit leiser gestelltem Radio geöffnet bleibt, schlage ich meine Zeit tot, vor mir einen Pfefferminz- oder Schwarztee. Die Behörden haben nicht gewagt, den Moslems fleischlose Tage und Lebensmittelscheine zu verordnen, weshalb Hammelfleisch für sie frei verkäuflich ist. Wenn ich also nicht bei Chatzivassilis esse, schlage ich mir den Bauch im arabischen Viertel mit Fleischspießchen und Kebap voll. Ich bestelle auch Sesamsalat oder Radieschen und zum Schluss Baklava-Gebäck. Bringt man mir die Rechnung, muss ich an mich halten, um nicht laut zu rufen: So wenig? Als hätten wir keinen Krieg, so billig ist es; die Profitgier hat die Leute noch nicht erreicht. Jedes Mal, wenn ich in ein jüdisches Restaurant geraten bin, habe ich es hungrig wieder verlassen, auch wenn man Fleisch essen durfte. Zu den hohen Preisen will ich gar nichts sagen, denn die sind irgendwie erklärbar; diese Leute haben immerhin Ausgaben; der jüdische Gewerkschaftsverband hält die Tagelöhne hoch. Aber koschere Speisen machen mich eben nicht satt.
Das christliche Viertel meide ich nach Möglichkeit. Beim Heiligen Grab war ich noch nicht und mir scheint, ich komme da auch nicht hin. »Eine Sünde«, sagte Frau Margetoula, als ich es ihr gestand, »geh eine Kerze anzünden, dass Seine Gnade über dir wacht, wo du doch in der Fremde gestrandet bist, mein Jungchen. Geh zum Heiligen Grab, wer sollte dir was antun? Dann freut sich auch Lilikas Seele, denn sie sieht uns von oben sieht und grämt sich …« Zum ersten Mal hörte ich, dass man meine Großmutter Lilika nannte, wo wir sie doch als Vassiliki kannten. Doch ich ging nicht hin.
Bleiben das russische und das armenische Viertel. Dort komme ich schon mal vorbei, aber selten. Es gibt da einen Krämer namens Louisidis, der Käse vom Balkan verkauft, und ein Bäcker, der Weißbrot backt; er tarnt es, indem er ein paar Rosinen reinstreut, sodass es wie Rührkuchen aussieht; aber er verkauft es teuer. Brot, Käse, gekochte Eier und eingelegtes Gemüse für den Mittag packe ich sorgfältig ein, klemme alles unter den Arm und trage es die ganze Nacht überall mit mir herum. Kaffee und Zigaretten habe ich mir abgewöhnt. Es wird Tag. Beim Zeitungsverkäufer, der seinen Stand am Zionstor hat, kaufe ich die Palestine Post – samstags nehme ich die andere, aber die ist nicht besonders – und gehe schlafen.
In letzter Zeit stellt die Alte Ziege ihr Feldbett immer in der Nische unter der Treppe auf. Sie stellt sich schlafend. Ich gehe hoch und bemühe mich, die knarrenden Bohlen zu meiden. Wenn ich Lärm mache, hält sie sich für verpflichtet, in ihrem schrecklichen Französisch zu fragen: »Sind Sie es, Herr Kalojannos?« Wenn ich nicht antworte, wiederholt sie die Frage, diesmal lauter, wohl um das ganze Haus aufzuwecken. Als wollte sie mir sagen: »Siehst du, was für eine gute Hauswirtin ich bin? Mir entgeht nichts.« (Oder vielleicht: »Zieh mich da nicht hinein, ich will nicht wissen, dass du dich versteckst!«). Dann kann ich nicht anders und erwidere: »Entschuldigen Sie, Madame, ich wollte Sie nicht wecken. Es ist ja noch früh.«
Ob Chatzivassilis’ Schlafzimmerläden halb geöffnet oder geschlossen sind: Das Problem, das sie lösen oder auch nicht, gehört zu den geringfügigeren: nachts allein zu sein. Es ist eigentlich gar kein Problem. Ich könnte monatelang in meiner Zelle bleiben; Jahre. So lange wie nötig. Hat Pascal nicht einmal gesagt: »Fast alle Schicksalsschläge treffen uns, weil wir nicht gelernt haben, in unserem Zimmer zu bleiben«? Vor dieser Art der Einsamkeit haben diejenigen Angst, die wie rumpflose Köpfe reden. Sind sie allein, werden sie leer, als existierten sie nicht. Kaum sehen sie einen Menschen, klettern sie auf das Katheder der Pflicht und reden und reden. Meine Ungeduld im abendlichen Zwielicht hat mit einer anderen, größeren Einsamkeit zu tun. Und an diesem Problem wird nun schon seit Monaten nicht gerührt. Auch kann ich nicht sagen, ob es sich je lösen lässt. Lieber will ich nicht daran denken. Natürlich denke ich daran, aber zu einer festgelegten Zeit, methodisch und beinahe objektiv. Sonst kapselte es mich ein und ich ginge zugrunde.
In Chatzivassilis’ Haus rufen Handarbeiten und Bilderrahmen Erinnerungen an die vor Jahren verstorbene Tochter wach, die aber nur von seiner Frau namentlich erwähnt wird. Wenn ich »Amalitsa« höre, glaube ich, sie meint die Mutter. Ich stelle sie mir sogar vor: Da ist sie, wie sie auf unsere Veranda in Kifissia stürmt, ihre Brille abnimmt und inmitten der Platanen und Pappeln nervös die nach Kefalari führende Straße mustert: »Alkis hat wieder das Fahrrad genommen. Sag du ihm doch auch mal was, als älterer …«
DannsetzenwirunsunterdieWeinlaubeundunterhaltenunsleise wieNachbarn,diediekühleLuftgenießen.DerAlteerzählt,wener gesehenhatundwasgeredetwurde.PlötzlichöffnetsicheinWeg,eng undnurschwacherleuchtet.Ich frage.Die Bernsteinperlen gleiten langsam durchdie Finger; dann legt er das ganze Komboloi in seine Faust, reibt es schnell und kräftig mit beiden Händen und riecht daran. Seine Antworten sind überlegt. Der Weg hat sich geschlossen. Ein andermal.