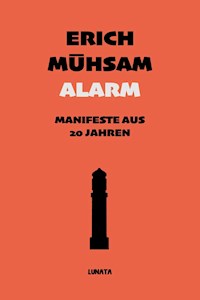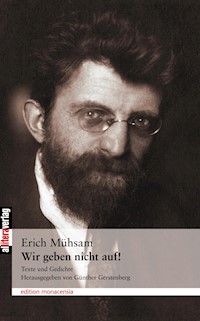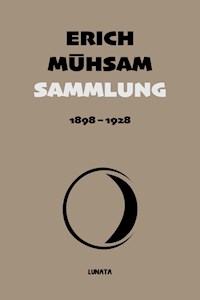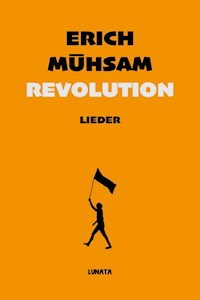Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbrecher Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Tagebücher in Einzelheften
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Erich Mühsam führte zwischen 1910 und 1924 Tagebuch. Er war Lyriker und Anarchist, Satiriker und Revolutionär und einer der führenden Köpfe der Münchener Räterepublik. In seinen Tagebüchern hat er sein Leben festgehalten - ausführlich, stilistisch pointiert, schonungslos auch sich selbst gegenüber - und niemals langweilig. Sie sind ein einmaliges zeitgeschichtliches Dokument. Die historisch-kritische Ausgabe der "Tagebücher" wird seit 2011 von Chris Hirte und Conrad Piens herausgegeben. Sie erscheint in 15 Bänden als Leseausgabe im Verbrecher Verlag und zugleich als Online-Edition unter muehsam-tagebuch.de. Begleitend werden nun die "Tagebücher" in Einzelheften" als E-Books veröffentlicht. Jedes Einzelheft dieser mitreißenden Tagebücher ist mit einem Register versehen und verschlagwortet. Die hier vorliegende Ausgabe ist das Heft 11.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erich Mühsam
Tagebücher in Einzelheften
Heft 11
29. Oktober 1912 – 30. September 1914
Herausgegeben von Chris Hirte
Erich Mühsam (1878–1934) hat 15 Jahre lang, von 1910 bis 1924, sein Leben und seine Zeit im Tagebuch festgehalten, ausführlich, stilistisch pointiert, schonungslos auch sich selbst gegenüber – und niemals langweilig. Mühsam macht die Nachwelt zum Zeugen eines einzigartigen Experiments: Er will Anarchie nicht nur predigen, sondern im Alltag leben. Er läßt seiner Spontaneität, seiner Sinnlichkeit, seinen Überzeugungen freien Lauf und beweist sich und seiner Mitwelt, daß ein richtiges Leben im falschen durchaus möglich ist – man muß es nur anpacken. Auch das Schreiben ist Aktion, in allen Sätzen schwingt die Erwartung des Umbruchs mit, den er tatsächlich mit herbeiführt: Die Münchner Räterevolution ist auch die seine, und die Rache der bayerischen Justiz trifft ihn hart. Doch sein Sendungsbewußtsein verleiht ihm eine Kraft, die ihn auch über die schlimmen Jahre der bayerischen Festungshaft rettet.
Mühsams Tagebücher sind ein Jahrhundertwerk, das es noch zu entdecken gilt. Sie erscheinen gedruckt in 15 Bänden, als eBooks in 35 Einzelheften und zugleich im Internet auf www.muehsam-tagebuch.de, wo neben dem durchsuchbaren Volltext auch ein kommentiertes Register und der Vergleich mit dem handschriftlichen Original geboten wird.
München, Dienstag, d. 29. Oktober 1912.
Gestern kam ich von Berlin zurück, wo ich mal wieder 8 Tage lang die Heirat mit Jenny zu fördern hoffte. Frau Brünn war dort und mein Bruder Hans bestellte mich telegraphisch zum Rendezvous mit ihr. Eine sehr lebenskluge jüdische Kleinbürgerin, mit der ich allein und bei Onkel Leopold verhandelte. Über alle Details habe ich Jenny in meinen Briefen Bericht erstattet, die als Ersatz des Tagebuchs gelten können. Als ich die Frau am Mittwoch früh in den Zug setzte, blieb ich mit dem Gefühl zurück, daß diese Begegnung unsre Eheschließung nicht gefördert habe. Die Frau ist schwer enttäuscht von mir und hält mich für die ärgste Messalliance für Jenny. Onkel Leopold und ich hatten gemeinsam vergeblich versucht, die Frau zur Nennung der Summe zu veranlassen, die man uns als Mitgift geben würde, da daraufhin Papa bearbeitet werden sollte, entsprechend zuzugeben. Onkel meinte nachher, er habe die Empfindung, daß Brünns außer der Einrichtung und Aussteuer garnichts geben würden, und ich hatte den Eindruck, man rechne dort nur mit einem Schwiegersohn, dem man Geld ins Geschäft stecken könne, um womöglich dabei selbst noch ein Geschäft zu machen. Das alles scheint sich jetzt zu bestätigen. Denn Jenny schreibt in dem Brief, der heute ankam, es sei völlig ausgeschlossen, daß ihre Eltern jemals einer Heirat mit mir zustimmten, und nun beginnt damit eine neue Epoche in unsrer Liebe: der Konflikt mit den Eltern. Jenny ist entschlossen, zu mir zu kommen, und ich habe ihr eben meinen Entschluß mitgeteilt, sie mit oder ohne Geld, mit oder ohne Heirat zu mir zu nehmen. Ich bin schon fast bereit, die Weigerung der Eltern als einen Glücksfall zu betrachten, zumal ich bei Jenny die prachtvolle Entschlossenheit erkenne, um ihrer Liebe willen auf Elternhaus, Wohlstand und jegliche Bürgerlichkeit zu verzichten. Die widerwärtige Konzession der religiösen Trauung wird uns nun sicher erspart bleiben, auf die – eventuell spätere – standesamtliche Verbindung werde ich allerdings um der Kinder willen, auf die ich hoffe, dringen, denen sonst die Beteiligung an den Häuserzinsen entginge. Ich habe bei dieser Gelegenheit in Waidmannslust genau erfahren, was die Häuser wert sind und wie groß mein Anteil ist. Demnach habe ich die Dinge allerdings weit überschätzt gehabt. Es sind nicht elf, sondern nur 9 Häuser, die einen Gesamtwert von 1017000 Mk haben, und mit etwa 500000 Mk belastet sind. Demnach kommt für mich als dem Inhaber eines Achtels ein Besitzwert von etwa 70000 Mk heraus, die selbst mit 6 % verzinst kaum ausreichen würden, allein eine Familie zu ernähren. Ich nehme aber an, daß die Erbschaft aus Papas Vermögen erheblich größer sein wird. Und Papa ist wieder krank. Er hat Herzschwäche-Anfälle, die mit Atemnot und schrecklicher Todesangst in die Erscheinung treten. Jetzt wünsche ich ihm selbst die Erlösung schon so aufrichtig wie ich sie mir wünsche. Vielleicht wird es dann garnicht erst nötig sein, Jenny Entbehrungen und großen Opfern auszusetzen.
In Berlin ist alles beim Alten. Man traf ebenso viel Münchner dort, wie hier in der Regel Berliner. Einen Abend war ich mit Max Halbe, Weigert, Schaumberger und Aram zusammen, der seine junge amerikanische Frau bei sich hatte. Ferner sprach ich Behmer, Schmied (der wieder furchtbar säuft), Hubert, Melnik, den Wiener Fränkel[?], Schickele, Hollaender, den Schauspieler Kühne, Brann und noch viele. Im Theater war ich einmal: »Magdalena« von Thoma bei Barnowsky. Eine wirklich starke ehrliche gekonnte Volkstragödie. In der – im ganzen einwandfreien – Darstellung zeichneten sich besonders Ilka Grüning und Centa Bré aus. Ich bin auf die Münchner Aufführung im Residenztheater gespannt.
München, Donnerstag, d. 21. November 1912.
Nach langer Pause gibt es mal wieder ein kurzes Résumée. Es gibt genug Dinge, die mir wichtig genug scheinen, um hier für all meine Zukunft vermerkt zu stehn. In der Angelegenheit mit Jenny ist eine Wandlung immer noch nicht eingetreten. Das gute Mädchen leidet zu Hause arges Leid. Sie ist entschlossen, spätestens mit dem Eintreten ihrer Mündigkeit (am 6. Januar) das Elternhaus zu verlassen und zu mir zu kommen. Ich warne sie redlich, das zu tun, wenn nicht für unsren Unterhalt irgendwie gesorgt wird. Mir geht es materiell grade schlecht genug – ganz besonders wieder in der letzten Zeit – und ich wüßte nicht, wie es werden sollte, wenn wir nun zu zweien von dem bischen leben sollten. Gestern kam ein Brief, in dem Jenny die Hoffnung aussprach, ihre Eltern dazu bewegen zu können, daß sie schon im Dezember einer stillen Trauung in Berlin beiwohnen werden, um den Skandal zu vermeiden, der durch Jennys Fortgehn im Januar entstehn würde. Ich weiß garnicht was ich von alledem halten soll. Mir scheint nur, daß ich in dieser Sache ebensowenig Glück habe wie in allem andern. Hätte ich nicht an die Eydtkuhner Eltern geschrieben und wir hätten garnicht ans Heiraten gedacht, dann wäre sie längst wieder hier, kein Mensch wüßte von unsrer Beziehung und wir wären glücklich.
Nun zu Einzelheiten. – Im Jahre 1904 reiste ich von Zürich ab und hinterließ meine Habseligkeiten, in 2 Reisekörben verstaut, bei dem Spediteur Kuoni. Da waren eine Unmenge Briefe und mir persönlich werte Erinnerungen dabei und in meiner Einbildung waren es der Schätze noch viel mehr und schönere als in Wirklichkeit. Ich träumte all die Jahre davon, die Körbe wiederzukriegen. Aber die Lagerkosten wurden immer größer. Durch die Bekanntschaft mit dem Buchhändler Horst Stobbe bekam die Sache eine neue Wendung. Ich erzählte ihm von Hille-Briefen und -Manuskripten, von Schlafs, Harts, Scheerbarts etc. etc. und beredete ihn, die Körbe kommen zu lassen. In Gegenwart der Herren von Maaßen und v. Hörschelmann fand die Eröffnung statt. Aus einem Korb kamen unglaubliche Dinge zum Vorschein: total zerfetzte und zerfressene Kleidungsstücke, dreckig und grauenerregend. Aus dem andern manche Dinge, die mich sehr freuten: vor allem mein altes Photographiealbum, ferner alte Briefe, Manuskripte von mir. Aber die Dinge, die ich sonst noch erhoffte, fehlten zum großen Teil. So war kaum ein einziges Buch dabei, was mir Stobbe gegenüber recht fatal war, da ich ihm von allen möglichen Widmungsbüchern erzählt hatte. Daß er die Briefe von Liliencron, Hille, etc. etc. alle behalten hat, tat mir sehr weh, ich konnts aber nicht ändern. Aus lauter Menschenliebe hat er ja die 80 Mark für die Geschichte nicht bezahlt. Die alten Klamotten habe ich vernichten lassen, vielleicht hat Stobbe sie noch an einen Trödler verkauft. Den großen Korb mit vielerlei Briefen und allen möglichen Erinnerungen habe ich noch unsortiert in meinem Zimmer stehn.
Im Theater war ich während der Zeit seit der letzten Eintragung nur ein einziges Mal, und zwar vor ein paar Tagen in Bahrs »Prinzip« das im Lustspielhaus (neuerdings vielmehr »Münchner Kammerspiele«) gegeben wurde. Das Ding ist nicht sehr belangvoll. Doch war die Aufführung teilweise sehr gut, und Lili Breda als sächsische Köchin so brillant, und so entzückend anzusehn, daß der Abend zum Erlebnis wurde. Nachher war ich mit Hermann Bahr, Wedekind und Frau, Robert und der Roland in der Jahreszeiten-Bar beisammen. Am nächsten Tag hielt Bahr einen Vortrag im Bayerischen Hof über Schauspielkunst, in dem er in brillanter Rede nicht sehr tiefe Dinge sehr geschmackvoll aussprach. Nachher wieder mit ihm zusammen in der Torggelstube.
Bald hätte ich meinen eignen Ehrenabend vergessen. Am Montag, d. 11. November, hatte ich im Gobelinsaal der Vier Jahreszeiten den I. Intimen Abend des Neuen Vereins zu bestreiten. Ich las Gedichte aus »Wüste«, »Krater« und dem Manuskript und hatte großen Beifall bei dem außerordentlich zahlreichen Publikum, das zum großen Teil nicht mal Platz zum Sitzen fand. Ich hatte die große Freude, am nächsten Tage in der »Münchner Zeitung« eine außerordentlich anerkennende Kritik des Herrn Richard Braungart zu lesen, der auch den 1. Akt der »Freivermählten«, den ich vorgelesen hatte, so lobte, daß ich nun wirklich hoffe, der Neue Verein wird das Stück doch spielen. Kutscher meinte nachher, meine Gedichte seien gradezu Offenbarungen gewesen. – Außer der Münchner Zeitung hat aber kein einziges Blatt es der Mühe für wert gehalten, von meinem Vortrag Notiz zu nehmen. Eine offizielle Veranstaltung des Neuen Vereins wird in den Münchner Neuesten Nachrichten einfach totgeschwiegen, weil man mich nicht mal als Lyriker leben lassen will. Ich will das hier vermerken, um das Pressgesindel unsrer Tage der dauernden Verachtung späterer Menschen preiszugeben. – Lulu Strauß setzte bei Rosenthal und Kaufmann durch, daß mir – ganz ausnahmsweise – ein Ehrenhonorar von 50 Mk ausgezahlt und der Jahresbeitrag für den Verein in diesem Jahr erlassen werden.
Im übrigen bin ich in großer Sorge. Steinebach teilte mir mit, daß das Defizit des »Kain« bereits die Summe von 2500 Mk überschritten habe, und daß er endlich Geld sehn wolle. Er möchte 1000 Mk haben, die er mit 5 % für das Jahr verzinsen will. Ich habe ihn an Jaffé schreiben lassen, fürchte aber natürlich, daß der nichts hergeben wird. Sich an Rößler zu wenden, scheint mir erst recht aussichtslos. Der war nur anständig, solange er arm war. Außerdem lebt er jetzt in Berlin und auf Briefe reagiert er garnicht. – Nun setzte ich mich dieser Tage mit dem jungen Verleger Bachmaier in Verbindung, um ihn zur Herausgabe der »Freivermählten« zu bewegen. Er erklärte, vor Frühjahr an derartige Publikationen nicht denken zu können. Im Laufe des Gesprächs fragte ich ihn, ob er nicht vielleicht den »Kain« in Verlag übernehmen wolle, und zu meiner Überraschung schien er dazu sehr geneigt zu sein. Wir verabredeten uns zu gestern, wo wir zusammen zu Steinebach wollten, um die Bücher einzusehn etc. Ich war rechtzeitig im Café Bauer, wo wir uns treffen sollten. Statt Bachmaiers war sein Freund Becher da, der mir erzählte, Bachmaier sei morgens schon allein bei Steinebach gewesen und erwarte mich jetzt bei sich. Wir gingen hin. In zweistündiger Unterhaltung wurden alle geschäftlichen Schwierigkeiten hin und her ventiliert. Herr Bachmaier konnte sich vor allem mit dem einen Gedanken nicht befreunden, daß er gleichzeitig mein Gläubiger und mein Angestellter sein sollte. Endlich und schließlich, als wir nun einen gemeinsamen Besuch beim Anwalt und bei Steinebach verabredet hatten, kam der Herr auf die Tendenz des »Kain« zu sprechen und stellte das unerhörte Ansinnen an mich, ich müsse da eine Wandlung und Mäßigung eintreten lassen. Ich war außer mir. Als ich erklärte, die Leute kauften doch das Blatt grade um meine Ansichten kennen zu lernen, meinte Herr Becher ganz ungeniert, das glaube er nicht, man kaufe den »Kain« nur der Kuriosität wegen. Ich brach das Gespräch ab und ging sehr aufgeregt fort. Nun bin ich wieder so weit als wie zuvor und weiß nirgends ein und aus. Ein Brief, in dem ich Ludwig Thoma mein Leid klagte und ihn bat, mich beim Verlage Albert Langen als Lektor neben Holm anzubringen, blieb überhaupt ohne Antwort. Ich sehe nach keiner Seite mehr einen Ausweg. Ich habe garkeine Möglichkeit mehr, Geld zu verdienen. Der »Simplizissimus« hat mir wohl immer wieder ein Gedicht abgenommen, aber gebracht noch kein einziges. Mein Name ist mir auch dort im Wege. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll.
Die Erotik ist ebenfalls nicht mehr sehr produktiv. Ich war zweimal des Nachts verabredet in der letzten Zeit: einmal mit Frieda Gutwillig, einmal mit Eny Crussie, einer ehemaligen Collegin vom Intimen Theater, die mir später sehr liebe Bekenntnisbriefe schrieb, da sie Kain-Abonnentin ist. Beide Damen versetzten mich. Bei der Gutwillig war es mir ziemlich einerlei. Sie kommt gelegentlich mal zu mir und läßt sich abküssen. Bei Eny Crussie tat es mir weh. Montag klingelte sie mich an, sie sei eben in München angekommen und möchte mich sehn. Ich lud sie zum Kaffee ein, und als sie kam, begrüßten wir uns sofort mit einem Kuß, obwohl unser Verkehr früher absolut konventionell war. Der starke erotische Charakter, den unser Zusammensein dann annahm, führte nicht zum Ziel, da Eny fort mußte, um ihr Kind nicht zu verfehlen. Doch verabredeten wir uns zum nächsten Abend, wo sie versprach, bei mir zu schlafen. Sie kam nicht. Erst heute kam ein Brief von ihr, und nun soll ich sie heut abend im Café treffen, wohin sie aber ihr Kind mitbringen wird. Ich bin neugierig, wie sich diese Beziehung weiter entwickeln wird.
Mit Dr. Wahl, dem Korrespondenten der »Frankfurter Zeitung« sprach ich vorgestern und klagte, daß kein Mensch etwas von mir drucken wolle. Eben rief er mich an. Er habe mit Dr. Coßmann von den »Süddeutschen Monatsheften« gesprochen, der sich bereit erklärt habe, von mir Beiträge zu bringen, sogar Lyrik. Ich werde ihm gleich einiges schicken. – Jedenfalls nett von Wahl.
[Vom 22. November 1912 bis zum 2. August 1914 hat Erich Mühsam kein Tagebuch geführt.]
München, Montag/Dienstag, d. 3/4. August 1914.
Es ist 1 Uhr nachts. Der Himmel ist klar und voll Sternen, aber über die Akademie ragt der Rand einer weißen, in dicken Schichten gehäuften Wolke, in der es unaufhörlich blitzt. Unheimlich grelle, lang sichtbare, in horizontaler Linie laufende Blitze.
Und es ist Krieg. Alles Fürchterliche ist entfesselt. Seit einer Woche ist die Welt verwandelt. Seit 3 Tagen rasen die Götter. Wie furchtbar sind diese Zeiten! Wie schrecklich nah ist uns allen der Tod!
Immer und immer hat mich der Gedanke an Krieg beschäftigt. Ich versuchte, mir ihn auszumalen mit seinen Schrecken, ich schrieb gegen ihn, weil ich seine Entsetzlichkeit zu fassen wähnte.
Jetzt ist er da. Ich sehe starke schöne Menschen einzeln und in Trupps in Kriegsbereitschaft die Straßen durchziehn. Ich drücke Dutzenden täglich zum Abschied die Hand, ich weiß nahe Freunde und Bekannte auf der Reise ins Feld oder bereit auszuziehn – Körting, Kutscher, Bötticher, v. Jacobi, beide Söhne von Max Halbe und viele mehr –, weiß daß viele nicht zurückkehren werden, lese Depeschen und Nachrichten, die – jetzt schon, ehe noch die Katastrophe eingesetzt hat, – einem das Herz aufschreien machen, ich sehe alles schaudervoll nahe und viel schlimmer noch in der Realität, als die theoretisierende Phantasie es ausdachte. Und – ich, der Anarchist, der Antimilitarist, der Feind der nationalen Phrase, der Antipatriot und hassende Kritiker der Rüstungsfurie, ich ertappe mich irgendwie ergriffen von dem allgemeinen Taumel, entfacht von zorniger Leidenschaft, wenn auch nicht gegen etwelche »Feinde«, aber erfüllt von dem glühend heißen Wunsch, daß »wir« uns vor ihnen retten! Nur: wer sind sie – wer ist »wir«? –
Aber der Gedanke ist doch grauenhaft, daß die Russen ins Land kommen könnten. Barbaren? Immerhin Menschen andrer Art, ohne Achtung vor unsrer Welt, ohne Rücksicht auf unsre Gefühle mordend und sengend, Frauen und Kinder mißhandelnd und mit unsern Kulturgütern Kosakenspäße treibend. Und wie furchtbar ist es zu lesen, daß heut ein französischer Arzt mit zwei Offizieren in Metz versucht hat, einen Brunnen mit Cholerabazillen zu vergiften!* Vorgestern haben die Hände eines Chauvinisten Jaurès gemordet, den Mann, der den Frieden wollte, der eigentlich verkörperte, was wir als die überlegene französische Kultur verehren. Und nun fahren französische Flieger über das Land und werfen Bomben. Da verlassen einen die Theorien, man wird einer von allen, mit den Instinkten aller, aber mit erhöhtem Leid, weil die Kritik neben dem Gefühl wirksam bleibt, und weil alle Parteinahme den Opfern, nicht den Machern gilt.
Die Massen sind durch die Aufregung dieser Tage in wahre Hysterie geraten. Überall werden Spione gewittert. Dann rennen die Menschen in Haufen zusammen, mißhandeln die Unglücklichen und übergeben sie der Polizei. Manchmal sollen ja wirklich schon russische Bombenwerfer abgefaßt sein – Rosenthal erzählte eben im Torggelhaus, daß heut am Bahnhof 28 als Frauen oder Pfaffen verkleidete Russen verhaftet worden seien, – aber meistens müssen Unschuldige dran glauben. Gestern rettete ich die übermäßig geschminkte Frau Dr. Douglas-Andree aus der Situation. Sie wurde für einen verkleideten Mann gehalten. Ich kam hinzu, legitimierte sie und ging mit ihr und dem armen Addi, der bei ihr war, ihrem 15jährigen Sohn, zum nächsten Auto, gefolgt von johlenden, schimpfenden, maßlos erregten Menschenmengen. Kaum saß sie im Wagen und wollte abfahren, da stellten sich die Leute in den Weg, und obwohl ich und die Kellner des Stefanie erklärten, die Frau zu kennen, wurden zwei Soldaten requiriert, die sie im Auto zur Kaserne begleiteten. – Heut früh sah ich ein etwas ausländisch aussehendes Paar von erregtem Volk gehetzt durch die Straßen eilen. Was draus wurde, weiß ich nicht. Und nachmittags in der Sendlingerstraße brachten wieder Hunderte ein Mädchen zum Schutzmann, von dem behauptet wurde, es sei ein verkleideter Mann.
Wilde Gerüchte laufen um, unkontrollierbar, da die Behörden über fast alles Schweigen bewahren. Danach sollen gestern und heute hier eine ganze Menge Serben und Russen standrechtlich erschossen sein. Sie sollen die Hauptpost, den Bahnhof, den Pulverturm bei Freymann haben in die Luft sprengen wollen. Heut früh wurde ausgesprengt, das Leitungswasser sei vergiftet. Offiziere riefen es warnend aus – ich selbst war Zeuge davon –, die Häuser wurden einzeln benachrichtigt. Es stellte sich als leeres Gerede heraus. Man hört – ganz heimlich – von massenhaften Soldatenselbstmorden etc.
Aber doch ist die Einmütigkeit des Gefühls, eine gerechte Sache zu führen, bei aller Verblendung ergreifend. Man ist sehr ernst, aber doch sichtlich gehoben. Wäre blos nicht schon überall eine üble Gesinnungsriecherei bemerkbar! Vorgestern nacht traf ich Köhler, v. Maaßen und Bötticher im großen Raum der Torggelstube. Mein Erscheinen bewirkte das Mißtrauen umsitzender nationaler Studenten, die uns belauschten und, obwohl kein Wort, das Gefühle hätte verletzen können, fiel, denunzierten. Es gab böse Auseinandersetzungen. Maaßen teilte Ohrfeigen aus. Schließlich wurde Bötticher – am Tage vor seiner Abfahrt zur Marine! – abgeführt (freilich noch auf der Straße freigelassen) und ich beschimpft und bedroht. Ohne ein politisches Wort gesprochen zu haben!
Heut habe ich eine Erklärung an die Leser des »Kain« herausgegeben, in der ich begründe, daß ich das Blatt während der Kriegsdauer eingehn lasse. Ferner habe ich mich beim Schwabinger Krankenhaus als Hilfsarbeiter in der Registratur gemeldet. Wo alles schwankt, ich vielleicht morgen nicht weiß, wovon leben, will ich nicht müßig sein. Bekomme ich keine oder eine ablehnende Antwort, dann gehe ich morgen zum Magistrat und frage nach Beschäftigung im humanitären Zivildienst: bei Kranken, Irren oder der Feuerwehr. Vielleicht kann mir da auch meine alte Apothekererfahrung nützlich werden.
Um Jenny bin ich sehr besorgt. Die letzte Nachricht erhielt ich am 29. Juli noch aus Eydtkuhnen, das inzwischen von den Russen besetzt ist. Ein Brieftelegramm, in dem sie mich bat, ich solle ihr postlagernd nach Königsberg schreiben. Das tat ich sofort, las aber inzwischen, daß die Bestellung postlagernder Briefe jetzt entweder aufgehoben oder sehr erschwert ist. Nun weiß ich nicht einmal, wo die Geliebte ist und ängstige mich sehr. Ließe mich die allgemeine Spannung zur Besinnung über die Privatangelegenheiten kommen, ich glaube, ich stürbe vor Unruhe.
Auch von Lübeck höre ich nichts. Der Landsturm ist aufgerufen, und ich fürchte, daß meine beiden Schwäger und vielleicht auch mein Bruder ins Feld müssen. Das wäre für unsern alten Vater sehr arg – und Charlotte ist grade von ihrem dritten Kind entbunden. Aber was sagt das gegen das Los der armen Lucie v. Jacobi, die vor einem halben Jahr ihr einziges Kind verlor und nun den Mann in den Krieg ziehn sieht!
Morgen dürfte der Krieg mit Frankreich offiziell beginnen. Es sind Telegramme angeschlagen, daß der Gesandte in Paris aufgefordert sei, seine Pässe zu verlangen weil die Franzosen völkerrechtswidrig die Grenzen überschritten haben. Libau soll von einem kleinen Kreuzer beschossen sein, der Kriegshafen soll brennen. Das wäre wohl ein Erfolg der Deutschen. Wie das Einmarschieren der Russen in Eydtkuhnen und das der Deutschen in Czenstochau zu bewerten ist, läßt sich noch gar nicht übersehn. Es wird erst mal zu allem Hurra gebrüllt.
Rosenthal wollte wissen, daß der Louvre in Paris brenne. Ich glaubs nicht. Aber wie scheußlich schon, daß das möglich werden kann!
* Tatarenmeldung. Dementiert.
München, Dienstag/Mittwoch, d. 4/5 August 1914
Es ist wieder spät nach Mitternacht. Aber heut regnet es und ist trübe und trostlos. Und alles Unglück scheint ausgegossen über dies arme Land und seine ärmeren Menschen.
Eine entsetzliche Botschaft steht auf den Anschlagtafeln: Kurz nach 7 Uhr (also vor noch nicht 6 Stunden) erschien in Berlin der englische Botschafter im Auswärtigen Amt, um Deutschland den Krieg zu erklären.
Krieg mit England! Da mit Rußland und Frankreich die Kämpfe schon begonnen haben. Aus der Ferne durchs offene Fenster, von der Ludwigstrasse her, tönen lärmende Jubelrufe und Hurrahgeschrei – jetzt auch Gesang herüber. Der Zug nähert sich und wird gleich dicht bei mir am Siegestor sein. – Nein, sie kamen von der Türkenstrasse und eben zogen sie – vielleicht 300 Mann – unter unserm Fenster vorbei, die Akademiestrasse entlang. Singen können vor solchen Nachrichten! Arme Menschen! Vielleicht sind viele unter ihnen, die selbst mit müssen in den Krieg, die garnicht oder als Krüppel wiederkehren.
Krieg mit England! Der ist der Schlimmste! Wie das ertragen werden kann, – ich habe graue Zweifel. Heut sind im Reichstag die Kriegskredite sämtlich bewilligt worden. Die Sozialdemokraten haben für alle Forderungen gestimmt und auf Kaiser und Vaterland mit Hurrah! gebrüllt. Was sollten sie auch tun? Sie haben die Suppe einbrocken helfen. Nun stehen sie dem fait accompli gegenüber. – Aber was jetzt werden soll? Krieg! Tod! Nacht über die Welt! Es ist schaurig, es ist unausdenkbar.
Ich bin maßlos traurig. Ich zwinge mich zu Friedenshoffnungen. Aber die Zweifel sind stärker. Ich kann nicht glauben, daß mit den Mächten von England, Frankreich und Rußland jetzt noch von Frieden zu sprechen ist. – Und nun ging ich auch noch mit dem Ekel Friedenthal nach Hause, dem schmockigen Korrespondenten des Berliner Tageblatts mit dem Kommisgesicht und der geleckten Sprache des Schaufensterdekorateurs. Er trug seine Verzweiflung über die Wendung der Dinge mit öligem Akzent auf der Zunge, weil er woanders nichts hat, was Trauer oder Empfindung einschließen könnte. Der machte mir durch die Nutzanwendungen der Katastrophe noch mießer als mir ohnehin ist.
Zweimal entlud sich heute meine Gepreßtheit in Tränenausbrüchen. Die erleichtern in den Stunden das Alleinseins. Die tun wohl, wenn das Herz platzen will. Und niemand mehr, der mich versteht, den ich verstehe. Aber hätte ich nur erst Nachricht, ob ich im allgemeinen Dienst Arbeit finden kann. Das Schwabinger Krankenhaus verwies mich an den Magistrat, und an den habe ich mich heute gewandt. Vielleicht weiß ich morgen abend schon, wohin ich gerufen werde. Dies Herumsitzen zuhause und in den Cafés habe ich satt. Dabei gehe ich kaput. – Überhaupt das Warten auf Nachrichten. Wo Jenny ist, weiß ich nicht, von Lübeck kein Wort, – die Post scheint fast garnicht mehr zu funktionieren. Es ist gräßlich.
Was mit Johannes Nohl vorgeht, ist mir ganz schleierhaft. Alle Deutsche sind aus Frankreich ausgewiesen. Ob er sich zum Militär gestellt hat und wo? – ich weiß es nicht. Vielleicht ist er auch nach Belgien desertiert. Und in Belgien ist deutsches Militär eingezogen. Der Reichskanzler hat es heute im Reichstag mitgeteilt, – daher die englische Kriegserklärung. Völkerrechtsbruch überall: Rußlands und Frankreichs Eindringen in deutsches Gebiet ohne Kriegserklärung, und Deutschlands Neutralitätsbruch in Belgien und Luxemburg. Nirgends ehrlicher Kampf, überall Spionage und Heimtücke. Furchtbar!
Heut passierte ein heiterer Zwischenfall. Ich saß mit Nonnenbruch