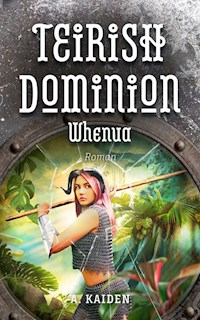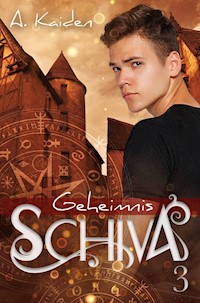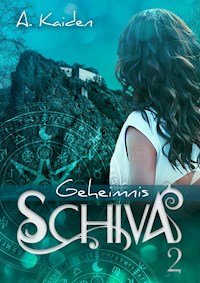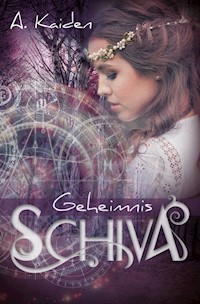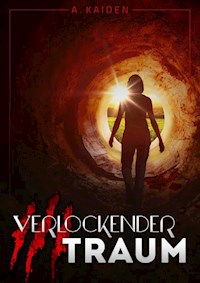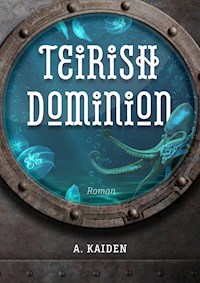
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Im Traum begegnet Melisse der Göttin Kiandra aus einer anderen Welt. Kiandra bittet die Jugendliche darum, den Frieden in ihrer Welt zu bewahren. Dafür muss Melisse auf die Teirish Dominion, ein Luxusschiff der Anderwelt, das droht, durch eine Bombe eines Unbekannten in die Luft zu fliegen. Voller Tatendrang und mit dem Willen, unzählige Leben zu retten, sagt Melisse zu. Wird sich die Jugendliche in der anderen Welt zurechtfinden und vor allen Dingen: Kann sie das Unglück verhindern?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 434
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Teirish Dominion
1. Auflage: August 2017
Copyright by A. Kaiden, Alexandra Kraus
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags, sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Autorin A. Kaiden
Cover-/Umschlaggestaltung: Buchgewand | www.buch-gewand.de
Fotos:
© Olga Visavi / shutterstock
© Andrey_Kuzmin / shutterstock (3 Fotos)
© Dmitrijs Mihejevs / shutterstock
© Ase / shutterstock
© DmitriyRazinkov / shutterstock
Besuchen Sie mich in
Facebook (https://www.facebook.com/a.kaiden159357), auf Youtube: https://m.youtube.com/?#/channel/UCvMoHwEjuXyLPsaplvoH1Iw
oder auf meiner Homepage www.a-kaiden.de
Danksagung
Besonderen Dank gilt Torsten von Buchgewand, der mir mit Rat und Tat zur Seite stand und das wunderschöne Cover von Teirish Dominion gezaubert hat.
Auch Marcel Weyers möchte ich für das Lektorat und die Beratung an dieser Stelle danken.
Kapitel 1
Melisse – Samstag, 10:20 Uhr
Eiseskälte umhüllt meinen schweren Körper, lähmt ihn und versucht, mich in den Erdboden zu ziehen. Ich liege auf dem Bauch und bringe es nicht fertig, mich zu bewegen. Wo bin ich? Was ist passiert? Das Nachdenken fällt mir so schwer. Was ist das nur? Langsam fahren meine Fingerspitzen über den Boden. Zarte Grashalme umschmeicheln meine Haut. Kitzeln. Necken. Ich bin bemüht, meine Augen zu öffnen, doch vergebens. Noch einmal versuche ich mich zu erinnern, durch das tiefe Dunkel zu dringen, das meinen Verstand verschlungen hat. Streit. Natürlich. Es gab eine Auseinandersetzung zwischen meiner Mutter und mir. Schon wieder. Und abermals wegen ihm. Es ist immer wegen ihm. Egal wie ich es anstelle, ich kann nicht gegen ihn gewinnen. Er ist immer im Vorteil. Sie glaubt mir nicht. Hat sie noch nie. Tut sie nicht. Wird sie auch nie. Da brauche ich mir nichts vorzumachen. Doch das ist nicht schlimm. Ich schaffe das. Kämpfen – ich muss kämpfen. Mir geht es gut.
Es gelingt mir, die Lider ein Stück zu öffnen. Dunkelgrüne Halme bedecken den kalten Erdboden und tanzen leicht im Wind. Das ergibt keinen Sinn. Wo bin ich? Ich blinzle ein paarmal, doch das Bild bleibt dasselbe, verschwindet einfach nicht. Ein Traum. Genau. Das ist es! Ich träume! Bestimmt ist es ein Traum. Das muss es sein. Dennoch fühlt er sich sehr realistisch an. Etwas zu realistisch. Diese Schwere, die meine Glieder zu lähmen scheint und all meine Kraft aus meinem Körper saugt … Unaufhaltsam wie ein Tsunami. Mühselig öffne ich meine Augen nun ganz und richte mich schwerfällig auf wie eine alte Frau. Vereinzelte Steinplatten, teilweise liegend und andere stehend, ragen aus dem grünen Meer wie kleine Inseln. Kühler Wind streicht mir sanft durch die Haare und lässt einen Schauer über meinen Rücken laufen. Fröstelnd schlinge ich meine Arme um mich, doch vergeblich. Es bringt nichts. Die Kälte kommt von innen. Von tief in mir drin. Dort, wo es schmerzt. Vorsichtig setze ich einen Fuß vor den anderen. Der Boden schmatzt leise unter meinen Füßen, fast als würde er gleichsam mit meinem Herz weinen.
„Beruhige dich, Melisse. Dir geht es gut. Du gehst auf das Gymnasium und hast ordentliche Noten. Hungern musst du auch nicht und an Kleidern und Geld mangelt es nicht. Du hast ein Dach über dem Kopf und gute Freunde. Was wünschst du dir mehr?“, flüstere ich zu mir selbst und meine Stimme hört sich eigenartig fremd an. So, als würde sie nicht zu mir gehören. Rau wie Schleifpapier. Langsam sehe ich mich um, immer einen Schritt nach dem anderen setzend und die Schwere weicht allmählich von meinem Körper, als würde ich eine Decke abstreifen. Vor einer größeren Platte bleibe ich stehen und lasse meine Finger fast andächtig über den rissigen Stein gleiten. Verwaschene Schriftzüge sind darauf zu erkennen, doch ich kenne die eingravierte Sprache nicht. Dennoch bin ich mir sicher, dass es sich hierbei um ein Grab handelt. Ein sehr altes. Und nicht nur direkt vor mir – Ich stehe inmitten eines grünen Meers mit vereinzelten Gräbern. Nachdenklich laufe ich weiter, lasse meine Augen unermüdlich kreisen, doch ich finde nichts, was mir bekannt vorkommt. Ausgeschlossen. Hier bin ich noch nie gewesen. Doch der Friedhof ist nicht endlos. Poröse, grauschwarze Mauern rahmen ihn ein. Verwundert bleibe ich stehen, als ich ein kreuzähnliches Gebilde an der rechten Steinwand erkenne. Ganz plötzlich muss ich an ein zerfallenes Kloster denken. Als mir schwindelig wird, schließe ich kurz meine Lider und lasse meinen Kopf in den Nacken gleiten. In der Ferne höre ich ein gleichmäßiges Rauschen. Ich atme tief ein und kann die frische Luft des Meeres riechen. Etwas Feuchtes rinnt über meine Wange und ich öffne behutsam meine Augen und sehe direkt in den wolkenbehangenen Himmel, der mit unterschiedlichen Grautönen direkt auf die Erde hinunter zu fallen droht. Traurig. Das Ganze hat etwas unheimlich Melancholisches. Doch warum?
„Melisse …“
Eine fremde Stimme wispert bittend meinen Namen. Ruckartig drehe ich mich um, doch ich bin allein. Habe ich es mir eingebildet? Nein, da ist es wieder. Jemand ruft nach mir. Unaufhörlich. Immer wieder. Doch die Stimme scheint entfernt. Auch als ich flüchtig die Lider schließe, kann ich nicht ausmachen, woher sie kommt. Ich schlucke kurz, denn ein Anflug von Angst steigt in mir auf. Diese fremde Umgebung. Diese Stimme … Ich darf nicht zögern! Es ist bestimmt nur ein Traum. In Träumen muss man sich seinen Ängsten stellen, dann zerplatzen sie wie Seifenblasen. Das sagt mein Bruder immer zu mir - Tailor. Ich wünschte, er wäre jetzt hier. Wenn es mein Traum ist, warum kann ich ihn mir dann nicht herbeiwünschen? Ich versuche es einige Male, doch das Ergebnis ist gleich null.
„Melisse, hilf uns!“
Ich schrecke auf und balle meine Hände zu Fäusten. Entschlossen setze ich meinen Weg durch die Ruine fort, beobachtet vom dunklen Himmelszelt und begleitet vom Rauschen des entfernten Meeres. Meine Beine zittern und ich stolpere, aber ich kann mich auf den Beinen halten. Auf einmal ist sie wieder da, diese Schwere, die ich glaubte, abgestreift zu haben. Abermals schließe ich meine Augen und konzentriere mich auf die fremde und leise Stimme.
„Melisse …“
Dieser flehende Ton jagt mir durch Mark und Bein und lässt mich erschauern. Schweigend gehe ich nach links und steige fünf Stufen nach oben, sodass ich mich auf einer erhöhten Ebene befinde. Suchend lasse ich meine Blicke schweifen. Nichts.
Mein Weg führt mich abermals nach links, zehn weitere, halb zerfallene Treppenstufen nach oben. Wieder höre ich die helle Stimme meinen Namen rufen. Dieses Mal erscheint sie mir näher. Nicht weit entfernt. Ich drehe mich einmal langsam im Kreis, doch immer noch kann ich die Person zu der bittenden Stimme nicht ausmachen.
Ein schmaler Weg führt nach rechts. Vorsichtig balanciere ich darüber, überwinde meine Höhenangst, indem ich versuche, nicht daran zu denken und meine Augen geradeaus richte, versuchend, einen Punkt zu fixieren. Ich strauchle kurz, als mein rechter Fuß auf dem unebenen, moosbewachsenen Stein ausrutscht. Zitternd finde ich mein Gleichgewicht und warte, bis meine Beine wieder fähig sind, sich in Bewegung zu setzen. Donnergrollen ertönt und lässt mich zusammenzucken. Ein weiteres Mal rutsche ich ab. Ich möchte umdrehen. Zurückgehen. Endlich aus diesem Traum erwachen, doch da höre ich sie wieder. Eindringlich bettelnd, wie ein Gefangener um Erlösung.
„Hilf uns, Melisse! Wir brauchen dich!“
Ich muss es wissen! Wem gehört die zierliche Stimme? All meinen Mut zusammennehmend setze ich meinen Weg fort und schaffe es über den schmalen Pfad. Erleichtert lasse ich mich auf den feuchten Erdboden nieder und hole tief Luft, warte, bis sich meine Atmung wieder stabilisiert. Dann stehe ich auf. Ich blicke direkt auf erhöhte Rundbögen aus Stein, die groß genug sind, um hindurch zu klettern. Doch nach einer kurzen Überlegung entscheide ich mich anders und nehme den Umweg nach rechts, der mir sicherer erscheint. Meine Kletterkünste sind nicht die besten und mein Herz schlägt ohnehin protestierend laut in meinem Brustkorb umher. Der Himmel schreit auf und einige Regentropfen erkämpfen sich ihren Weg aus dem dichten Wolkenzelt. Meine Schritte werden schneller, der Wind heftiger, als wolle er mich zusätzlich antreiben. Unheil verkündendes Pfeifen durchzieht die Luft und lässt sie vibrieren. Gänsehaut überzieht meinen Körper, jedoch friere ich nicht. Vielmehr fühle ich mich auf einmal unglaublich leer. Ein seltsam unangenehmes Gefühl, das mich im Alltag nur allzu oft befällt. Meistens im Kreis meiner Familie.
„Melisse …“
Ich komme näher, kann die Stimme ganz deutlich vernehmen. Vorsichtig nehme ich die Biegung am Ende des ehemaligen Ganges und steige weitere Treppenstufen hervor, die mich um eine halbe Kurve führen. Nun bin ich auf der anderen Seite der Rundbögen, die früher einmal als Fenster gedient haben mussten. Für einen kurzen Moment schweifen meine Gedanken ab, als ich versuche, das Kloster vor meinem geistigen Auge zu rekonstruieren. Welche Gemälde zierten die Räumlichkeiten? Welche Leute mochten durch die Gänge gewandelt sein? Meine Gedankengänge nehmen ein jähes Ende, als ich plötzlich vor einer grauen Steinwand stehe. Sackgasse. Ich drehe mich langsam um. Von einer Person keine Spur. Entmutigt seufze ich aus und wende mich dem letzten Rundbogen zu. Von hier oben lässt sich die gesamte Ruine überblicken. Ein weiteres Donnergrollen ertönt, nun lauter und bedrohlicher als die anderen zuvor. Mit einem Mal reißt die Himmelsdecke auf und lässt einer ganzen Armee von Regentropfen Platz, die prasselnd hinunter sausen und auf den kalten Boden unbarmherzig aufschlagen. Müde lehne ich mich an die tote Steinwand und beobachte gedankenverloren das Schauspiel des Regens, das mich schwermütiger werden lässt. Was mache ich hier eigentlich? Wann erwache ich endlich aus diesem Traum?
„Das liegt ganz bei dir!“
Ruckartig fahre ich herum, als die zierliche Stimme genau hinter mir ertönt. Wie versteinert verharre ich in meiner Bewegung. Tatsächlich ... Da ist sie, die Person, der die fremde Stimme gehört. Eine Gestalt in der Größe eines Kindes steht vor mir, eingehüllt in einer rotbraunen Kutte mit Kapuze, sodass ihr Gesicht völlig verdeckt ist. Aus Reflex weiche ich einen Schritt zurück, doch die Fremde schüttelt leicht den Kopf.
„Hab keine Angst, Melisse. Ich tue dir nichts. Bitte.“
Jetzt habe ich keine Zweifel mehr, dass vor mir ein Kind steht. Die Stimme ist deutlich und klar. Doch warum diese seltsame Aufmachung? Ich nicke zögernd und gehe in die Hocke, um mit dem Kind gleichauf zu sein und in sein Gesicht sehen zu können. Doch die Kapuze sitzt so tief, dass ich nur einen schmalen Mund erkennen kann.
„Wo bin ich hier?“, flüstere ich fragend und kann mich selbst kaum verstehen, so leise bin ich. Jedoch hat die Gestalt mich verstanden.
„Du bist in einem Traum, den ich dir geschickt habe.“
Verdutzt blicke ich in das verdeckte Gesicht. Was hat das zu bedeuten?
„Den du mir geschickt hast?“
„Ja, so ist es.“
Trotz dass es sich um die Stimme eines Kindes handelt, klingt sie erwachsen, ernst und irgendwie monoton. Ausdruckslos. Das verwirrt mich. Meine Gedanken wirbeln durcheinander, ohne dass ich einen zu fassen bekomme.
„Du hast geschlafen und ich habe die Chance genutzt, dich in einen bestimmten Traum zu lotsen. Darum bist du hier an diesem Ort.“
„Aber wieso? Wer bist du?“
„Damit wir uns treffen können. Deine Hilfe wird benötigt.“
„Hilfe? Wobei kann ich helfen?“
Ich streiche mir eine widerspenstige Strähne aus meinem Gesicht, doch wende ich meinen Blick nicht von der reglos dastehenden Person ab.
„Ich komme aus einer anderen Welt. Eine Welt, in der Frieden, Recht und Ordnung herrscht. Aber diese Ordnung droht, zerstört zu werden. Verschwindet die Ordnung, somit auch der Frieden. Denn das eine geht mit dem anderen einher. Du musst uns helfen.“
„Ich verstehe nicht …“
Etwas verwirrt reibe ich mir mit meiner Hand über meine Stirn. Die Worte ergeben für mich keinen Sinn. Eine andere Welt? Ordnung und Friede sind in Gefahr? Wodurch und wie kann ich helfen? Zu viele Fragen und keine einzige traut sich über meine Lippen.
„Wichtige Persönlichkeiten, die diese Ordnung aufrechterhalten werden noch heute Nacht die Teirish Dominion betreten und mit ihr davon schwimmen. Die Teirish Dominion ist ein großes Ngwenya, oder wie ihr es in eurer Welt bezeichnet: U-Boot. Auf diesem befindet sich allerdings auch ein Attentäter. Wenn er Erfolg hat, dann sprengt er das gesamte Ngwenya in die Luft, mit all seinen Passagieren. Unzählige unschuldige Leute werden sterben. Unter anderem auch die wichtigen Persönlichkeiten und Oberhäupter. Das wird das Ende des langjährigen Friedens sein und Krieg wird mein Land in den Untergang reißen.“
Ein Schauer überfällt meinen Körper und lässt mich zusammenzucken. Auch wenn mein Verstand noch mit den Worten des Kindes hadert, in meinem Herzen sind sie längst angekommen. Der Gedanke an massenhaft sterbende Passagiere, die nichts von der Gefahr ahnen, brennt sich in Sekundenschnelle in mein Herz ein und lässt es vor Schmerz aufschreien. Ich möchte helfen, es verhindern, doch wie? Mitfühlend blicke ich die kleine Gestalt an, dennoch weiß ich nicht, wie ich in der Lage sein soll, etwas zu verändern.
„Bitte, du musst den Attentäter finden und die Sprengung verhindern! Diese Zukunft darf nicht stattfinden!“
„Ich … woher weißt du davon? Wie kann ich dabei helfen?“
„Ich bin Kiandra, eine der zehn Töchter der Gottheit Nimnus. Meine Fähigkeit liegt darin, einen Teil der Zukunft vorauszusehen, jedoch darf ich nicht direkt eingreifen. Doch du könntest den vermeidlichen Saboteur finden und das Unglück verhindern. Meine Hoffnung ruht auf dir. Bitte, hilf uns!“
Mein Herz krampft sich in meinem Inneren auf die Größe einer Rosine zusammen und ich schlucke schwer. Ich zweifle nicht an den Worten des Kindes. Mein Gefühl sagt mir, dass sie die Wahrheit spricht. Unschuldige Menschen sind in Gefahr. Nichtsahnend auf den Weg in ihr Unglück – in ihren Tod. Tränen schießen mir in die Augen, doch ich kann sie mit aller Kraft zurückhalten. Ich bin zu nah am Wasser gebaut. War ich schon immer.
„Ich würde gerne, doch ich weiß nicht wie …“
„Durch meine Kräfte bin ich in der Lage, dich in meine Welt zu bringen, sodass auch du unter den anderen Passagieren auf der Teirish Dominion eincheckst. Doch ich werde das nicht gegen deinen Willen tun. Dir steht es frei zu wählen, ob du uns hilfst oder nicht. Falls du dich dagegen entscheidest, wirst du ganz normal in deiner Welt erwachen. Es liegt ganz bei dir.“
Nachdenklich streiche ich mir über die Stirn. Auch wenn es verrückt ist, doch wie sollte ich mich jetzt noch anders entscheiden? Ich kann niemanden im Stich lassen. Nicht, wenn ich die Möglichkeit habe zu helfen und unschuldige Leben zu retten. Doch eine Frage bleibt offen.
„Verschwinde ich aus meiner Welt, wenn du mich auf das U-Boot bringst?“
Die Gottheit schüttelt den Kopf, bevor sie mir im gleichen Tonfall wie zuvor antwortet.
„Nein, dein Körper verbleibt ebenfalls in deiner Welt. Allerdings muss ich dich in einen tiefen Schlaf versetzen. In deiner Welt wird es so aussehen, als hättest du für lange Zeit dein Bewusstsein verloren. Dies birgt Risiken, ich weiß. Deshalb überlege dir gut, ob du sie eingehen möchtest. Denn ich kann dir noch nicht einmal eine Belohnung für deine Hilfe anbieten. Auch kann ich dir nicht mehr sagen oder dir helfen, sobald du meine Welt betreten hast.“
Ich schließe kurz meine Lider und versuche, über das Gesagte nachzudenken. Das Konzentrieren fällt mir schwer, wo doch mein Herz die Antwort förmlich hinausschreit und sich schon längst entschieden hat. Ich werde also ins Koma fallen, solange die Fahrt auf der Teirish Dominion andauert. Mein Bruder wird sich große Sorgen machen. Wiederum schreit mein Herz bei dem Gedanken auf und ein Bild von Tailor schiebt sich vor mein geistiges Auge, wie er vor meinem Bett steht. Verzweifelt. Traurig. Das kann ich nicht verantworten. Das möchte ich nicht. Doch dann sehe ich all die unschuldigen Passagiere vor mir. Dieses Bild droht, mein Herz in Stücke zu reißen.
„Sind auf dem Schiff auch kleine Kinder?“
„Ja. Passagiere jeden Alters und beider Geschlechter befinden sich darauf. Die meisten machen Urlaub und ahnen nichts von der bevorstehenden Gefahr.“
Das reicht. Noch einmal schließe ich für einen kurzen Moment meine Augen. Es tut mir leid, Tailor. Ich kann nicht anders. Ich hoffe, du wirst mir verzeihen, aber das kann ich nicht verantworten. Zumindest versuchen muss ich es. Hast du mich doch gelehrt, immer das Beste und alles zu geben. Verzeih mir, doch ich muss gehen. Entschlossen sehe ich Kiandra an.
„Ich möchte helfen.“
Kapitel 2
Tailor – Samstag, 16:45 Uhr
Dampf umschlingt die Leute in einem dichten Nebel. Hektisches Geklapper von Töpfen, Pfannen und Geschirr überall. Schweiß dringt aus unseren Poren und in der Luft liegt der betörende Geruch von angebratenem Fleisch und gekochtem Gemüse. Die Stimmung ist angespannt und zeichnet sich in den Gesichtern meiner Kollegen wider. Nur in meinem nicht. Ich liebe meine Arbeit durch und durch, auch wenn meine Mutter zuerst gegen meine Berufswahl war, so hat sie mich nicht davon abhalten können, die Ausbildung als Koch zu beginnen. Wahrscheinlich hat sie gehofft, ich würde nach kurzer Zeit meine Meinung und meinen Berufsweg ändern, jedoch musste ich sie enttäuschen. Sie wird drüber wegkommen, da bin ich mir sicher. Monotone Büroarbeit oder technische Dinge waren noch nie mein Ding gewesen. Ich liebe es einfach, Menüs für andere zuzubereiten. Den Duft des Essens, während es vorbereitet wird und wenn es fertig ist. Die Gerichte auf den Teller ansprechend zu verteilen. Und vor allen Dingen die erfreuten Gesichter oder zumindest die Vorstellung daran, wenn die Gäste das bestellte Essen serviert bekommen und es sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich könnte mir keinen anderen Beruf für mich vorstellen. Deswegen macht mir wohl der Stress nicht ganz so viel aus wie meinen Arbeitskollegen, doch ich bin mir sicher, sie haben ihren Beruf gern, auch wenn sie sich meistens beschweren. Warum wären sie sonst noch hier?
„Tailor, bist du mit der Soße fertig?“
„Fast. Gib mir eine Minute“, rufe ich mit einem Lächeln im Gesicht zurück, das schon manch einen hier auf die Palme gebracht hat. Schnell schmecke ich die Brühe ab, während Niklas drängelt.
„Wir haben keine Minute mehr Zeit! Die Pommes und die Schnitzel sind fertig und müssen raus!“
„Alles klar. Schmeckt perfekt und ist heiß. Just in time.“
Ich verteile die Soße geübt auf die fertigen Teller und Niklas verdreht genervt die Augen, bevor er sie zur Theke bringt und läutet.
„Du solltest ihn nicht immer so reizen, auch wenn ich es immer wieder zum Schießen finde.“
Thomas lacht beherzt auf und seine Grübchen treten dabei zum Vorschein, die ihn noch sympathischer machen, als er ohnehin schon ist. Ich grinse verschmitzt, während ich nach der nächsten Ladung Pommes sehe.
„Ich weiß nicht, was du meinst. Hab ja schließlich nichts gemacht.“
Er zwinkert mir noch einmal zu und widmet sich dann wieder den Salaten zu, während Niklas zurückkommt. Ich hätte es mit meiner Ausbildungsstelle nicht besser treffen können. Die Bezahlung ist in Ordnung und die Mitarbeiter sind top, die Vorgesetzten fair. Was kann ich mehr verlangen? Mein Leben könnte nicht besser laufen. Mit innerer Ruhe gebe ich mich voll und ganz meiner Arbeit hin.
*
Es ist fast 17 Uhr, als ich meine Pause antrete und kurz frische Luft schnappe, die mir kalt entgegenschlägt und meine erhitzte und verschwitzte Haut mit einem Schauer abkühlt. Ich schließe kurz meine müden Augen und beginne sanft, mit den Fingern mein Gesicht zu massieren. Da heute drei Leichenschmäuse anstanden, bin ich schon seit elf Uhr morgens dort. Heute sind wohl Überstunden angesagt, aber das macht mir nichts aus. Damit habe ich schon gerechnet. Langsam bewege ich meinen Kopf abwechselnd nach links und nach rechts, sodass mein Genick laut knackt. Das hat gutgetan. Ich atme tief durch, um die letzten Spuren der Müdigkeit, wenn auch nur kurzfristig, zu vertreiben. Für einige Augenblicke stehe ich einfach nur da und lausche den Geräuschen um mich herum. Kinder streiten sich um einen MP3-Player und belustigtes Lachen von einer Männergruppe mittleren Alters hallt zu mir herüber. Ein paar junge Frauen kichern und lästern über andere, die zurzeit nicht bei ihnen sind. Eine ältere Dame tadelt ihren Ehegatten, weil er einer jungen Bedienung hinterhergesehen hat. Ein amüsiertes Schmunzeln rinnt über mein Gesicht. Entspannt öffne ich meine Lider und strecke mich kurz. Die Sonne steht hoch am Himmel und schenkt uns einen milden Septembertag. Ein wundervoller Tag. Meine Gedanken schweifen kurz zu meiner Familie. Ich hoffe nur, dass meine kleine Schwester das Wetter nutzt und irgendetwas mit ihren Freundinnen unternimmt. Sie schließt sich viel zu oft in ihrem Zimmer ein, um zu lesen. Dabei täte es ihr gut, öfter rauszukommen. Auch wenn sie es nicht offen sagt, so sehe ich doch, dass unser Zuhause sie erdrückt.
Ich seufze leicht auf, als mein Handy plötzlich anfängt in der Hosentasche zu vibrieren. Etwas ungeschickt krame ich es hervor und starre kurz auf das Display, bevor ich den Anruf annehme.
„Mama?“
Ein mulmiges Gefühl durchzieht meine Eingeweide. Meine Mutter ruft mich sonst nie auf meinem Handy an, außer wenn etwas passiert ist.
„Tailor? Ich habe dich schon fünfmal versucht zu erreichen, doch du bist nicht drangegangen!“
Die Stimme meiner Mutter überschlägt sich und etwas Vorwurfsvolles klingt in ihr mit.
„Tut mir leid, aber während der Arbeit kann ich nicht an das Telefon gehen. Das weißt du doch. Außerdem hab ich es nicht bemerkt. Was ist …“
„Ja, aber wieso kannst du denn jetzt telefonieren?!“
Ich verdrehe kurz meine Augen und massiere mit meiner freien Hand die Schläfe. Manchmal kann sie dermaßen anstrengend sein. Besonders wenn es um meine Ausbildung zum Koch geht, da hat sie einfach kein Verständnis dafür. Für einen Moment vergesse ich das flaue Gefühl, das sich in meinem Magen eingenistet hat.
„Ich habe gerade Pause, Mama. Was gibt es? Wieso rufst du mich an?“
Ein kurzes Schweigen tritt ein und ich bin mir nicht sicher, ob sie meine Frage verstanden hat. Als ich diese gerade wiederholen möchte, antwortet sie.
„Deine Schwester, sie … sie liegt im Krankenhaus. Sie wacht nicht mehr auf. Gerhard und ich sind gerade dort und warten, bis wir in die Intensivstation dürfen.“
Für einen Moment steht die Zeit still. Die Worte habe ich wohl verstanden, doch ich weigere mich, sie in mein Gehirn dringen zu lassen. Meine Hände zittern und fühlen sich mit einem Mal taub an, sodass mir mein Handy fast aus den Händen gleitet. Ein unsichtbares Band schnürt meine Kehle zu und das Atmen fällt mir schwer.
„Tailor? Tailor, bist du noch dran?“, hallt die ängstliche, schon fast hysterische Stimme meiner Mutter an mein Ohr.
„Ich … ja. Wie konnte das passieren?“, antworte ich krächzend, da ich kaum einen Ton herausbekomme. Es scheint, als hätten mich alle Kräfte verlassen und ich sacke langsam auf den Boden. Vor meinen Augen wird es kurz schwarz. Ich kann nicht verstehen, was gerade geschieht. Das darf doch nicht wahr sein! Das kann unmöglich jetzt passieren! Doch leider passiert es und es gibt kein Entrinnen.
„Das wissen wir nicht. Deine Schwester hat sich mal wieder in ihr Zimmer verkrochen und ich habe sie gerufen, damit sie mir hilft, das Mittagessen zu machen. Als keine Reaktion erfolgt ist, wollt ich sie holen gehen. Sie … sie lag regungslos in ihrem Bett.“
Meine Mutter stockt und mir wird schwindelig. Warum kann es nicht ein Traum sein? Ein einfacher, schlimmer Albtraum aus dem ich in wenigen Sekunden erwache?
„Was, was war dann?“, frage ich kraftlos nach und meine eigene Stimme klingt fremd und verzerrt.
„Ich hab sie versucht zu wecken, doch sie hat auf nichts reagiert. Tailor, ich hab ihr sogar eine Ohrfeige gegeben! Sie ist einfach nicht aufgewacht! Was hätte ich anderes tun sollen? Gerhard hat schließlich den Krankenwagen gerufen.“
Ich schließe kurz meine Augen und warte, bis meine Umgebung aufhört, sich zu drehen. Dann schlage ich sie wieder auf und richte mich vorsichtig auf meine wackeligen Beine auf.
„In Ordnung. Ich mache mich sofort auf den Weg.“
Ohne eine Antwort abzuwarten, lege ich auf und schwanke wie ein Betrunkener zurück zu meinen Kollegen und Vorgesetzten.
*
Ich drücke hastig auf den Knopf für den Fahrstuhl. Es dauert viel zu lange, bis er ankommt. Nervös wende ich mich ab und schlage den Weg ins Treppenhaus ein. Immer zwei Stufen auf einmal nehmend renne ich nach oben. Jede Sekunde ist kostbar. Ich darf keine Zeit verlieren. Die seltsamen Blicke der Leute, die ich streife, nehme ich aus meinen Augenwinkeln wahr, jedoch nur flüchtig. Schnell reiße ich die Tür auf und folge der Beschilderung in Richtung Intensivstation. Nur mit Mühe kann ich mich beherrschen, nicht zu rennen. Die Flure erscheinen mir endlos, erinnern mich an ein unüberschaubares Labyrinth. Als ich um die nächste Ecke eile, sehe ich meine Mutter mit ihrem Freund. Erwartungsvoll blicke ich beide an, doch meine Mutter schüttelt ihr aschfahles Gesicht. So blass habe ich sie noch nie gesehen. Meine nicht ausgesprochene Frage ist mit ihrer Geste beantwortet und raubt mir beinahe jegliche Hoffnung. Ich nehme meine Mutter in den Arm und streiche ihr tröstend über den Rücken, bevor ich Gerhard zur Begrüßung die Hand reiche.
„Wart ihr schon bei ihr drin?“, frage ich und versuche, meiner Stimme einen festen Klang zu verleihen, was mir nicht ganz glückt.
„Ja, allerdings durften wir nicht lange bleiben“, antwortet mir Gerhard und nimmt meine Mutter in den Arm.
„Wir haben aber Bescheid gesagt, dass du noch kommst und auch rein musst. Das geht in Ordnung. Wir müssen nur klingeln“, fügt meine Mutter schnell hinzu und ich nicke ihr zu.
„Danke.“
Gerhard zeigt mir, wo ich meine Hände desinfizieren kann und einen Kittel sowie Handschuhe herbekomme. Meine Mutter betätigt die Klingel und es dauert ganze weitere fünf Minuten, bis eine Schwester schließlich öffnet.
*
Außer Melisse sind fünf andere Personen im Zimmer der Intensivstation. Blaue Plastikvorhänge trennen die verschiedenen Betten. Es ist zu eng und viel lauter, als ich gedacht habe. Von jeder Seite hört man das mechanische Piepen der Geräte. Menschen stöhnen und ächzen und für einen kurzen Moment ertappe ich mich dabei, wie meine Gedanken einen Vergleich mit einem Versuchslabor für Menschen machen. Ich schüttle schnell meinen Kopf. Dafür ist jetzt keine Zeit. Ich ziehe den Vorhang beiseite und trete an das Bett. Am liebsten würde ich meine Schwester sofort hier rausbringen. Wie soll sie sich hier erholen? Wie zu sich kommen? Ich balle meine Hände zu Fäusten und ich sehe langsam auf sie herab. Mein Herz macht einen schmerzenden Sprung, als ich sie so daliegen sehe. Leblos. Die Hände flach neben sich liegend. Zögernd streiche ich ihr über ihre kalte Wange. Ich fühlte mich so hilflos. Was soll ich tun? Kann ich überhaupt etwas unternehmen?
Vorsichtig setze ich mich auf den Rand des Bettes und greife nach ihrer Hand. Irgendwo habe ich mal gelesen oder gehört, dass Bewusstlose Berührungen und Worte wahrnehmen können. Ob das stimmt, weiß ich nicht, doch ich hoffe darauf.
„Ähm, hallo Melisse. Wie geht es dir?“, beginne ich zögernd, lache im nächsten Moment beschämt auf. Kann man sich denn noch bescheuerter verhalten? Wie geht es dir? Bestimmt super, deswegen liegt sie auch in einer Art Koma. Was bin ich doch für ein dämlicher Idiot! Ich beiße mir auf meine Unterlippe und der Schmerz hilft mir, meine Tränen zu unterdrücken.
„Die Frage war überflüssig. Tut mir leid. Es ist nur so … ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll“, murmle ich aufs Neue und drücke sanft ihre Hand. So klein, zierlich und reglos. Ein Krampf schüttelt meinen Körper und in mir beginnt etwas zu schreien.
„Melisse, ich bitte dich. Bitte, wach auf! Was ist passiert? Wie soll es denn jetzt weitergehen? Was soll ich machen ohne dich? Wie soll ich denn so ein Auge auf dich haben? Okay, nicht witzig, nicht wahr?“
Eine Träne bahnt sich ungehindert ihren Weg aus meinem Auge und hinterlässt eine fast unsichtbare Spur auf meiner Wange. Die Hilflosigkeit verbündet sich mit dem Schmerz und frisst mich von innen auf. Meine Schwester rührt sich nicht. Ich bin mir sicher, sie hört mich nicht. Alles Unsinn, was in den Medien verbreitet wurde. Schwachsinn. Ich bin so ein Idiot. Ich hätte es verhindern müssen. Sie aufhalten. Sie retten. Auch wenn ich nicht weiß, wie ich das hätte machen sollen. Ich weiß nicht einmal, was passiert ist. Als eine Krankenschwester mir bedeutet, dass meine Zeit um ist, hauche ich Melisse einen leichten Kuss auf die Hand. Dann verlasse ich schweren Herzens die Intensivstation.
*
Seit Stunden wälze ich mich ruhelos im Bett. Zu viele Gedanken gehen mir durch den Kopf. So kann ich unmöglich schlafen. Immer wieder sehe ich Melisse vor mir, wie sie mich heute Morgen noch verabschiedet und mir viel Spaß und Erfolg für meinen Tag gewünscht hatte. Was mag danach nur passiert sein? Was hat sie noch gemacht?
Seufzend hieve ich mich auf meinen Rücken und starre an die Zimmerdecke. Ich habe meine Mutter zigmal ausgefragt, jedoch keine andere Aussage oder mehr Informationen wie am Telefon erhalten. Ratlos schließe ich kurz meine Augen und reibe mir mit meinen Händen über meine Lider. Dieses scheußliche Zimmer der Intensivstation … Dort kann sie sich nicht wohl fühlen, auch wenn sie nicht bei Bewusstsein ist. Das weiß ich. Ich kenne sie.
„Verdammt!“
Ich schlage mit der flachen Hand auf die Matratze und fluche leise vor mich hin. Dann stehe ich mit einem Ruck auf und schleiche mich in die Küche im Erdgeschoss, wo ich mir ein Glas Wasser einschenke. Ruhelos lasse ich mich auf dem Stuhl am Fenster nieder und starre hinaus auf die dunkle Landschaft, die nur schwach vom Schein einzelner Laternen beleuchtet wird. Die Straßen sind menschenleer und trostlos. Nicht einmal das schimmernde Licht der Sterne und des Mondes ist zu sehen. Eine dichte Wolkendecke verbirgt sie. Ich seufze lautlos auf. Meine innere Unruhe möchte nicht weichen. Wie soll ich auch schlafen, wo meine Schwester bewusstlos ist und mir keiner sagen kann, wann und ob sie jemals wieder aufwacht? Verzweifelt trete ich gegen die Wand. Ein altes Bild springt mir ins Auge und lässt mich verharren, scheint meine Wut zu lähmen. Es zeigt meine Schwester und mich, als ich gerade eingeschult worden bin. Das war kurz nachdem unser Vater uns verlassen hat. Ein leichtes Schmunzeln umspielt meine Mundwinkel bei der Erinnerung, wie das Bild geschossen wurde. Ich habe es schon früher gehasst, fotografiert zu werden. Ich hatte mich auch damals geweigert und meine Mutter konnte mich nur damit überreden, dass auch Melisse mit auf das Bild durfte und die wollte damals unbedingt meine Schultüte halten. Sie war so stolz gewesen und ich fand sie dermaßen niedlich, dass ich ihr gleich die Hälfte meiner Süßigkeiten abgegeben habe. Na ja, zumindest nachdem ich sie fast den ganzen Tag geärgert und ihr die Nase lang gezogen hatte. Nachdenklich fahre ich mir durch mein wirres Haar und nehme noch ein Schluck vom Wasser. Auf dem Bild sieht man deutlich den Kontrast. Wir sehen uns optisch nicht sehr ähnlich. Meine Schwester kommt komplett nach unserem Vater: haselnussbraune Haare und mandelförmige, walnussbraune Augen. Ich dagegen bin völlig nach unserer Mutter geraten: blond mit kristallblauen Augen, wie es Melisse immer beschrieben hat. Na ja. Das Einzige, was wir äußerlich gemeinsam haben, ist die Form unserer Augen und unser brauner Teint. Ansonsten sind wir völlig verschieden. Auch charakterlich gehen wir weit auseinander. Ich bin mehr der offene Typ, wobei sie mehr verschlossen und in sich gekehrt ist. Doch das war nicht immer so … oder? Gedankenverloren stiere ich auf die Fotografie. Nein, früher war sie sehr lebhaft gewesen. Erst mit den Jahren hat sie sich in die Richtung entwickelt. Ich weiß gar nicht mehr, wann es begann, dass ich nicht mehr zu ihr durchdringen konnte.
Abermals seufze ich auf, bevor ich ermattet aufstehe und zurück in mein Bett wanke. Meine Suche nach Antworten bleibt erfolglos. Heute Nacht werde ich sie nicht finden. Schlafen kann ich jedoch auch nicht.
Kapitel 3
Melisse – Samstag, 22:50 Uhr
Mein Weg führt mich durch einen dunklen Tunnel. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Nachdem ich Kiandra meine Entscheidung mitgeteilt habe, ist sie so plötzlich verschwunden, wie sie aufgetaucht war. Dann wurde es schwarz um mich herum und nun befinde ich mich hier: Inmitten einer drängelnden und drückenden Menschenmasse, die mich vorwärts schiebt. Vorwärts in meine unbekannte Zukunft. Ich kann weder nach vorne, noch nach hinten oder zur Seite sehen. Alles was ich ausmachen kann, sind gedrängte Körper, die sich anrempeln und unaufhaltsam nach vorne preschen. Ich habe Angst, stehen zu bleiben. Sie würden mich einfach überrennen. Bestimmt. Ich bemühe mich, das Gleichgewicht zu halten und mich gleichzeitig etwas größer zu machen, indem ich mich auf meinen Zehenspitzen fortbewege. Die Luft hier unten ist viel zu stickig. Leider macht das bei meiner Größe von 1,60 Meter nicht viel Sinn. Ich kneife kurz meine Augen zusammen, als ich direkt in einen der wenigen Lichtkegel sehe, die vergebens versuchen, den runden Tunnel zu erhellen. Immer wieder zucke ich zusammen, weil mich ständig fremde Körper berühren. Ein kalter Schauer schießt mir über den Rücken und ich beginne allmählich zu schwitzen. Hier drin ist es unerträglich schwül. Mir wird übel. Auf was habe ich mich eingelassen? Ich komme mir vor wie ein Lamm zur Schlachtbank. Ich schlage wärmend meine Arme um meinen zitternden Körper und stolpere mit der dichten Masse weiter. Die Angst keimt in mir auf und breitet sich rasend schnell wie ein bedrohlicher Virus aus. Was passiert mit mir? Wer sind all diese Menschen? Wo werde ich hingebracht? Muss ich jetzt sterben? Ist dies das Ende meines bisher nutzlosen Lebens? Das möchte ich nicht! Ich habe doch noch nichts erreicht, noch gar nichts bewirkt oder getan, was meine Existenz gerechtfertigt hätte …
Meine Augen werden wässrig, ohne dass ich es verhindern kann. Schnell beiße ich mir auf die Zunge, um weinerliche Laute zu unterdrücken, obgleich ich mir sicher bin, dass die Masse sie nicht wahrnehmen würde. Denn die hallenden Schritte sind viel zu laut, gleich einem Gewitterhagel. Doch ich möchte mich selbst nicht hören. Ich möchte nicht weinen. Weinen ist ein Zeichen von Schwäche. Schwäche ist etwas für Verlierer und ich möchte keiner sein. Daran bin ich selbst schuld. Ich habe mich für diesen Weg entschieden, deshalb darf ich nicht jammern. Es bringt nichts. Dadurch wird das Ganze auch nicht rückgängig gemacht.
Auf einmal geht ein erfreutes Raunen durch die Menge. Eine frische Brise weht durch den Tunnel und nur nach wenigen Schritten wird es plötzlich hell. Die Masse zerlegt sich in viele Menschen. Ich blinzle und werfe einen Blick an die Decke und meine Augen weiten sich vor Erstaunen. Über mir befindet sich nun nicht mehr die dunkle Tunnelwand, sondern eine transparente Decke, durch die man direkt in das Meer blickt. Ein Schwarm bunter Fische schwimmt eilig vorbei und ich erfreue mich während des Laufens an ihrem Farbenspiel. Von kindlicher Neugier getrieben versuche ich, einen Blick auf die rechte Seite zu erhaschen. Nach einigen Versuchen habe ich Erfolg und kann meine Position nach rechts verlegen, sodass mich nur zwei Menschen von der transparenten Wand trennen. Ich bin vom tiefblauen Meer in all seiner Pracht umgeben. Meine Angst flaut augenblicklich ab, so als hätte ich ein wirksames Medikament gegen das Virus eingenommen. Aufgeregtes Flüstern liegt in der Luft und es riecht angenehm nach Salzwasser. Ein inneres Gefühl bedeutet mir, die Leute um mich herum zu betrachten, doch ich kann nicht. Viel zu faszinierend erstreckt sich das sanfte Blau um mich herum, das nach dem dunklen Gang wie eine Befreiung wirkt. Immer wieder schwimmen vereinzelt oder in ganzen Schwärmen farbenfrohe Fische vorüber und merkwürdige Algen wiegen sich tänzelnd in den Wogen des Wassers. Meine Begeisterung flaut nicht ab. Nur eine drängelnde Stimme hinter mir lässt mich kurz aufhorchen.
„Mami, wann sind wir denn endlich da?“
„Noch ungefähr 30 Minuten, mein Schatz. Jetzt sei brav und lauf artig weiter.“
Das Kind gibt einen protestierenden Laut von sich, folgt jedoch der Aufforderung seiner Mutter. Ich gebe meinem inneren Drang nach und lasse meinen Blick wieder umherschweifen, um die Schönheit, die mich umgibt zu genießen. 30 Minuten können verdammt kurz sein.
*
Meine Füße tänzeln nervös hin und her, während ich alles neugierig erkunde. Der Gang endete schließlich in einen großen, runden Raum, den ich gemeinsam mit der freudig aufgeregten Menschenmasse betreten habe. Nun sitze ich inmitten des großen Zimmers, das einer Kuppel ähnelt, auf einem der unzähligen Stühle, die nebeneinander aufgereiht sind. Auch hier sind die Wände durchsichtig und ich habe das Gefühl, ganz von dem Wasser umgeben zu sein wie von einer kuscheligen Decke. Ich gluckse erfreut auf, als ich ein Seepferdchen über mir erkenne. Noch nie zuvor habe ich ein echtes gesehen. Die Freudensprünge, die mein Herz vollführt, sind unglaublich. Schon lange habe ich mich nicht mehr so gefühlt. Befreit, aufgeregt und irgendwie ausgelassen. Mein Blick wandert zu einer Gruppe von Kindern, die vergnügt umherspringt und Fangen spielt. Zugleich wird mir wieder der Ernst der Lage bewusst. Es ist wunderschön hier, doch diese Leute sind alle in Gefahr. Unter ihnen ist ein Attentäter. Prüfend suchen meine Augen nach etwas oder jemand Auffälligem. Doch das ist schwerer als gedacht. Befinde ich mich eigentlich schon auf dem Schiff? Wahrscheinlich nicht. Doch wo genau bin ich nun? Fragen über Fragen und vorerst keine Antwort in Sicht. Ich werde mich wohl etwas gedulden müssen. Stattdessen versuche ich zu schätzen, wie viele Menschen sich im Raum befinden. Zum Zählen sind es zu viele, doch ich bin mir sicher, dass es über 300 Leute sind. Ich schlucke. Das ist wie eine Nadel im Heuhaufen zu suchen. Zweifel steigen in mir auf. Habe ich mir zu viel zugemutet? Nachdenklich senke ich meinen Kopf und starre auf den Fußboden, der mir perlmuttfarben entgegenschimmert, als wären unzählige Muscheln darin verarbeitet worden. Für die übrigen Anwesenden scheint dies nichts Ungewöhnliches zu sein. Ich bin die Einzige im Raum, die so fasziniert davon ist. Hoffentlich falle ich nicht zu sehr auf, doch meine Zweifel scheinen unbegründet, wie ich nach einem erneuten Rundblick feststelle. Familien sitzen beisammen und versuchen, ihre Kinder zu zügeln. Junge Frauen und Männer sind vertieft in eine mir fremde Zeitschrift und in Büchern. Kleine Gruppen unterhalten sich angeregt miteinander. Es ist ein buntes Treiben von unterschiedlichsten Leuten an einem Fleck. Es gibt vornehme Herrschaften in Anzügen und schicken Kleidern, aber auch schlicht gekleidete Passagiere, wie ich erleichtert feststelle, denn so falle ich mit meinen zerschlissenen Jeans und meinem lilafarbenen Sweatshirt nicht auf. Die Mode unterscheidet sich vom Stil nicht sonderlich von dem mir bekannten und in der Tat nimmt niemand richtig Notiz von mir. Meine Augen wandern erneut durch die Halle und bleiben an den seltsamen Pflanzen hängen, die vereinzelt an den transparenten Wänden in großen, ovalen Vasen stehen. Ich war noch nie sehr interessiert in Botanik, doch die grünen Ranken, die sich spielerisch ineinander verknoten, wecken meine Neugier, doch ich traue mich nicht, aufzustehen und sie von der Nähe aus zu betrachten. Mein Verhalten würde auffallen und somit ich. Das sollte ich verhindern. Fasziniert fahren meine Blicke die Ranken und die vereinzelten Blüten ab, die sternenförmig in den unterschiedlichsten Farben leuchten. Wie gerne würde ich sie berühren. Ob ich es nicht doch wagen soll, aufzustehen? Die Entscheidung wird mir abgenommen, als ein Rauschen erklingt. Erst ganz leise, dann immer lauter werdend. Beunruhigt sehe ich mich um, doch von den anderen Menschen erfolgt keinerlei Reaktion. Ich bin die Einzige, die nicht begreift, was nun passiert und nervös wird. Das Rauschen schwillt an – ich kann kaum noch etwas hören. Ich beginne, auf meiner Unterlippe zu kauen, und blicke mich langsam um. Meine Augen weiten sich vor Erstaunen und mein Herz setzt für einen Schlag aus. Eingeschüchtert sacke ich in meinem Stuhl zusammen und starre auf das riesige Geschöpf, das sich uns nähert. Ich bin unfähig, auch nur eine Bewegung zu tätigen. Meine Gedanken rasen kreuz und quer und ich kann nicht einen einzigen davon fassen. Mein Pulsschlag beschleunigt auf höchste Stufe und mir wird unglaublich heiß. Ich kann nicht sagen, was lauter ist: das Rauschen von dem Ungetüm oder mein Herzschlag. Dröhnend und anmutig schwimmt es auf die Kuppel zu. Seine Flossen, die viel zu klein für seinen kugelförmigen Körper scheinen, bewegen sich ebenmäßig im Wasser, fast zu gleichmäßig und monoton. Irgendwie nicht natürlich. Kurz vor dem Aufprall kommt es majestätisch zum Stehen und treibt beobachtend auf und ab. Mit einem Mal verstummt das Rauschen und seine Glubschaugen stieren in den Raum, als würde es vor einem Becken voller Königskrebse stehen und sich überlegen, welchen von uns es zuerst verspeisen möchte. Mein Körper zittert wie Espenlaub, doch ich kann den Blick nicht von dem gewaltigen Monstrum abwenden. Viele kleine Ausbuchtungen übersähen seinen Körper wie Beulen. Meine Finger krallen sich in mein Sweatshirt und ich bin vor Angst wie gelähmt. Viel zu spät erkenne ich in den Ausbeulungen des übergroßen Kugelfisches transparentes Glas und dahinter Tische, Betten, Schränke. Mein Mund klappt nach unten und mein beschleunigter Atem, wie auch mein Puls, beruhigen sich wieder. Eine kurze, glockenähnliche Melodie hallt durch den Raum, gefolgt von einer Durchsage.
„Meine Damen und Herren, wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Die Teirish Dominion ist soeben eingetroffen. Bitte halten Sie Ihre Fahrkarten bereit und melden Sie sich beim Ausrufen der Nummern an unseren Schaltern zum Einchecken. Ihr Gepäck befindet sich selbstverständlich schon an Board und in den jeweiligen gebuchten Zimmern des Schiffes. Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt. Genießen Sie die Reise.“
*
Das Einchecken dauert ermüdend lange. Schon seit über 40 Minuten sitze ich da, warte und beobachte die Leute, deren Nummer ausgerufen wurde. Eifrig eilen sie nach vorne und zeigen den grün uniformierten Damen an den zehn Schaltern, die aussehen wie hölzerne Podeste aus einer Kirche, ihre Karten. Ich kann nicht erkennen, was genau geprüft wird, doch nach ein paar Minuten dürfen die Leute dann passieren und betreten eine große Säule. Sobald sich die geschlossen hat wird Wasser hineingelassen, das sofort anfängt zu blubbern und etliche Blasen entstehen, sodass die Person darin nicht mehr zu erkennen ist. Nach wenigen Augenblicken ist es vorbei und die Säule wieder leer. Ein mulmiges Gefühl durchzieht meine Magengegend und lässt eine leichte Übelkeit in mir aufsteigen. Unsicher fahren meine Finger in jede einzelne Tasche meiner Jeans, auf der Suche nach einem Ticket. Was soll ich tun, wenn ich als Letztes sitzenbleibe und man mich anspricht? Wie kann ich auf die Teirish Dominion kommen?
„Nummer 82 bitte an Schalter fünf.“
Ich unterbreche meine verzweifelte Suche kurz, um aufzublicken. Ein Mädchen, das nicht viel älter sein kann als ich, steht fünf Sitzplätze von mir entfernt auf und läuft zielstrebig zu dem fünften Schalter. Ihre kirschroten, hüftlangen Haare sind zu zwei Zöpfen geflochten und wippen emsig im Takt ihrer beschwingten Schritte hin und her. Als sie an mir vorbeigeht, treffen sich für einen flüchtigen Moment unsere Blicke. Noch nie habe ich Augen so leuchten sehen. Sie lächelt mir leicht zu, dann wendet sie ihren Blick geradeaus und ihre türkisfarbenen Augen von mir ab. Ein leichter Schauer flutet meinen Körper und ich starre ihr wie gebannt hinterher. Auch als sie am Schalter steht und sich kurz mit der Empfangsdame unterhält, kann ich mich nicht abwenden. Mir fällt auf, dass wir fast den gleichen Kleidungsstil haben. Die Frau hinter dem Schalter nickt ihr zu und die Rothaarige betritt zielstrebig die durchsichtige Säule. In Sekundenschnelle wird sie von Wasser umschlungen, das sie brodelnd vor meinen Blicken verbirgt. Dann ist sie verschwunden und das Rohr leer. In diesem Moment treffen meine Finger auf etwas Festes und Flaches. Mein Herz beginnt schneller zu schlagen. Die Geräusche um mich herum verbinden sich zu einem dröhnenden Zischen, als ich meine Finger langsam aus meiner Jeans ziehe und eine Fahrkarte in der Hand halte. Egal wo die auf einmal herkommt, sie ist meine Rettung.
„Ich wiederhole: Nummer 85 bitte zum Schalter neun!“
Wie in Trance drehe ich das handliche Ticket um und meine Vermutung bestätigt sich. Ruckartig stehe ich auf und schleppe mich mit wackeligen Beinen nach vorne. Der Boden unter mir scheint zu schwanken und erschwert meinen Weg, der mir viel zu kurz vorkommt. Woher kommt diese große Angst? Was soll schon passieren? Die Säule und das blubbernde Wasser werden mich nicht töten, sondern nur an Board der gewaltigen Teirish Dominion bringen. Mut. Ich brauche nur etwas Mut. Meine Augen gleiten noch einmal zu dem großen Unterwasserboot, das königlich im Wasser treibt, als würde ihm alles gehören. Ein aufgeregtes Kribbeln durchzieht meine Fingerspitzen und ich streiche mir gedankenverloren durch die Haare. Auf einmal breitet sich eine ungeheure Neugierde in mir aus und vertreibt die Angst. Ich muss unbedingt an Board dieses riesigen Ungetüms. Was verbirgt sich dahinter? Wie mag es da drin aussehen? Ich muss es einfach wissen. Etwas vorschnell schießt meine Hand nach vorne, um der Frau am Schalter das Ticket zu reichen. Diese mustert mich mit einem einstudierten Lächeln und nimmt mir dann nachsichtig die Fahrkarte ab, bevor sie in ihren Unterlagen zu blättern beginnt. Nervös kaue ich an meiner Unterlippe herum und bete, dass alles gut läuft.
„Ihr Name ist Melisse Quam?“, fragt sie mich mit heller Stimme, ohne von ihren Unterlagen aufzusehen.
„Ja, das ist korrekt“, gebe ich zurück und versuche, meiner zittrigen Stimme einen selbstbewussten Klang zu verleihen, was mir allerdings nur halbwegs gelingt. Das war noch nie eine meiner Stärken gewesen.
„Sie sind wie alt und wann geboren?“
„Ich bin 16 und am neunten März geboren.“
„Gut. Ihre Zimmernummer ist die 224. Bitte betreten Sie den Lift. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.“
„V… vielen Dank.“
Angespannt nehme ich mein Ticket wieder entgegen und wanke unsicher zur Säule. Unaufhaltsam kämpft sich die Angst in meinen Körper zurück. Als ich auf das Rohr zutrete, flammt in mir das Bild von einem Sarg auf. Ich schlucke und bleibe für einen Bruchteil einer Sekunde vor dem unheimlichen Lift stehen. Ein letztes Mal atme ich tief ein. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Die Säule schließt sich hinter mir und ich schließe lieber meine Augen. Noch bevor ich einen weiteren Gedanken an meine Furcht vor dem jetzt bevorstehenden Ereignis verschwenden kann, spüre ich, wie mich das Wasser sprudelnd umhüllt und meine Haut mit einem seltsamen Kribbeln überzieht. Für einen kurzen Moment bekomme ich keine Luft, dann ist es schon vorbei.
Kapitel 4
Tailor – Sonntag, 14:35 Uhr
„Verdammt! Tailor, merkst du noch was?!“
Niklas rennt genervt an mir vorbei zu der überkochenden Suppe, während ich perplex im Weg stehe. War das mein Topf? Ach ja, in der Tat. Gedanklich knalle ich mir eine, doch das Resultat bleibt dasselbe. Schnell hievt er den Pott auf die Seite und dreht den Herd ab. Ich brauche nicht näherkommen und mir die Misere ansehen. Ich ahne das fatale Ergebnis und Niklas schlägt es mir eine Sekunde später ins Gesicht wie einen kalten Lappen.
„Die Suppe ist völlig angebrannt! Die können wir unmöglich unseren Gästen vorsetzen! Könntest du mal deinen Kopf anschalten und anfangen zu arbeiten, anstatt in der Gegend herumzustehen und zu träumen?! Selbst meine Tochter wäre momentan nützlicher als du und die ist fünf!“
„Ja, es tut mir leid. Ehrlich …“, murmle ich geknickt und mache mich sofort daran, eine neue Suppe zu zubereiten. Dass meine Haltung geduckt ist wie bei einem Hund, der Angst vor Schläge hat, fällt mir zwar auf, doch ändern kann ich es momentan nicht. Niklas meckert ununterbrochen weiter, während er sich daranmacht, die Salate anzurichten. Ich kann ihm nicht mal widersprechen. Er hat ja recht. Dennoch kann ich es heute nur schwer ertragen. Vielleicht liegt es daran, dass der mangelnde Schlaf schwer an meinen Knochen zieht. Ich bekomme meinen Kopf einfach nicht frei. Normalerweise lenkt mich das Kochen ab. Ich gebe mich einer Sache gerne ganz hin, doch es gelingt mir zurzeit nicht mehr. Die Sorge um meine Schwester bringt mich um den Verstand. Wie kann ich hierstehen und arbeiten, während sie um ihr Leben kämpft? Wenn sie denn kämpft. Ich habe keine Ahnung, was Leute ohne Bewusstsein tun oder nicht tun. Ach verdammt! So komme ich nicht weiter. Ich kann niemandem helfen. Nutzlos … Ja, ich bin so nutzlos.
Gedankenverloren gehe ich zu den Brettern, wo ich mir eines davon nehme und ein Messer zücke, um die Lauchzwiebeln zu schneiden. Nochmals versuche ich, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren, doch vergebens. Das Bild von Melisse, wie sie sich morgens von mir verabschiedet, gefolgt von dem, wie sie bewusstlos im Krankenhaus liegt, schleicht sich immer wieder in meinen Kopf wie ein Einbrecher in die Wohnung. Gab es Anzeichen dafür? Was habe ich übersehen? Sie sah an diesem Morgen bedrückt aus. Doch das hat sie öfter getan. Seit unser Vater ausgerissen ist. Anfangs habe ich es nicht ganz begriffen. Okay, ich war auch erst sechs Jahre alt und ziemlich mit der Situation überfordert gewesen. Ich konnte damals nicht verstehen, warum mein Vater uns alle zurückgelassen hatte. Nicht ein Wort der Verabschiedung hatte er uns gelassen. Er war einfach gegangen. Still und heimlich. Die Freude und den Familienfrieden hatte er mitgenommen. Selbst heute begreife ich es noch nicht. Wahrscheinlich werde ich das nie. Ich würde ihn gerne danach fragen. Warum er uns verlassen hat. Was wir ihm getan haben. Wie er uns das antun konnte. Ob er sich bewusst war, wie furchtbar es Mutter und uns danach ergangen war. Wie sehr wir alle gelitten haben, besonders Melisse. Kein einziges Mal hat er sich bei uns gemeldet oder sich gar nach uns erkundet. Wir sind ihm wohl schlichtweg egal. Das ist einfach nicht fair. Auch wenn es meine Schwester nie breitgetreten hat, ich weiß, dass sie ihn vermisst und ihn gern wiedersehen würde. Ich bin mir nicht sicher, ob ein Teil von mir das ebenso gerne würde, doch ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihm als Dankeschön meine Faust in sein Gesicht rammen würde. Für die unzähligen Tränen meiner Mutter, die ich nicht zu trösten vermochte. Für die Leiden meiner Schwester, die ich nicht mindern oder gar verhindern konnte. Und für mich, da mein einziges Vorbild, das ich jemals hatte, an diesem Tag gestorben ist. Ein brennender Schmerz reißt mich unsanft aus den trüben Gedanken und ich lasse das Messer zu Boden fallen. Es dauert einige Sekunden, bis ich begreife, dass der Schmerz von meinem Finger kommt, in dem nun eine tiefrote Wunde klafft. Gebannt starre ich auf meinen pochenden Finger, aus dem das Blut in Sturzbächen zu Boden fließt.
„Ach du Scheiße, Tailor!“
Thomas' überschlagende Stimme reißt mich aus meiner Starre. Hektisch springt er zu mir rüber und zieht mich zum Verbandskasten, wo er nach einem Desinfektionsspray und etlichen Tüchern greift. Ich bin wie hypnotisiert und nicht in der Lage zu sprechen. Ich verstehe mich gerade selber nicht.
„Okay, das war's. Wir bringen deinen Finger halbwegs in Ordnung und dann gehst du heim!“
Seine Stimme klingt wieder ruhig, jedoch sehr bestimmend und keine Widerrede duldend.
„Das geht nicht … es ist noch so viel zu tun“, stammle ich kaum verständlich vor mich hin, doch Thomas winkt sofort ab. In diesem Moment tritt auch Niklas hinzu.
„Ach du Schande! Was machst du nur? Schöne Sauerei. So wird das heute nix. Sieh zu, dass du Land gewinnst und komm zurück, wenn du wieder du selbst bist!“
Ich seufze ergeben auf. Sieht so aus, als habe ich keine andere Wahl.
*
Mein Weg hat mich natürlich nicht nach Hause geführt. Der Schnitt war nur halb so wild. Ich habe Glück gehabt. Etwas Wasser, Desinfektionsmittel und ein Pflaster genügen. Trotzdem haben meine Kollegen darauf bestanden, dass ich gehen sollte. Wohl ist mir dabei nicht, ich habe jetzt bestimmt ein völlig schlechtes Bild von mir hinterlassen. Ich muss mich endlich fangen und es wiedergutmachen, auf jeden Fall. Doch zuerst muss ich zu Melisse. Das ist mir im Augenblick das Wichtigste. Die Schwester von der Intensivstation vertröstet mich allerdings. Melisse wäre auf ein anderes Zimmer verlegt worden und ich solle eine Kollegin im Schwesternzimmer der Station fragen. Schnell eile ich zu besagtem Ort. Ist das ein gutes Zeichen? Bedeutet das, dass sie wieder aufgewacht ist? Es muss ein gutes Zeichen sein. Doch ich werde enttäuscht. Der Zustand meiner Schwester sei stabil, doch aufgewacht ist sie noch nicht. Auch ist es ungewiss wann und ob sie jemals wieder erwachen wird.
„Weiß man, wie es dazu kommen konnte? Was sie hat?“, frage ich die hagere Frau und meine Stimme klingt ungewohnt monoton und rau. Die Schwester sieht mich mit unbewegter Miene an, mustert mich kurz von oben bis unten. Dann schüttelt sie den Kopf.
„Nein, soweit aus der Akte hervorgeht nicht. Aber das kann Ihnen ein Arzt oder Ihre Mutter genauer erklären.“