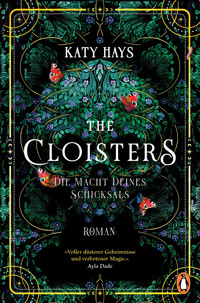
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Hinter den Mauern eines alten Museums wird eine junge Studentin in einen gefährlichen Strudel aus geheimen Affären, Verrat und dunklen Mythen gezogen …
Mit einem Abschluss in Kunstgeschichte und voller Ambitionen kommt die junge Ann nach New York, um dort bei The Cloisters, einer Außenstelle des ehrwürdigen Metropolitan Museum of Arts für Mittelalter- und Renaissancekunst, ein Praktikum zu absolvieren. Das einem gotischen Kloster nachempfundene Museum mit steinernen Kreuzgängen und einem üppigen botanischen Garten zieht sie sofort in seinen Bann.
Ann ist dankbar, endlich die Vergangenheit hinter sich zu lassen, und stürzt sich in die Arbeit für den sympathischen Kurator Patrick. Schnell freundet sie sich auch mit ihrer Kollegin an, der ebenso schönen wie charismatischen Rachel, und gemeinsam bereiten sie eine Ausstellung über Vorhersagung und Schicksal vor. Als Ann auf ein mysteriöses Tarotkarten-Set mit versteckten Zeichnungen aus dem 15. Jahrhundert stößt, gerät sie jedoch in ein gefährliches Spiel von Macht, Ehrgeiz und Verführung... Sie muss sich entscheiden: Kann sie den Karten vertrauen oder muss sie selbst ihr Schicksal in die Hand nehmen?
»Ein geheimnisvoller Mentor, ein verdammt heißer Gärtner mit einem Faible für Giftpflanzen, ein verdächtiger Todesfall und Jahrhunderte alte, geheime Karten – all das verdichtet sich zu einer twisty Geschichte, bei der den Leser mehr und mehr das Gefühl beschleicht, dass hier wirklich niemand die ganze Wahrheit sagt …« The New York Times
»Akademische Obsession trifft auf Renaissance-Magie – düster, atmosphärisch und wunderschön geschrieben!« Mikka liest
Hochwertig ausgestattet und mit umfangreichem Tarot-Leitfaden im Anhang.
Dieses Buch ist perfekt für dich, wenn du diese Tropes liebst:
- dark academia
- toxic friendship
- frenemies
- obsession
- dark secrets
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 528
Ähnliche
KATY HAYS
THE CLOISTERS
DIE MACHT DEINES SCHICKSALS
ROMAN
Aus dem Englischen von Simone Schroth
Die Originalausgabe erschien 2022
unter dem Titel THECLOISTERS
bei Atria Books, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © der Originalausgabe Katy Hays 2022
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
This edition published by arrangement with the original publisher, Atria Books, a Division of Simon & Schuster, Inc., New York.
Redaktion: Ulla Mothes
Covergestaltung: Favoritbüro nach einem Entwurf von Marianne Issa El-Khoury / TW Images © Alamy, Getty, Shutterstock
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-30428-7V001
www.penguin-verlag.de
Für Andrew Hays
(und The Cheese)
Und der Tag der Geburt Deutet zugleich Den Todestag an
Seneca, Oedipus. Tragödie in fünf Akten.
Prolog
Der Tod klopfte immer im August an meine Tür. In einem langsamen, herrlichen Monat, den wir schnell und brutal gemacht hatten. Die Veränderung geschah so überraschend wie bei einem Kartentrick.
Ich hätte es kommen sehen müssen. Wie die Leiche auf dem Bibliotheksboden drapiert lag, wie man während der Ermittlungen ohne jede Rücksicht die Gärten durchpflügte. Wie unsere Eifersucht, unsere Gier und unser Ehrgeiz nur darauf warteten, uns alle zu verschlingen wie eine Schlange, die ihren eigenen Schwanz auffrisst. Wie der Uroboros. Und obwohl ich weiß, welche dunklen Wahrheiten wir in diesem Sommer voreinander verbargen, sehnt sich ein Teil von mir noch immer nach The Cloisters – und nach der Person, die ich vorher war.
Ich habe lange geglaubt, dass es auch anders hätte laufen, dass ich auch Nein zu dem Job hätte sagen können, oder zu Leo. Dass ich in jener Sommernacht nicht an den Long Lake gefahren wäre. Sogar dass sich der Gerichtsmediziner gegen eine Autopsie hätte entscheiden können. Aber ich hatte nicht die Wahl. Das weiß ich inzwischen.
Heute denke ich sehr viel über das Glückhaben nach. Glück. Wahrscheinlich kommt das Wort aus dem Mittelhochdeutschen, wo gelücke »Schicksal« oder »günstiger Zufall« bedeutet. Dante nannte Fortuna die ministra di Dio, die Dienerin Gottes. »Fortüne«, ein altmodisches Wort für »glückliches Schicksal«. Die alten Griechen und Römer handelten stets im Dienste des Schicksals. Sie errichteten Tempel zu seinen Ehren und verbanden ihr Leben fest mit seinen Launen. Sie zogen Seherinnen und Propheten zurate. Sie deuteten Tierspuren und studierten Vorzeichen. Selbst Julius Cäsar, so heißt es, überquerte den Rubikon erst, nachdem er den Würfel befragt hatte. Alea iacta est, der Würfel ist gefallen. Das gesamte Schicksal des Römischen Reiches hing von diesem Wurf ab. Wenigstens hatte Cäsar einmal Glück.
Was, wenn unser ganzes Leben – unser Leben und Sterben – längst für uns entschieden wäre? Würde man sich von einem Würfel oder von gezogenen Karten das Ergebnis verraten lassen wollen? Kann das Leben so brüchig, so verstörend sein? Was, wenn wir alle einfach wie Cäsar sind? Wenn wir nur auf unseren glücklichen Wurf warten, uns zu sehen weigern, was die Iden des März für uns bereithalten?
Zuerst war es leicht, die Omen zu ignorieren, die The Cloisters in diesem Sommer heimsuchten. Die Gärten quollen vor Blumen und Kräutern geradezu über, es gab Terrakottatöpfe mit Lavendel, und der Apfelbaum erblühte, süß und weiß. Die Hitze trieb einen Schweißfilm auf unsere Haut, Röte in unsere Gesichter. Eine unentrinnbare Zukunft fand uns, nicht umgekehrt. Ein unglücklicher Wurf. Einer, den ich hätte vorhersehen können, wenn ich nur – wie die Griechen und Römer – gewusst hätte, wonach ich Ausschau hätte halten müssen.
1. Kapitel
Ich würde Anfang Juni in New York eintreffen. Zu einer Zeit, während der sich Hitze aufbaute, im Asphalt sammelte, von den Glasfronten reflektiert wurde, bis sie einen Höhepunkt erreichte, der sich erst spät im September entladen sollte. Ich reiste nach Osten, anders als so viele Studierende aus meinem Jahrgang am Whitman College, die nach Westen unterwegs waren, in Richtung Seattle und San Francisco, manche sogar nach Hongkong.
Die Wahrheit sah folgendermaßen aus: Ich bewegte mich zwar gen Osten, jedoch nicht an einen der Orte, auf die ich ursprünglich gehofft hatte, nämlich Cambridge oder New Haven oder sogar Williamstown. Doch als die E-Mails von Institutsleitern eintrafen, Mit großem Bedauern … Ein starkes Bewerberfeld … Alles Gute für Ihren weiteren beruflichen Weg, war ich dankbar, dass zumindest eine Bewerbung ein positives Ergebnis gezeitigt hatte: das Sommerprogramm für Forschende am Metropolitan Museum of Art. Damit, das wusste ich, wollte man meinem Betreuer einen Gefallen tun: dem bereits emeritierten Richard Lingraf. Der war eine Art Koryphäe der renommierten Ivy League gewesen, bevor ihn das Wetter an der Ostküste – oder vielleicht doch ein dubioser Vorfall an seiner Alma Mater? – gen Westen getrieben hatte.
Das Ganze wurde als Associates-Programm bezeichnet, also als Programm für Wissenschaftliche Mitarbeitende, doch eigentlich handelte es sich um ein Praktikum, und zwar um eines mit äußerst bescheidener Bezahlung. Das war mir egal; ich hätte auch zwei zusätzliche Jobs angenommen und die Leute dafür bezahlt, dass sie mich nahmen. Schließlich ging es hier um eine Tätigkeit am Met. Also genau um das Prestige-Siegel, das ich als Unbekannte von einer ebenso unbekannten Universität benötigte.
Völlig unbekannt war das Whitman College zugegebenermaßen nicht. Aber weil ich in Walla Walla aufgewachsen war, in dieser staubigen Stadt mit ihren niedrigen Gebäuden im Südosten des Staates Washington, begegnete ich nur sehr selten jemandem von außerhalb, der überhaupt von ihrer Existenz wusste. Das College hatte meine gesamte Kindheit ausgemacht und dadurch sehr viel von seiner Magie eingebüßt. Andere Studierende trafen voller Aufregung hier ein, weil ihre Ankunft einen Neuanfang in ihrem Erwachsenenleben bedeutete. Mir jedoch war eine solche Tabula-rasa-Situation nicht vergönnt. Das lag daran, dass meine Eltern beide für das Whitman College arbeiteten. Meine Mutter war für die Mahlzeiten zuständig; sie plante die Speisekarte und entsprechende Motto-Abende für die Studierenden, die auf dem Campus wohnten: baskische, äthiopische und Asado-Gerichte. Wenn ich dort untergebracht gewesen wäre, hätte sie vielleicht auch meine Mahlzeiten geregelt, doch die finanziellen Vergünstigungen für die Kinder von Uni-Angestellten schlossen nur die Studiengebühren ein, also wohnte ich weiterhin zu Hause.
Mein Vater hingegen war Sprachwissenschaftler gewesen – auch wenn er nicht zur Fakultät gehörte. Als Autodidakt hatte er sich Bücher aus der Penrose Library ausgeliehen, mir den Unterschied zwischen den sechs Fällen im Lateinischen beigebracht und mir gezeigt, wie man ländliche italienische Dialekte analysierte, all das zwischen seinen Stunden am College. Doch dann begruben wir ihn im Sommer vor meinem Abschlussjahr neben meinen Großeltern, hinter der Lutheranerkirche am Stadtrand. Er war einem Unfall mit Fahrerflucht zum Opfer gefallen. Woher seine Liebe zu den Sprachen kam, hatte er mir nie erzählt – nur welche Dankbarkeit er empfand, weil ich diese Liebe teilte.
»Dein Dad wäre so stolz auf dich, Ann«, sagte Paula.
Bald würde meine Schicht im Restaurant enden. Paula, die es führte, hatte mich, damals fünfzehn, angestellt. Das war jetzt fast ein Jahrzehnt her. Der Raum war tief und lang gezogen, mit einer stumpf wirkenden Blechpaneldecke, und wir hatten die Eingangstür offen stehen lassen, weil wir hofften, die frische Luft werde die hartnäckigen Essensgerüche vertreiben. Hin und wieder kroch ein Auto auf der breiten Straße vorbei, dessen Scheinwerfer die Dunkelheit durchschnitten.
»Danke, Paula.« Ich zählte auf dem Tresen mein Trinkgeld und tat dabei mein Bestes, die feuerroten Male auf meinen Unterarmen zu ignorieren. Die Rushhour der Abendessenszeit – wegen der Abschlusszeremonie am Whitman mit mehr Gästen als sonst – hatte mich gezwungen, beim Servieren die von der Warmhalteplatte noch heißen Keramikteller direkt auf den Unterarmen zu balancieren. Der Weg von der Küche durch den Gastraum reichte, um sich Verbrennungen zu holen.
»Weißt du, du kannst jederzeit wiederkommen«, verkündete John, der Bartender, als er die Zapfanlage betätigte und mir das mir zustehende Bier überreichte. Eines pro Schicht durften wir trinken, doch diese Regel wurde nur selten befolgt.
Ich glättete meinen letzten Dollarschein und schob das zusammengefaltete Geld in die Gesäßtasche. »Ich weiß.«
Doch ich wollte nicht hierher zurück. Mein Vater, der auf ebenso unerklärliche wie plötzliche Weise verstorben war, schien auf sämtlichen Bürgersteigen der Innenstadt umzugehen, selbst auf der braun verdorrten Grasfläche vor dem Restaurant. Die altbewährten Fluchtmöglichkeiten – Bücher und Forschung – brachten mich nicht mehr weit genug weg.
»Auch im Herbst, wenn wir keine Leute brauchen«, fuhr John fort. »Dich nehmen wir immer.«
Ich versuchte die Panik zu ersticken, die ich bei dem Gedanken daran empfand, mich im kommenden Herbst in Walla Walla wiederzufinden. Da hörte ich hinter mir Paulas Stimme: »Wir haben geschlossen.«
Über die Schulter schaute ich zur Tür, wo sich eine Gruppe feierwütiger junger Frauen versammelt hatte. Einige lasen die ausgehängte Speisekarte, andere hatten sich schon durch die Tür mit dem Fliegengitter gedrängt, sodass das Geschlossen-Schild gegen das Holz schlug.
»Aber Sie schenken doch noch Getränke aus«, meinte eine der jungen Frauen und deutete auf mein Bier.
»Tut mir leid. Geschlossen«, bekräftigte John.
»Ach, nun kommen Sie schon«, rief eine andere. Die Gesichter der Frauen waren rosig von der Wärme des Alkohols, doch ich konnte schon vorhersehen, wie die Nacht für sie enden würde: mit schwarzen Schlieren unter den Augen und vereinzelten blauen Flecken auf den Beinen. In meinen ganzen vier Jahren am Whitman College hatte ich nie eine solche Nacht erlebt – nur die paar Bier während der Schicht und verbrannte Haut.
Mit ausgestreckten Armen trieb Paula alle nach draußen, schob sie durch die Tür. Ich wandte meine Aufmerksamkeit wieder John zu.
»Kennst du die?«, wollte er wissen, während er mit lässigen Bewegungen den hölzernen Tresen abwischte.
Ich schüttelte den Kopf. Wenn man als einzige Studentin nicht auf dem Campus lebte, war es nicht leicht, an der Uni Freunde zu finden. Anders als an einer öffentlichen Schule liefen solche Dinge am Whitman College nicht einfach von selbst. Am Whitman, einem kleinen College für Geisteswissenschaften oder besser gesagt einem teuren kleinen College für Geisteswissenschaften, wohnten alle auf dem Campus, zumindest im ersten Jahr.
»In der Stadt ist schon ganz schön was los. Freust du dich auf deine Abschlussfeier?« John schaute mich erwartungsvoll an, doch ich reagierte nur mit einem Schulterzucken. Ich wollte weder über das College noch über die Abschlussfeier reden. Ich wollte nur mein Geld einsacken und es zu Hause in Sicherheit bringen, bei den anderen gesparten Trinkgeldern. Das ganze Jahr über hatte ich fünf Abende die Woche gearbeitet, manchmal sogar auch noch tagsüber, wenn mein Stundenplan es zuließ. Wenn ich nicht gerade in der Bibliothek saß, war ich hier. Ich wusste, dass mir die Erschöpfung nicht dabei helfen würde, der Erinnerung an meinen Vater oder dem Gedanken an die Absagen zu entkommen, doch sie ließ die brutale Realität ein wenig unschärfer werden.
Meine Mutter äußerte sich nie dazu, dass ich so viel arbeitete und nur zum Schlafen nach Hause kam, aber sie war auch zu sehr mit ihrer eigenen Trauer und ihren eigenen Enttäuschungen beschäftigt, als dass sie sich mit meinen auseinandergesetzt hätte.
»Dienstag ist mein letzter Tag«, erklärte ich, stieß mich ab und trank den letzten Rest, ging um den Tresen herum und stellte das Glas aufs Abtropfgitter. »Nur noch zwei Schichten, dann war’s das.«
Paula trat hinter mich und legte mir die Arme um die Taille, und sosehr ich auch den Dienstag herbeisehnte, spürte ich, wie ich mich in die Umarmung sinken ließ. Ich lehnte meinen Kopf an ihren.
»Du weißt, dass er dich von da oben sieht, oder? Er bekommt mit, was für Chancen sich für dich ergeben.«
Ich glaubte ihr nicht; ich glaubte niemandem von den Leuten, die mir versicherten, hinter allem stehe eine Magie, eine Logik, doch ich zwang mich, trotzdem bestätigend zu nicken. Ich hatte bereits gelernt, dass kein Mensch hören wollte, wie sich ein Verlust tatsächlich anfühlte.
Zwei Tage später nahm ich in einer blauen Polyesterrobe meine Abschlussurkunde entgegen. Meine Mutter war anwesend, für Fotos und für die Feier der kunstgeschichtlichen Abteilung. Die fand auf einem nassen Rasenstück vor der neogotischen Gedenkhalle statt, dem ältesten Gebäude hier auf dem Campus. Mir stand immer sehr deutlich vor Augen, wie jung das im Jahr 1899 fertiggestellte Bauwerk im Vergleich zu denen in Harvard oder Yale war. Die Claquato Church, eine bescheidene Methodistenkapelle mit Schindelverkleidung aus dem Jahr 1857, stellte das älteste Gebäude dar, das ich bisher aus eigener Anschauung kannte. Möglicherweise verführte mich deshalb die Vergangenheit so leicht – sie war mir in meiner Jugend entgangen. Der östliche Teil des Staates Washington bestand hauptsächlich aus Weizenfeldern und Futterspeichern, silbernen Getreidesilos, die ihr Alter nicht verrieten.
Tatsächlich war ich während meines vierjährigen Studiums am Whitman College die einzige Studentin gewesen, die sich mit der Frührenaissance befasste. In einer geschützten Nische, in der ich mich vor den berühmten Künstlern wie Michelangelo und Leonardo da Vinci versteckte, konzentrierte ich mich auf vereinzelte Figuren und vergessene Maler wie Bembo oder Cossa, mit Spitznamen wie »der grobe Tom« oder »der Schieler«. Ich befasste mich mit Herzogtümern und höfischen Gesellschaften statt mit riesigen Reichen. Höfische Gesellschaften waren schließlich nett und ließen sich von exotischen Dingen faszinieren: von Astrologie, Amuletten und Chiffren. Selbst hätte ich nie an so etwas glauben können. Doch die Faszination für diese Themen hatte auch zur Folge, dass ich oft allein war: in der Bibliothek oder bei meiner selbstständigen Arbeit mit Professor Lingraf, der immer mindestens zwanzig Minuten zu spät zu unseren Treffen erschien, wenn er sich überhaupt an sie erinnerte.
Obwohl das alles sehr unpraktisch war, hatten mich die wenig wahrgenommenen Randgebiete der Renaissance mit ihrem Goldschnitt und ihrem Prunk gepackt, mit ihrem Glauben an die Magie, ihren Machtdemonstrationen. Weil solche Dinge in meiner eigenen Welt überhaupt nicht vorkamen, fiel mir die Entscheidung leicht. Als ich mir dann langsam Gedanken über mein Studienprogramm in den höheren Fachsemestern machte, hatte man mich jedoch gewarnt, nur sehr wenige Abteilungen würden sich für meine Arbeit interessieren. Sie war zu abseitig, betraf ein zu kleines Gebiet, war weder ehrgeizig noch breit genug angelegt. Am Whitman College ermutigte man die Studierenden, die Disziplin zu hinterfragen, sich der Ökokritik zu widmen, die multisensorischen Eigenschaften des menschlichen Blicks zu erforschen. Hin und wieder fragte ich mich, ob meine Studienthemen, die übersehenen Objekte, die niemand wollte, in Wirklichkeit mich ausgewählt hatten, denn ich fühlte mich nicht in der Lage, sie aufzugeben.
Im Schatten vollführte meine Mutter im Gespräch mit anderen Eltern Kreisbewegungen mit den Armen, und dabei klimperten ihre Silberarmreifen. Ich sah mich in der Menge nach Lingrafs vollem weißem Haarschopf um, doch er war ganz eindeutig nicht erschienen. Obwohl wir vier Jahre lang viel zusammengearbeitet hatten, zeigte er sich wie meistens auch diesmal nicht auf der Zusammenkunft der Abteilung. Er sprach auch nur wenig über seine eigene Forschung. Woran er zurzeit arbeitete, wusste niemand – auch nicht, wann er endgültig vom Campus wegbleiben würde. In gewisser Hinsicht hatte die Zusammenarbeit mit Lingraf ein Risiko dargestellt. Wenn andere Studierende und sogar Angehörige der Fakultät hörten, dass er mir als Betreuer zur Seite stand, kam häufig die Frage, ob ich mir da auch ganz sicher sei, denn er nahm nur sehr selten Leute an. Aber es stimmte. Lingraf hatte die nötigen Unterschriften für meine Abschlussarbeit geliefert; die Formulare zur Beendigung meines Hauptstudiums, meine Empfehlungsschreiben – alles hatte er unterzeichnet. Und das, obwohl er die Gemeinschaft des Whitman Colleges mied. Stattdessen arbeitete er lieber in seinem Büro. Die geschlossene Tür sollte ihn vor Ablenkungen schützen, und jedes Mal, wenn jemand den Raum betrat, ließ er seine Papiere in einer Schublade verschwinden.
Als ich meinen Blick über die gesamte Gesellschaft hatte schweifen lassen, erschien Micah Yallsen neben mir, der wie ich heute seinen Abschluss feierte.
»Ann«, begrüßte er mich. »Ich habe gehört, du verbringst diesen Sommer in New York.«
Micah hatte als Kind und Jugendlicher in Kuala Lumpur, Honolulu und Seattle gelebt. Mit einem zermürbenden Reisepensum, wie es ein Privatflugzeug oder wenigstens Business-Class-Reisen mit sich brachten.
»Wo wirst du denn wohnen?«
»Ich habe in Morningside Heights was zur Untermiete gefunden.«
Er spießte einen blassen Käsewürfel auf, der auf dem Pappteller in seiner Hand lag. Das College war schon immer geizig gewesen, was das Catering betraf, und ich zweifelte nicht daran, dass die Kolleginnen und Kollegen meiner Mutter die Tabletts mit dem Fingerfood selbst vorbereitet hatten.
»Es ist auch nur für drei Monate«, fügte ich hinzu.
»Und danach?«, fragte er kauend.
»Weiß ich noch nicht.«
»Ich wünschte, ich könnte mir eine Auszeit gönnen«, verkündete er und ließ dabei den Zahnstocher nachdenklich zwischen den Lippen herumwirbeln.
Micah hatte einen Platz im Promotionsprogramm für Geschichte, Theorie und Kritik des Massachusetts Institute of Technology ergattert, einem der angesehensten im ganzen Land. Allerdings hätte seine Auszeit wohl völlig anders ausgesehen als meine.
»Ich hätte auch sehr gern gleich weitergemacht«, erwiderte ich.
»Es ist einfach sehr schwierig, heutzutage Arbeit auf dem Gebiet der Frührenaissance zu finden«, meinte er. »In unserer Disziplin hat es Verschiebungen gegeben. Zum Besseren natürlich.«
Ich nickte. Das war einfacher als Protestieren. Schließlich hörte ich dieses Argument nicht zum ersten Mal.
»Aber egal. Wir brauchen Leute, die die Arbeit früherer Generationen weiterführen. Außerdem ist es gut, wenn man sich für etwas interessiert – leidenschaftlich interessiert.« Er spießte einen weiteren Käsewürfel auf. »Trotzdem solltest du bestimmte Trends nicht ignorieren.«
Ich gehörte zu den Leuten, deren Gespür sich Trends schon immer entzogen hatten. Wenn ich sie erfasste, wanden sie sich wild unter meinem Griff. Was mich am Universitätsleben so gereizt hatte, war die Tatsache, dass ich mich dort wunderbar frei von Trends gewähnt hatte; meiner Vorstellung nach würde ich mich in einem Thema einrichten, um es nie mehr zu verlassen. Lingraf hatte immer nur Bücher über die Künstler von Ravenna publiziert; dafür hatte er nicht einmal die kurze Distanz bis nach Venedig überwinden müssen.
»Darauf kommt es jetzt an«, erklärte Micah. »Vor allem weil es im fünfzehnten Jahrhundert nicht mehr so viel zu tun gibt, oder? Das ist inzwischen ziemlich gut erschlossen. Keine neuen Entdeckungen. Außer man versucht einen Masaccio jemand anderem zuzuordnen oder so.« Er lachte und nahm seine Bemerkung zum Anlass, sich angenehmeren Themen zuzuwenden. Er hatte seine Ratschläge erteilt, und damit waren seine Verpflichtungen erfüllt. So, Ann, jetzt erkläre ich dir mal, warum du diese ganzen Absagen erhalten hast. Als hätte ich das nicht längst gewusst.
»Brauchst du Hilfe?« Meine Mutter lehnte im Türrahmen meines Zimmers. Ich zog gerade mehrere Bücher gleichzeitig aus dem Regal, um sie auf dem Boden aufzustapeln.
»Danke, ich komme klar«, gab ich zurück. Trotzdem betrat sie mein Zimmer, spähte in die bereits gepackten Kisten und zog die Schubladen meiner alten Kommode auf.
»Viel ist ja nicht mehr übrig«, kommentierte sie, und zwar so leise, dass ich sie fast nicht gehört hätte. »Bist du ganz sicher, dass du nicht ein paar Sachen hierlassen möchtest?«
Sollte ich mich jemals schuldig gefühlt haben, weil sie allein in Walla Walla zurückblieb, so hatte mich das mein Selbsterhaltungstrieb verdrängen lassen. Selbst als mein Vater noch lebte, hatte ich meine Zeit in diesem Zimmer als begrenzt angesehen. Ich wollte die Orte kennenlernen, die er in den Büchern aus der Penrose Library mit nach Hause gebracht hatte: die Glockentürme Italiens, die windgepeitschte Küstenlinie Marokkos, die glitzernden Wolkenkratzer Manhattans. Orte, zu denen ich bisher aus finanziellen Gründen nur auf Buchseiten hatte reisen können.
Als er starb, beherrschte mein Vater zehn Sprachen und konnte mindestens fünf nicht mehr verwendete Dialekte lesen. Sprachen waren seine Methode, um die vier Wände unseres Zuhauses und seine eigene Kindheit zu verlassen. Es tat mir leid, dass er nicht hier war und sehen konnte, wie ich in Angriff nahm, was er sich immer am meisten gewünscht hatte. Doch meine Mutter fürchtete sich vor dem Reisen, vor Flugzeugen, vor unbekannten Orten, vor sich selbst, und deswegen hatte sich mein Vater meist dafür entschieden, bei ihr zu bleiben, nie weit wegzufahren. Ich konnte nicht anders: Manchmal fragte ich mich, ob er mit dem Wissen, dass er jung sterben würde, nicht mehr unternommen hätte, um wenigstens ein paar Orte zu besuchen.
»Ich will einfach sicher sein, dass du das Zimmer vermieten kannst, falls das nötig wird.« Ich steckte die letzten Bücher in eine Kiste, und das Geräusch der Klebebandpistole ließ uns beide zusammenzucken.
»Ich möchte nicht, dass irgendjemand anders hier wohnt.«
»Vielleicht aber eines Tages doch«, gab ich behutsam zurück.
»Nein. Warum erwähnst du das ausgerechnet jetzt? Wo willst du denn dann schlafen, wenn du mich besuchst? Und wie soll ich dich sehen, wenn du nicht zurückkommst?«
»Du könntest doch mich besuchen«, schlug ich vor.
»Nein. Du weißt genau, dass ich das nicht kann.«
Ich wollte eine Diskussion mit ihr anfangen, sie anschauen und ihr ins Gesicht sagen, dass sie das sehr wohl konnte. Sie konnte in ein Flugzeug steigen, und dann würde ich am Ziel auf sie warten. Aber ich wusste, das war die Sache nicht wert. Sie würde mich nie in New York besuchen, und ich konnte nicht hierbleiben. Sonst, das wusste ich, hätte ich mich sehr leicht in den Spinnweben verfangen können, genau wie sie.
»Ich habe immer noch nicht richtig verstanden, warum du überhaupt wegwillst. In eine Großstadt wie New York. Hier kümmert man sich doch viel besser um dich. Hier kennen dich die Leute. Und mich auch.«
Diese Unterhaltung war mir nur allzu vertraut, aber damit wollte ich meinen letzten Abend zu Hause nicht verbringen. Über dieses Thema hatten wir seit dem Tod meines Vaters so oft gesprochen.
»Es wird schon alles gut, Mom«, sagte ich, sprach aber nicht aus, was ich insgeheim dachte. Das muss es einfach.
Sie nahm ein Buch in die Hand, das auf dem Bett lag, und blätterte es durch. In meinem Zimmer gab es gerade genug Platz für ein Bücherregal und eine Kommode, das Bett stand in die äußerste Ecke gequetscht. »Mir ist nie aufgefallen, wie viele Bücher du besitzt«, meinte sie.
Die Bücher brauchten mehr Platz als meine Kleidung. Das war schon immer so gewesen.
»Berufsrisiko«, gab ich zurück, erleichtert über den Themenwechsel.
»Okay.« Sie legte das Buch wieder hin. »Dann lasse ich dich mal zum Ende kommen.«
Ich räumte weiter, packte meine Bücher in die Kisten, die mir per Post zugestellt werden sollten, und dann zog ich meinen Seesack zu. Ich griff unters Bett und suchte nach dem Pappkarton, in dem ich meine Trinkgelder aufbewahrte. In meinem Schoß konnte ich das Gewicht des Geldes spüren.
Morgen würde ich in New York sein.
2. Kapitel
Es tut mir leid, aber wir haben diesen Sommer keinen Platz für Sie am Met«, eröffnete mir Michelle de Forte.
Wir saßen in ihrem Büro, und ich trug noch ein Namensschild mit meiner Abteilung und Ann Stilwell an der Bluse.
»Wie Sie wissen, hatte man Sie Karl Gerber zugeteilt.« Sie sprach mit flacher, neutraler Stimme, aus der sich ihre Herkunft nicht einmal erahnen ließ, die jedoch gleichzeitig darauf hindeutete, dass sie an den besten Schulen kultiviert worden war. »Er bereitet eine Giotto-Ausstellung vor, aber dann hat sich für ihn eine Gelegenheit in Bergamo ergeben, und er musste ganz unerwartet dorthin.«
Ich versuchte mir einen Job vorzustellen, in dem es einem passieren konnte, dass man ganz plötzlich nach Bergamo berufen wurde. Dem folgte der Versuch, mir den Typ Arbeitgeber vorzustellen, der mir das dann erlaubte. Weder das eine noch das andere wollte mir gelingen.
»Er braucht zur Erledigung der damit verbundenen Aufgaben womöglich mehrere Wochen. Ich kann also nur wiederholen, dass es mir sehr leidtut, aber wir sehen keine Möglichkeit mehr, Sie hier zu beschäftigen.«
Michelle de Forte, die Personaldirektorin des Metropolitan Museum of Art, hatte mich beiseitegenommen, sobald ich an diesem Morgen zur Orientierungsveranstaltung erschienen war. Sie hatte mich aus dem Raum mit heißem Kaffee in Kannen und süßen Teilchen weggeführt, in ihr Büro, und dort saß ich nun in einem Lounge Chair aus Plastik. Meinen Rucksack hatte ich noch auf dem Schoß. Sie schaute mich über ihren Schreibtisch hinweg an und hob dabei die Augen über das blaue Lucite-Brillengestell, das ihr weit über den Nasenrücken gerutscht war. Mit ihren schmalen, vogelklauenartigen Fingern produzierte sie auf dem Holz einen konstanten Metronomimpuls.
Möglicherweise erwartete sie, ich würde etwas sagen, aber ich hätte nicht gewusst, was. Wie es aussah, stellte ich in ihrer Sommerplanung einen Flüchtigkeitsfehler dar. Eine administrative Unbequemlichkeit.
»Sie verstehen sicher, dass wir uns deshalb in einer unglücklichen Lage befinden, Ann.«
Ich wollte schlucken, doch mein Hals war zu trocken. Ich konnte nur blinzeln und versuchen, nicht an das winzige Apartment zu denken, das ich zur Untermiete bewohnte, an die ungeöffneten Bücherkisten, an die anderen im Programm, die würden bleiben dürfen.
»Zurzeit sind sämtliche Positionen in der Abteilung besetzt. Wir brauchen keine zweite Kraft für das Altertum, und ehrlich gesagt verfügen Sie auch nicht über die Qualifikationen für eine Tätigkeit in den Abteilungen mit größerem Arbeitsaufkommen.«
Sie war nicht einmal unfreundlich, einfach nur geradeheraus. Sachlich. Sie rechnete ihre Bedürfnisse gegen meine nun traurigerweise unangemessene Anwesenheit auf. Durch die Glaswände ihres Büros konnte man verfolgen, wie ein steter Strom von Angestellten eintraf. Manche hatten noch ein Hosenbein hochgerollt, trugen Fahrradhelme, andere hatten abgenutzte Ledertaschen und knallrot geschminkte Lippen, und fast alle hielten einen Kaffeebecher in der Hand. Ich hatte den Morgen damit verbracht, die wenigen Kleidungsstücke in meinem Schrank durchzugehen, bevor ich mich für ein Outfit entschied, das ich für angemessen und professionell hielt: eine hochgeschlossene Baumwollbluse und einen grauen Rock, dazu Tennisschuhe. Auf meinem Namensschild hätte genauso gut Landei stehen können, denn ich kam mir vor wie die Verkörperung des unerfahrenen Kleinstadtmädchens.
Im Kopf versuchte ich auszurechnen, wie ich nach dem Verlust des Met-Stipendiums mit meinen Ersparnissen aus den Trinkgeldern dastand. Meiner Schätzung nach hatte ich genug Geld, um bis Mitte Juli in New York bleiben zu können, und es bestand immerhin die Chance, eine andere Arbeit zu finden. Der erstbeste Job hätte es getan. Meiner Mutter brauchte ich die neue Entwicklung gar nicht erst mitzuteilen. Jetzt, da ich einmal hier war, würde mehr nötig sein als eine Absage von Michelle de Forte, um mich zur Abreise zu bewegen. Meine Lippen formten schon die Worte »Das verstehe ich«, meine Hände machten sich bereit, mich vom Stuhl abzustoßen. Da klopfte es an die Glasscheibe hinter mir.
Ein Mann schirmte sich mit beiden Händen die Augen ab und schaute zu uns herein. Sein Blick begegnete meinem, bevor er mit energischen Schritten das Zimmer betrat. Dabei bückte er sich leicht, damit er sich nicht den Kopf am Türrahmen stieß.
»Patrick, bitte gedulden Sie sich einen Moment. Ich muss mich noch um diese Sache hier kümmern.«
Diese Sache hier war ich.
Doch Patrick ließ sich unbeeindruckt in den Stuhl neben meinem sinken. Verstohlen betrachtete ich sein Profil: ein gebräuntes Gesicht, attraktive Falten um Augen und Mund, graue Tupfer im Bart. Ein älterer Mann, doch kein alter. Vielleicht Ende vierzig, Anfang fünfzig. Gut aussehend, aber nicht auf auffällige Weise. Er streckte die Hand in meine Richtung aus, und ich schüttelte sie. Die Hand war trocken und schwielig, fühlte sich angenehm an.
»Patrick Roland«, erklärte er, ohne überhaupt in Michelles Richtung geschaut zu haben. »Kurator von The Cloisters.«
»Ann Stilwell, im Sommerprogramm der Renaissanceabteilung.«
»Ah. Sehr gut.« Patrick lächelte dünn und ein wenig ironisch. »Welche Periode?«
»Ferrara. Teilweise auch Mailand.«
»Haben Sie ein Spezialgebiet?«
»In letzter Zeit Himmelsgewölbe«, gab ich zurück und dachte an meine Arbeit mit Lingraf. »Astrologie der Renaissance.«
»Die weniger wahrscheinliche Renaissance also.«
Die Art und Weise, wie er mich von der Seite ansah, mir halb zugewandt, aber mit voller Aufmerksamkeit, ließ mich einen Augenblick lang vergessen, dass mich jemand anders im Raum gerade feuern wollte.
»Zur Forschung auf einem Gebiet, das noch immer Archivarbeit erfordert, gehört einiger Mut«, erklärte er. »Da gibt es nur selten Übersetzungen. Beeindruckend.«
»Patrick …« Michelle setzte zu einem weiteren Versuch an.
»Michelle.« Patrick führte die Handflächen zusammen und schaute ihr direkt ins Gesicht. »Ich habe schlechte Neuigkeiten.« Er beugte sich vor und schob ihr über den Schreibtisch sein Smartphone hin. »Michael ist gegangen. Ohne Vorankündigung. Er hat einen Job in der Kunst- und Kulturabteilung eines Technologieunternehmens angenommen. Wie es aussieht, ist er schon auf dem Weg nach Kalifornien. Er hat mir letzte Woche eine Mail geschickt, aber ich habe sie erst heute Morgen gesehen.«
Michelle las den Text auf Patricks Handy; ich konnte nur vermuten, dass es sich dabei um Michaels Kündigung handelte. Hin und wieder scrollte sie hoch und runter.
»Wir hatten schon vorher zu wenig Personal. Wie Sie wissen, konnten wir keinen geeigneten Hilfskurator finden, und Michael hat diese Rolle übernommen. Und das, obwohl er dafür in keiner Weise qualifiziert war. Also musste Rachel in allen Bereichen Doppelschichten einlegen, und ich mache mir Sorgen, das könnte ihr zu viel werden. Wir haben ein paar Leute in der Museumspädagogik, die aushelfen können, aber es reicht einfach nicht.«
Michelle gab Patrick das Handy zurück und rückte einen Papierstapel auf ihrem Schreibtisch zurecht.
»Ich hatte gehofft, Karl würde uns ein paar Wochen aushelfen können, bis wir jemanden finden«, fuhr er fort.
Während dieses Gesprächs hatte ich still dagesessen und mir überlegt, wenn ich mich nicht bewegte, würde Michelle vielleicht vergessen, dass ich überhaupt anwesend war, dass sie mich schon weggeschickt hatte.
»Karl ist den Sommer über in Bergamo, Patrick«, gab Michelle zurück. »Es tut mir leid. Wir können Ihnen niemanden zur Verfügung stellen. The Cloisters wird sich selbst darum kümmern müssen. Wir waren schon ziemlich großzügig, als wir Ihnen das Jahresbudget für Rachel bewilligt haben. Und jetzt, wenn es Ihnen nichts ausmacht …« Sie wies in meine Richtung.
Patrick lehnte sich in seinem Stuhl zurück und betrachtete mich wohlwollend.
»Kann ich sie haben?«, fragte er und klappte den Daumen in meine Richtung aus.
»Völlig unmöglich«, erklärte Michelle. »Ann wollte gerade gehen.«
Patrick beugte sich über seine Stuhllehne, und dadurch kam mir sein Oberkörper so nahe, dass ich seine Wärme spüren konnte. Erst nach einer Sekunde merkte ich, dass ich die Luft angehalten hatte.
»Möchten Sie für mich arbeiten?«, fragte er. »Das wäre aber nicht hier. Es ist in The Cloisters. Im Norden, ein Stück die Straße hoch. Wo wohnen Sie denn? Wäre das sehr umständlich für Sie?«
»In Morningside Heights«, antwortete ich.
»Passt. Direkt an der Linie A, und umzusteigen brauchen Sie auch nicht. Das geht wahrscheinlich sogar schneller als zu Fuß durch den Park.«
»Patrick«, unterbrach ihn Michelle. »Unser Budget erlaubt uns nicht, Ihnen Ann zu überlassen. Ihr Budget für das Sommerprogramm wird bereits durch Rachel aufgebraucht.«
Er unterbrach sie mit einer Geste und nahm sein Handy, scrollte durch die Kontaktliste, bis er die Nummer fand, die er brauchte. Am anderen Ende meldete sich jemand.
»Hallo. Ja. Herr Gerber. Hör mal, ich habe da ein wichtiges Anliegen. Kann ich deine Assistentin im Sommerprogramm …« Er schaute mich erwartungsvoll an und schnipste mit den Fingern.
»Ann Stilwell«, sagte ich.
»Kann ich Ann Stilwell den Sommer über haben? Wer das ist? Soweit ich weiß, war sie dir im Sommerprogramm zugeteilt, aber du musstest ja weg.« Er schaute mich an, weil er eine Bestätigung wollte, und ich nickte. Die beiden unterhielten sich ein paar Minuten auf Deutsch weiter, dann lachte Patrick und reichte Michelle das Handy.
Die meiste Zeit hörte sie schweigend zu. Alle paar Minuten warf sie etwas wie »Nur wenn Sie ganz sicher sind« und »Dann verlieren Sie allerdings das Ihnen zugeteilte Geld« ein. Am Ende nickte sie nur noch und gab zustimmende Geräusche von sich. »Okay … Hmmm … Also gut.« Sie reichte das Telefon Patrick, der laut lachte und einige Male das Wort Ciao wiederholte, was mir ganz wunderbar in den Ohren klang.
»Okay.« Er erhob sich aus seinem Stuhl und tippte mir auf die Schulter. »Kommen Sie mit mir, Ann Stilwell.«
»Patrick«, protestierte Michelle. »Sie hat ja noch nicht mal zugestimmt!«
Er schaute mich an und zog dabei eine Augenbraue hoch.
»Ja, natürlich«, sagte ich, und die Worte purzelten mir förmlich aus dem Mund.
»Gut«, gab er zurück und strich sich eine verirrte Hemdfalte glatt. »Dann erledigen wir jetzt alles und verschwinden hier.«
Während mir Michelle ausführlich erklärt hatte, warum ich nicht bleiben konnte, hatte sich der Vorraum mit Sommerprogramm-Leuten gefüllt, die im Gegensatz zu mir bleiben konnten. Das Programm genoss einen ausgezeichneten Ruf: Man holte sich nur eine Handvoll Uniabsolventen der besten Institute, und hinter den Kulissen sorgte man effizient und verschwiegen dafür, dass sich ihnen der Weg in eine erfolgreiche Zukunft eröffnete. Als ich die Zusage bekommen hatte, hatte ich gedacht, das könne nicht wahr sein, sei irgendein Fehler, doch bis zum Ende des Sommers sollte ich lernen, dass das Leben einige Fehler für einen bereithielt.
Die Vollzeitangestellten waren zur Anwesenheit verpflichtet, und obwohl sie keine Namensschilder trugen, erkannte ich einige von ihnen: den jungen Hilfskurator für islamische Kunst, direkt von der University of Pennsylvania, die Kuratorin für altrömische Kunst, eine feste Größe in der Serie über die Zivilisation des Altertums bei der Fernsehsenderkette PBS. Alle attraktiv und clever und absolut unerreichbar. Als ich feststellte, dass ich als Einzige noch einen Rucksack bei mir trug, hing er mir noch peinlicher an den Schultern als vorher.
»Ich bin in ein paar Minuten wieder da«, verkündete Patrick. »Sie besorgen sich jetzt einen Kaffee« – er deutete auf die Kannen – »und dann fahren wir zu The Cloisters.« Er ließ den Blick durch den Raum schweifen, und weil er so hochgewachsen war, konnte er leicht alle Anwesenden erfassen. »Rachel ist noch nicht da. Aber Sie kennen vermutlich einige andere im Sommerprogramm, oder?«
Ich wollte gerade sagen, dass dem nicht so war, doch da marschierte Patrick schon davon. Schwungvoll legte er den Arm um die Schultern eines älteren Mannes in einem abgetragenen Tweedjackett. Ich spürte, wie mir ein einzelner Schweißtropfen seitlich am Körper herunterlief, und presste den Arm dagegen, um ihn aufzuhalten.
Genau deswegen war ich natürlich früher erschienen. Um nicht in Gespräche hineinfinden zu müssen. Mit der Ersten im Raum mussten die Leute einfach reden. Wenn sich dann langsam eine Gruppe gebildet hätte, wäre ich in einem Kreis ähnlich früher Ankömmlinge geschützt gewesen. Stattdessen klemmte ich jetzt die Daumen in die Träger meines Rucksacks und schaute mich um, wobei ich so zu tun versuchte, als hielte ich nach jemandem Ausschau. Obwohl es sich um ein Willkommensfrühstück handelte, war es, so begriff ich, keine Veranstaltung, bei der man die Neuzugänge begrüßt und sich einander vorgestellt hätte. Ich sah, wie vertraut sich die Sommerprogramm-Leute unterhielten, und so wurde mir bewusst, dass sie sich während der letzten vier Jahre bereits kennengelernt hatten: auf Symposien und bei Vorträgen, denen sich Dinnerpartys und spätnächtliche Gespräche mit viel Alkohol angeschlossen hatten. Ich pirschte mich unauffällig an eine Gruppe heran, um wenigstens dem Austausch folgen zu können.
»Ich bin in L. A. aufgewachsen«, berichtete eine Frau. »Das ist gar nicht so, wie sich die Leute das immer vorstellen. Alle denken, da gibt’s nur Promis und Saftkuren und so. Aber wir haben eine richtige Kunstszene. Und die erlebt im Moment eine Blütezeit.«
Die Leute um sie herum nickten. »Jedenfalls habe ich letzten Sommer in der Gagosian in Beverly Hills gearbeitet, und da haben sowohl Jenny Saville als auch Richard Prince Vorträge über ihre Arbeit gehalten. Aber bei uns gibt’s nicht nur große Galerien«, fuhr sie fort und trank einen Schluck aus einem mundgeblasenen Glas.
Ich nutzte die Pause, um mit einer Schulter in den Kreis zu kommen, und bemerkte dankbar, dass die junge Frau links von mir einen Schritt zurücktrat.
»Wir haben auch öffentlich zugängliche Experimentierflächen und andere Angebote. Eine Freundin von mir betreibt sogar ein Kombiprojekt für Essen und zeitgenössische Kunst. Active Cultures heißt es.«
Jetzt konnte ich das Namensschild der Sprecherin lesen: Stephanie Pearce, Zeitgenössische Malerei.
»Als ich letzten Sommer in Marfa war …«, begann jemand aus der Gruppe. Doch der Satz blieb unvollendet, weil Stephanie Pearce ihre Aufmerksamkeit dem Eingang zuwandte. Dort sah man Patrick bei einem vertrauten Gespräch mit einer jungen Frau mit so weißblondem Haar, dass die Farbe nur ihre natürliche sein konnte. Quer durch den Raum schaute sie mich direkt an, schob sich dann eine Haarsträhne hinters Ohr und flüsterte Patrick etwas zu. Seine Antwort brachte sie zum Lachen, und die Art und Weise, wie ihr Körper dabei erbebte, wie alle scharfen Konturen etwas Weiches bekamen, ließen mich nur zu sehr meines eigenen Körpers bewusst werden.
Früher hatte ich mir immer wieder vorgestellt, wie es wäre, so schön zu sein. Das tun alle Frauen, glaube ich. Aber bei mir wuchs einfach nie so etwas wie ein Busen, und mein Gesicht holte meine Nase nie ein. Meine dunklen Locken waren eher unpraktisch wild als romantisch, und die Sommer unter der Sonne Ost-Washingtons hatten die Sommersprossen, die sich unregelmäßig über mein Gesicht und meine Arme erstreckten, sehr dunkel werden lassen. Das Attraktivste an mir waren meine großen, weit auseinanderstehenden Augen, aber die konnten die sonstige Unscheinbarkeit nicht wettmachen.
»Ist das Rachel Mondray?«, wollte die Frau neben mir wissen. Stephanie Pearce und einige andere in der Gruppe nickten.
»Ich habe sie bei meinem Schnupperwochenende in Yale kennengelernt«, sagte Stephanie. »Sie hat gerade ihren Abschluss gemacht, ist aber schon fast ein Jahr im The Cloisters. Letzten Sommer hat sie in Italien an der Sammlung Carrozza gearbeitet.«
»Wirklich?«, fragte jemand aus der Gruppe.
Die Sammlung Carrozza war ein Privatarchiv und Museum in der Nähe des Comer Sees, zugänglich nur auf Einladung. Gerüchten zufolge befanden sich dort einige der kostbarsten Renaissancemanuskripte weltweit.
»Angeblich hat man ihr dort eine Vollzeitstelle nach dem Abschluss angeboten, aber sie hat abgelehnt.« Stephanie Pearce schaute mich an und fügte hinzu: »Weil sie nach Harvard wollte.«
Während Stephanie sprach, sah ich zu, wie sich Rachel durch den Raum bewegte. Natürlich hatte es auch am Whitman College reiche junge Frauen gegeben. Solche, deren Eltern Privatflugzeuge und Sommerhäuser im Sun Valley besaßen. Aber die hatte ich nie richtig gekannt, ich hatte nur gewusst, dass es sie gab – ich kannte Gerüchte über unerreichbare Leben, die ich mir nicht vorzustellen wagte. Rachel brauchte keine Einladung in unseren Kreis, sie tauchte einfach auf, ganz natürlich.
»Ich habe dich ja seit dem Frühling nicht mehr gesehen, Steph«, begann Rachel, während sie sich in der Runde umschaute. »Wie hast du dich denn entschieden?«
»Letzten Endes für Yale.«
»Dort wird es dir sehr gefallen«, verkündete Rachel mit einer solchen Herzlichkeit, dass man den Eindruck bekam, sie meine es wirklich.
»Ich gehe an die Columbia«, flüsterte die junge Frau neben mir.
Ich konnte nicht anders, ich beneidete die Leute um mich herum. Ihre Zukunftsaussichten – wenigstens für die nächsten paar Jahre – waren durch elitäre Graduiertenprogramme abgesichert. Ganz kurz machte ich mir Sorgen, jemand könnte mich zu meinen Plänen für das kommende Jahr befragen, aber die interessierten ganz eindeutig niemanden. Das löste in mir sowohl Dankbarkeit als auch Scham aus.
»Ann«, fuhr Rachel mit einem Blick auf mein Namensschild fort. »Patrick hat mir gesagt, dass wir diesen Sommer zusammenarbeiten werden.« Sie trat aus dem Kreis und umarmte mich. Nicht lasch, sondern ganz fest, sodass ich spüren konnte, wie weich sie war, ihren Zitronenduft roch, mit ein wenig Bergamotte und schwarzem Tee. Sie fühlte sich kühl an, und wieder bemerkte ich nur zu deutlich den Schweiß an meinem Körper, den groben Stoff meiner Kleidung. Als ich mich zurückzuziehen versuchte, hielt mich Rachel fest – so lange, dass ich mir Sorgen machte, sie könnte womöglich die Anspannung fühlen, die mir heiß und schmierig auf der Haut klebte.
Alle im Kreis nahmen sehr deutlich wahr, was da vor sich ging, wie man etwa die Leistung eines Rennpferdes unter der Führung eines neuen Jockeys beurteilte.
»Da sind dann nur wir beide«, sagte sie und löste sich endlich von mir. »Sonst verschlägt es niemanden ins The Cloisters. Aber für eine Verbannung ist das ein angenehmer Ort.«
»Ich dachte, dein Gebiet wäre die Renaissance?«, fragte Stephanie und schaute zur Bestätigung auf mein Namensschild.
»Stimmt, und genau die brauchen wir«, gab Rachel zurück. »Deswegen hat Patrick auch sofort dafür gesorgt, dass wir uns Ann schnappen. Wir haben sie euch allen am Met geklaut.«
Ich war dankbar, meine Situation nicht näher erklären zu müssen.
»Also, komm mit«, forderte mich Rachel auf, und dabei kniff sie mich in den Arm. »Wir sollten los.«
Ich hielt schützend eine Hand über die Stelle, und trotz der Hitze und des Schmerzes, die sich den Weg zu meinem Schlüsselbein bahnten, merkte ich überrascht, dass ich das alles genoss – die Aufmerksamkeit, die Berührung, die Tatsache, dass ich meine Zeit nicht hier mit Stephanie Pearce verbringen würde. Und all das, weil ich mich dafür entschieden hatte, einen Augenblick länger in Michelle de Fortes Büro zu sitzen, gerade lange genug, damit Patrick vorbeikommen und anklopfen konnte.
3. Kapitel
Wie es war, an diesem Junitag in The Cloisters anzukommen, werde ich wohl nie vergessen. Hinter uns erstreckte sich die verstopfte Museumsmeile, jener Teil der Fifth Avenue, der vor Touristengruppen und wartenden Taxis, Sommercamp-Kindern und Erstbesuchern nur so überquoll, weil alle fasziniert die Fassaden von Frick, Met und Guggenheim betrachteten. Vor uns lag das Grün des Fort Tyron Parks am nördlichen Stadtrand. Als das Museum in unserem Blickfeld erschien, musste ich aufpassen, nicht in Rachels Schoß zu landen, weil ich mich im Auto auf die andere Seite lehnte, um alles besser erkennen zu können. Nie wäre mir die Idee gekommen, Gelassenheit vorzutäuschen. Hier wirkte es so, als hätten wir die Stadt ganz und gar hinter uns gelassen, eine nicht beschilderte Ausfahrt genommen und plötzlich ein buntes Netzwerk daunenweicher Ahornblätter erreicht. Die Straße zu The Cloisters wand sich einen sanften Hügel hinauf, und eine graue Steinmauer, bewachsen mit Moos und Efeu, kam in Sicht. Sie verlief zwischen großzügig verteilten Bäumen. Ein rechteckiger Glockenturm mit schlanken romanischen Fenstern ragte über das Laubdach hinaus. Ich war nie in Europa gewesen, aber so stellte ich es mir ungefähr vor: schattig, mit gepflasterten Wegen und mittelalterlicher Atmosphäre. Dieser Ort gehörte zu denen, die einen daran erinnerten, wie vergänglich der menschliche Körper war, und wie vergleichsweise unvergänglich Stein.
Das Museum The Cloisters, das wusste ich, war wie so vieles andere eine Schöpfung von John D. Rockefeller Jr. gewesen. Der Sohn des Räuberbarons hatte eine Fläche von siebenundzwanzig Hektar und eine kleine Sammlung mittelalterlicher Kunstwerke in ein bis ins letzte Detail realisiertes mittelalterliches Mönchskloster verwandelt. Die bröckelnden Überbleibsel aus Abteien und Klöstern des zehnten bis zwölften Jahrhunderts hatte man in den Dreißigerjahren aus Europa geholt und unter dem aufmerksamen Blick des Architekten Charles Collens wieder zusammengefügt. Gebäude, die dem Wüten von Naturelementen und Kriegen ausgesetzt gewesen waren, hatte man erneut zusammengesetzt und poliert, ganze Kapellen restauriert, Bruchsteinkolonnaden ihren ursprünglichen Glanz zurückgegeben.
Ich folgte Patrick und Rachel einen gepflasterten Pfad hinauf, der sich um die Rückseite des Museums wand. Dann erreichten wir einen natürlich entstandenen Torbogen aus sich neigenden Ilexbüschen, deren Stachelblätter und dunkelrote Beeren sich in meinem Haar verfingen. Wie in einem richtigen Kreuzgang herrschte hier abgesehen vom Klang unserer Schritte völlige Stille. Wir gingen weiter, bis wir die Mauer erreichten, wo uns ein großes schwarzes Metalltor in einem steinernen Torbogen Einhalt gebot. Fast erwartete ich, uns würde ein bewaffneter Wächter aus dem dreizehnten Jahrhundert entgegentreten.
»Keine Sorge«, erklärte Patrick. »Das Tor ist dafür da, dass keine Leute reinkommen. Nicht, um uns einzuschließen.«
Auf den groben Steinblöcken, die die Fassade des Gebäudes bildeten, konnte ich ganz schwach erkennen, wo man sie bearbeitet hatte. Kerben, die von der Schärfe der Bronzeschneide einer Haue erzählten. Patrick zog eine Schlüsselkarte hervor und fuhr damit über eine dünne graue Plastikplatte, so vollkommen im Stein verborgen, dass ich sie nicht bemerkt hatte. Außerdem gab es in der großen eine kleine Tür mit Bogen, die Rachel aufschwingen ließ. Um den dahinterliegenden Raum zu betreten, mussten wir uns ducken.
»Normalerweise geht man vorn rein, aber das hier macht mehr Spaß«, erklärte Patrick hinter mir. »Mit der Zeit werden Sie hier weitere Geheimgänge und interessante Ecken entdecken.«
Auf der anderen Seite befand sich ein begrünter Innenhof mit zierlichen Sträuchern silbrigen Salbeis, der vor rosafarbenen und weißen Blüten regelrecht überquoll. Es handelte sich um eine der Grünflächen innerhalb eines der Kreuzgänge, denen das Museum seinen Namen verdankte. Uns umgab eine Stille, die sogar die Insekten zu respektieren schienen, und man hörte nichts als ein leises Summen und hin und wieder das Geräusch von Schuhsohlen auf den Kalksteinböden. Ich wollte innehalten und den Anblick der Pflanzen in mich aufnehmen, die da aus den Töpfen und Beeten sprossen, die Hand ausstrecken und die steinernen Mauern berühren, die den Hof ringförmig umgaben, mich mit den Fingern davon überzeugen, dass diese Welt, die mir wie ein Traum erschien, wirklich existierte. Ich sehnte mich danach, die Augen zu schließen und die Mischung aus Lavendel und Thymian einzuatmen, bis sie den Geruch von Michelle de Fortes Büro ganz und gar überlagerte, doch Rachel und Patrick strebten voran.
»Üblicherweise wurde jeder quadratisch angelegte mittelalterliche Garten, der wie dieser von Fußwegen umgeben ist, als Kreuzgang bezeichnet«, erklärte Rachel. »Das hier ist der Cuxa-Kreuzgang, so benannt nach der Benediktinerabtei Saint-Michel-de-Cuxa in den Pyrenäen. Der Grundriss des Gartens wurde ursprünglich im Jahr 878 entwickelt, und bei der Planung des Kreuzgangs haben die Bauherren in New York die ursprüngliche Nordachse wiederverwendet. Hier gibt es noch drei weitere solcher Gärten.«
Der Laufweg wurde von Säulen flankiert, jede mit Kapitellen, die ihre Flügel entfaltende Adler, Löwen kurz vor dem Sprung, sogar eine ihren eigenen Schwanz festhaltende Meerjungfrau zeigten. Zwischen den Säulen gab es Bogenrahmen mit Palmetten und Steinfachwerk. Und trotz der vielen Bilder von mittelalterlichen Kathedralen, die ich kannte, war ich nicht auf die überwältigenden Dimensionen von The Cloisters vorbereitet, darauf, wie detailliert alles gemeißelt war, wie viele in Stein gehauene und gemalte Augen meinen Blick erwiderten, wie der Stein für Kühle im Garten sorgte. Eine Umgebung, die mir immer wieder Überraschungen bereiten würde, egal wie vertraut ich irgendwann mit ihr wäre.
Ich folgte Rachel und Patrick durch eine Tür am Ende des Kreuzgangs in das eigentliche Museum. Der Raum war eine aufregende mittelalterliche Welt in Miniaturausgabe: Holzbalken aus dem dreizehnten Jahrhundert liefen unter der Decke entlang, in den Wänden befanden sich riesige Buntglasfenster. Es gab Vitrinen voller Goldschmiedearbeiten mit glitzernden Edelsteinen – blutroten Rubinen und Saphiren so dunkel wie ein mondloses Meer. Eine Emaille-Miniatur fiel mir ins Auge – trotz ihres Alters in lebendigen Farben, und während ich sie eingehend betrachtete, tippte ich mit den Fingerspitzen an das Glas. Hier waren sie, die Objekte, so klein in der Ausführung, von denen ich immer geglaubt hatte, der Umgang mit ihnen würde mich größer machen.
»Komm weiter«, forderte mich Rachel auf. Sie wartete bei einigen Stufen auf mich. Patrick war schon nicht mehr zu sehen.
Es war unmöglich, sich von dieser Schatzkammer nicht überwältigt zu fühlen. Anders als im Metropolitan Museum of Art konnte man den Blick nirgends ausruhen. Hier stellte der gesamte Raum das Werk dar. Ich war dankbar, als ich feststellte, dass uns die Stufen nach unten ins Foyer und zum Haupteingang führten. Hier bekamen Besucher Lagepläne und Audio-Geräte, mit denen sie erfahren konnten, welche Räume die bekanntesten Werke beherbergten. New Yorker hatten zu The Cloisters wie zum Met kostenlos Zugang.
»Moira«, rief Patrick und ging auf eine Frau zu, an deren Schläfen sich einzelne fedrige graue Haare in die schwarzen mischten. »Das ist Ann. Sie wird diesen Sommer bei uns arbeiten.«
»Ich muss Ihnen mitteilen«, verkündete Moira, die hinter dem Informationsschalter hervorkam, »dass Leo wieder im Schuppen geraucht hat. Das konnte ich riechen. Und wenn ich es riechen konnte, konnten es die Besucher auch, da bin ich sicher. Er ist übrigens noch nicht weg. Rauchen darf man hier nicht. Das ist schon das vierte Mal diesen Monat.«
Patrick wischte Moiras Besorgnis mit der Professionalität von jemandem weg, der es gewohnt ist, in einer Institution Frieden zu schaffen. »Ann, das hier ist Moira, unsere Managerin an der Rezeption.«
»Außerdem die Koordinatorin des Dozentenprogramms«, fügte Moira hinzu und würdigte mich dabei keines Blickes, sondern wandte ihre Aufmerksamkeit wieder Patrick zu.
»Sie leistet ganz ausgezeichnete Arbeit«, verkündete der.
Moira legte Patrick eine Hand auf den Arm. »Ich habe mir überlegt, wir könnten ja Rauchmelder im Gärtnerbereich anbringen. Dann wird vielleicht …«
»So ist sie immer«, erklärte mir Rachel und lehnte sich näher zu mir, um mir ins Ohr flüstern zu können. »Wenn du zu spät kommst, wird sie das auf die Minute genau mitbekommen, darüber musst du dir im Klaren sein.«
Dieser verschwörerische Austausch fühlte sich gut an, auch wenn er nur einen Augenblick dauerte. Ich spürte Rachels heißen Atem am Hals, und die Worte, die nur wir beide hören konnten, brannten dort förmlich.
»Moira«, sagte Patrick. »Wir sind gerade auf dem Weg zum Sicherheitsdienst. Ich wollte Ihnen nur schnell Ann vorstellen. Meinen Sie, wir könnten …«
»Später darüber sprechen?«
Patrick gab nach. »Ich werde dafür sorgen, dass jemand mit Leo redet.«
»Das sollten Sie tun.«
Wir gingen durch eine unscheinbare Metalltür weiter zum Sicherheitsdienst, und dort ließ uns Patrick schließlich allein. Vorher jedoch bedachte er mich mit einem entschuldigenden Lächeln und einem Zwinkern. Einen Augenblick lang bildete ich mir ein, ich hätte gesehen, wie er Rachel in einer vertraulichen Geste berührte, doch das geschah so schnell – wie schon der ganze Vormittag, unsere Ankunft hier, unser Weg durch die Galerien –, dass ich mir nicht sicher sein konnte. Ich hatte keine Zeit zu lächeln, als mein Foto gemacht wurde. Man erstellte eine Schlüsselkarte für mich, und Rachel führte mich über den Flur, tiefer in den Bürotrakt hinein.
»Du kommst, oder?«, rief sie über die Schulter, während ich immer noch mit meiner Schlüsselkarte kämpfte und sie an meinen Rock zu heften versuchte. Dann gab ich mir Mühe, Rachel nicht hinterherzurennen.
Die Büroräume gingen von einem Labyrinth aus Steinfluren und gotischen Türen ab, schwach erleuchtet durch Wandlampen, die sich ein wenig zu weit voneinander entfernt befanden, sodass dunkle Lücken entstanden. Rachel stellte mich dem museumspädagogischen Dienst vor, wo bleiverglaste Fenster mit Ausblick auf den Hudson River halb offen standen. Von dort aus zeigte sie mir die Personalküche, überraschend modern und voller europäischer Geräte aus Edelstahl.
Als Nächstes kam der Raum der Konservatoren, wo ein Team in Kitteln und weißen Handschuhen in den langwierigen Prozess vertieft war, den Belag von Jahrhunderten von einem Gemälde zu entfernen. Den filigranen Goldrahmen hatte man abgenommen und beiseitegestellt. Dann gab es einen Raum mit Neonröhren und Schubladen zur Lagerung – für Neuanschaffungen, erklärte mir Rachel –, wo Tausende kleinerer Kunstwerke untergebracht waren wie naturwissenschaftliche Exponate: das Magazin. Ich merkte mir so viel, wie ich konnte: Gesichter, die Zahl der Türen zwischen Küche und dem museumspädagogischen Dienst, die nächste Toilette. Und dann, endlich, als wir schon wieder den Weg in Richtung Foyer eingeschlagen hatten, führte mich Rachel in einen weiteren Raum voller verschiebbarer Archivregale, alle fest geschlossen, mit Kurbelrädern, die nur darauf warteten, in Bewegung zu kommen.
»Von hier aus kommt man durch eine Hintertür in die Bibliothek. Dort arbeiten wir, aber sie gehört nicht zu den Büros.«
Wir gingen durch die Regalwand, und die Gummisohlen meiner Schuhe quietschten auf dem Terrazzoboden. Rachel lehnte sich gegen eine schwere Holztür, die in die Bibliothek führte, einen langen, niedrigen Raum mit Rippengewölben, die über riesigen Eichentischen und Stühlen mit grünen Lederpolstern und großen Messingnieten ihre Struktur entfalteten. Eine Bibliothek, wie sie in ein luxuriöses Landhaus gehört hätte. Mit Buntglasfenstern und Wänden mit sorgfältig eingebundenen Büchern; manche Titel hatte man handschriftlich auf den Stoffeinbänden vermerkt.
»Ganz da hinten ist Patricks Büro.« Rachel deutete auf eine mit geschwungenem Eisenwerk verzierte Holztür: zwei Hirsche, die Geweihe im Kampf ineinander verkeilt. »Aber du und ich, wir arbeiten hier, in der Bibliothek. Hier in The Cloisters gibt es nicht genug Büroräume für alle.«
Während ich mich im Raum umsah, schien es mir unvorstellbar, zwischen den vier weißen Wänden eines normalen Büros zu arbeiten, wenn doch das hier möglich war. Jahrelang hatte ich mich immer wieder den Bildern zugewandt, nicht nur denen von Gemälden, sondern von Archiven – schwach beleuchteten Räumen voller Bücher und Dokumente, mit der konkreten Geschichte, die ich unbedingt in den Händen halten, mit eigenen Augen sehen wollte. Und jetzt stand ich mitten in der Bibliothek von The Cloisters. Gut, es gab keine seltenen Manuskripte – auch wenn viele hier ausgestellt waren und noch viele mehr bei den Neuanschaffungen lagen. Aber es war ein Ort voller Erstausgaben und seltener Buchtitel, und man zollte den Toten genauso großen Respekt wie ich. Was das betraf, fühlte es sich für mich an wie ein Zuhause.
Ich konnte spüren, dass mich Rachel dabei beobachtete, wie ich alles in mich aufnahm. Mir wäre die Nonchalance unmöglich gewesen, die sie während der ganzen Tour an den Tag gelegt hatte. Als wäre das alles hier – die Deckenbalken und das Leder – einfach nur normal. Unabdingbar. Ich zog einen Stuhl heran und stellte meine Tasche ab. »Möchtest du nicht die Sammlung sehen?«, erkundigte sich Rachel. »Das hier« – und bei diesen Worten erfasste sie mit einer Geste die Bibliothek – »ist nur der Arbeitsraum.«
Sie wartete meine Antwort nicht ab. Vielleicht konnte sie sie ja nur zu deutlich auf meinem Gesicht lesen. Stattdessen öffnete sie die Haupttüren der Bibliothek, sodass ich sofort vom Sonnenlicht geblendet wurde.
»Das hier ist der Trie-Kreuzgang«, verkündete Rachel.
Der Garten wurde von einem steinernen Kruzifix im Zentrum optisch zusammengehalten. Es war von einem Überfluss an Wildblumen umgeben, einige von ihnen so klein und unauffällig, dass sie ihren Weg durch die Ritzen im Fußpfad gefunden hatten, der den Garten umlief.
»Beim Anpflanzen hat man versucht, die Blumenteppiche nachzuahmen, die man von den Einhorn-Wandbehängen aus dem fünfzehnten Jahrhundert kennt«, erklärte Rachel. »Und ganz auf der anderen Seite gibt es ein Café. In ein paar Stunden kann man dort zu Mittag essen. Ganz großartigen Kaffee und gute Salate haben sie.«
»Bekommen Angestellte da Ermäßigung?«, fragte ich und bereute es sofort.
Rachel sah mich an, während wir uns auf eine weitere Tür zubewegten. »Natürlich.«
Ich erlaubte mir ein Ausatmen und merkte dabei, dass ich seit meiner Ankunft in The Cloisters Angst zu atmen gehabt hatte. Aus Sorge, die Leute könnten es sich anders überlegen, wenn ich zu viel Platz einnahm.
»Patrick hat mir erzählt, was bei Michelle passiert ist«, meinte Rachel und senkte dabei die Stimme, als wir einen Raum betraten, dessen hohe Decke eine ganze mittelalterliche Kapelle im Miniaturformat nachempfand. Die rot gesprenkelten Buntglasfenster warfen rosa Lichtflecke auf den sandfarbenen Boden. »Ich konnte es gar nicht glauben. Dich den ganzen Weg hierherzulocken – woher noch mal? Aus Portland?«
»Washington«, gab ich zurück und hoffte dabei, ich würde nicht rot werden, weil es mich so unglaublich verlegen machte, sie korrigieren zu müssen. Irgendetwas an Rachel ließ mich geradezu verzweifelt auf ihre Anerkennung hoffen: Hätte ich in diesem Moment dafür sorgen können, aus Portland zu kommen, dann hätte ich es getan. Vielleicht lag es daran, wie sie sich gab: Sie drängte immer nach vorn. Selbst als uns jemand bei den Restauratoren erklärt hatte, wir könnten jetzt den Raum nicht betreten, hatte Rachel nur die Schultern gezuckt. Sie hatte die Tür aufgehalten, damit ich alles sehen konnte – riesige Flaschen mit Terpentin und Leinöl.
»Eine Freundin von der Spence ist ans Reed gegangen. Sascha Sacharow.«
»Ich kenne niemanden am Reed. Das ist ziemlich weit weg vom Whitman.«
»Ah.«
Rachel schien durch ihren Fehler nicht in Verlegenheit gebracht, und ich fragte mich, wie es sich wohl anfühlte, sich einer Position so sicher zu sein, dass es nichts ausmachte, ob man zuhörte, wenn einen eine Kollegin korrigierte. Wir waren vor zwei in Wandnischen geschmiegten Steinsärgen stehen geblieben.
»Was ich noch sagen wollte«, setzte ich an und klang dabei vielleicht ein wenig zu atemlos, »ich bin zwar für die Arbeit in der Renaissanceabteilung gekommen, aber ich weiß ziemlich viel über das Mittelalter. Und wenn ich etwas nicht weiß, nehme ich mir die Zeit und lerne es.«
Ich wusste nicht, warum ich das unbedingt loswerden wollte. Rachel hatte mich nicht nach meinen Studienschwerpunkten gefragt, und an meinen Fähigkeiten hatte sie auch in keiner Weise gezweifelt.
Sie wischte meine Besorgnis weg. »Ich bin mir sicher, du wirst gut klarkommen.«
Ich schwieg in der Hoffnung, sie würde weitersprechen.
»Patrick stellt nicht einfach irgendjemanden ein.« Sie schaute mich an, zum ersten Mal, nahm in sich auf, was sie sah, registrierte meine Schuhe, meine Kleidung, meine Sommersprossen. »Er muss gewusst haben, dass es mit dir bei uns klappen würde.«
Während wir vor den Särgen standen, bewegten sich Besucher langsam durch den Raum und lasen die Wandtafeln.
»Bist du zum ersten Mal in New York?«, erkundigte sich Rachel, und dabei trafen sich unsere Blicke.
»Ja.« Auch wenn ich mir in diesem Augenblick wünschte, das wäre nicht der Fall.
»Wirklich?«, fragte sie mit verschränkten Armen. »Und was ist dein erster Eindruck?«
»Ich weiß nicht, ob ich für einen ersten Eindruck schon genug gesehen habe. Ich bin erst seit drei Tagen hier.« Den ersten hatte ich damit verbracht, meine Sachen auszupacken und irgendeinen klebrigen Belag von Geschirr und Kochtöpfen in meiner Mietwohnung zu schrubben. Am nächsten hatte ich mir den Weg zur Arbeit eingeprägt, den ich nie wieder brauchen würde: mit der U-Bahn bis zur Haltestelle Eighty-First Street und dann zu Fuß durch den Central Park. Obwohl Manhattan für seine riesigen Betongebäude und gläsernen Wolkenkratzer bekannt war, hatte ich die meiste Zeit in üppigen Grünanlagen verbracht.
»Du musst doch aber vorher bestimmte Vorstellungen gehabt haben.«
»Ja, schon …« Die besorgten Einwände meiner Mutter spulten sich in meinem Kopf ab: Die Stadt sei so groß, so unpersönlich. Ich würde dort nicht zurechtkommen.
»Und entspricht New York diesen Vorstellungen?«
»Ehrlich gesagt gar nicht.«
»Das ist typisch für diese Stadt. Sie ist beides: alles, was man sich vorgestellt hat, und gleichzeitig völlig anders als das Erwartete. Sie kann einem die Welt zu Füßen legen oder sie einem ganz plötzlich wegnehmen.« Rachel lächelte mich an, warf einen Blick auf meine Schuhe, die seit unserer Ankunft über die Böden quietschten. Dann ging sie in den nächsten Raum und bedeutete mir, ihr zu folgen.
»Was ist denn dein Eindruck?«, fragte ich, um das Gespräch in Gang zu halten.
»Ich bin hier aufgewachsen.«
»Oh, das wusste ich nicht.«
»Schon okay. Ich hatte doch die Spence erwähnt? Da dachte ich, du würdest zwei und zwei zusammenzählen.«
»Ich weiß nicht, was das ist, die Spence.«
»Das ist wahrscheinlich auch besser so«, gab Rachel lachend zurück. »Wir haben alle eine komplizierte Beziehung zu unserer Geburtsstadt.«
Inzwischen hatten wir einen Raum mit einer Glasvitrine voller Emaille-Miniaturen betreten. Glänzende Darstellungen von Jona, der vom Wal verschluckt wurde. Von Eva, die in einen rot glänzenden Apfel biss. Kleine Meisterwerke, über achthundert Jahre alt.
Rachel winkte dem Wachmann zu, der sich zu seiner nächsten Station bewegte. »Wann fängt denn Matteos Sommercamp an, Louis?«, rief sie ihm nach.
Er blieb kurz vor seinem Ziel stehen. »Nächste Woche. Bis dahin treibt er seine Mutter in den Wahnsinn, fürchte ich. Danke noch mal, dass du letzten Samstag auf ihn aufgepasst hast.«
Rachel winkte ab. »Wir sind doch nur im Park spazieren gegangen. Bei den Booten waren wir ziemlich lange.«
Ich versuchte, mir Rachel beim Babysitten vorzustellen, aber es gelang mir nicht.
»Diese Boote findet er ganz toll«, meinte Louis.
»Ich auch«, gab Rachel zurück. »Louis, das ist übrigens Ann. Sie wird den Sommer hier verbringen. Louis ist der Chef des Sicherheitsdienstes.«
Louis kam auf uns zu und streckte mir eine Hand entgegen. »Ich springe hier heute nur ein.«
Ich schüttelte ihm zur Begrüßung die Hand.
»Eine Station fehlt uns noch«, verkündete Rachel, umfasste mein Handgelenk und zog mich von Louis weg.
Sobald wir den Raum verlassen hatten, flüsterte sie mir ins Ohr: »Sein Sohn ist eine absolute Nervensäge. Ich habe mich nur zum Babysitten bereit erklärt, weil mich Louis Moira gegenüber deckt, wenn ich zu spät dran bin oder der Feueralarm losgeht, weil ich rauche.«
Wir bewegten uns durch eine weitere Galerie, in der sich bereits Besucher befanden. Sie sogen die kühlen, dunklen Räume in sich auf, in denen sich Darstellungen von fantastischen Ungeheuern mit denen von abgeschnittenen Fingern Heiliger mischten. Ich fühlte mich von diesen Objekten angezogen, von ihrer Fremdheit. Vor einem Reliquienschrein des heiligen Sebastian blieb ich stehen; es handelte sich um eine Statue, die seinen Torso darstellte, hautfarben und rot, die Seiten von Pfeilen durchbohrt. In einem kleinen verglasten Kästchen in der Mitte des Torsos konnte man den Knochen seines Handgelenks erkennen – oder zumindest einen menschlichen Handgelenksknochen.





























