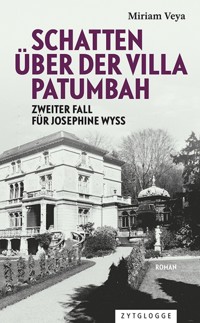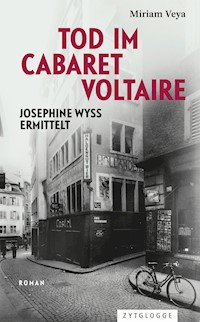
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zytglogge Verlag
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Zürich, im Oktober 1919: Die junge Witwe Josephine, deren soeben verstorbener Mann eine «Auskunftsstelle für vermisste Personen» betrieben hat, in dem auch sie tätig war, steht vor dem Nichts. Als sie am Abend nach der Beerdigung im verwaisten Büro überlegt, dieses aufzulösen, stürmt eine Frau herein und beauftragt sie mit der Suche nach ihrer verschwundenen Freundin. Diese ist Tänzerin im Cabaret Voltaire, der Wiege der DADA-Bewegung, wo auch die Auftraggeberin als Künstlerin arbeitet. Eigentlich will Josephine den Auftrag ablehnen. Doch dann wird die Künstlerin auf der Bühne des Kleintheaters von einem herabstürzenden Kulissenteil erschlagen, und Josephine glaubt als Einzige nicht an einen Unfall. Sie beginnt, auf eigene Faust zu ermitteln. Dabei bringt sie nicht nur sich selbst in Gefahr, sondern muss sich auch gegen alle Widerstände den Weg freikämpfen, als alleinstehende Frau ein unabhängiges Leben führen zu können.Die Autorin erzählt einen spannenden historischen Kriminalfall, der durch seinen aktuellen Bezug überrascht. Gleichzeitig zeichnet sie ein authentisches und atmosphärisch dichtes Bild des Lebens in Zürich vor hundert Jahren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 433
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Impressum
Titel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Nachwort der Autorin
Über die Autorin
Backcover
Miriam Veya
Tod im Cabaret Voltaire
Autorin und Verlag danken für die Unterstützung:
Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur miteinem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2024 unterstützt.
© 2023 Zytglogge Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel Alle Rechte vorbehalten Lektorat: Thomas Gierl Korrektorat: Anna Katharina MüllerCoverbild: Spiegelgasse 1, Stadt Zürich, Baugeschichtliches Archiv,Schweizerische Lichtbildanstalt
Miriam Veya
Tod im Cabaret Voltaire
Josephine Wyss ermittelt
Roman
1
Josephine blieb wie angewurzelt hinter der Tür stehen, die mit einem lauten Knall ins Schloss gefallen war. Aus dem Treppenhaus klang das Poltern der Männer, die den Sarg hinuntertrugen, und von der Straße drangen Gesprächsfetzen der wartenden Leute nach oben.
Sie fühlte sich verkleidet. Der ungewohnt lange Rock, dessen schwerer Stoff sie in den Boden zu ziehen schien, als ob er mit Wasser vollgesogen wäre, die hochgeschlossene Bluse mit den altmodischen Rüschen auf der Brust, das kratzige Jäckchen, alles in schwarz. Diese unmögliche Vorkriegsmode. Sie zog am Blusenkragen und versuchte, den Stoff etwas weicher zu machen. Warum musste er so eng sein? Auch die Stäbe des Korsetts schienen sich in ihre Rippen zu bohren, und die Hutnadel kratzte auf ihrer Kopfhaut. Sie seufzte und warf einen letzten prüfenden Blick in den Spiegel. So sollte es gehen.
Sie streifte die Handschuhe über und griff nach ihrer Tasche. Nach kurzem Zögern öffnete sie die oberste Schublade der Kommode, nahm ein zusätzliches Taschentuch heraus und stopfte es in ihre Jackentasche.
Neben ihr wartete Alma und sah mit erwartungsvollem Blick zu ihr hoch.
«Nein, heute darfst du nicht mitkommen», sagte Josephine und schob den Bobtail zur Seite, «Friedhöfe sind nichts für Hunde, da liegen viel zu viele Knochen herum.» Sie quälte sich zu einem Lächeln. Dass sie überhaupt fähig war, einen solchen Spruch zu machen.
Alma zog den Kopf ein.
«Ich weiß, du vermisst ihn auch», flüsterte Josephine, ließ sich auf ein Knie hinunter und drückte den Hund an sich.
Alma winselte leise.
In diesem Moment schrillte die Türklingel, und sie zuckten beide zusammen.
Josephine wischte sich die wässrigen Augen und streichelte Alma noch einmal über den Kopf. Dann erhob sie sich, zog ihren Mantel über und nahm den Schirm. In den letzten Tagen war es merklich kühler geworden, und ein beißender Herbstwind zog um die Häuser. Gestern hatte sie schrecklich gefroren. Auch heute hatten sich dunkle Wolken über Zürich zusammengeballt.
Sie atmete tief ein und öffnete die Tür zum Treppenhaus. Ihre Beine fühlten sich bleischwer an, als sie langsam die Stufen hinunterstieg. Sie öffnete die Haustür, und sofort verstummten die Gespräche, am liebsten wäre Josephine im Erdboden versunken. Gleich neben der Tür stand Klara, zuvorderst in der Menschenmenge. Sie war ebenfalls schwarz gekleidet, jedoch nach der neuesten Mode, mit wadenlangem Kleid, gesticktem Umhang und Glockenhut. In der Hand hielt sie einen kleinen Strauß weißer Nelken, den sie ihr in die Hand drückte. Dann umarmte sie sie und sagte leise:
«Wir schaffen das, Josy!»
Josephine lehnte für ein paar Sekunden ihren Kopf an die Schulter ihrer Freundin. Klaras Parfum stieg ihr in die Nase, und der Schleier an ihrem Hütchen kitzelte sie am Ohr. Könnte sie doch nur für immer so stehenbleiben, in dieser tröstenden Umarmung. Doch Klara schob sie sanft wieder von sich.
Einige Leute traten zu ihnen heran, Freds Familie, Freunde und Bekannte. Sie gaben ihr die Hand und murmelten ihr Beileid, manche umarmten sie. Josephine stand da, unfähig, etwas zu sagen oder sich zu bewegen.
Freds Mutter drückte sie fest an sich und Josephine spürte, wie der Körper der Arbeiterfrau zitterte. Über die Schulter von Freds Mutter sah sie dessen Vater. Er schien um Jahre gealtert, seit sie ihn vor einer Woche, als die Nachricht vom Unfall seines Sohnes eingetroffen war, gesehen hatte. Seine Stirn war in tiefe Falten gelegt, und er sah sie mit geröteten Augen an. Sie konnte die Verzweiflung in seinem Blick nicht ertragen und wandte sich rasch wieder Freds Mutter zu. Diese löste sich langsam aus ihrer Umarmung und strich ihr mit beiden Händen über die Oberarme. Sie wollte etwas sagen, schluchzte aber nur leise auf.
«Josy», sagte Klara und zupfte Josephine am Ärmel, «wir sollten los.»
Klara führte sie zum Pferdewagen, auf den die Träger den geschlossenen Sarg gehoben hatten. Josephine ließ sich mitziehen und versuchte, auf dem groben Kopfsteinpflaster nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Hätte sie doch wenigstens bequeme Schuhe an und nicht diese Damenschühchen mit den Absätzen.
Die Menschengruppe, die die Straße über eine halbe Häuserzeile entlang blockiert hatte, setzte sich langsam in Bewegung. Alle waren gekommen, Fred hatte viele Leute gekannt, war überall beliebt gewesen und geschätzt worden. Josephine freute sich darüber und gleichzeitig machte es sie noch trauriger. Die meisten kannte sie, doch es waren auch einige dabei, von denen sie nicht wusste, wer sie waren.
Aus den Augenwinkeln sah sie einen Mann, der etwas abseits der Gruppe ging. Er überragte die anderen Menschen um einiges, obwohl er den Kopf gesenkt hielt. Er kam Josephine bekannt vor, doch sie wusste nicht, woher. Jetzt sah er auf, und ihre Blicke begegneten sich. Seine struppigen Haare und die Grübchen in seinen Wangen verliehen ihm trotz seiner Größe ein jungenhaftes Aussehen. Sie senkte rasch den Blick.
Bei der Schmiede Wiedikon drängte sich der Trauerzug zwischen Straßenbahnen und Autos hindurch auf die andere Straßenseite und bewegte sich dann auf der Aemtlerstraße Richtung Friedhof Sihlfeld.
Der Hufschlag der Pferde, das Rattern der Holzräder und das gelegentliche Murmeln der Menge plätscherten als Hintergrundgeräusch zu ihren Gedanken.
Nun war es also so weit. Ihr Ehemann wurde begraben.
Schon von Weitem sah Josephine die zwei schwarz gekleideten Gestalten vor dem schmiedeeisernen Friedhofstor stehen. Ihre Eltern. Der Kragen ihrer Bluse wurde noch enger.
«Deine Eltern», sagte Klara leise und drückte Josephine, «auch das noch.»
«Ich habe schon gedacht, dass sie kommen werden», antwortete sie ebenso leise.
«Hast du sie benachrichtigt?»
«Ja, ich habe ihnen eine Karte geschickt. Anrufen mochte ich nicht. Ich hätte gar nicht gewusst, was sagen. ‹Hallo, wie geht es euch? Mein Mann ist gerade gestorben.› Nach zehn Jahren, in denen wir nicht miteinander gesprochen haben. Unmöglich.»
Klara nickte zustimmend.
«Nun muss ich also heute nicht nur meinen Mann beerdigen, sondern auch noch meinen Eltern gegenübertreten.»
«Denken sie wohl immer noch, dass Fred dich ihnen damals weggenommen hat?»
«Wenn ich das wüsste.»
Die Spitze des Trauerzugs war jetzt am Eingang des Friedhofs angekommen, und der Pferdewagen stoppte. Weit und breit war kein Pfarrer in Sicht, der hätte sie hier doch in Empfang nehmen sollen.
Josephine blieb also nichts anderes übrig, als zu ihren Eltern zu gehen, die wie angewurzelt beim Tor stehen geblieben waren.
«He, du drückst mir ja das Blut ab», beschwerte sich Klara.
Sie löste Josephines Hand von ihrem Arm und schob sie nach vorne.
«Guten Morgen», sagte Josephine und streckte ihrer Mutter die Hand hin.
Diese schaute sie prüfend von oben bis unten an und ergriff ihre Hand dann mit festem Griff.
«Guten Tag, Josephine. Unser herzliches Beileid.»
«Danke», antwortete sie und zog ihre Hand zurück.
«Ja, unser herzliches Beileid», wiederholte ihr Vater und nickte ihr förmlich zu.
Wie immer sahen ihre Eltern wie aus dem Ei gepellt aus. Altmodisch zwar, aber sehr elegant und gepflegt. Ihr Vater trug einen maßgeschneiderten schwarzen Anzug mit Weste, goldenen Manschettenknöpfen, blütenweißem Kragen und schwarzer Fliege. Sein Schnauz war perfekt gestutzt, und auf seinem Kopf thronte ein Zylinder. An seinen Füßen glänzten frisch polierte schwarze Schuhe.
Auch die Schnallenschuhe, die unter dem langen Rock ihrer Mutter hervorblitzten, waren makellos, die Oberflächen ohne einen Kratzer oder Fleck. Die Stoffe ihrer Kleidung waren von höchster Qualität, und jedes Detail war aufeinander abgestimmt, der Schmuck teuer und geschmackvoll. Auf ihren perfekt eingedrehten und hochgesteckten Haaren trug sie einen großen Hut mit breiter Krempe, der ihr trotz der etwas veralteten Form ein mondänes Aussehen verlieh.
Ihr Vater räusperte sich. «Wenn wir etwas helfen können ...»
«Dieser Sarg», unterbrach ihn Josephines Mutter, «der sieht nicht sehr ... wie soll ich es ausdrücken ... professionell hergestellt aus. Geschweige denn stabil. Wer hat ihn gezimmert?»
«Louise», warf ihr Vater ein, «das geht uns doch nichts an.»
Ihre Mutter schaute ihn mit hochgezogenen Augenbrauen an. «Man darf doch wohl noch fragen?» Ihr Vater zog es anscheinend vor, nichts mehr zu sagen, und auch Josephine ließ die Frage unbeantwortet.
«Meine Liebe, du verstehst, dass wir nicht mit dem Trauerzug mitlaufen konnten», wechselte ihre Mutter das Thema, «das, nun, das hätte sich nicht geziemt.»
«Natürlich nicht. Es hätte ja jemand denken können, dass ihr Bekannte aus dem Arbeitermilieu habt.»
Ihre Mutter sah sie nun ebenfalls entrüstet an und schüttelte missbilligend den Kopf, sodass ihr Hut hin und her schwankte. «Wie auch immer», bemühte sie sich um Fassung, «deine Schwester und Emil sollten auch gleich eintreffen. Und wo bleibt eigentlich der Pfarrer? Sollte der nicht schon lange hier sein? Heinrich, ich bitte dich, frag doch einmal nach.»
«Louise, es ist doch bestimmt nicht an uns, nach dem Pfarrer zu fragen.»
«Mama, er wird sicher gleich hier sein.»
In dem Moment spürte Josephine, dass sich hinter ihr etwas bewegte. Sie drehte sich um und sah Freds Eltern, die schüchtern näherkamen. Anscheinend wollten sie sich ihren Eltern vorstellen lassen. Sie lächelte das Ehepaar Wyss an und sagte dann:
«Mama, Papa, das sind Herr und Frau Wyss, Freds Eltern. Und das sind meine Eltern, Herr und Frau Vonarburg.»
Louise Vonarburg lächelte säuerlich und Heinrich Vonarburg tippte sich an den Hut. Die ausgestreckten Hände von Freds Eltern ignorierten sie. Diese blieben unentschlossen stehen und Freds Vater zog den Kopf ein wie ein geschlagener Hund.
Josephine reichte es. Es war ja das Eine, wenn ihre Eltern sonst alles kritisierten, aber sich den Eltern ihres Mannes gegenüber so herablassend zu benehmen, ging zu weit. Vor allem an diesem Tag.
Sie hakte Herrn und Frau Wyss unter und zog sie weg von ihren Eltern.
«Es tut mir leid», flüsterte sie.
«Da sind Charlotte und Emil», rief Klara.
Josephines Schwester und ihr Mann kamen über die Straße, auch sie sehr elegant gekleidet. Ihre ältere Schwester umarmte sie und Emil drückte ihr die Hand. Sie entschuldigten sich für die Verspätung und erklärten, dass sie die Kinder nicht hatten mitnehmen wollen und diese dann aber prompt kurz vor ihrer Abfahrt einen ungeheuerlichen Tumult veranstaltet hätten.
Auch Vonarburgs kamen nun heran und begrüßten Charlotte und Emil herzlich, dann herrschte Stille. Josephine kam es vor wie eine Ewigkeit.
Endlich trat der Pfarrer aus dem Steingebäude auf der linken Seite und erlöste sie.
Der Pfarrer führte Josephine hinter dem Pferdewagen durch das Tor und ging dann neben ihr die breite Kastanienallee hoch. Dicht hinter ihnen folgten Freds Eltern und Klara, danach die restliche Trauergemeinde. Ihre Schritte knirschten auf dem Kies, niemand sprach mehr. Am Ende der Allee thronte das Krematorium, ein imposanter Bau mit großem Portal, Säulengang, Steinfiguren und Eckpavillons. Normalerweise hätte sich Josephine an der außergewöhnlichen Architektur erfreut, doch heute sah sie das Gebäude nur wie durch einen Schleier. Vor dem Empfangshof mit dem Wasserbecken berührte der Pfarrer sie behutsam am Arm und zeigte nach links.
«Hier durch, bitte», sagte er, und mechanisch bog Josephine auf den kleinen Weg ab. An dessen Ende konnte sie in der Grabreihe, die ihnen am nächsten war, eine dunkle Grube erkennen. Am Erdhaufen daneben lehnte ein schlichtes Holzkreuz. Genau darauf führte sie der Pfarrer zu. Die Männer luden den Sarg vom Wagen und stellten ihn neben die Grube. Der Pfarrer bedeutete Josephine, näher heranzutreten. Die anderen Leute rückten nach und versammelten sich rund um das Grab von Alfred Wyss.
Der Pfarrer begann zu erzählen, von Gott, den Menschen, von Fred, nur allgemeine, unpersönliche Dinge, er hatte ihn nicht gekannt. Josephines Gedanken schweiften ab zu Fred, als er noch lebte und nicht in dieser Holzkiste lag. Seine Augen, seine Hände, seine Fröhlichkeit, sein lautes Lachen. Damit hatte er einen ganzen Raum füllen und alle anwesenden Leute anstecken können. Das war es auch gewesen, was sie vom ersten Augenblick an in ihren Bann gezogen hatte. Seine charismatische Art, der kaum jemand hatte widerstehen können. Seine Begeisterung für die kleinen Dinge, aber auch für die großen, für Gerechtigkeit, für Frieden, für Freiheit. Wie er sich hatte einsetzen können für andere, wie er gekämpft hatte für Menschen, denen es weniger gut ging als ihm. Und trotzdem war er immer optimistisch geblieben, hatte viel und gerne gelacht, auch über sich selbst. Sie lächelte bei der Erinnerung daran und senkte rasch den Blick. Hoffentlich hatte es niemand gesehen. Was würden die Leute denken, wenn die Witwe am Grab lächelte?
Sie bemühte sich um eine ernste Miene und hob vorsichtig den Kopf. Ihr Blick fiel erneut auf den großen Mann, der jetzt rechts vom Sarg am Rand der Menschengruppe stand. Er hielt den Kopf gesenkt, betrachtete seine Hände, mit denen er sich an seiner Mütze festklammerte. Jetzt sah er auf und schaute ihr direkt in die Augen.
Schnell blickte sie weg und versuchte, sich auf die Rede des Pfarrers zu konzentrieren. Doch dessen Mund bewegte sich nur, was er sagte, drang nicht bis zu ihr durch. Sie ließ den Blick über die Menschenmenge schweifen und dann hoch in den grauen Himmel. Könnte sie doch einfach wegfliegen. Floskelhafte Satzfetzen erreichten ihr Ohr: «tragisch», «in so jungen Jahren», «für die Hinterbliebenen schwer zu verstehen».
Die eine Frage, die in ihrem Kopf kreiste, seit sie die Nachricht von Freds Tod erhalten hatte, bohrte sich wieder schmerzhaft in ihr Bewusstsein: Welchen Sinn hatte es, dass ein junger, gesunder Mann, der niemandem etwas Böses gewollt hatte, bei einem Autounfall ums Leben kam? Und sie als Witwe im Alter von neunundzwanzig Jahren zurückließ? Witwe, wie das klang.
Sie sah wieder das Auto vor sich, wie es von der Quaibrücke hing, das Eisengeländer durchbrochen. Die Motorhaube ragte über den Fluss hinaus und das Fahrzeug schien jeden Augenblick die Balance zu verlieren und ins Wasser zu kippen. Der Fahrer hatte anscheinend die Kontrolle verloren und Fred auf dem Trottoir erfasst und überrollt. Er sei sofort tot gewesen. Danach war das Auto ins Brückengeländer gekracht; auch der Fahrer war noch an der Unfallstelle verstorben. Bis Josephine benachrichtigt worden war und auf der Brücke ankam, war schon alles geräumt und der Verkehr rollte wieder, wie wenn nichts geschehen wäre. Nur das Auto hing über dem Fluss wie eine groteske Kunstinstallation.
Es war still, verdächtig still. Klara stupste ihr in die Seite. Verwirrt schaute sie auf und sah alle Blicke auf sich gerichtet.
«Josy, du bist dran», flüsterte Klara.
Was meinte ihre Freundin?
«Die Blumen, du musst die Blumen auf den Sarg legen.»
Der Pfarrer streckte seine Hand nach ihr aus und winkte sie zu sich heran. Sie stolperte nach vorne und fühlte sich wie früher in der Schule, wenn sie an die Wandtafel musste und nicht wusste, wie die Lösung lautete.
Vor dem Sarg blieb sie stehen. Der Pfarrer deutete auf den Strauß in ihrer Hand. Mit zitternden Händen legte sie die weißen Nelken auf den Sarg. Tränen stiegen in ihr hoch und sie kramte nach dem Taschentuch. Als sie es herauszog, blieb die Spitzenborte des Tuches am Griff ihrer Tasche hängen und das Stoffstück fiel zu Boden. Wie ein Schneefleck lag es auf dem dunklen Boden neben ihren Füßen. Sie konnte sich nicht bewegen, das Taschentuch nicht aufheben.
«Alles gut, Josy.» Klara war zu ihr hingetreten. Sie hob das Spitzentuch auf, schüttelte es aus und reichte es Josephine. Dann legte sie den Arm um sie und Josephine lehnte sich dankbar an ihre Freundin.
Klara umfasste ihre Hand und sagte leise: «Es tut mir so leid.»
Dann zog sie sie vom Sarg weg wieder an ihren Platz zurück. Josephine zitterte am ganzen Körper und Tränen liefen ihr über das Gesicht. Verschwommen sah sie, wie die anderen Leute zum Sarg traten, Blumen hinlegten und sich von Fred verabschiedeten.
Dann sprach der Pfarrer den Segen und kündigte an, dass sie nun zur Abdankung in die Kapelle gehen würden. Der Sarg werde später von Friedhofsangestellten ins Grab hinuntergelassen und das Kreuz aufgestellt.
Die Predigt im Raum der Friedhofskapelle bekam Josephine nur wie durch einen dicken Vorhang mit. Die Orgelmusik, das Singen der Trauergemeinde, das gelegentliche Hüsteln und Räuspern, alles schien weit weg zu sein. Sie betrachtete ihre gefalteten Hände im Schoss. Wenn nur schon alles vorbei wäre.
Endlich erhoben sich alle zum Schlussgebet. Josephine wurde es kurz schwarz vor Augen, als sie aufstand und sie hielt sich an Klara fest, die neben ihr die Worte des Vaterunser murmelte.
Als sie kurz darauf aus der Kapelle traten, atmete Josephine tief ein, die frische Herbstluft tat gut. Jetzt nur noch die Verabschiedung durchstehen und dann konnte sie endlich weg von hier.
Draußen beim Tor schüttelte sie die ihr hingestreckten Hände, ließ sich über die Schultern streicheln und hörte sich die tröstenden Worte an, von denen die Leute wohl dachten, dass sie ihr halfen. Aber was sollte ihr denn helfen?
Eigentlich wäre es Tradition gewesen, dass sie als Witwe zum Leichenmahl eingeladen hätte. Doch sie hatte ihre Schwiegereltern angefleht, dass sie darauf verzichten sollten. Die Kosten seien so schon enorm hoch. Dafür hatten diese sofort Verständnis gehabt; auch sie hatten sich allein nur für die Trauerkleidung bereits verschulden müssen.
Josephine war es jedoch nicht nur um das Geld gegangen, sondern sie hatte gewusst, dass sie nach der Abdankung nur noch allein sein wollte. Allein mit ihren Gedanken, allein mit Fred.
So verabschiedeten sich die schwarz gekleideten Menschen einer nach dem anderen von ihr und verließen mit gesenkten Köpfen den Friedhof. Auf der anderen Seite des Tores sah Josephine den hochgewachsenen Mann stehen. Er nickte ihr zu, setzte dann seine Mütze auf und ging mit langen Schritten Richtung Albisriederplatz.
Als Letzte traten ihre Eltern zu ihr hin.
Josephine wollte sich auch von ihnen zügig verabschieden, sie sehnte sich nach Ruhe. Zudem fühlte sie sich nicht in der Lage, sich nochmals mit ihnen zu unterhalten, wenn sie sich ohnehin nur Kritik anhören musste. Jedes falsche Wort konnte jetzt das Fass zum Überlaufen bringen und die alten Streitereien wieder aufleben lassen.
Sie drückte beiden die Hand, bedankte sich, dass sie gekommen waren und wollte schon gehen, als ihre Mutter mit gepresster Stimme fragte: «Sehen wir dich wieder?»
Josephine zupfte an ihrem Kragen herum. «Ich melde mich», antwortete sie, «lasst mir ein bisschen Zeit.»
«Nun, du weißt, wo du uns findest. Falls du Hilfe brauchst. Dein Vater würde sich freuen, dich zu unterstützen. Das weißt du.»
«Ja, selbstverständlich. Jederzeit», bekräftigte Heinrich Vonarburg.
«Danke», sagte Josephine, «aber ich muss jetzt gehen.»
Sie wandte sich um und ließ ihre Eltern stehen. Auf eigenartige Weise taten sie ihr leid.
Fast hätte sie vergessen, Klara Adieu zu sagen, doch diese hatte sie schon eingeholt.
«Wo willst du denn hin? Nach Hause?»
«Nein, ganz bestimmt nicht, da fällt mir nur die Decke auf den Kopf. Ich gehe ins Büro, dort gibt es einiges zu tun.»
«Ins Büro, jetzt? Es ist ja schon fast Abend.»
Josephine nickte.
«Soll ich mitkommen?», bot Klara an.
«Nein, ich muss jetzt erstmal für mich sein», antwortete Josephine und fühlte sich schuldig, dass sie ihre Freundin, die ihr so geholfen hatte seit Freds Tod, zurückwies.
Sie umarmte Klara zum Abschied. Dann machte sie sich auf den Weg in Richtung Innenstadt.
Bereits am Stauffacher taten ihr die Füße weh, und am rechten kleinen Zeh begann sich eine schmerzhafte Blase zu bilden. Das steife Leder der Schuhe und die ungewohnten Absätze quälten sie und sie sehnte sich nach ihren groben, abgetragenen Alltagsschuhen, in denen sie stundenlang gehen konnte, ohne sie an ihren Füßen zu spüren. Sie war schon immer gerne zu Fuß unterwegs gewesen oder dann mit dem Fahrrad. Sie liebte es, den Fahrtwind im Gesicht zu spüren und sich im Straßenverkehr durchzuschlängeln. Geschlossene Fahrzeuge engten sie ein, und seit Freds Unfall war dieses Gefühl noch viel stärker geworden.
Auf der Höhe der Sihl begann es zu regnen. Sie spannte den Schirm auf und versuchte, die durch den Wind schräg einprasselnden Tropfen abzuwehren. Beim Speiselokal Sihlhof überquerte sie den Fluss und kurz darauf den Schanzengraben. Fast jeden Morgen war sie diesen Weg mit Fred zusammen gegangen. Die halbe Stunde von ihrer Wohnung in Wiedikon zum Büro im Niederdorf war ihnen heilig gewesen, sie hatte nur ihnen gehört. Manchmal waren sie den ganzen Weg in ein Gespräch vertieft gewesen, manchmal hatten sie auch einfach geschwiegen. Und auch wenn sie die Umgebung in- und auswendig kannten, hatten sie jedes Mal etwas Neues entdeckt. Je nach Wetter und Jahreszeit sah die Stadt immer wieder anders aus, das Licht, die Bäume, die Farbe des Wassers. Doch heute hatte Josephine keine Augen für die Umgebung. Nie wieder würde sie diesen Weg mit Fred gehen können.
Windböen peitschten plötzlich durch den Regen und lenkten sie von ihren düsteren Gedanken ab. Sie umfasste den Griff des Schirmes fester und bereute, dass sie bei diesem Wetter und in diesen unpraktischen Kleidern durch halb Zürich wanderte. Trotz der Kälte schwitzte sie. Der enge Spitzenkragen ihrer Bluse kratzte wie verrückt, und der lange Rock schleifte am Boden entlang. Sie wünschte, sie wäre nach der Beerdigung zuerst nach Hause gegangen und hätte bequemere Kleidung angezogen.
Gleichzeitig war sie froh, diese äußeren Dinge zu spüren, die kalte Luft und die Nässe, die langsam durch den Stoff bis auf ihre Haut drang. Sie lenkten vom Schmerz in ihrer Brust ab und erlaubten ihr, für einige Minuten etwas anderes zu empfinden. Seit Freds Tod fühlte sie sich, als ob ihr Körper vorne in der Mitte aufgeschnitten worden wäre und ihr Inneres schutzlos daliegen würde. Wie sollte eine solche Wunde jemals heilen?
Der Straßenlärm wurde lauter, je näher sie dem Stadtzentrum kam. Die Bahnhofstraße mit ihrem regen Verkehr und den vielen Leuten lag nun quer vor ihr. Trotz der schmerzenden Füße schritt sie aus, schlüpfte zwischen den Menschen und Fahrzeugen hindurch und erreichte endlich die Limmat. Jetzt war es nicht mehr weit. Über die Rudolf-Brun-Brücke gelangte sie zum Limmatquai und dann hoch ins Niederdorf.
Auf dieser Seite der Stadt herrschte jahrein, jahraus emsiges Treiben. Auch jetzt hörte Josephine, schon bevor sie in die Hauptgasse einbog, das Hämmern und Schleifen der Handwerker. Händler boten ihre Waren feil und versuchten die Passanten mit lautstarkem Rufen anzulocken. Waschfrauen schrubbten mit roten Gesichtern und Händen Kleidungsstücke in großen Zubern. Ein Rosskarren polterte durch die Straße, Josephine konnte sich gerade noch an eine Häuserwand drücken, die Holzräder des Wagens kämpften mit dem Kopfsteinpflaster. Kinder rannten in dem ganzen Getümmel frei herum und spielten Fangen. Ihr stiegen die unterschiedlichsten Gerüche in die Nase, an jeder Hausecke ein anderer. Dabei gehörten verbranntes Fett, verfaulte Küchenabfälle und Pferdeschweiß noch zu den angenehmeren.
Was ihre Mutter wohl denken würde, wenn sie diesen Rummel sähe? Ihre Mutter. Ob sie in ihrem Leben jemals einen Fuß ins Niederdorf gesetzt hatte?
«Hoi Josephine», rief jemand laut über die Gasse, «was machst du denn noch so spät hier an einem Freitagnachmittag?»
Die Stimme holte sie zurück in die Realität. Sie gehörte zu Hans Schmid, dem Wirt des Gasthauses, das gegenüber von Freds Büro lag und in dem Josephine und Fred mindestens einmal pro Monat zu Mittag gegessen hatten.
Sie murmelte etwas und eilte weiter. Obwohl Hans eine gute Seele war, hatte sie keine Lust, mit ihm zu sprechen. Offensichtlich hatte er noch nichts von Freds Unfall gehört. Und das Letzte, was sie im Augenblick wollte, war, noch einer Person zu erzählen, dass ihr Mann tot war. Sie bog um die Hausecke in den kleinen Vorhof und eilte auf die Tür des zweistöckigen Gebäudes zu, in dem Freds Büro untergebracht war. Das Haus lag etwas zurückversetzt von der Straße und sah aus, als sei es zwischen die anderen Altstadthäuser hineingezwängt worden.
Alfred Wyss, Auskunftsstelle für vermisste Personen, Flüchtlinge und Kriegsgefangene stand dicht gedrängt auf einem kleinen Schild neben der Klingel.
Josephine schloss die schwere Holztür auf, stemmte sich dagegen und schob sie mühsam auf. Über die schiefe Treppe gelangte sie nach oben in den ersten Stock. Sie schloss die Tür mit dem Milchglaseinsatz auf und öffnete sie. Die Leere, die sich vor ihr auftat, schnürte ihr für ein paar Sekunden die Luft ab. Zwar sah das Büro aus wie immer, alles war an seinem Platz beziehungsweise in Fredscher Manier unordentlich verteilt. Doch er selbst fehlte.
Erschöpft ließ sie sich auf einen der Besucherstühle vor dem großen Schreibtisch fallen. Hut und Handschuhe warf sie auf den Stuhl neben sich und zog die durchnässten Schuhe aus. Ihr Atem ging schnell, und die Hitze stieg ihr ins Gesicht. Sie war zu hastig gelaufen. Ächzend schälte sie sich aus dem engen Jäckchen und öffnete die obersten Knöpfe ihres Blusenkragens. Sie lehnte sich zurück und wartete, bis sich ihr Herzschlag beruhigt hatte.
Es war dunkel im Raum. Es war immer dunkel in der Auskunftsstelle, besonders jetzt im Winterhalbjahr. Die kleinen Fenster und die hohen Häuser rundherum ließen nicht viel Licht herein. Sie schaltete die Schreibtischlampe an und ein heller Strahl fiel auf die Holzplatte. Die braunen Möbel – Schreibtisch, Stühle, Regale, Aktenschränke – schienen die wenigen Lichtstrahlen aufzusaugen. Josephine hatte die Büroausstattung nie sonderlich gefallen, sie hätte gerne hellere, leichtere Stücke gehabt. Doch Freds Vater hatte bei der Eröffnung der Auskunftsstelle vor vier Jahren darauf bestanden, dass er die Einrichtung beisteuerte. Sein Schreinerstolz hatte es nicht zugelassen, dass sein Sohn und dessen Frau Möbel kauften. Nur ein kleiner weißer Tisch mit passendem Stuhl in der Ecke fiel aus dem Rahmen. Dies war ihr Arbeitsplatz, an dem sie jeden Tag Freds Papierkram erledigt hatte.
Sie griff nach dem Bilderrahmen, der mit der Rückseite zu ihr auf dem Schreibtisch stand. Ihr Hochzeitsfoto. Fred schaute ernst in die Kamera und hielt sie fest im Arm, sie selbst lachte übers ganze Gesicht und lehnte ihren Kopf an seine Schulter. Er hatte sich immer lustig gemacht über sie, dass sie es nicht einmal schaffte, auf einem Foto ernst zu schauen. Sanft strich sie mit dem Zeigefinger über sein Gesicht unter der kühlen Glasplatte.
Was sollte sie nur anfangen? Ohne ihn hatte doch alles keinen Sinn mehr. Sein Tod bedeutete auch, dass sie keine finanzielle Sicherheit und keine Arbeit mehr hatte. Die Auskunftsstelle würde sie niemals allein führen können. Diese war Freds Idee gewesen, seine Leidenschaft. Und sowieso: Der Krieg war vorbei und die Aufträge hatten schon seit Längerem immer weiter abgenommen. Vermisste Personen gab es zwar auch ohne Krieg, aber ohne die Flüchtlinge, die Familienzusammenführungen und die Kriegsgefangenen wäre ihnen die Arbeit wohl ohnehin bald ausgegangen. Auch die Zentralstelle in Genf, mit der Fred seit seinem Einsatz dort weiterhin zusammengearbeitet hatte, würde es vielleicht nicht mehr lange geben. Sie musste die Auskunftsstelle auflösen, den Mietvertrag kündigen und das Mobiliar verkaufen. Und dann? Von was sollte sie leben? Ihre Aussichten auf eine Anstellung waren gering. Zwar hatte sie nach ihrem Universitätsstudium bis zur Heirat als Nachhilfelehrerin gearbeitet, aber das war als Witwe sicher nicht mehr möglich und auch zu lange her. Und obwohl sie in der Auskunftsstelle die komplette Administration erledigt hatte, würde sie niemand als Sekretärin einstellen, da ihr die beruflichen Qualifikationen fehlten. Was blieb da noch übrig? Putzhilfe, Kinderfrau, Näherin?
Das Hochzeitsfoto verschwamm vor ihren Augen und Tränen liefen ihr über die Wangen. Sie unterdrückte ein Schluchzen. Die Wände waren dünn wie Papier, niemand sollte sie weinen hören.
In diesem Moment klopfte es an der Tür.
2
Josephines Blick wanderte zur alten Standuhr in der Ecke, ein weiteres wuchtiges Prachtstück aus dem Hause Wyss. Achtzehn Uhr fünfzehn, an einem Freitagabend. Wer wollte um diese Zeit noch etwas hier?
Sie horchte angestrengt, aber nichts rührte sich im Haus. Nur der Lärm von der Hauptgasse war aus der Ferne zu hören und aus dem Innenhof drang das Scheppern eines Kessels.
Wieder klopfte es energisch. Warum hatte sie nur die Schreibtischlampe angeknipst? Das Licht fiel durch die Milchglasscheibe auf den Korridor hinaus und verriet dem Besucher dadurch, dass noch jemand im Büro war. Bei den hohen Stromkosten ließ niemand aus Versehen das Licht brennen. Schon gar nicht nach Arbeitsschluss vor dem Wochenende. Sie bückte sich, zwängte sich in ihre nassen Schuhe und schlich auf Zehenspitzen zur Tür. Ihr Herz pochte bis zum Hals. Manchmal trieben sich unheimliche Gestalten in den Hinterhöfen der Altstadt herum, und womöglich hatte jemand vergessen, die Haustür unten abzuschließen. Aber vielleicht hatte sich auch nur jemand in der Adresse geirrt. Sie atmete tief ein und sagte laut und bestimmt:
«Wer ist da?»
«Hallo?», antwortete eine tiefe Frauenstimme, «ich möchte zu Herrn Alfred Wyss.»
«Er ist nicht da.»
«Bitte, ich muss ihn dringend sprechen.»
«Es tut mir leid, Herr Wyss ist nicht hier. Kommen Sie ein anderes Mal wieder.» Der Frau zu sagen, dass Fred tot war, brachte sie nicht über die Lippen.
Ihr Gegenüber hinter der Tür schwieg ein paar Sekunden und klopfte dann nochmals ans Milchglasfenster, das in der Fassung klirrte. «Ich bitte Sie, hören Sie mich doch wenigstens an. Sie sind doch eine Auskunftsstelle für vermisste Personen, und ich möchte jemanden als vermisst melden», insistierte die Fremde und rüttelte jetzt auch noch an der Türklinke.
Was erlaubte sich diese Frau eigentlich? Mit einem Schnauben drehte Josephine den Schlüssel um und öffnete die Tür.
Mit offenem Mund starrte sie die Gestalt an, die vom Türrahmen wie ein Bild eingefasst wurde. Was war denn das für eine Aufmachung?
Auf dem Kopf trug die Frau eine Art Turban aus glänzendem grünem Stoff, geschmückt mit Federn und glitzernden Steinen. Darunter schaute ein kantiger schwarzer Pagenschnitt hervor, die seitlichen Strähnen waren unterschiedlich lang geschnitten. Links reichten sie bis zur Schulter, rechts endeten sie kurz über dem Ohrläppchen. Von diesem baumelte ein riesiger Ohrring herunter, der an den Weihnachtsschmuck von Josephines Eltern erinnerte. Auch der Hals, die Arme und die Finger waren üppig dekoriert mit auffälligen Klunkern. Nichts davon schien echt zu sein, es sah alles eher aus wie von ungeschickten Kinderhänden gebastelt. Den Körper der Besucherin konnte Josephine nur erahnen, weite Stoffbahnen fielen an diesem herab, mehrere Schichten, Farben, Materialien. Wie war dieses Kleidungsstück denn zusammengenäht? Oder waren es mehrere Kleider übereinander? Der Saum endete kurz oberhalb der Knöchel und gab den Blick frei auf eine Art Pantöffelchen, gefertigt aus hellem Leder und mit goldenen Stickereien geschmückt.
Gehüllt war die Frau nicht nur in viel Stoff, sondern auch in eine schwere Parfümwolke. Der Duft stieg in Josephines Nase und löste ein feines Pochen in ihren Schläfen aus. Auch bei der Schminke hatte die seltsame Person nicht gespart: Die Augen waren schwarz umrandet, der Mund mit kräftigem Rot in Herzform geschminkt, was ihr das Aussehen einer Puppe verlieh.
Nichts an ihr schien zusammenzupassen, sie wirkte, wie wenn sie aus einer anderen Welt gefallen wäre. Ihr Alter konnte Josephine nur schwer einschätzen, vielleicht etwas jünger als sie selbst.
«Darf ich hereinkommen?», fragte die Fremde jetzt.
Josephine war so verblüfft, dass sie wortlos zur Seite trat und sie hereinließ. Schweigend deutete sie auf einen der Stühle und zwang sich, die Besucherin nicht weiter anzuglotzen. Sie ging um den Schreibtisch herum und setzte sich ihr gegenüber auf Freds Stuhl.
«Es tut mir leid, Sie zu stören», dunkle Knopfaugen schauten Josephine flehend an, «aber ich weiß nicht, an wen ich mich sonst wenden soll.»
«Sie möchten also jemanden als vermisst melden?»
«Ja genau.»
«Waren Sie schon bei der Polizei?», fragte Josephine und versuchte sich daran zu erinnern, welche Fragen Fred bei einem neuen Kunden jeweils gestellt hatte.
«Zur Polizei? Das ist unmöglich. Diese Halsabschneider würden uns nie helfen. Nur kassieren wollen sie, sonst nichts.» Die Frau verzog das Gesicht.
Oje, das schien ein schwieriger Fall zu sein.
«Wer ist ‹uns›?», hakte Josephine nach und bereute die Frage augenblicklich. Prompt ergoss sich ein Redeschwall über sie.
«Uns, das ist die Künstlergruppe DADA. Wir haben ein kleines Theater, das Cabaret Voltaire, vielleicht haben Sie schon davon gehört, ist gar nicht weit von hier. Die Polizei ist leider nicht so gut auf uns zu sprechen, wir sind ... nun ja, eher laut und ungewöhnlich. Mein Name ist übrigens Edda Kurz, und ich arbeite als Künstlerin und Pianistin im Cabaret. Wir machen Theater, Tanz, Musik, Literatur, eine bunte Mischung.»
Josephine erinnerte sich vage, dass sie irgendwo etwas von dieser eigenartigen Kunstrichtung gehört hatte.
«Nun, ich will Sie nicht mit Details über unser Theater langweilen. Die Sache ist die, dass eine meiner Freundinnen, die auch im Cabaret auftritt, spurlos verschwunden ist. Niemand hat sie seit ihrem Auftritt am letzten Sonntagabend gesehen, zu den Proben diese Woche ist sie nicht erschienen und übermorgen ist die nächste Aufführung. Niemand weiß, wo sie steckt. Ich mache mir solche Sorgen.»
Edda stoppte, um Luft zu holen und sah Josephine erwartungsvoll an. Als sie nichts erwiderte, fuhr sie fort: «Und ja, die Polizei. Die kommt nicht in Frage. Wir sind denen ein Dorn im Auge. Wir zahlen regelmäßig Bußen, damit sie uns den Laden nicht schließen. Die würde es nicht mal interessieren, wennʼs Mord und Totschlag gäbe bei uns.»
Josephine rieb sich die Schläfen. Warum hatte sie die Frau nur hereingelassen? Ohne Fred konnte sie ja ohnehin keine Aufträge mehr annehmen. Hätte sie sie doch nur abgewimmelt! Edda sollte sie einfach in Ruhe lassen und wieder gehen.
Diese ließ sich von Josephines Schweigen jedoch nicht irritieren und redete munter weiter: «Sind Sie Herrn Wyss’ Sekretärin? Können Sie mir sagen, wann er wieder hier ist? Am Montag? Es ist wirklich dringend, und ich wäre sehr froh, wenn ich ihn so schnell wie möglich sprechen könnte. Er ist doch spezialisiert auf vermisste Personen, oder? Ein Bekannter hat mich an ihn verwiesen. Dessen Bruder wurde nach dem Krieg vermisst, und Herr Wyss konnte ihm damals weiterhelfen. Mein Bekannter hat in den höchsten Tönen von ihm gesprochen.»
«Ich bin nicht seine Sekretärin», unterbrach Josephine das Geplapper, «ich bin seine Frau. Ich ... war seine Frau.»
«War? Wieso? Hat er Sie verlassen?»
Josephine wollte dieser Fremden nichts über sich oder Fred erzählen, aber es schien die einzige Möglichkeit zu sein, sie loszuwerden.
«Nein, er ... er ist gestorben, vor einer Woche.»
Edda sah sie mit offenem Mund an. «Mein Beileid. Wenn ich das gewusst hätte ...»
«Konnten Sie ja nicht. Aber wie gesagt, ich kann Ihnen wirklich nicht weiterhelfen, so leid es mir tut. Sie verstehen.»
«Selbstverständlich.»
Nun würde Edda bestimmt endlich gehen, doch sie machte keine Anstalten aufzustehen. Ihre fast schwarzen Augen blickten Josephine nachdenklich an. «Arbeiten Sie auch hier?», fragte sie dann.
«Ja, ich habe bei der Administration geholfen, Botengänge erledigt, das Telefon bedient, solche Dinge.» Was spielte das für eine Rolle?
«Nun, ich möchte Sie wirklich nicht länger belästigen, in Ihrer Situation haben Sie bestimmt anderes zu tun. Aber vielleicht könnten Sie versuchen, etwas herauszufinden? Eventuell wäre es sowieso besser, wenn das Ganze unter uns Frauen bliebe. Und ich würde Sie natürlich dementsprechend bezahlen für Ihre Aufwände. Vielleicht hilft Ihnen das ja gerade jetzt, es ist schließlich keine einfache Zeit, als Frau allein für sich sorgen zu müssen. Ich habe nicht viel, aber ich bin bereit, Ihnen alles zu geben, was ich nur kann. Hauptsache, meine Freundin taucht wieder auf.»
«Frau Kurz ...»
«Edda, bitte nennen Sie mich Edda.»
«Edda. Es geht nicht. Ich kann nicht. Wirklich nicht.» Warum zitterte ihre Stimme? Edda lehnte sich über den Tisch und griff nach ihrer Hand. «Ich schreibe Ihnen die Telefonnummer des Cabaret Voltaire auf. Dort können Sie mich erreichen oder eine Nachricht hinterlassen. Überlegen Sie es sich in Ruhe. Sie sind meine einzige Hoffnung.» Sie erhob sich und rückte ihre Gewänder zurecht. Aus einer kleinen Stofftasche nahm sie Bleistift und Papier und schrieb eine Zahlenreihe darauf. Sie reichte Josephine die Notiz und sagte erneut: «Mein herzliches Beileid, Frau Wyss.»
«Josephine.»
«Josephine», wiederholte Edda und rauschte zur Tür hinaus. Ein leichter Parfümduft blieb in der Luft hängen.
Kaum hatte Edda das Büro verlassen, erhob sich Josephine, ging zur Tür und drehte den Schlüssel zweimal um. Dann lehnte sie sich an den Türrahmen und schaute verwundert auf den Stuhl, auf dem Edda gerade noch gesessen hatte. Was für eine Erscheinung! Und obwohl sich Josephine die ganze Zeit eingeschüchtert gefühlt hatte von der Präsenz, mit der sie den kleinen Raum ausgefüllt hatte, war sie ihr auf eine seltsame Art und Weise gleich vertraut gewesen. Sie hatte schon immer eine Schwäche für außergewöhnliche Menschen gehabt. Und wenn sie nicht gerade ihren Mann verloren hätte, hätte sie sich vielleicht wunderbar mit Edda verstanden, und Fred und sie hätten bestimmt versucht, ihr zu helfen.
Etwas fühlte sich rau und feucht in ihrer linken Hand an. Eddas Zettel. Vorsichtig faltete sie ihn auseinander und betrachtete die Zahlen.
Eine verschwundene Frau. Diese Worte lösten sofort eine Reihe von Fragen in ihrem Kopf aus. Sie hatte Fred nicht nur mit dem Papierkram geholfen. Sie war über jeden Fall informiert gewesen und hatte mitverfolgt, wie er bei seinen Fällen vorgegangen war. Mit der Zeit hatte auch sie ein Gespür und eine Routine entwickelt, wo und wie man eine vermisste Person sucht und findet.
Sie schüttelte den Kopf, sie hatte wirklich anderes zu tun im Moment. Freds Sachen ordnen, sie musste alles regeln mit den Ämtern und dann vor allem herausfinden, was sie ohne ihn machen sollte, wie sie überleben würde.
Entschlossen trat sie zurück an den Schreibtisch und wollte den Zettel in den Papierkorb werfen. Er prallte jedoch vom Rand des Korbs ab und fiel auf den Boden. Sie seufzte und bückte sich, um den Zettel aufzuheben. Dabei fiel ihr Blick auf eine große braune Ledertasche, die ganz hinten unter dem Schreibtisch stand, dort, wo man seine Beine zwischen den beiden schweren Schubladenelementen ausstrecken konnte. Was für ein Ort, um eine Tasche abzustellen. Man stieß sich ja immer die Füße daran. Da der Schreibtisch an der vorderen Front geschlossen war, konnte man sie auch nicht wegschieben. Und sichtbar war sie nur, wenn man sich weit nach unten beugte und direkt unter den Schreibtisch schaute, so wie Josephine es jetzt gerade tat.
Sie ging in die Knie und zog die Tasche hervor. Schwer war sie nicht, auch nicht verstaubt. Lange konnte sie nicht unter dem Tisch gestanden haben. Gesehen hatte sie die Tasche noch nie, da war sie sich sicher. Sie hob sie hoch und stellte sie auf den Schreibtisch, ein leises Kribbeln im Bauch. Irgendetwas stimmte hier nicht. Fred und sie wohnten und arbeiteten seit Jahren zusammen, und sie war überzeugt, dass sie über all die Dinge Bescheid wusste, die er besaß. Auch wenn das bei seiner Unordentlichkeit nicht ganz einfach gewesen war. Auf jeden Fall wusste sie, dass er keine braunen, großen Taschen gehabt hatte.
Sie strich über das Leder und spürte das glatte, kühle Material unter ihren Fingern. Ein herber Duft nach Teer, Harz und Vanille stieg ihr in die Nase, die Tasche roch neu. Josephine atmete tief ein und griff nach dem silbernen Verschluss. Rasch schaute sie sich im Zimmer um, zum Fenster, rief sich nochmals in Erinnerung, dass sie die Tür abgeschlossen hatte. Als ob da plötzlich jemand stehen würde. Sie widerstand dem Drang, die Schreibtischlampe auszuschalten, und betätigte den Verschluss. Doch der ließ sich nicht hinunterdrücken. Sie presste stärker. Nichts. Sie rückte die Tasche näher an die Lampe und entdeckte ein kleines Schlüsselloch in der Mitte der Metallleiste. Die Tasche war abgeschlossen. Da half alles Drücken und Ziehen nichts.
Sollte sie sie aufschneiden? Nein, dafür sah sie viel zu wertvoll aus. Und vielleicht gehörte sie ja gar nicht Fred. Vielleicht hatte er sie nur für einen Kunden aufbewahrt? Trotzdem merkwürdig, dass er ihr nichts davon erzählt hatte, und der Ort unter dem Schreibtisch sah wie ein Versteck aus. Hatte Fred nicht gewollt, dass sie die Tasche entdeckte? Und wenn ja, warum nicht?
Langsam stellte sie sie wieder unter den Schreibtisch zurück und schob sie weit nach hinten. Sie würde sich ein anderes Mal darum kümmern. Jetzt sollte sie wirklich langsam nach Hause gehen, draußen war es schon finster.
Als sie die Haustür hinter sich abschloss und ihr Blick auf Freds Namen auf dem kleinen Schild fiel, merkte sie, dass sie zum ersten Mal seit seinem Tod für kurze Zeit an etwas anderes hatte denken können.
3
Mit pochenden Kopfschmerzen stand Josephine am Küchenfenster in ihrer Wohnung und beobachtete durch den Nieselregen, wie die Spatzenbande im Hinterhof um ein paar nasse Krümel Brot kämpfte. Sie lehnte den Kopf an die Fensterscheibe, das kühle Glas tat gut auf ihrer heißen Stirn. Ihre Augen brannten, wie in den Nächten davor hatte sie auch letzte Nacht kaum geschlafen. Die Leere, die Fred hinterlassen hatte, schien sich nachts noch weiter auszudehnen. Immer wieder ertappte sie sich dabei, wie sie im Dunkeln nach ihm tastete, ihre Hand aber nur das kalte Laken berührte. Würde sie ohne ihn jemals wieder im Bett liegen und einfach einschlafen können?
Minutenlang verharrte sie so mit der Stirn an der Scheibe und konnte sich nicht überwinden, sich zu bewegen. Sie war erst am Nachmittag zu einem Spaziergang mit Klara verabredet. Ihre Freundin hatte darauf bestanden, dass sie sich gleich heute, einen Tag nach der Beerdigung, wiedersehen sollten. Und auch wenn Josephine sich am liebsten zu Hause verkrochen hätte, war es wahrscheinlich gut, wenn Klara sie zwang, nach draußen zu gehen und sich abzulenken. Doch bis zu ihrem Treffen war sie allein und niemand wartete auf sie, niemand erwartete etwas von ihr.
Ein leises Tappen holte sie zurück in die Realität. Alma setzte sich zu ihren Füßen nieder und stupste mit ihrer Schnauze an ihre Hüfte. Sie kraulte den großen flauschigen Kopf des Hundes. «Richtig, dich habe ich ja noch.»
Alma war Freds Ein und Alles gewesen, sein Hund. Natürlich hatte auch Josephine die treue Gefährtin ihres Mannes ins Herz geschlossen, aber Fred war immer Almas wichtigste Bezugsperson gewesen. Jetzt gab es also nur noch sie beide. Seit Fred gestorben war, hatte Josephine oft daran gedacht, wie es wäre, wenn sie wenigstens ein Kind von ihm gehabt hätte. Dann wäre sie jetzt nicht ganz so einsam. So sehr hatten sie sich Kinder gewünscht, so lange hatten sie gehofft, dass sie eine Familie sein würden. Aber sie war einfach nicht schwanger geworden. Vielleicht war es ja besser so, die Probleme wären nicht kleiner, wenn sie jetzt auch noch Kinder zu versorgen hätte. Und wie schlimm wäre es für diese gewesen, ihren Vater zu verlieren.
Das Schrillen der Türglocke stach wie ein Messer in ihre Schläfe. Alma bellte laut und rannte in den Flur, um mit ihren Krallen am Holz der Türschwelle zu kratzen.
Josephine löste sich vom Fensterrahmen und ging durch die Küche in den Flur. Wahrscheinlich war es eine Nachbarin oder vielleicht der Postbote.
Sie schob Alma zur Seite und öffnete die Tür. Vor ihr stand ihre Mutter.
«Was machst du denn hier?»
«Danke für die freundliche Begrüßung. Lässt du mich bitte herein?»
«Was willst du?»
«Möchtest du das wirklich hier im Treppenhaus mit mir besprechen?»
Widerwillig wich Josephine zur Seite, und ihre Mutter trat über die Schwelle. Alma umkreiste sie aufgeregt und hechelte freudig. Josephines Mutter umklammerte ihren Schirm und versuchte, den Hund damit wegzuschieben.
Ungehalten packte Josephine Alma am Halsband und zog sie weg. Dummer Hund, konnte Freund und Feind nicht auseinanderhalten.
Ihre Mutter nahm den Hut vom Kopf und schaute sich um. Die kleine Kommode im engen Flur schien ihr ein geeigneter Ablageort. Sie zog ein Taschentuch hervor und wischte die Oberfläche ab, bevor sie den Hut darauf ablegte. Dann streifte sie ihre Handschuhe ab und platzierte sie sorgfältig neben dem Hut. Die Jacke hängte sie an die Garderobe, nachdem sie eine von Josephines Jacken umgehängt hatte, um einen freien Haken zu bekommen.
Josephine sah dieser Prozedur schweigend zu. Obwohl ihr Kopf hämmerte und sie eigentlich keine Lust auf eine Auseinandersetzung mit ihrer Mutter hatte, amüsierte sie das Theater, das diese aufführte. Louise Vonarburg hatte schon immer das Talent, mit drei Gesten mehr zu sagen als mit tausend Worten.
«Nun, meine Liebe, bekomme ich eine Tasse Kaffee?», fragte ihre Mutter und strich sich den Rock glatt. «Und bitte sperr den Hund weg. Dieses Viech macht einen ja ganz konfus.»
Josephine gab Alma ein Zeichen, worauf sich der Hund auf seine Decke im Wohnzimmer verzog. Dann ließ sie ihre Mutter wortlos im Flur stehen und ging in die Küche. Laut polternd setzte sie Wasser auf.
«Soll ich im Wohnzimmer warten?», rief ihre Mutter.
«Mach, was du willst.»
Der Duft nach Kaffee beruhigte Josephine etwas, und sie servierte das heiße Getränk auf dem kleinen Sofatisch im Wohnzimmer.
«Lass mich dich einmal anschauen.» Ihre Mutter zog sie zum Fenster. Sie musterte Josephine von oben bis unten und schüttelte missbilligend den Kopf. «Was ist denn das für ein Aufzug? Dieser lächerliche Umhang? Und ist das tatsächlich eine Hose? Trägt man in Zürich-Wiedikon keine Röcke mehr?»
«Mama, was willst du? Du bist bestimmt nicht hergekommen, um meine Kleidung zu beurteilen.»
Louise Vonarburg antwortete nicht und begann, im Raum auf und ab zu gehen. Sie betrachtete die einfachen Möbel, den abgewetzten Teppich, das Geschirr in der Vitrine, bei dem fast jedes Stück einen Kratzer oder Sprung hatte. Sie fuhr mit den Fingern über Möbeloberflächen, die Türrahmen, die Fenstersimse, als ob sie nach irgendwelchen Spuren suchen würde. Dann stellte sie fest: «Sauber ist es, aber hier kannst du nicht bleiben.»
«Wie bitte?» Sollte sie über das Benehmen ihrer Mutter belustigt sein oder sich darüber ärgern?
«Es gehört sich nicht. Eine Frau, auch eine verwitwete, kann nicht allein in einer Wohnung leben. Und schon gar nicht in so einer Arbeiter-Mietwohnung. Wenigstens arbeitete Fred im Büro, war kein Handwerker. Warum ihr so einfach gelebt habt, verstehe ich nicht. Aber das muss sich jetzt ändern, eine Frau deines Standes kann hier nicht bleiben. Es ziemt sich nicht.»
Sie schritt zum Sofa, setzte sich auf die Sitzkante und griff nach einer der Tassen. «Setz dich!», forderte sie Josephine auf und klopfte mit der Hand neben sich aufs Polster.
Josephine schüttelte den Kopf. Ganz bestimmt würde sie sich nicht zu ihrer Mutter setzen. Was fiel ihr eigentlich ein? Und dann das Sofa zu tätscheln, als ob sie ein kleines Kind wäre, das man herlocken möchte. Sie zog den Umhang, den ihr Klara geschenkt hatte, enger um sich und verschränkte die Arme vor der Brust.
«Josephine, dein Vater und ich sind sehr besorgt um dich.»
«Ah ja, ihr seid besorgt um mich? Nachdem wir uns zehn Jahre nicht gesehen haben, schneist du hier herein und willst mir sagen, was ich zu tun habe? Ich komme schon zurecht.»
Ihre Mutter zog die Augenbrauen hoch. «Bist du dir da sicher? Du hast kein Einkommen, niemanden mehr, der dich finanziell unterstützt.»
Damit traf sie einen wunden Punkt, doch Josephine ließ sich nichts anmerken. «Ich werde schon eine Lösung finden.»
«Hör zu, dein Vater und ich haben nie gewollt, dass du so lebst. Aber du wolltest gehen, und wir haben es akzeptiert. Doch jetzt hat sich die Situation geändert.»
«Ja, mein Mann ist gestorben, der Mann, den ihr partout nicht akzeptieren wolltet. Ihr habt mir damals keine Wahl gelassen. Entweder Fred oder ihr und euer Zuckerguss-Leben. Ich habe mich entschieden und ich werde heute wieder genau gleich entscheiden.»
«Josephine, wir hätten damals bestimmt einen Kompromiss gefunden. Aber du wolltest wieder einmal mit dem Kopf durch die Wand.»
«Einen Kompromiss? Damit meinst du wohl, dass ich euch hätte entgegenkommen sollen. Du und Papa habt mir ja sogar verboten, Fred überhaupt zu sehen!» Josephine machte einen Schritt auf ihre Mutter zu. Dabei stieß sie an den Sofatisch und der Kaffee in ihrer Tasse schwappte über.
«Junge Dame, dein Ton gefällt mir gar nicht!» Louise Vonarburg verzog den Mund. «Ich bin nicht hierhergekommen, um mit dir über die Vergangenheit zu streiten.»
«Warum bist du dann hier? Wenn wir uns nach all den Jahren wieder begegnen, kann es doch um gar nichts anderes gehen als die Vergangenheit.»
Betont langsam stellte ihre Mutter die Tasse auf den Tisch zurück und erhob sich. Sie kam auf Josephine zu, die instinktiv zurückwich. Jetzt griff sie sogar nach ihrer Hand.
Ein Schweißtropfen rann über Josephines Rücken. Mit aller Kraft widerstand sie dem Drang, ihre Hand wegzuziehen.
«Wir möchten dir anbieten, dass du eine Weile bei uns wohnen kannst, um dich zu erholen und auszuruhen, und dann schauen wir, wie es weitergeht. Du könntest dein altes Zimmer haben und hättest wieder alle Annehmlichkeiten, die dir von Standes wegen zustehen. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass es dir an nichts fehlt und dass dir alle Bediensteten zur Verfügung stehen. Herr und Frau Konrad vermissen dich noch immer sehr. Und du kannst wieder mit deinem Vater im Garten die Rosen pflegen und in der Bibliothek lesen, das hast du doch immer so gerne gemacht. Und deine schönen Kleider und Schuhe und die Taschen. Ich habe alles behalten. Und stell dir vor: das feine Essen und der gute Wein! Wäre das nicht herrlich?»
War ihre Mutter komplett übergeschnappt?
«Schau mich doch nicht so an, Kind!»
Josephine wand ihre Hand aus dem Griff der Mutter und trat einen Schritt zurück. Die Hitze in ihrem Körper wurde unerträglich, und das Hämmern in ihrem Kopf hatte sich von den Schläfen zur Stirn verlagert.
«Nun, was sagst du?», ließ ihre Mutter nicht locker, «das wäre doch das Beste für alle. Deine Schwester und die Kinder würden sich sicher sehr freuen, dich öfter zu sehen. Sie kommen jeden Sonntag zum Abendessen. Und deinen Schwager Emil hast du ja gar nie richtig kennengelernt. Als Anwalt hat er sehr interessante Geschichten zu erzählen. Wir haben wirklich immer viel zu diskutieren und zu lachen.»
Ihre Mutter und lachen, das wäre ja das Neuste.
«Dein Vater könnte sofort alles in die Wege leiten für deinen Umzug, und er würde dir bestimmt auch helfen, Freds Büro aufzulösen. Und was nachher kommt, schauen wir.»
«Mama, hör auf! Du bist doch nicht mehr bei Verstand!»
«Josephine, wie sprichst du denn mit mir!»
Louise Vonarburg drehte sich abrupt um, setzte sich wieder aufs Sofa und begann, den Rest ihres Kaffees in kleinen Schlucken zu trinken.
«Es kommt überhaupt nicht in Frage, dass ich zu euch ziehe», sagte Josephine, «und die Auskunftsstelle werde ich bestimmt nicht auflösen. Ich habe bereits einen neuen Auftrag erhalten. Es gibt Leute, die meine Hilfe brauchen.»
«Du willst arbeiten? In einem Büro? Ah, entschuldige, in einer ‹Auskunftsstelle›? Niemand weiß, was das überhaupt sein soll.»
«Ja, Mama, ich will arbeiten und meinen Lebensunterhalt selbst verdienen. So wie ich es die letzten zehn Jahre getan habe.»
«Josephine, ich bitte dich, ohne Fred hättest du nie überleben können. Immerhin das hat er geschafft. Dich einigermaßen zu versorgen, damit du nicht noch in der Gosse landest.»
Natürlich wusste Josephine, dass sie es ohne Fred wohl kaum zu dem Lebensstandard gebracht hätte, den er ihr hatte bieten können. Ihre Mutter zielte genau auf diese Schwachstelle. «Hör auf, Mama!»
«Nein, du hörst jetzt auf mit deinen kindischen Ideen.»
Josephine schwieg. Ihre Mutter war zäh, daran hatte sich nichts geändert.
«Also, was ist? Ich muss gleich los, Samstagmittag ist immer Frauentreff im Glockenhof.»
«Nein, Mama.»
«Josephine, sei vernünftig. Nur so hast du eine Chance, noch etwas aus deinem Leben zu machen. Du bist doch eine kluge Frau, deine ganze Ausbildung, dein Studium sollen doch nicht umsonst gewesen sein. Und wenn du erst einmal wieder vernünftige Kleider trägst, siehst du bestimmt auch immer noch ganz hübsch aus. Vielleicht findest du ja sogar wieder einen Mann, wer weiß.» Louise Vonarburg lächelte.
Josephine ballte die Fäuste. Was fiel ihrer Mutter eigentlich ein?
«Raus hier!», rief sie und zeigte zur Tür, «ich will dich hier nicht mehr sehen!»
Alma hob den Kopf und schaute sie verwirrt an. Ihre Mutter erhob sich zögernd.
«Nichts hat sich geändert! Nichts! Wie oft habe ich daran gezweifelt, ob meine Entscheidung zu gehen richtig war. Aber nein, hier sind wir, zehn Jahre später, und immer noch die gleichen Diskussionen. Für wen hältst du dich eigentlich? Kommst hierher und denkst, dass du mich ‹retten› musst, nachdem ich es all die Jahre allein geschafft habe?» Ihre Stimme wurde noch lauter: «Ich brauche euch nicht, verstehst du? Euch nicht und euer Geld auch nicht.»
In diesem Moment erhob sich Alma, tappte zu Louise Vonarburg hin und sah sie erwartungsvoll an. Als keine Reaktion kam, rieb sie sich nach Streicheleinheiten bettelnd an ihren Beinen.