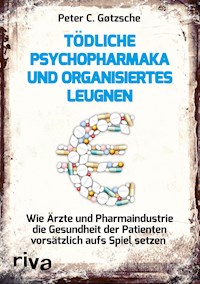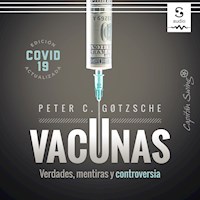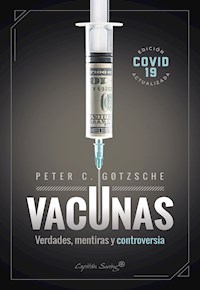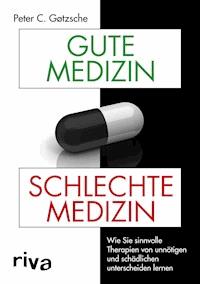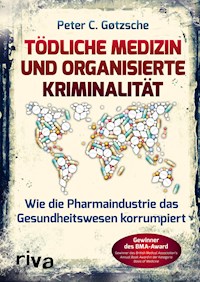
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Riva
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Ein Pharmakonzern wurde durch den Verkauf von Heroin groß. Ein anderer steht im Verdacht, mit falschen Behauptungen über ein Arthritis-Medikament den Tod von Tausenden Patienten verursacht zu haben. Ein weiterer belog die US-amerikanische Food and Drug Administration und wurde zu einer Strafe von 2,3 Milliarden Dollar verurteilt. Dieses Buch handelt von der dunklen Seite der Pharmaindustrie, von der Art und Weise, wie Medikamente entdeckt, produziert, vermarktet und überwacht werden. Es zeigt detailliert auf, wie Wissenschaftler Daten fälschen, um ihre Meinung zu verteidigen. Dabei stehen die Pharmakonzerne der Mafia in nichts nach, sie sind sogar schlimmer und haben mehr Menschenleben auf dem Gewissen. Gøtzsches Buch handelt jedoch nicht nur von Problemen. Der Autor bietet Lösungen, von denen einige größere Erfolgschancen haben als andere, und er zeigt auf eindrückliche Weise die Notwendigkeit für umfassende Reformen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 782
Ähnliche
Peter C. Gøtzsche
TÖDLICHE MEDIZIN UND ORGANISIERTE KRIMINALITÄT
Peter C. Gøtzsche
TÖDLICHE MEDIZIN UND ORGANISIERTE KRIMINALITÄT
Wie die Pharmaindustrie das Gesundheitswesen korrumpiert
Dieses Buch ist ein Augenöffner. Peter Gøtzsche erklärt, wie die profit-orientierte Vermarktung von Medikamenten dabei ist, das Vertrauen zwischen Patient und Arzt, aber auch zwischen Arzt und Industrie langfristig zu zerstören. Es ist nur zu hoffen, dass dieses mutige Buch Politik und Öffentlichkeit wachruft, etwas zu tun, um dem Gesundheitssystem die ganz große Vertrauenskrise zu ersparen. Bevor Sie das nächste Medikament nehmen, sollten Sie auf jeden Fall erst einmal dieses Buch lesen.
Prof. Dr. Gerd Gigerenzer, Direktor des Harding-Zentrums für Risikokompetenz an der Universität in Potsdam
Gøtzsche, den ich kenne und schätze, beschreibt und bestätigt die Analyse früherer Autoren wie Marcia Angel, Ben Goldacker, Markus Grill u.a., dass das Gewinnstreben der Pharmaunternehmen unsere Gesundheit gefährdet, dass die dafür zuständigen Behörden unzureichend arbeiten und die Parlamente keine wirksamen Gesetze zum diesbezüglichen Schutz der Bevölkerung erlassen. Auch wenn nach jedem solchen Buch behauptet wird, dass es sich um Vorkommnisse der Vergangenheit handelt und dass in der Zwischenzeit die Fehler behoben worden sind, ändert sich wenig. Nach wie vor scheint bei Medikamenten die Regel zu gelten „Umsatz vor Umsicht“. Prof. Dr. Peter Sawicki, ehemaliger Leiter des IQWiG
Wenn der Profit wichtiger ist als das Patientenwohl, geht das Peter Gøtzsche gewaltig gegen den Strich. Der Arzt und Studienautor, der auch eine Vielzahl von Veröffentlichungen systematisch auf Qualität und Aussagekraft überprüft hat, weiß, wovon er schreibt. Wie kaum ein anderer Verfasser all der vielen Bücher zum Thema Arzneimittelmarkt und Pharmaindustrie kennt er die Interna des Pharmageschäftes. Wer sein Buch liest, wird rasch verstehen, warum der provokante Titel keine Übertreibung ist. Wie die im Buch genannten Firmen darauf reagieren, darf man gespannt erwarten. Wolfgang Becker-Brüser, Herausgeber von arznei-telegramm
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Wichtiger Hinweis
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
5. Auflage 2022
© 2015 by riva Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Die englische Originalausgabe erschien 2013 bei Radcliffe Publishing Ltd unter dem Titel Deadly Medicines and Organised Crime. How Big Pharma Has Corrupted Healthcare. © 2013 by Peter C. Gøtzsche. All rights reserved.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Übersetzung: Martin Rometsch
Redaktion: Matthias Michel, Jörg Schaaber
Umschlaggestaltung: Kristin Hoffmann
Umschlagabbildung: Shutterstock
Satz: Carsten Klein, Torgau
eBook: ePubMATIC.com
ISBN Print: 978-3-7423-1161-0
ISBN E-Book (PDF): 978-3-86413-594-1
ISBN E-Book (EPUB, Mobi): 978-3-86413-595-8
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.rivaverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Inhalt
Vorwort von Richard Smith
Vorwort von Drummond Rennie
Über den Autor
1 Einführung
2 Geständnisse eines Insiders
Inhalatoren töteten Asthmatiker
Zwielichtiges Marketing und die Forschung
3 Das organisierte Verbrechen als Geschäftsmodell für die Pharmariesen
Hoffmann-La Roche, der größte Drogenhändler
Die »Hall of Shame« der Pharmariesen
Wiederholungstäter
Organisiertes Verbrechen
4 Sehr wenige Patienten profitieren von ihren Medikamenten
5 Klinische Studien: ein gebrochener Gesellschaftsvertrag mit Patienten
6 Interessenkonflikte der medizinischen Fachzeitschriften
7 Der korrumpierende Einfluss des leicht verdienten Geldes
8 Was tun Tausende von Ärzten, die Geld von der Industrie bekommen?
Seeding Trials
Gekaufte Meinungsmacher geben bezahlte »Ratschläge«
Gekaufte Meinungsmacher »bilden aus«
9 Aggressive Verkaufsstrategien
Klinische Studien sind getarntes Marketing
Ghostwriter
Die Marketing-Maschine
Aggressive Vermarktung bis zum Erbrechen
Überteuerte Medikamente
Übertreibungen mit dem Bluthochdruck
Patientenorganisationen
NovoSeven für blutende Soldaten
10 Unzureichende Arzneimittelüberwachung
Interessenkonflikte in Überwachungsbehörden
Korruption in Überwachungsbehörden
Die unerträgliche Leichtigkeit der Politiker
Arzneimittelüberwachung basiert auf Vertrauen
Unzureichende Tests für neue Medikamente
Zu viele Warnungen und zu viele Medikamente
11 Öffentlicher Zugang zu den Daten der Arzneimittelbehörden
Unser Durchbruch bei der EMA im Jahr 2010
Zugang zu Daten anderer Arzneimittelbehörden
Tödliche Schlankheitspillen
12 Neurontin: ein Epilepsie-Medikament für alles
13 Merck – wo die Patienten zuerst sterben
14 Die betrügerische Celecoxib-Studie und andere Lügen
Marketing ist schädlich
15 Teure Medikamente als Ersatz für billige – bei denselben Patienten
Novo Nordisk stellt Patienten auf teures Insulin um
AstraZeneca stellt Patienten auf teures Omeprazol um
16 Blutzuckerspiegel in Ordnung, Patient tot
Novo Nordisk mischt sich in eine wissenschaftliche Veröffentlichung ein
17 Die Psychiatrie, das Paradies der Pharmaindustrie
Sind wir alle verrückt?
Psychiater als Drogenhändler
Der Schwindel mit dem chemischen Ungleichgewicht
Psychiatrische Vorsorgeuntersuchungen
Unglückspillen
Ein schreckliches Medikament von Eli Lilly wurde zum Kassenschlager: Prozac
Bewegung ist ein gutes Heilmittel
Weitere Lügen über Glückspillen
18 Glückspillen treiben Kinder in den Selbstmord
Die Glaxo-Studie 329
Klinische Studien verschweigen Suizide und Suizidversuche
Lundbecks Evergreen: Citalopram
Antipsychotika
Zyprexa, ein weiteres schreckliches Medikament von Eli Lilly – und ein Kassenschlager
Psychopharmaka – ein Fazit
19 Einschüchterung, Drohungen und Gewalt zur Verkaufsförderung
20 Die Märchen der Industrie fliegen auf
21 Das Versagen des Systems schreit nach Revolution
Unsere Medikamente töten uns
Wie viele Medikamente brauchen wir wirklich und zu welchem Preis?
Gewinnorientierung ist das falsche Modell
Klinische Studien
Arzneimittelbehörden
Arzneimittellisten und Leitlinienausschüsse
Arzneimittel-Marketing
Ärzte und ihre Organisationen
Patienten und ihre Organisationen
Medizinische Fachzeitschriften
Journalisten
22 Den Pharmakonzernen Paroli bieten
Geld stinkt nicht
Krankheiten werden erfunden
Literaturnachweise
Vorwort von Richard Smith
Wahrscheinlich schüttelt es viele Leute, wenn sie hören, dass Peter Gøtzsche demnächst einen Vortrag hält, oder wenn sie seinen Namen im Inhaltsverzeichnis einer Fachzeitschrift lesen. Er gleicht dem kleinen Jungen, der nicht nur sieht, dass der Kaiser nichts anhat, sondern dies auch sagt. Die meisten von uns bemerken nicht, dass der Kaiser nackt ist, oder sie halten den Mund angesichts seiner Blöße. Darum brauchen wir Menschen wie Peter. Er ist kompromisslos und kein Heuchler, und er bevorzugt eine unverblümte Sprache mit anschaulichen Metaphern. Manche oder sogar viele Leserinnen und Leser dieses Buches mögen darüber empört sein, dass Peter die Pharmaindustrie mit dem organisierten Verbrechen vergleicht, doch wer das Buch darum beiseitelegt, verpasst die Chance, etwas Wichtiges über die Welt zu lernen – und darüber schockiert zu sein.
Peter beendet sein Buch mit einer Geschichte. Die Dänische Gesellschaft für Rheumatologie bat ihn, zum Thema Zusammenarbeit mit der Pharmaindustrie. Ist sie wirklich so schädlich? zu sprechen. Ursprünglich lautete der Titel: Zusammenarbeit mit der Pharmaindustrie. Ist sie schädlich? Aber das war der Organisation zu heftig. Zu Beginn seines Vortrags zählte Peter die »Verbrechen« der Sponsoren der Konferenz auf. Roche sei durch den illegalen Verkauf von Heroin groß geworden. Abbott habe ihm den Zugang zu unveröffentlichten Studien der Arzneimittelbehörden verweigert, die die Gefährlichkeit eines Schlankheitsmittels belegten. Auch UCB habe Studienergebnisse verheimlicht, und Pfizer habe die Food and Drug Administration belogen und sei in den Vereinigten Staaten wegen der zulassungsüberschreitenden Anwendung von Arzneien zu einer Strafe von 2,3 Milliarden Dollar verurteilt worden. Merck habe mit falschen Behauptungen über ein Arthritis-Medikament den Tod von Tausenden Patienten verursacht. Nach dieser Eröffnung begann er mit seinem Angriff gegen die Industrie.
Sie können sich vorstellen, dass die Sponsoren vor Wut kochten und die Organisatoren peinlich berührt waren. Peter zitiert einen Kollegen, dem es so vorkam, als »habe ich vielleicht ein paar Leute, die unschlüssig waren, eher abgeschreckt«. Aber die meisten Zuhörer waren auf seiner Seite und fanden seine Kritik gerechtfertigt.
Die vielen begeisterten Verfechter der regelmäßigen Mammografie zur Brustkrebsvorsorge sympathisieren vielleicht mit den Sponsoren, weil Peter sie kritisiert und ein Buch über seine Erfahrungen rund um die Mammografie veröffentlicht hat. Mir ist wichtig, dass Peter einer der wenigen Menschen ist, die routinemäßige Mammografien ablehnten, als er mit seinen Nachforschungen begann. Er wurde deswegen heftig angegriffen, behielt aber im Wesentlichen recht.
Als die dänischen Behörden ihn aufforderten, die Belege für den Nutzen der Mammografie zu prüfen, hatte er noch keine bestimmte Meinung dazu. Doch bald stellte er fest, dass ein großer Teil dieser Belege nicht überzeugend war. Sein allgemeines Fazit lautete: Regelmäßige Mammografien können vielleicht einigen Frauen das Leben retten, wenn auch viel seltener, als die Befürworter behaupten, jedoch auf Kosten zahlreicher falsch positiver Diagnosen, die Frauen zu nutzlosen und Angst auslösenden Operationen verleiten. Außerdem werden dabei zu viele harmlose Tumore entdeckt. Der folgende Streit über die routinemäßige Mammografie verlief bitter und feindselig, aber heute könnte man Peters Standpunkt als herrschende Meinung bezeichnen. Sein Buch zu diesem Thema zeigt detailliert auf, wie Wissenschaftler Daten fälschen, um ihre Meinungen zu verteidigen.
Mir ist seit Langem klar, dass Wissenschaftler Menschen sind und keine objektiven Roboter. Darum sind sie vielen menschlichen Schwächen unterworfen. Aber ich war entsetzt über Peters Fallbeispiele zur Mammografie in seinem Buch.
Auch dieses Buch ist zu einem großen Teil ähnlich schockierend. Es zeigt, wie korrupt Wissenschaftler sein können, um eine bestimmte Einschätzung und Beweisführung zu stützen. Geld, Profite, Jobs und das Image korrumpieren am häufigsten.
Peter räumt ein, dass manche Medikamente sehr nützlich sind. Darum schreibt er: »In meinem Buch geht es nicht um die wohlbekannten Vorteile mancher Arzneimittel, zum Beispiel um die großen Erfolge im Kampf gegen Infektionen, Herzkrankheiten, einige Krebsarten und Hormonmangelzustände wie Diabetes Typ 1.« Manche Leser mögen das für unzureichend halten; doch Peter legt Wert darauf, dass dieses Buch vom Scheitern des ganzen Systems handelt, von der Art und Weise, wie Medikamente entwickelt, produziert, vermarktet und überwacht werden. Es ist kein Buch über den Nutzen von Arzneien.
Viele Leser dieses Buches werden fragen, ob Peter übertreibt, wenn er die Aktivitäten der Pharmaindustrie mit dem organisierten Verbrechen vergleicht. Das amerikanische Recht definiert organisiertes Verbrechen als wiederholte Straftaten bestimmter Art, zum Beispiel Erpressung, Betrug, Drogenhandel, Bestechung, Unterschlagung, Behinderung der Justiz und der Polizei, Beeinflussung von Zeugen und Korruption in der Politik. Peter legt Beweise vor, meist in allen Details, um seine Behauptung zu untermauern, dass Pharmakonzerne die meisten dieser Straftaten begehen.
Und er ist nicht der Erste, der diese Industrie mit dem organisierten Verbrechen vergleicht. Er zitiert einen ehemaligen Vizepräsidenten bei Pfizer mit den Worten:
Die Ähnlichkeit zwischen dieser Industrie und dem organisierten Verbrechen ist beängstigend. Die Mafia verdient unverschämt viel Geld, diese Industrie ebenfalls. Die Nebenwirkungen des organisierten Verbrechens sind Morde und Tote, und das sind auch die Nebenwirkungen dieser Industrie. Die Mafia besticht Politiker und andere Leute, die Pharmakonzerne tun das ebenfalls.
Auf jeden Fall gerät die Industrie häufig mit dem Gesetz in Konflikt, und Firmen wurden zu Milliardenstrafen verurteilt. Peter nimmt sich die größten zehn Unternehmen im Detail vor, doch es gibt noch viele andere. Wahr ist auch, dass sie immer wieder Straftaten begehen, vielleicht mit dem Kalkül, dass sie mit Gesetzesverstößen trotz der Strafen hohe Gewinne erzielen können. Man kann die Strafzahlungen als »Geschäftsausgaben« betrachten, so wie Heizung, Strom und Miete.
Die Industrie tötet viele Menschen, viel mehr als das organisierte Verbrechen. Hunderttausende sterben jedes Jahr an verschreibungspflichtigen Medikamenten. Viele halten das für nahezu unvermeidlich, weil diese Arzneimittel gegen Krankheiten eingesetzt werden, die ihrerseits tödlich sind. Aber ein Gegenargument lautet: Der Nutzen der Medikamente wird übertrieben, und die Belege für ihre Wirksamkeit werden häufig gefälscht. Dieses »Verbrechen« kann man der Industrie getrost vorwerfen.
Ein bekanntes Wort des großen Arztes William Osler lautet, es wäre gut für die Menschheit und schlecht für die Fische, würfe man alle Medikamente ins Meer. Das sagte er vor der therapeutischen Revolution Mitte des 20. Jahrhunderts, der wir Penicillin, andere Antibiotika und viele weitere wirksame Arzneimittel verdanken. Dennoch stimmt Peter weitgehend mit ihm überein, wenn er spekuliert, es ginge uns ohne die meisten Psychopharmaka besser, da ihr Nutzen gering, der von ihnen angerichtete Schaden erheblich und ihr Konsum enorm sei.
Der größte Teil dieses Buches trägt Beweismaterial dafür zusammen, dass die Pharmakonzerne die Wissenschaft systematisch korrumpieren, indem sie den Nutzen ihrer Medikamente übertreiben und den Schaden herunterspielen. Als Epidemiologe, der über eine enorme Erfahrung im Umgang mit Zahlen ebenso wie über eine Leidenschaft fürs Detail verfügt, und als weltweit führender Kritiker klinischer Studien steht Peter auf sehr festem Boden. Zusammen mit vielen anderen, unter ihnen ehemalige Herausgeber des New England Journal of Medicine, deckt er dunkle Machenschaften auf. Er weist nach, dass die Industrie Ärzte, Akademiker, Fachzeitschriften, Berufs- und Patientenorganisationen, Hochschulinstitute, Journalisten, Kontrolleure und Politiker kauft. Das sind Mafiamethoden.
Dieses Buch spricht auch Ärzte und Akademiker nicht frei. Man könnte argumentieren, dass Pharmakonzerne tun, was man von ihnen erwartet, wenn sie die Profite ihrer Aktionäre mehren. Ärzte und Akademiker sollten jedoch moralischer handeln. Gesetze, die Firmen vorschreiben, Zahlungen an Ärzte offenzulegen, beweisen, dass sehr viele Ärzte eng mit der Pharmaindustrie verbunden sind und dass viele von ihnen sechsstellige Geldbeträge dafür erhalten, dass sie Unternehmen beraten oder in ihrem Auftrag Vorträge halten. Man kann sich der Schlussfolgerung nur schwer entziehen, dass diese wichtigen Meinungsmacher gekauft werden. Sie sind Söldner der Industrie.
Und wehe dem, der Missstände aufdeckt oder gegen die Industrie aussagt. Peter berichtet von mehreren Informanten, die gejagt wurden, und John le Carrés Roman Der ewige Gärtner über die Skrupellosigkeit von Pharmakonzernen wurde ein Bestseller und ein erfolgreicher Hollywoodfilm. Es ist wie bei der Mafia.
Darum ist es nicht ganz unrealistisch, die Pharmakonzerne mit dieser zu vergleichen. Auch die Öffentlichkeit ist trotz ihrer Begeisterung für Medikamente skeptisch gegenüber der Pharmaindustrie. In einer Umfrage in Dänemark landete die Pharmaindustrie auf dem vorletzten Platz, als die Teilnehmer gefragt wurden, welchen Unternehmen sie vertrauten. In einer amerikanischen Umfrage bildete die Pharmaindustrie zusammen mit den Tabak- und Ölkonzernen das Schlusslicht. Der Arzt und Autor Ben Goldacre äußert in seinem Buch Die Pharma-Lüge den interessanten Gedanken, dass Ärzte es inzwischen für »normal« halten, mit der Pharmaindustrie Verbindungen zu unterhalten, die in den Augen der Öffentlichkeit – falls sie darüber aufgeklärt wird – als völlig unakzeptabel gelten. In Großbritannien könnten die Ärzte bald ebenso in Ungnade fallen wie Journalisten, Parlamentsabgeordnete und Banker, weil sie nicht einsehen wollen, wie korrupt sie geworden sind. Derzeit neigt die Öffentlichkeit noch dazu, Pharmakonzernen zu misstrauen, aber Ärzten zu trauen; doch dieses Vertrauen könnte schnell verloren gehen.
Peters Buch handelt jedoch nicht nur von Problemen. Er schlägt auch Lösungen vor, von denen einige größere Erfolgsaussichten haben als andere. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass Pharmaunternehmen verstaatlicht werden; aber es ist wahrscheinlich, dass alle Daten, die für die Zulassung von Medikamenten notwendig sind, demnächst öffentlich zugänglich sein werden. Die Unabhängigkeit der Überwacher sollte gestärkt werden. Manche Länder könnten versucht sein, Medikamente häufiger von öffentlichrechtlichen Instanzen bewerten zu lassen, und immer mehr Menschen setzen sich dafür ein, die finanziellen Verbindungen zwischen Pharmaunternehmen und Ärzten, Berufsverbänden, Patientengruppen und Fachzeitschriften aufzudecken. Der Umgang mit Interessenkonflikten muss auf jeden Fall besser werden. Vielleicht wird die Vermarktung weiter eingeschränkt, und der Widerstand gegen Direktwerbung beim Konsumenten wächst.
Die Kritiker der Pharmaindustrie werden zahlreicher, ihr Ansehen und ihre Entschlossenheit wachsen zusehends. Indem er diese Industrie mit dem organisierten Verbrechen vergleicht, übertrifft Peter sie alle. Ich hoffe, dass die Kühnheit dieses Vergleichs niemanden von der Lektüre dieses Buches abschreckt. Vielleicht wird diese ungeschönte Botschaft nützliche Reformen einleiten.
Dr. med. Richard Smith, ehemaliger Herausgeber des British Medical Journal
Vorwort von Drummond Rennie
Empörung, die sich auf Beweise stützt
Es gibt bereits Hunderte von wissenschaftlichen Studien und zahlreiche Bücher, die enthüllen, wie Pharmaunternehmen wissenschaftliche Methoden pervertieren und, mit enormen Finanzmitteln im Rücken, allzu oft gegen die Interessen der Patienten verstoßen, denen sie angeblich helfen wollen. Auch ich habe zu diesem Stapel von Veröffentlichungen beigetragen. Was also ist neu an diesem Buch, und was verdient Ihre Aufmerksamkeit?
Die Antwort ist einfach: die einzigartigen wissenschaftlichen Fähigkeiten des Autors, seine Forschungen, seine Integrität, seine Wahrhaftigkeit und sein Mut. Kein anderer verfügt über so viel Erfahrung wie er. Peter Gøtzsche hat für Pharmaunternehmen gearbeitet, teils als Vertreter, der Ärzten Tabletten andiente, teils als Produktleiter. Er ist Arzt und Forscher und hat sich als Leiter des Nordic Cochrane Centre einen ausgezeichneten Ruf erworben. Wenn er über Voreingenommenheit spricht, kann er sich also auf eine jahrzehntelange sorgfältige Forschungstätigkeit stützen, deren Ergebnisse mittels Peer-Review geprüft und in Fachzeitschriften veröffentlicht wurden. Er weiß über die Verzerrung von Statistiken und die Analyse von klinischen Studien genau Bescheid und hat als einer der Ersten systematische und strenge Methoden und Metaanalysen entwickelt, um die Befunde klinischer Studien zu überprüfen und anhand von strengen Kriterien die tatsächliche Wirksamkeit von Medikamenten und Tests zu ermitteln. Er ist oft unangenehm hartnäckig, verfolgt aber immer eine wissenschaftliche Beweisführung.
Darum vertraue ich darauf, dass Gøtzsches Angaben stimmen. Mein Vertrauen gründet auf soliden Beweisen und auf Erfahrungen, die ich im Laufe von Jahrzehnten sammelte, als ich untersuchte, welchen Einfluss Pharmaunternehmen auf meine Kollegen in der klinischen Forschung und auf die Öffentlichkeit haben. Zudem vertraue ich Gøtzsche, weil ich weiß, dass er recht hat, wenn er über Ereignisse schreibt, die ich selbst bestätigen kann.
Mein letzter Grund dafür, dass ich Gøtzsche vertraue, hat etwas mit meiner Arbeit als Herausgeber einer großen medizinischen Fachzeitschrift zu tun. Herausgeber prüfen die Berichte der Forschungsinstitute als Erste. Sie oder die Gutachter merken es, wenn Artikel, die ihnen vorgelegt werden, voreingenommen sind; außerdem werden ihnen Beschwerden und Beschuldigungen vorgelegt.
Ich habe mehrere, oft entrüstete Leitartikel geschrieben, die unethisches Verhalten von Forschern und deren Sponsoren entlarvten. Mindestens drei Herausgeber, die ich gut kenne, Dr. Jerome Kassirer und Marcia Angell (The New England Journal of Medicine) sowie Richard Smith (British Medical Journal) haben Bücher geschrieben, in denen sie ihre Bestürzung über den Umfang des Problems ausdrücken. Andere Herausgeber, zum Beispiel Fiona Godlee vom British Medical Journal, haben wortgewandt über den korrumpierenden Einfluss des Geldes geschrieben und gezeigt, welche negativen Auswirkungen es auf die Behandlung von Patienten und auf die Kosten hat.
Ich möchte nicht so tun, als könne ich die Wahrheit aller von Gøtzsche vorgetragenen Fakten bezeugen – dies ist ein Vorwort, kein Gutachten. Aber das allgemeine Bild, das er zeichnet, ist mir sehr vertraut. Vielleicht ist seine Darstellung überspitzt; doch meine eigenen deprimierenden Erfahrungen sowie die Erfahrungen anderer Herausgeber und Forscher, die ich persönlich kenne, bestätigen mir, dass er recht hat.
In einem Vortrag vor einer Gruppe von Richtern erwähnte ich, dass klinische Forscher und Juristen das gleiche Wort, nämlich trial, für zwei Arten von Verfahren benutzen: für Gerichtsverfahren und für das wissenschaftliche Verfahren in Form von Studien. Als Mediziner musste ich einräumen, dass Verfahren im juristischen Sinne in der Regel fairer sind und sich auf einer ethisch solideren Grundlage abspielen als klinische Studien (Gøtzsche zitiert das auf Seite 108).
Gøtzsche macht Vorschläge und fordert eine Revolution. Meiner Meinung nach wird nichts helfen, es sei denn, wir trennen die Durchführung und Bewertung von klinischen Studien vollständig von ihrer Finanzierung. Da wir unsere Therapien auf die Ergebnisse klinischer Studien stützen, geht es hier um Leben oder Tod. Patienten, die an Studien teilnehmen, erwarten, dass ihr Opfer der Menschheit nützt. Sie rechnen nicht damit, dass die Ergebnisse wie Geschäftsgeheimnisse behandelt und manipuliert werden. Diese Resultate sind öffentliches Eigentum. Darum sollten sie allen Menschen zur Verfügung stehen und vom Staat finanziert werden – aus den Steuern, die Pharmaunternehmen zahlen. Heute stehen wir in den USA vor einer grotesken Situation, denn die Pharmakonzerne bezahlen die Behörde (die FDA), die ihre Projekte beurteilt. Ist es da noch eine Überraschung, dass diese Behörde der Industrie zu Diensten ist, die sie eigentlich überwachen sollte?
Ich hoffe, Sie ziehen nach der Lektüre dieses Buches Ihre eigenen Schlüsse. Meiner lautet: Wenn Gøtzsche über das Verhalten der Akademiker und der Industrie wütend ist, hat er ein Recht dazu. Was wir brauchen, ist mehr Unterstützung für seine wohlbegründete Empörung.
Dr. med. Drummond Rennie, ehemaliger stellvertretender Herausgeber des Journal of the American Medical Association
Über den Autor
Professor Peter C. Gøtzsche machte 1974 seinen Master of Science in Biologie und Chemie und legte 1984 sein medizinisches Examen ab. Er ist Facharzt für Innere Medizin. Von 1975 bis 1983 führte er klinische Studien für Pharmaunternehmen durch und kümmerte sich um die Zulassung von Medikamenten. Von 1984 bis 1995 arbeitete er in verschiedenen Kliniken in Kopenhagen. 1993 war er Mitgründer der Cochrane Collaboration und gründete im selben Jahr das Nordic Cochrane Centre. Im Jahr 2010 ernannte ihn die Universität Kopenhagen zum Professor für Forschungsdesign und Forschungsanalyse.
Peter Gøtzsche hat mehr als 50 Artikel in den »großen Fünf« der medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht (BMJ, The Lancet, JAMA, Annals of Internal Medicine und New England Journal of Medicine), und seine wissenschaftlichen Arbeiten sind bisher mehr als 10 000-mal zitiert worden.
Peter Gøtzsche befasst sich mit Statistik und Forschungsmethodik. Er ist Mitglied mehrerer Arbeitskreise, die Richtlinien für gute Forschungsberichte herausgeben, und ist Koautor des CONSORT-Statements für randomisierte Studien (www.consort-statement.org), des STROBE-Statements für Beobachtungsstudien (www.strobe-statement.org), des PRISMA-Statements für systematische Übersichten und Metaanalysen (www.prisma-statement.org) und des SPIRIT-Statements für Mindeststandards bei Studien (www.spirit-statement.org). Außerdem war er Herausgeber der Cochrane Methodology Review Group.
Bücher von Peter Gøtzsche
Gøtzsche, P. C.: Impfen – Für und Wider. München: riva Verlag, 2021
Gøtzsche, P. C.: Gute Medizin, schlechte Medizin. München: riva Verlag, 2018
Gøtzsche, P. C.: Tödliche Psychopharmaka und organisiertes Leugnen. München: riva Verlag, 2016
Gøtzsche, P. C.: Mammography Screening: truth, lies and controversy. London: Radcliffe Publishing, 2012
Gøtzsche, P. C.: Rational Diagnosis and Treatment: evidence-based clinical decision-making. 4. Aufl. Chichester: Wiley, 2007
Gøtzsche, P. C.: På Safari i Kenya [Auf Safari in Kenia]. Kopenhagen: Samlerens Forlag, 1985
Wulff, H. R., Gøtzsche, P. C.: Rationel klinik. Evidensbaserede diagnostiske og terapeutiske beslutninger [Vernünftige klinische Praxis. Evidenzbasierte Diagnostik und therapeutische Entscheidungen]. 5. Aufl. Kopenhagen: Munksgaard Danmark, 2006.
Einführung
Infektionen und parasitäre Krankheiten, die großen Seuchen, die einst viele Todesopfer forderten, sind heute in den meisten Ländern unter Kontrolle. Wir haben gelernt, Aids, Cholera, Malaria, Masern, Pest und Tuberkulose zu verhüten und zu behandeln, und wir haben die Pocken ausgerottet. An Aids und Malaria sterben immer noch sehr viele Menschen, aber nicht deshalb, weil wir nicht wissen, wie wir mit diesen Infektionen umgehen müssen. Es liegt eher an Einkommensunterschieden und an den enorm teuren lebensrettenden Medikamenten für Menschen in armen Ländern.
Allerdings leiden wir nun an zwei Seuchen, die wir selbst gemacht haben: Tabak und verschreibungspflichtige Medikamente. Beide sind extrem schädlich.
In den Vereinigten Staaten und Europa sind Medikamente die dritthäufigste Todesursache nach Herzkrankheiten und Krebs.
Ich werde in diesem Buch erklären, warum das so ist und was wir dagegen tun können. Wären diese Todesfälle nicht die Folge von Medikamentenkonsum, sondern einer Infektion, einer Herzkrankheit oder einer durch Umweltverschmutzung verursachten Krebsart, würden zahllose Patientenorganisationen Geld sammeln, um das Übel zu bekämpfen, und es gäbe umfangreiche politische Initiativen. Es fällt mir schwer zu verstehen, warum niemand etwas unternimmt, wenn Menschen durch Medikamente sterben.
Die Tabak- und die Pharmaindustrie haben vieles gemeinsam. Die moralisch abstoßende Missachtung von Menschenleben ist die Norm. Die Tabakfirmen sind stolz darauf, dass ihre Umsätze in wehrlosen Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen zunehmen. Ohne eine Spur von Scham berichtete das Management von Imperial Tobacco im Jahr 2011 seinen Aktionären, das britische Unternehmen habe einen Preis für verantwortungsbewusste Unternehmensführung erhalten.1 Die Tabakfirmen sehen »viele Chancen … unser Geschäft auszubauen«, also »zu verkaufen, süchtig zu machen und zu töten«, wie The Lancet schrieb. Dies sei »mit Sicherheit das grausamste und korrupteste Geschäftsmodell, das Menschen sich ausdenken können«.1
Die Manager der Tabakindustrie wissen, dass sie den Tod feilbieten, und die Manager der Pharmaunternehmen wissen das auch. Es ist nicht mehr zu bestreiten, dass Tabakkonsum eine der häufigsten Todesursachen ist, dennoch gelingt es der Pharmaindustrie erstaunlich gut, die Tatsache zu verbergen, dass für ihre Produkte das Gleiche gilt. In diesem Buch werde ich nachweisen, dass Pharmaunternehmen die tödlichen Nebenwirkungen ihrer Medikamente bewusst und arglistig verschweigen, sowohl in der Forschung als auch beim Marketing, und dass sie standhaft Tatsachen leugnen, mit denen sie konfrontiert werden. So wie die Vorstandsvorsitzenden der Tabakfirmen, die 1994 bei einer Anhörung vor dem amerikanischen Kongress bestritten, dass Nikotin süchtig macht, obwohl sie seit Jahrzehnten wussten, dass dies eine Lüge ist.2 Der Tabakriese Philip Morris rief ein Forschungsinstitut ins Leben, das die Risiken des Passivrauchens dokumentierte; doch obwohl mehr als 800 wissenschaftliche Berichte erstellt wurden, veröffentlichte das Unternehmen keinen einzigen von ihnen.2
Beide Industrien haben ihre Handlanger. Wenn seriöse Forscher nachweisen, dass ein Produkt gefährlich ist, tauchen plötzlich zahlreiche Studien auf, die das Gegenteil behaupten. Das verwirrt die Öffentlichkeit, weil – so formulieren es Journalisten – »die Wissenschaftler sich uneins sind«. Diese Industrie des Zweifels verleitet die Menschen höchst geschickt dazu, schädliche Wirkungen zu ignorieren – sie erkauft Zeit, während immer mehr Menschen sterben.
Das ist Korruption. Dieses Wort hat viele Bedeutungen. Ich stimme meinem Wörterbuch zu, das Korruption als moralischen Verfall definiert. Eine weitere Bedeutung ist Bestechung, also eine geheime Zahlung, meist in bar, für eine Leistung, die anderenfalls nicht erbracht werden würde, zumindest nicht so schnell. Im Gesundheitssystem hat Korruption, wie wir noch sehen werden, viele Gesichter. Unter anderem verstehe ich darunter die Bezahlung scheinbar edler Dienste, die möglicherweise nur ein Vorwand für Geldleistungen an einen Großteil der Ärzte ist.
Die Charaktere in Aldous Huxleys Roman Schöne neue Welt (1932) schlucken jeden Tag Somatabletten, um ihr Leben im Griff zu haben und unangenehme Gedanken zu vertreiben. In den Vereinigten Staaten rufen TVWerbespots die Zuschauer dazu auf, genau das Gleiche zu tun, indem sie deprimierte Menschen zeigen, die nach Einnahme der angepriesenen Pille schlagartig wieder leistungsfähig und glücklich werden.3 Wir haben Huxleys wildeste Träume bereits weit übertroffen und nehmen immer mehr Medikamente ein. In Dänemark werden beispielsweise derart viele Arzneimittel konsumiert, dass jeder kranke oder gesunde Einwohner rechnerisch von der Wiege bis zur Bahre ständig 1,4 Tagesdosen von Medikamenten zu sich nimmt. Obwohl viele Medikamente Leben retten, liegt der Verdacht nahe, dass es schädlich ist, unsere Gesellschaft in diesem Ausmaß mit ihnen zu traktieren. Ich werde nachweisen, dass dieser Verdacht berechtigt ist.
Was ist der Hauptgrund dafür, dass wir so viele Arzneimittel konsumieren? Nun, die Pharmaunternehmen verkaufen keine Medikamente, sondern Lügen über Medikamente. Und sie lügen unverfroren weiter, selbst wenn ihre Behauptungen widerlegt wurden. Insofern unterscheiden sich Medikamente von allen anderen Produkten. Wenn wir ein Auto oder ein Haus kaufen wollen, können wir meist selbst beurteilen, ob das Angebot günstig ist oder nicht; doch wenn jemand uns ein Medikament anbietet, besteht diese Möglichkeit nicht. Fast alles, was wir über Medikamente wissen, entnehmen wir den Informationen, die wir oder unsere Ärzte von den Pharmafirmen erhalten. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle erklären, was ich unter einer Lüge bzw. einem Lügner verstehe. Eine Lüge ist eine Aussage, die nicht wahr ist; doch ein Mensch, der eine Lüge ausspricht, ist nicht unbedingt ein Lügner. Leute, die Medikamente verkaufen, geben viele Lügen von sich, aber sie wurden häufig von ihren Vorgesetzten getäuscht, die ihnen die Wahrheit bewusst vorenthalten (und daher meiner Meinung nach Lügner sind). In seinem hübschen Büchlein Bullshit erklärt der Moralphilosoph Harry G. Frankfurt, eines der auffallendsten Merkmale unserer Kultur sei der viele »Bockmist«, der seiner Ansicht nach der Lüge nahekommt.
In meinem Buch geht es nicht um die wohlbekannten Vorteile mancher Arzneimittel, zum Beispiel um die großen Erfolge im Kampf gegen Infektionen, Herzkrankheiten, einige Krebsarten und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes Typ 1. Das Buch handelt vom Versagen des gesamten Systems, dessen Ursachen weit verbreitete Kriminalität, Korruption und unzulängliche Überwachung von Medikamenten sind. Wir brauchen radikale Reformen. Manche Leser werden mein Buch einseitig und polemisch finden, doch ist es nicht sehr sinnvoll zu beschreiben, was in einem System, das sich der Kontrolle der Öffentlichkeit entzieht, gut funktioniert. Wenn ein Kriminologe eine Studie über Straßenräuber durchführt, erwartet niemand eine »ausgewogene Darstellung«, die erwähnt, dass viele Räuber fürsorgliche Familienväter sind.4
Wenn Sie nicht glauben, dass das System aus den Fugen geraten ist, schicken Sie mir bitte eine E-Mail, in der Sie mir erklären, warum Medikamente die dritthäufigste Todesursache in jenen Teilen der Welt sind, in denen der Arzneimittelverbrauch am höchsten ist. Würde eine neue Bakterie oder ein Virus eine derart gefährliche Epidemie oder auch nur ein Hundertstel davon verursachen, würden wir alles in unserer Macht Stehende tun, um die Erreger zu bekämpfen. Die Tragödie besteht darin, dass wir unsere Arzneimittelepidemie leicht in den Griff bekommen könnten, doch unsere Politiker, die die Macht hätten, etwas zu verändern, tun so gut wie nichts. Selbst wenn sie handeln, verschlimmern sie die Situation meist noch, weil die Lobbyisten der Pharmaindustrie sie derart bearbeitet haben, dass sie alle verführerischen Mythen glauben. Ich werde diese Mythen in diesem Buch entlarven.
Das Hauptproblem unseres Gesundheitssystems sind die finanziellen Anreize, die es in Gang halten. Sie verhindern einen vernünftigen, wirtschaftlichen und ungefährlichen Umgang mit Medikamenten. Die Pharmaindustrie floriert dabei und hat die Informationen voll unter Kontrolle. Die wissenschaftliche Literatur über Medikamente wird durch Studien mit fehlerhaftem Design und unzutreffenden Analysen sowie durch selektive Veröffentlichung von Studien und Daten, Unterdrückung unerwünschter Ergebnisse und durch von Ghostwritern verfasste Artikel systematisch verfälscht. Ghostwriter erhalten Geld dafür, dass sie Artikel schreiben, ohne ihre Identität preiszugeben, und dann treten einflussreiche Ärzte als die Autoren auf, obwohl sie wenig oder gar nichts zum Text beigetragen haben. Auf diese unwissenschaftliche Weise wird für Medikamente geworben.
Verglichen mit anderen Branchen betrügt niemand die US-Regierung so häufig wie die Pharmaindustrie – sie stellt falsche Behauptungen (über die Wirksamkeit) auf und verstößt damit gegen den False Claims Act.5 Die Öffentlichkeit scheint über die Pharmaindustrie Bescheid zu wissen. In einer Meinungsumfrage, bei der 5000 Dänen gebeten wurden, 51 Branchen zu benoten, wie viel Vertrauen sie ihnen entgegenbrachten, landete die Pharmaindustrie auf dem vorletzten Platz, nur Autowerkstätten schnitten schlechter ab.6 In einer ähnlichen amerikanischen Erhebung wurde die Pharmaindustrie mit den Tabak- und Ölkonzernen Letzte.7 Im Jahr 1997 glaubten laut einer Umfrage 79 Prozent der amerikanischen Bürger, die Pharmaindustrie leiste gute Arbeit. Im Jahr 2005 waren nur noch 21 Prozent dieser Meinung.8 Ein ungewöhnlich schneller Verlust des öffentlichen Vertrauens!
Vor diesem Hintergrund erscheint es etwas widersprüchlich, dass Patienten großes Vertrauen in die Medikamente haben, die ihre Ärzte ihnen verschreiben. Aber ich bin sicher, dass die Patienten einfach ihr Vertrauen zu ihren Ärzten auf die verordneten Medikamente übertragen. Den Patienten ist nicht klar, dass ihre Ärzte zwar eine Menge über Krankheiten, Physiologie und Psychologie wissen, aber sehr, sehr wenig Informationen über Medikamente haben, die nicht von der Pharmaindustrie sorgfältig zusammengestellt und geschönt wurden. Sie wissen auch nicht, dass ihre Ärzte möglicherweise ein Eigeninteresse daran haben, bestimmte Medikamente zu verordnen, oder dass viele Verbrechen der Pharmaindustrie ohne Mitwirkung von Ärzten nicht möglich wären.
Es ist schwer, ein System zu ändern, und es ist keine Überraschung, dass Menschen, die mit einem fehlerhaften System leben müssen, das Beste daraus machen wollen, obwohl das oft dazu führt, dass wohlmeinende Leute das Falsche tun. Viele Manager der Pharmaunternehmen können diese Ausrede jedoch nicht vorbringen, denn sie belügen Ärzte, Patienten, Behörden und Gerichte vorsätzlich.
Ich widme dieses Buch den vielen ehrlichen Menschen in den Pharmaunternehmen, die über die kriminellen Handlungen ihrer Vorgesetzten und deren Folgen für Patienten und unsere Wirtschaft genauso empört sind wie ich. Einige dieser Insider erklärten mir gegenüber, ihre höchsten Vorgesetzten gehörten ins Gefängnis, weil die Drohung mit Haft die einzige Möglichkeit sei, sie von weiteren Straftaten abzuschrecken.
Geständnisse eines Insiders
»Nimm jeden Tag zwei Vitamintabletten, eine grüne und eine rote«, sagte meine Mutter. Ich war damals erst acht Jahre alt; trotzdem fragte ich:
»Warum?«
»Weil sie gut für dich sind.«
»Woher weißt du das?«
»Großvater hat es gesagt.«
Ende der Debatte. Großvater besaß eine Menge Autorität. Er war praktischer Arzt, er war klug, und darum hatte er recht. Als ich Medizin studierte, fragte ich ihn einmal, ob er einige seiner Lehrbücher aufgehoben habe. Ich wollte sie mit meinen Büchern vergleichen und schauen, welche Fortschritte es in den letzten 50 Jahren gegeben hatte. Seine Antwort verblüffte mich. Er hatte alle seine Bücher kurz nach seiner Approbation jüngeren Studenten geschenkt. Er glaubte, er brauche sie nicht mehr, weil er alles wisse, was sie enthielten!
Ich hatte großen Respekt vor meinem Großvater und seinem vorzüglichen Gedächtnis, aber ich bin von Natur aus skeptisch. Wir konnte er so sicher sein, dass die Tabletten gut für mich waren? Zudem schmeckten und rochen die Tabletten trotz ihres Zuckerüberzugs grässlich – wenn ich die Flaschen öffnete, kam ich mir vor wie in einer Apotheke.
Ich hörte auf, die Tabletten zu nehmen, und zweifellos fand meine Mutter heraus, warum die Packung nicht leer wurde. Aber sie versuchte nicht, mich dazu zu zwingen.
Ende der fünfziger Jahre sah alles so einfach aus. Da Vitamine für uns lebenswichtig sind, musste es gut sein, Vitamintabletten zu schlucken, um sicherzustellen, dass wir hinreichend mit den Wirkstoffen versorgt waren, die wir brauchten. Aber Biologie ist selten einfach. Der Mensch hat sich im Laufe von Millionen Jahren zum Homo sapiens entwickelt, der an seine Umwelt sehr gut angepasst ist. Wenn wir uns ausgewogen ernähren, dürfen wir also erwarten, genügend Vitamine und andere Mikronährstoffe aufzunehmen. Hätten einige unserer Vorfahren an Vitaminmangel gelitten, wäre ihre Chance, ihre Gene zu reproduzieren, geringer gewesen als bei jenen, die weniger Vitamine brauchten oder sie besser resorbierten.
Wir brauchen auch Mineralien, zum Beispiel Zink und Kupfer, damit unsere Enzyme ihre Aufgaben erfüllen können. Aber wenn wir zu viel davon aufnehmen, sind sie giftig. Nach allem, was wir über den menschlichen Körper wissen, können wir also nicht davon ausgehen, dass Vitamintabletten gesund sind. Dies ist meine älteste Erinnerung an eine vorbeugende medizinische Maßnahme, und es dauerte etwa 50 Jahre, bis man herausfand, ob Vitamine nützlich oder schädlich sind. Eine Analyse der placebokontrollierten Studien über Antioxidantien (Betacarotin, Vitamin A und Vitamin E) belegte im Jahr 2008, dass sie die Gesamtsterblichkeit erhöhen.1
Eine andere Kindheitserinnerung illustriert, wie schädlich und irreführend die Vermarktung von Medikamenten ist. Weil das Wetter in Dänemark oft schlecht ist, zogen meine Eltern – sie waren Lehrer mit langen Ferien – jeden Sommer in den Süden, anfangs nur nach Deutschland und in die Schweiz, aber selbst dort machten wir einige unangenehme Erfahrungen mit schlechtem Wetter und Platzregen, was nur sehr bedingt Vergnügen bereitet, wenn man gerade in einem Zelt haust. Also wurde Norditalien unser nächstes Ziel. Mein Großvater gab uns für alle Fälle Enterovioform (Clioquinol) gegen Durchfall mit. Dieses Medikament kam 1934 auf den Markt, und man wusste sehr wenig darüber.2 Mein Großvater wusste damals nicht – und der Pharmavertreter der schweizerischen Firma Ciba hatte ihm nicht gesagt –, dass dieses Arzneimittel nur gegen Durchfälle wirkte, die von Protozoen (Amöben und Giardia) oder Shigella-Bakterien verursacht wurden, und dass selbst diese Wirkung umstritten war, weil es keine randomisierten Studien gab, die das Medikament mit einem Placebo verglichen hätten. Zudem war es unwahrscheinlich, dass wir uns in Italien mit diesen Organismen infizieren würden. Reisedurchfall wird fast immer von anderen Bakterien – nicht von Shigellen – oder von Viren verursacht.
Wie viele andere Allgemeinärzte, selbst heutzutage, schätzte mein Großvater die Besuche der Pharmavertreter. Aber er war das Opfer fragwürdiger Marketingmethoden, die dazu führten, dass das Medikament sehr häufig eingenommen wurde.3 Ciba brachte Clioquinol auf den Markt, um Amöbenruhr zu bekämpfen,2 doch als die Firma 1953 in den lukrativen japanischen Markt vordrang, vertrieb sie Clioquinol bereits weltweit als Mittel gegen alle Formen von Durchfall. Das Medikament ist neurotoxisch und löste in Japan eine Katastrophe aus: 10 000 Menschen erkrankten bis 1970 an subakuter myelooptischer Neuropathie (SMON).2 SMON-Opfer litten an einem Kribbeln in den Füßen, das nach einiger Zeit zum Totalverlust der Empfindung und zur Lähmung der Füße und Beine führte. Manche erblindeten oder litten an anderen schweren Sehstörungen.
Die Firma Ciba, später Ciba-Geigy und heute Novartis, kannte die schädlichen Nebenwirkungen, verschwieg sie aber viele Jahre lang.4 Als die Katastrophe in Japan ans Licht kam, veröffentlichte Ciba Stellungnahmen, die das Medikament verteidigten. Das Unternehmen behauptete, Clioquinol könne nicht die Ursache von SMON sein, weil es fast unlöslich sei und vom Körper nicht resorbiert werde.2 Anwälte, die einen Prozess gegen das Unternehmen vorbereiteten, fanden jedoch verstörende Beweise dafür, dass die Arznei doch resorbiert wurde. Auch das wusste die Firma. Schon 1944 empfahlen die Erfinder des Medikaments nach Tierversuchen, die Verabreichung von Clioquinol streng zu überwachen und sie auf zwei Wochen zu beschränken.
Im Jahr 1965 veröffentlichte ein schweizerischer Tierarzt Befunde, nach denen Hunde, die man mit Clioquinol behandelt hatte, an akuten epileptischen Krämpfen gestorben waren. Raten Sie mal, wie Ciba darauf reagierte. Die Firma warnte in England auf Beipackzetteln davor, das Medikament Tieren zu verabreichen!
Im Jahr 1966 untersuchten zwei schwedische Kinderärzte einen dreijährigen Jungen, der mit Clioquinol behandelt worden war und an schweren Sehstörungen litt. Sie veröffentlichten ihren Befund in einer Fachzeitschrift und informierten auch Ciba darüber, dass Clioquinol resorbiert wurde und den Sehnerv schädigen konnte. Diese Vorfälle, einschließlich der Katastrophe in Japan, hatten keine erkennbaren Auswirkungen auf die Politik des Unternehmens, das die Vermarktung auf der ganzen Welt fortsetzte. Im Jahr 1976 war Clioquinol nach wie vor fast überall als frei verkäufliches Medikament für die Vorbeugung gegen und die Behandlung von Reisedurchfall erhältlich, obwohl es keine Beweise für seine Wirkung gab.3 Beipackzettel in 35 Ländern wiesen erhebliche Unterschiede auf, was die Dosierung, die Behandlungsdauer, Gegenanzeigen, Nebenwirkungen und Warnungen anbelangt. Es herrschte ein totales Chaos.
Bis 1981 hatte Ciba-Geigy 490 Millionen Dollar an japanische SMON-Opfer gezahlt, aber erst 1985 nahm die Firma das Medikament vom Markt, 15 Jahre, nachdem es sich als Ursache der SMON-Katastrophe herausgestellt hatte und vom japanischen Gesundheitsministerium verboten worden war.
Die Geschichte illustriert zugleich das allzu häufige Versagen der Aufsichtsbehörden, die hätten eingreifen müssen, aber nichts unternahmen.
Ein Drittel meiner Kindheitserinnerungen an die Medikamente, die mein Großvater verwendete, betrifft Corticosteroide. Als man das kurz zuvor synthetisierte Cortison im Jahr 1948 in der Mayo-Klinik in Rochester zum ersten Mal 14 Patienten mit rheumatoider Arthritis gab, geschah ein Wunder.5 Die Ergebnisse waren so erstaunlich, dass manche Leute glaubten, ein Heilmittel für rheumatoide Arthritis sei gefunden worden. Corticosteroide sind auch bei vielen anderen Krankheiten wirksam, zum Beispiel bei Asthma und Ekzemen. Die anfängliche Begeisterung verflüchtigte sich jedoch rasch, als man die zahlreichen schweren Nebenwirkungen entdeckte.
Mitte der sechziger Jahre brach sich mein Großvater die Hüfte. Der Bruch wollte nicht heilen. Er verbrachte zwei Jahre im Krankenhaus und lag unbeweglich auf dem Rücken. Ein Bein steckte in einem riesigen Gipsverband. Das war vermutlich eine Art Rekord, was Hüftfrakturen anbelangt. Ich erinnere mich nicht mehr genau daran, was er dazu sagte, aber der Grund für seine Probleme war der langjährige Missbrauch von Corticosteroiden. Das Medikament hatte so viele positive Wirkungen, dass er es sogar Gesunden empfahl, um sie zu kräftigen und aufzumuntern. Wie ich in späteren Kapiteln darlegen werde, stirbt der Traum von einem legalen oder illegalen »Wundermittel«, das unsere körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit und unsere Laune verbessert, anscheinend nie.
Damals hielt ich es für sehr wahrscheinlich, dass ein Pharmavertreter meinen Großvater überredet hatte, Corticosteroide zu nehmen. Verkäufer halten sich meist eher bedeckt, was die Risiken der von ihnen vertriebenen Arzneimittel angeht, während sie den Nutzen regelmäßig übertreiben und die Medikamente auch für nicht zugelassene Indikationen empfehlen. Nichts ist lukrativer, als Gesunden die Einnahme von Medikamenten einzureden, die sie nicht brauchen.
Alle meine Kindheitserinnerungen an Medikamente sind negativ. Medikamente, die nützlich sein sollten, schadeten mir. Ich litt an der Reisekrankheit, und mein Großvater gab mir Tabletten dagegen, zweifellos ein Antihistaminikum, das mich schläfrig machte. Ich fühlte mich derart unwohl, dass ich nach wenigen Versuchen entschied, die Arznei sei schlimmer als die Krankheit, und mich weigerte, mehr davon einzunehmen. Stattdessen bat ich ihn anzuhalten, wenn ich mich übergeben musste.
Junge Leute sind unstet, und manchen fällt es schwer, sich für einen Beruf zu entscheiden. Als ich fünfzehn war, verließ ich die Schule, um Radiomechaniker zu werden, weil ich seit einigen Jahren begeisterter Radioamateur war. Mitten im Sommer änderte ich meine Meinung und besuchte von da an das Gymnasium, da ich jetzt davon überzeugt war, Elektroingeneur werden zu wollen. Aber auch diesen Plan gab ich bald auf. Mein Interesse verlagerte sich auf die Biologie, zusammen mit Psychologie eines der beliebtesten Fächer Ende der sechziger Jahre. Wir wussten, dass es in beiden Disziplinen nicht sehr viele Jobs gab, kümmerten uns aber nicht um solche Bagatellen. Also begannen wir mit unserem Studium, und zwar 1968, in dem Jahr, in dem Traditionen auf den Kopf gestellt wurden und die Welt uns zu Füßen lag. Wir sprühten vor Optimismus, und das Wichtigste war, eine eigene Lebensphilosophie zu finden. Nachdem ich Sartre und Camus gelesen hatte, war ich davon überzeugt, dass jeder Mensch eigene Entscheidungen treffen sollte, anstatt eingefahrene Denkmuster, Traditionen und Ratschläge anderer zu übernehmen. Wieder änderte ich meine Meinung und wollte nun Arzt werden.
Schließlich studierte ich beide Fächer. Die Ferien verbrachte ich oft bei meinen Großeltern, und einer dieser Besuche überzeugte mich davon, dass ich meine Zeit nicht damit vergeuden sollte, Arzt zu sein. In meinem letzten Schuljahr hatte mein Großvater mich in seine Praxis eingeladen. Ich wohnte in einem wohlhabenden Viertel von Kopenhagen, wo mir nicht verborgen blieb, dass vieles, worüber die Patienten klagten, kaum der Rede wert war und lediglich Langeweile widerspiegelte. Viele Frauen hatten sehr wenig zu tun. Sie übten nicht nur keinen Beruf aus, sondern verfügten auch noch über Bedienstete, die ihnen halfen, das Haus in Ordnung zu halten. Warum also nicht den freundlichen, gutaussehenden Arzt besuchen – wie in dem Scherz von den drei Frauen, die sich regelmäßig im Wartezimmer begegneten. Eines Tages fehlte eine von ihnen, und eine der anderen fragte, was passiert sei. »Oh«, antwortete die Dritte, »sie kann heute nicht kommen, weil sie krank ist.«
Das Studium der Tiere schien mir sinnvoller zu sein, und ich brachte es im Eiltempo hinter mich, als nähme ich an einem sportlichen Wettkampf teil. Aber ich wusste immer noch nicht, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Die Aussicht, einen Job zu bekommen, war gering, weil ich während des Studiums nicht geforscht hatte und auch keine anderen Projekte vorweisen konnte, die mich für einen Arbeitgeber interessanter gemacht hätten als fünfzig andere Bewerber.
In dieser Situation werden die meisten Leute Lehrer. Das probierte ich ebenfalls, aber es klappte nicht. Kaum hatte ich die Schule verlassen, kehrte ich wieder zurück. Der einzige Unterschied bestand darin, dass ich nun auf der anderen Seite des Lehrerpults stand. Ich war nicht viel älter als meine Schüler und hatte das Gefühl, eher zu ihnen zu gehören als zu meinen neuen Kollegen. Zudem war ich ein unglaublich starker Raucher. Obwohl ich lernte, Pfeife zu rauchen, war ich für diesen Job nicht reif genug, und ich konnte mir nicht vorstellen, ihn 45 Jahre lang auszuüben. Mein Leben wäre vorbei gewesen, ehe es angefangen hätte.
Sechs Monate lang brachte ein anderer Lehrer mir bei, wie man unterrichtet. Zwei Dinge störten mich während dieser Zeit am meisten. Obwohl es hervorragende Biologie-Lehrbücher gab, benutzten wir sie eher selten. Wir befanden uns jetzt in den dunklen siebziger Jahren, in denen die Universitäten und das akademische Leben stark von Dogmen, vor allem vom Marxismus, geprägt waren und man nicht zu oft fragen durfte, ob man dieses oder jenes nicht vielleicht auch anders machen könne. Mein Betreuer wollte, dass ich keine Lehrbücher benutzte, sondern das Unterrichtsmaterial selbst zusammenstellte, angepasst an die Gegenwart. Manche bezeichnen diese Zeit mit Recht als geschichtslose Ära. Also schnitt ich Zeitungsartikel über die Ölindustrie und die Umweltverschmutzung aus und verbrachte endlose Stunden am Kopierer, wo ich meine eigenen Handbücher mit »neuesten Nachrichten« zusammenstellte. Ich behaupte nicht, dass diese Themen uninteressant oder unwichtig sind, aber mein Fach war die Biologie, die auf Millionen Jahre zurückblickt. Warum also diese rastlose Beschäftigung mit Ereignissen vom Vortag?
Das zweite Problem war die vorherrschende Mode in der Pädagogik, die verlangte, dass ich vor jeder Unterrichtsstunde genau festhielt, welche Unterrichts- und Teilziele ich anstrebte, welche Methoden ich dabei einsetzen würde, und so weiter. Und zwar schriftlich. Nach der Stunde musste ich meine Leistung analysieren und mit meinem Betreuer besprechen, ob ich alle Ziele erreicht hatte. Natürlich ist es sinnvoll, darüber nachzudenken, was man erreichen will, und die eigene Leistung zu bewerten. Aber es gab so vieles, was mich auslaugte, da ich kein Buchhaltertyp bin. Ich unterrichtete auch Chemie, und in diesem Fach kamen mir die starren Schablonen erst recht übertrieben vor. Es ist einfach, Schülern beizubringen, warum und wie Chemikalien miteinander reagieren. Wie in der Mathematik gibt es auch in der Chemie Fakten und Prinzipien, die man lernen muss, und wenn ein Schüler sie nicht lernen will oder kann, ist ein Lehrer ziemlich hilflos. Man stelle sich vor, eine Klavierlehrerin müsste vor jeder Unterrichtsstunde ähnlich ausgeklügelte Pläne entwickeln und sich hinterher selbst bewerten. Ich bin sicher, sie würde bald davonlaufen.
Die Sitzungen mit meinen Betreuern erinnerten mich an den Dänischunterricht während meiner Gymnasialzeit. Dort mussten wir Gedichte interpretieren. Ich war ziemlich schlecht in dieser Raterei und ärgerte mich darüber, dass die Dichter nicht klarer ausgedrückt hatten, was ihnen vorschwebte – schließlich wollten sie mit uns Normalsterblichen kommunizieren. Ein Lehrer hat es viel leichter, weil er einen Goldstandard besitzt, ein Lehrbuch, das ein Philologe geschrieben hat und in dem die behandelten Gedichte analysiert und interpretiert werden. Das ist wirklich lustig. Es gibt die Anekdote, dass ein Maler gefragt wurde, ob die Kunstkritiker mit der Interpretation seiner Bilder richtig lägen, woraufhin er lachte und sagte, er wolle mit seinen Bildern gar nichts ausdrücken – er wolle einfach nur malen und Freude daran haben. Pablo Picasso malte im Laufe der Jahre in vielen verschiedenen Stilen und wurde einmal gefragt, wonach er suche. Er antwortete: »Ich suche nicht, ich finde.«
Meine Schüler waren mit mir zufrieden, meine Betreuer nicht. Sie erklärten, sie könnten zwar »Bestanden« in mein Zeugnis schreiben, jedoch mit einer so schlechten Beurteilung, dass ich kaum eine Stelle als Lehrer finden würde. Lieber sei es ihnen, mich durchfallen zu lassen, um mir die Chance zu geben, darüber nachzudenken, ob ich wirklich Lehrer werden wollte. Dies war das einzige Mal, dass ich eine Prüfung nicht bestand. Ich bin meinen Prüfern sehr dankbar dafür, dass sie diese kluge Entscheidung trafen. Ich hätte mich in meinem neuen Beruf viel zu wenig angestrengt. Meine Jahre an der Universität waren so einfach gewesen, dass ich nicht einmal davon geträumt hatte, abends zu arbeiten, im Gegensatz zu den Lehrern, die erfolgreicher waren als ich. Ich hatte keine Ahnung, dass es als derart schwierig galt, Schüler zu unterrichten. Später hielt ich an der Universität mehr als zwanzig Jahre lang Vorlesungen über Wissenschaftstheorie.
Nachdem ich mich ein paarmal vergeblich als Chemiker oder Biologe beworben hatte, schlug mir mein Großvater vor, in die Pharmaindustrie zu gehen. Ich schickte drei Bewerbungen und wurde zweimal zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Meine erste Erfahrung war wirklich bizarr. Ich konnte die Vitamintabletten meiner Kindheit fast riechen, als ich das Büro betrat. Der Mann, der mit mir sprach, sah angestaubt aus und hatte eine Halbglatze. Mit seinem langen Schnurrbart wäre er ein perfekter Darsteller in einem Western gewesen – als Quacksalber oder Barmann in einem Saloon. Einen Gebrauchtwagen hätte ich von ihm nicht gekauft. Auf mich wirkte er wie ein Vertreter, der alten Damen Unterwäsche oder Parfüm andreht. Selbst der Name der Firma war altmodisch. Es war ziemlich klar, dass wir beide uns in Gegenwart des anderen unwohl fühlten.
Die zweite Firma war modern und attraktiv. Es war die Astra Group mit Hauptsitz in Schweden. Ich bekam den Job und nahm sieben Wochen lang in Södertälje und Lund an Kursen teil, bei denen es hauptsächlich um Physiologie, Krankheiten und Medikamente ging. Es gab auch einen Kurs über »Informationstechnik«, der eigentlich »Verkaufstechnik« hätte heißen müssen, was ich dem Kursleiter auch vorschlug. Er kommentierte meine Anregung nicht, aber im Kurs ging es darum, wie man Ärzte überreden könnte, die Produkte unserer Firma und nicht die der Mitbewerber zu verwenden und neuen Patientengruppen noch mehr Medikamente unserer Firma in noch höheren Dosen zu verschreiben. Wichtig war nur, den Umsatz zu steigern. Das lernten wir anhand von Rollenspielen. Einige spielten unterschiedliche Ärztetypen – von griesgrämigen bis entgegenkommenden –, andere versuchten, deren Widerstand zu brechen und ins Geschäft zu kommen.
Als ich etwas über die Anwendung von Medikamenten lernte, war mein erster Gedanke: »Donnerwetter, es ist erstaunlich, dass es so viele Medikamente gibt und dass sie so oft und für alle Arten von Krankheiten verschrieben werden. Sind sie tatsächlich so wirksam, dass diese massive Anwendung gerechtfertigt ist?«
Ich reiste als Pharmavertreter – mein offizieller Titel lautete Pharmareferent – durch meinen Bezirk und besuchte Allgemeinärzte, Fachärzte und Krankenhausärzte. Das gefiel mir nicht. Ich war Akademiker mit guten Noten und fühlte mich minderwertig, wenn ich mit Ärzten sprach, die mich bisweilen schlecht behandelten, was ich durchaus verstehe. Es muss lästig sein, Zeit für Verkäufer zu opfern, und ich fragte mich oft, warum sie nicht nein sagten. Es gab so viele Firmen, dass Allgemeinärzte häufig mehr als einen Vertreter in der Woche empfingen.
Die akademischen Herausforderungen waren sehr gering, und mir war klar, dass das Wissen, das ich an der Universität erworben hatte, rasch verblassen würde, wenn ich mich nicht nach einem anderen Job umsah. Außerdem schadete dieser Beruf meiner Selbstachtung und meinem Selbstbewusstsein. Um ein erfolgreicher Verkäufer zu sein, muss man sich wie ein Chamäleon verhalten und die eigene Persönlichkeit der des Kunden anpassen. Wer so viele Rollen spielt und Übereinstimmung mit Ärzten vortäuscht, mit denen er nicht übereinstimmt, läuft Gefahr, sich selbst zu verlieren. Ich hatte einiges von Søren Kierkegaard gelesen und wusste, dass dieser Verlust der schlimmste Fehler ist, den man begehen kann. Wenn man nicht nur Ärzte, sondern auch sich selbst betrügt, wird es zu schmerzhaft, in den Spiegel zu schauen und zu akzeptieren, was man sieht. Es ist leichter, eine Lüge zu leben, und es bewegte mich tief, als ich Jahre später in einem Londoner Theater Arthur Millers Schauspiel Tod eines Handlungsreisenden aus dem Jahr 1949 sah. Ich wusste genau, worum es darin ging.
In der Regel hörten sich die Ärzte meine Werbesprüche an, ohne unangenehme Fragen zu stellen. Doch einige Male widersprachen sie mir. Astra hatte Azidocillin entwickelt, einen neuen Penicillintyp, und ihm den einprägsamen Namen Globacillin gegeben, als wirke es gegen alles. In einer unserer Werbekampagnen versuchten wir, das Medikament als Heilmittel gegen Sinusitis zu verkaufen. Wir informierten die Ärzte über eine Studie, die belegte, dass das Mittel in die Schleimhaut der schwer zugänglichen Nebenhöhlen eindrang, wo die Bakterien sich vermehrten. Und wir wiesen darauf hin, dies sei ein Vorteil gegenüber dem normalen Penicillin. Ein Hals-Nasen-Ohren-Chirurg erklärte mir, es sei in diesem Fall unmöglich, Biopsien durchzuführen und die Konzentration eines Antibiotikums in der Schleimhaut zu messen, weil die Probe unweigerlich Kapillaren enthalten würde, in denen die Konzentration höher sei. Es war sehr peinlich für mich, von einem Spezialisten darüber aufgeklärt zu werden, dass meine Firma mich getäuscht hatte. Akademiker lernen selbständiges Denken, aber mir fehlte diese Fähigkeit, wenn es um medizinische Fragen ging.
Ein anderes Argument zugunsten des neuen, teureren Medikaments war seine Wirkung gegen eine Bakterie namens Haemophilus influenzae. Azidocillin sollte fünf- bis zehnmal besser sein. Diese Behauptung stützte sich auf Versuche, die in Petrischalen durchgeführt worden waren. Dazu hätte man folgende Fragen stellen müssen:
Wurden diese Versuche von der Firma selbst durchgeführt? Wurden die Ergebnisse von unabhängigen Forschern bestätigt?
Wie wirkt Penicillin oder Azidocillin bei akuter Sinusitis im Vergleich zu einem Placebo? Und falls es eine Wirkung gibt: Ist sie groß genug, um die routinemäßige Behandlung einer Sinusitis mit Antibiotika trotz der Nebenwirkungen zu rechtfertigen?
Und vor allem: Wurde Azidocillin in randomisierten Studien über akute Sinusitis mit Penicillin verglichen, und wirkte es besser?
Solche Fragen hätten Klarheit darüber erbracht, dass es keinen vernünftigen Grund gab, Azidocillin anzuwenden. Trotzdem gelang es uns, das Medikament dank unserer zweifelhaften Argumente eine Zeit lang einigen Ärzten zu verkaufen. Heute ist es nicht mehr auf dem Markt.
Nach nur acht Monaten als Pharmavertreter verließ ich den Außendienst und wurde Produktleiter. Ich war verantwortlich für das Schriftmaterial und für unsere alle drei Jahre stattfindenden Verkaufskampagnen. Dabei arbeitete ich mit dem Verkaufsleiter zusammen. Es macht mich nicht stolz, wenn ich daran danke, was wir taten. Wir verkauften ein Medikament namens Bricanyl (Terbutalin) gegen Asthma, und in einer dieser Kampagnen versuchten wir die Ärzte davon zu überzeugen, dass ihre Patienten nicht nur ständig mit den Tabletten, sondern auch mit einem Spray behandelt werden müssten. Erneut gaben wir den Ärzten nicht die notwendigen Informationen – es existierte keine randomisierte Studie, welche die Kombinationstherapie mit der Verabreichung der Tabletten oder des Sprays allein verglichen hätten.
Inhalatoren töteten Asthmatiker
Heutzutage wird das regelmäßige Inhalieren von Medikamenten wie Terbutalin nicht mehr empfohlen; die meisten Gebrauchsanweisungen raten sogar davon ab, weil es gefährlich ist. Der neuseeländische Epidemiologe Neil Pearce hat einen Artikel über die Macht der Pharmaindustrie und ihrer bezahlten Verbündeten unter den Ärzten verfasst.6 Was er über die Behandlung von Asthmatikern schreibt, ist bestürzend. Als in den sechziger Jahren Inhalatoren auf den Markt kamen, stieg nicht nur der Umsatz der Industrie, sondern auch die Zahl der Sterbefälle. Erst als die Behörden vor übermäßigem Inhalieren warnten, gingen beide Zahlen wieder zurück. Pearce wollte einen Arzneistoff, nämlich Isoprenalin von Riker, genauer untersuchen und erhielt von der Firma Informationen, welche die Behauptung widerlegen sollten, die Todesfälle hingen mit dem Medikament zusammen. Er bestätigte diese These jedoch, und als er dem Unternehmen seine Ergebnisse schickte (das sollte man nie tun), drohte es ihm mit einer Klage. Seine Universität versprach, ihm im Falle eines Prozesses ihre Anwälte zur Verfügung zu stellen, und er veröffentlichte seine Befunde. Doch nun wurde er von Asthma-Experten heftig angegriffen.
Ärzte werden in der Regel sehr wütend, wenn man ihnen vorwirft, ihren Patienten Schaden zugefügt zu haben, und sei es auch in gutem Glauben geschehen. Ich habe ein ganzes Buch über meine Erfahrungen geschrieben, nachdem ich 1999 die schädlichen Folgen der Mammografie aufgezeigt hatte: Sie macht aus vielen gesunden Frauen unnötigerweise Krebspatientinnen.7
Das war 1972. Obwohl Pearces Befunde damals Unterstützung fanden, behaupteten Asthma-Experten 16 Jahre später, als er seine Forschungen wieder aufnahm, die Theorie sei nachweislich falsch. Niemand konnte ihm die Zunahme und den Rückgang der Todesfälle bei Asthmatikern in den sechziger Jahren erklären. Offenbar hatte die »Zweifelindustrie« die falschen Behauptungen ausgeheckt und genährt – das heißt, die Pharmaunternehmen bezahlten Asthma-Experten, damit sie minderwertige Studien durchführen. »Unser Produkt ist der Zweifel«, sagte einmal ein Tabakmanager,8 und diese Verneblungstaktik scheint immer zu wirken: Man erzeuge lauten, bezahlten Lärm und verwirre die Leute, bis sie dem Lärm glauben und nicht der ursprünglichen, strengen Studie.
Im Jahr 1976 begann in Neuseeland eine neue Epidemie von Asthma-Sterbefällen. Als Pearces Kollegen den Verdacht äußerten, die Ursache könne Überbehandlung sein, stießen sie bei der offiziellen Asthma-Expertengruppe auf extreme Feindseligkeit. Die Experten hielten Unterbehandlung für das Problem. Dies ist die übliche Position der Industrie. In der Tat war die Firma Boehringer Ingelheim, die Fenoterol (Berotec) herstellte, ein wichtiger Sponsor der Asthmaforschung in Neuseeland.
Als Pearce und seine Mitarbeiter herausfanden, dass die neue Epidemie die Fenoterol-Umsatzkurve widerspiegelte, brach die Hölle los. Sie stießen von allen Seiten auf Widerstand, aber man forderte auch, Dritte sollten ihre Daten sorgfältig prüfen, und zwar nicht nur Leute mit freundschaftlichen Beziehungen zum Hersteller. Auch die Firma wollte die Daten haben. Ein kluger Anwalt riet den Forschern, alle Prozessdrohungen zu ignorieren und die Ergebnisse vor ihrer Veröffentlichung nicht an die Firma herauszugeben.
Der Druck nahm zu, auch von der Universität und vom Medical Research Council, obwohl dieser die Studie nicht einmal finanziell unterstützt hatte. Diese Leute verstanden nicht oder wollten nicht verstehen, dass sie kein Recht hatten, sich in die Studie einzumischen. Der einzige Ausweg bestand darin, sich ganz nach oben zu wenden, an das Gesundheitsministerium. Dort erfuhren die Forscher jedoch, dass Boehringer Ingelheim schneller gewesen war.
Allerlei Gerüchte wurden verbreitet, auch falsche Anschuldigungen, zum Beispiel die Behauptung, es gebe keinen Studienplan (Prüfplan), obwohl die Asthma Foundation und der Medical Research Council diesen Studienplan eingesehen hatten. Beide hatten sich geweigert, die Studie finanziell zu unterstützen. Boehringer Ingelheim gelang es, die Veröffentlichung im Lancet zu verzögern und beinahe zu verhindern. Die Redaktion bekam wegen des enormen Drucks kalte Füße, nachdem sie den Artikel bereits akzeptiert hatte. The Lancet erhielt von dem Unternehmen jeden Tag mehrere lange Telefaxe und musste die Absender schließlich auffordern, dies einzustellen.
Boehringer Ingelheim hatte viel Geld in die Ärzte investiert, und das zahlte sich nun aus. Ihre Sympathie galt der Firma, zumal sie fürchteten, die neuseeländische Niederlassung werde schließen. An ihre Patienten dachten sie nicht. Das Gesundheitsministerium stellte sich ebenfalls auf die Seite des Unternehmens und verstieß gegen seine Verschwiegenheitspflicht, als es ihm eine Kopie des Manuskripts überließ, das es von den Forschern verlangt hatte.
Schlimmer konnte es nicht kommen. Die erste Studie der Forscher fand keine Sponsoren, die zweite ebenfalls nicht. Das Dunedin Hospital verweigerte ihnen den Zugang zu seinen Patientendaten. Das Gesundheitsministerium wollte ihnen nicht versprechen, dass es das Manuskript der zweiten Studie vertraulich behandeln werde. Daraufhin bekam es zwar kein Manuskript von den Wissenschaftlern, forderte und erhielt es jedoch unter Berufung auf das Gesetz zur Informationsfreiheit von der Universität. Boehringer reichte die Daten an seine bezahlten Freunde weiter, so dass sie andere Ergebnisse vorlegen konnten, noch bevor die ursprünglichen Daten gedruckt wurden.
Das war ein empörender Verstoß gegen die ethischen Grundregeln der Wissenschaft. Trotz seiner schmutzigen Methoden verlor Boehringer jedoch den Kampf. Der Marktanteil von Fenoterol sank in nur drei Jahren von 30 Prozent auf 3 Prozent. Gleichzeitig nahm die Zahl der Asthmasterbefälle ab, was die Forschungsarbeit von Pearce und seine Kollegen rechtfertigte.
Zwielichtiges Marketing und die Forschung
Einmal besuchten wir Lungenspezialisten und zeigten ihnen einen Film über kleine weiße Teilchen, die in den Schleim in der Luftröhre eingebracht worden waren. Die Bewegung dieser Partikel in Richtung Mund wurde aufgezeichnet. Eine Gruppe von Patienten erhielt Terbutalin, die andere nicht. Bei den behandelten Patienten bewegten sich die Flimmerhärchen schneller. Mit dem Film wollten wir die Ärzte davon überzeugen, dass sie das Medikament nicht nur bei Asthma verordnen sollten, sondern auch bei einer Raucherlunge (chronischer Bronchitis). Diese Patienten husten oft; darum nahm man an, dass ein schnellerer Abtransport von Reizstoffen aus den Lungen vorteilhaft sei. Aber auch hier hätte eine einfache Frage enthüllt, dass der Kaiser nackt war. Es gab keine randomisierten Studien, die die Wirksamkeit von Terbutalin bei Patienten mit chronischer Bronchitis bewiesen hätten. Auch heute ist Terbutalin nur für Asthma und andere Bronchospasmen zugelassen, nicht für chronische Bronchitis.
Es ist illegal, ein Medikament für einen »zulassungsüberschreitenden Einsatz« zu vermarkten. Wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, kommt illegale Vermarktung dennoch sehr häufig vor, und es ist üblich, dass die Unternehmen das Gesetz umgehen. Es ist jedoch nicht verboten, Forschungsergebnisse mit Ärzten zu besprechen; deshalb durften wir den Film vorführen, ohne dass wir damit das Gesetz gebrochen hätten – solange wir den Ärzten nicht empfahlen, das Medikament gegen chronische Bronchitis zu verschreiben. Hätten sie uns gefragt, hätten wir sagen können, es sei uns verboten, das Medikament für diese Anwendung zu empfehlen, die Ergebnisse seien jedoch interessant und den Ärzten stehe es frei, das Medikament zu jedem Zweck einzusetzen, der ihnen vernünftig erscheine. Es ist absurd, dass solche indirekten Empfehlungen nicht illegal sind. Meiner Meinung nach sollten sie es sein. Es gibt keinen guten Grund dafür, praktizierenden Ärzten vorläufige Forschungsergebnisse zu präsentieren; es ist lediglich sinnvoll, sie mit akademischen Forschern zu diskutieren, um eine definitive klinische Studie vorzubereiten, in der Hoffnung, dass die neue Indikation von der zuständigen Behörde genehmigt wird.
Auch hinsichtlich einer anderen Indikation bewegten wir uns am Rande der Illegalität; doch bevor ich darauf eingehe, muss ich erklären, was die Cochrane Collaboration ist. Es ist eine gemeinnützige Organisation, die Iain Chalmers 1993 in Oxford in Großbritannien gegründet hat. Es war eine Reaktion auf eine verbreitete Unzufriedenheit von Forschern und anderen mit der schlechten Qualität und Voreingenommenheit der meisten medizinischen Studien und der Einsicht geschuldet, dass wir strenge und systematische Analysen der randomisierten Studien brauchen, die uns eine klare Auskunft über die Vorteile und Nachteile unserer Therapien geben. Die Cochrane Collaboration wuchs rasch und hat heute etwa 30 000 Mitarbeiter. Die Analysen werden elektronisch in der Cochrane Library veröffentlicht. Es gibt mehr als 5000 solcher Analysen, und sie werden regelmäßig auf den neusten Stand gebracht. Die Hälfte der Weltbevölkerung hat freien Zugang zu den vollständigen Analysen, dank nationaler Abonnements, die meist von Regierungen bezahlt werden. Der anderen Hälfte stehen Zusammenfassungen zur Verfügung.
Husten kommt sehr häufig vor, und es gibt einen riesigen Markt für rezeptfreie Hustenmedikamente. Eine systematische Cochrane-Analyse der randomisierten Studien zeigt, dass keine dieser Arzneien wirksam ist.9 Das bedeutet, dass auf dem riesigen Markt zugleich eine riesige Geldverschwendung herrscht. Auch Medikamente wie Terbutalin wirken anscheinend nicht,10 aber bei Astra kam jemand auf die Idee, in Bezug auf Terbutalin gegenüber den Ärzten das Gegenteil anzudeuten. Dabei sollten wir uns auf die Studie berufen, um die es im oben erwähnten Film ging. Ich glaubte das nicht. Warum sollte ein Medikament, das bei Asthmatikern die Luftwege erweiterte, bei Husten wirksam sein, dessen Ursache keine Bronchospasmen waren? Unabhängig von rechtlichen Detailfragen bin ich der Meinung, dass es sich hier um eine unzulässige Vermarktung handelte. Es gab keine Zeugen, die bestätigen konnten, wie viele Ärzte sich dazu bewegen ließen, das Medikament gegen Husten auszuprobieren, denn die meisten Gespräche fanden unter vier Augen statt – nur der Arzt und der Vertreter waren anwesend.