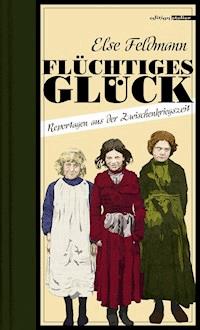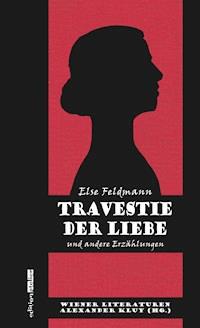
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Atelier
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Wiener Literaturen
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Else Feldmann zählt zu den unverdient vergessenen Autorinnen Österreichs. Von ihrem Leben weiß man heute nicht mehr viel, auch viele ihrer Texte sind verschollen oder vernichtet. - Alle anderen sind eine Entdeckung! In ihren Erzählungen nimmt sie wie im Vorübergehen (Alltags-)Szenen und Eindrücke auf. Klar und eindringlich schreibt sie vom oft schweren Leben in der Großstadt, vom Miteinander verschiedener Gesellschaftsschichten, von unermüdlich Arbeitenden, von Not und Glück, die oft näher beieinanderliegen, als man glaubt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 163
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Else Feldmann
TRAVESTIEDER LIEBE
und andere Erzählungen
herausgegeben und mit einem Nachwort
versehen von Alexander Kluy
Die Reihe WIENER LITERATUREN setzt sich zum Ziel, Literatur aus Wien, über Wien, von Wiener Autorinnen und Autoren, aber auch Blicke von außen auf die Stadt zu präsentieren.
In dieser Reihe erscheint Ungewöhnliches und Zeitenüberdauerndes: souverän eigensinnige Texte, die die Grenzen zwischen erzählender, feuilletonistischer und analytischer Prosa leichthändig ignorieren, dem gelebten Augenblick durch genaue Beobachtung Gehalt und Sinn, Witz und Leben verleihen – und urbane Eleganz.
Die Erzählungen der Wienerin Else Feldmann sind urban. Und dabei progressiv. Sie sind voller Emphase und voller genau beobachteter, eingefangener und wiedergegebener Details des Lebens in der Stadt. Was die leidenschaftliche Sozialistin, passionierte Journalistin und engagierte Sozialreformerin präsentiert, die wusste, wovon sie schrieb, wenn sie Armut schilderte – sie selber war in ärmlichsten Verhältnissen aufgewachsen und war jahrelang einfache Arbeiterin – und deren Lebensspuren nach dem gewaltsamen Tod im Sommer 1942 im KZ Sobibor für viele Jahrzehnte fast völlig verweht waren, ist ein Wien der Gefühle und Gefühllosigkeiten, der Liebe und der Lieblosigkeiten. Abenteuer Suchende treten bei ihr ebenso auf wie Abgestürzte. Es ist ein Land erfrorener Emotionen, eine Welt abgekämpfter Existenzen und, irgendwo im Hintergrund des pochenden Herzens, doch noch immer hoffender. Hoffend auf ein besseres Leben, eine bessere Liebe, eine menschlichere Welt.
»Mein größtes Vergnügen und meine liebste Unterhaltung«, schrieb Else Feldmann einmal, »war es, Menschen zu beobachten. Nichts entging mir – kein Wort, kein Zucken in einem Gesicht, kein Lächeln der Qual oder der Freude.«
ALEXANDER KLUY
TRAVESTIE DER LIEBE
Diese Tragödie einer Frau sah ich an einem Abend in der Zeit von elf bis zwölf Uhr nachts in einem Café der »besseren bürgerlichen Gesellschaft« sich abspielen. In einem der vornehmen Ringcafés wäre es nicht verwunderlich gewesen; alle diese Cafés dienen nachts hauptsächlich dem Geschäfte der Liebe.
Aber in einem Café, das nur von Bürgern besucht wird – –
Doch ich will von Anfang an erzählen. Einige Minuten nach elf Uhr trat ein Fräulein, ein etwas ältliches Mädchen, ein. An ihrem Mantel mit Pelzkragen fehlte nicht das Modeblümchen.
Sie legte den Mantel ab, setzte sich an einen Tisch, bestellte ein Glas Tee.
Nun saß sie da in ihrem leichten, billigen Kleid aus Kunstseide, buntes Hütchen auf dem Kopfe. Das unschöne, spitze Gesicht mit den leeren Augen sah abgemagert, verfallen, verhungert aus.
Sie musterte alle Tische, an denen Herren saßen, mit dem gewissen scheuen Seitenblick der Straßenmädchen. Nach einer Weile stand sie auf, verschwand für kurze Zeit. Als sie wiederkam, sah sie ganz verändert aus: die Wangen rosa und weiß, die Lippen leuchteten rot, aus den schwarz unterstrichenen Augen sprühten die Blicke. Nur die Schulterknochen, die bloß und häßlich aus dem Ausschnitt herausragten, konnten nicht weggetäuscht werden; doch es fiel ihr etwas ein, sie schmückte sich mit einem schwarzen Spitzentuch Ach, wie erbärmlich war ihr Bemühen, die Aufmerksamkeit der Männer zu erregen. Es wollte sie lange keiner ansehen, die meisten Bürger waren mit Frauen oder Tarockpartnern versorgt.
Endlich wurde die Tür aufgerissen. Ein schwarzer Kopf guckte herein. Die Augen des geschminkten Mädchens sprangen auf das Gesicht blieben dort haften, zogen den Mann herein, daß er an dem Tisch neben dem ihren Platz nehmen mußte.
Man sah es dem Mädchen an, daß eine glühende, fieberartige Stimmung über sie gekommen war. Unter dem rosa Puder färbte ihre Haut sich rot bis über den dünnen Hals, dunkelrot wie bei Schlagsüchtigen.
Die Bürger im Café begannen etwas zu merken und zu glotzen, und auch in ihnen regte es sich. Sie nahmen Anteil!
Aber das Mädchen war zu häßlich, das dämpfte ihre Lust, zu schauen.
Er war die Männlichkeit selbst. Seinen giftgrünen Wollschal trug er über die Brust gekreuzt. Er war mit einem nicht ganz sauberen Autopelzmantel bekleidet, trug eine verknüllte Werktagskappe in der Hand. Vielleicht war er arbeitslos, feierte und befand sich in verdrossener Stimmung, war bereit, sein letztes Geld durchzubringen, gleichviel wo und mit wem?
Das Mädchen am Tische sah ihn – um die Bürger unbekümmert – fest und beständig an. Es war ein trauriger Blick; er dachte an eine einzige Frage: wieviel wird er mir bezahlen?
Auch die Kellner sind aufmerksam geworden. Der Zahlkellner flüstert dem Fräulein an der Kasse etwas zu, worauf diese in den Spiegel blickt, um von dort aus dem schauerlichen Schauspiel zuzusehen: einem Handel zwischen zwei Wesen, wobei ein Körper die Ware ist. Der Mann mit dem grünen Schal sieht wie ein Zuhälter aus. Er hat eine herrische Stirn, feste, große, grobe Hände mit roten Fingern.
Er bestellt einen Schnaps und noch einen, ruft den Kellner, gibt ihm ein Zeichen. Der Kellner weiß sogleich, was der Gast befiehlt, stellt auch einen Schnaps vor das Mädchen hin. Sie verzieht den Mund zu einem verzerrten Lächeln, trinkt.
Der Kellner geht zwischen den Tischen hin und her, spricht halblaut mit den jungen Gehilfen.
Die »Volksstimmung« des Cafés wird mehr und mehr eine empörte. Alle scheinen unzufrieden. Eine junge, dicke Frau mit sehr lebhaft gemalten Farben tritt ein, legt den Mantel ab, setzt sich: Tutankhamen-Bluse, Seidenstrümpfe, neue Lackschuhe. Sie beginnt sofort umherzublicken.
Der Mann mit dem grünen Schal, dem im Augenblick eine Dicke besser gefällt, läßt seine Augen die Tutankhamen-Figuren eindringlich betrachten.
Auch die dicke Dame blickt, heftig angezogen, auf den grünen Schal. Da kommen die brennenden Augen vom anderen Tisch her wie Schlangen gekrochen. Die ganze Kraft der Kreatur liegt im Blick. Ihre Gebärde ist wie die eines Krüppels auf der Straße, der bettelt, der nichts anderes kann, als bittend, klagend seine trüben Augen erheben. Er aber ist erbarmungslos, sucht sich einen Platz für seine Augen, der ihn angenehmer reizt.
Wie verzweifelt ist das Mädchen, in ihrer Haltlosigkeit erhebt sie sich, verläßt ihren Platz, geht ein paar Schritte an den Tisch des Mannes. (Für die Anwesenden sollte es so aussehen, als bäte sie um eine Zeitung.) Sie streifte ihn, war ihm ganz nahe, wollte ihn durch ihre Nähe, durch ihr Parfüm betäuben. Im letzten Augenblick kam die Rettung. Ein Gast trat ein. Ein fetter, satter, von Geldbewußtsein strotzender Mensch mit flacher Stirn, kleinen Augen, breitem fleischigem Nacken.
Die Dicke hatte auf ihn gewartet; sie gingen nach rückwärts in eine Loge.
Der Mann mit dem grünen Schal bestellte heißen Tee mit Rum, vielleicht war es Grog. Sie saß nun da; eine selig lächelnde Karikatur. Es ging gegen Mitternacht. Die Bürger machten sich auf, heimzukommen – in ihre guten Pelze gehüllt –.
Im Café wurde es still und intim wie in einer kleinen Wohnung.
Man konnte die Gespräche der anderen hören: ein schweres Herz erzitterte, Mundwinkel verzogen sich in Qual, Röte der Scham kam und verging auf einem bleichen Gesicht.
Das waren die neuesten Gäste, die eingetreten waren. Sie hatten nichts mehr mit Ehrbarkeit und Bürgertum zu tun. Es kamen die Likör- und Absinthtrinker, die Gelegenheits- und Zufallsgäste von der Straße.
Ein Jüngling in sonderbarer Kleidung schob sich zu einem Fensterplatz. Er hatte bis zu den Ellbogen reichende Stulpenfechthandschuhe an. Ledermütze mit Kinnband auf dem Kopf – hübscher, zierlicher Junge, ein wenig geschminkt. Lächelnd sieht er hinüber zu dem Mann mit dem grünen Schal und beginnt ganz offen mit ihm zu kokettieren. Wieder geriet das Mädchen in furchtbare Aufregung, als sie den Burschen sah – und was er wollte. Aber der Mann zeigte ihm ganz deutlich, daß er ihn nicht wollte. Was war dieser mit dem grünen Schal für ein Satanskopf – Weiber wie Männer flogen auf ihn!
Auch den Zwischenfall hatten Gäste bemerkt. Sie saßen mit gespannter Aufmerksamkeit da und warteten, für wen er sich entscheiden würde.
Der Junge trank seinen Kaffee, lächelte enttäuscht und tänzelte auf seinen kurzhosigen Beinen wieder zur Tür hinaus. Das Mädchen atmet auf. Die schreckhafte Spannung auf ihrem Gesicht läßt nach.
Der Grüne ruft: Zahlen!
Da nimmt sie rasch ihren Mantel vom Rechen, streift die Handschuhe über, ergreift ihre Handtasche, ist zum Gehen bereit.
Aber der Mann hat noch einen Tee mit Doppelrum bestellt Demütig bleibt sie nun sitzen und wartet, bis er getrunken hat. Er läßt sich Zeit, wirft sogar hin und wieder einen Blick in das Witzblatt.
Das Mädchen sitzt geduldig da und wartet. Ein schweres Stück Arbeit für sie, einen Mann zu finden, der sie mitnahm. Ein Teil der Nacht war bereits vorbei; sie hatte noch nichts verdient.
Endlich gibt er ihr ein Zeichen, indem er das Kinn seitlich wirft. Sie versteht. Wie ein Hund versteht sie sich auf Gesten. Als erste verläßt sie das Café. Draußen auf der Straße muß sie noch eine ganze Weile warten, bis er gemächlich die Zeitung durchgesehen, langsam den Rock zugeknöpft hat und endlich kommt …
DREI MENSCHEN
Fräulein N. N. hatte für sich und noch zwei Personen zu sorgen. Sie gehörten nicht zum engen Kreise ihrer Angehörigen oder Verwandten. Das alles hatte sich auf besondere Art gefügt. –
Fräulein N. N. war eben eines Tages aus der Kleinstadt in die Großstadt gekommen. In ihrem Heimatstädtchen hatte sie einen Gemischtwarenladen geführt, Kinder aufgezogen, gekocht, gewaschen, gebügelt – alles, was im fremden Haushalte zu tun war. Eines Tages war sie überflüssig und auf die Straße gesetzt worden. Nach kurzem Entschluß fuhr sie in die große Stadt, fand Unterkunft bei einer alleinstehenden Frau, einer Klavier- und Sprachenlehrerin, die an einem Augenübel litt. Tagsüber lief die Frau herum zu ihren Schülern, die in allen Winden zerstreut wohnten. Abends kam sie müde heim, zündete eine Kerze an, legte sich zu Bett.
In der Kammer wohnte Fräulein N. N., die eine Stelle als Aushilfsköchin in einem Gasthause gefunden hatte. Die frühere Köchin kam aber nach kurzer Krankheit wieder zurück, und man entließ Fräulein N. N. Acht Tage vergingen ohne Stelle. Da litt Fräulein N. N. viel Hunger.
Einmal am Abend rief die Lehrerin sie zu sich ins Zimmer.
»Was tun Sie in Ihrer Kammer?«
»Nichts, ich wollte mich soeben schlafen legen.«
»Essen Sie mit mir erst Abendbrot. Sie hatten einen Hering und Brot.
Am dritten Abend sagte Fräulein N. N.:
»Es geht nicht, daß ich Ihnen das bißchen Abendbrot wegesse. Morgen werde ich schauen, etwas Geld einzunehmen.«
Am andern Tage lief sie die Straßen ab, in viele Läden, in manche Gasthausküche guckte sie hinein, fragte, ob man niemand brauche.
Man brauchte sie nicht.
Da färbte sie am Abend ihr Gesicht mit rosa Papier, kräuselte ihr Haar, zog eine Locke verrucht in die Stirn und ging in einer Gasse spazieren, auf und ab. Und brachte einiges Geld mit.
Fräulein N. N. hatte ein Buch genommen, sie war eingeschrieben, geduldet, reglementiert. Wenn die Lehrerin vom Unterrichten heimkam, fand sie warmes Essen im Ofenrohr. Den Tisch sauber gedeckt. Fräulein N. N. kam erst gegen Morgen, wenn die Lehrerin sich auf den Weg machte.
Nach Ablauf eines Jahres erschien der Sohn der Lehrerin, bleichwangig, abgezehrt, in einem zerrissenen, schmutzigen Hemd, schäbigen Kleidern und Schuhen, und erklärte, er habe genug Entbehrungen im Gefängnis gelitten, jetzt wolle er sich bei seiner Mutter ausruhen und erholen. –
Die ersten Tage zeigte er guten Willen. Er machte sich im Hause nützlich, strich die Küchenmöbel grau an, kaufte blaue Farbe und tünchte die Wände in der Kammer. Als dies alles geschehen war, sagte er, nun werde er nur noch die alte Nähmaschine vom Roste putzen und ölen und fortan ausruhen.
Das tat er auch; lag den ganzen Tag auf dem Sofa und sang die traurigen Weisen des Gefängnisses.
Die langen Nächte hustete er heftig. Seine Mutter kam mit bloßen Füßen an sein Lager und wickelte ihn wie ein kleines Kind in ihr Wolltuch ein. Dabei flüsterte sie: »So – schlaf schön, mein Kind, bist ja wieder bei mir.«
Er klagte aber den ganzen Tag, er bekäme kein Bier, davon komme er noch ganz herunter. Ein Mann müsse doch täglich seine Flasche Bier haben; was wäre das sonst für ein Mann?
Ach, wie war er häßlich bis zur Lächerlichkeit. Nichts war am Platze in diesem Gesicht. Nicht Augen noch Nase noch Mund. Alles am schiefen, ungeeigneten Ort. Wenn Zorn ihn packte, sah er wie ein Teufel und nicht wie ein Mensch aus.
Und doch kam Nacht für Nacht die Mutter, von seinem bösen Husten geweckt, und hüllte ihn ein.
Ehe Fräulein N. N. abends ausging, setzte sie zwei Teller auf den Tisch und eine Flasche Bier.
Und als es immer schlimmer mit dem Augenübel der Lehrerin wurde, und sie zuletzt gar nicht mehr ausgehen konnte, sagte Fräulein N. N.: »Jetzt leben wir eben von dem, was ich verdiene.«
Die Lehrerin sagte: »Nun bin ich ganz blind geworden, aber ich kann ihn trotzdem nicht fortschicken, sonst stellt er etwas an und kommt wieder ins Gefängnis.«
»Wir wollen ihn hierbehalten«, sagte Fräulein N. N.
Und das ging so Jahre und Jahre.
Einmal kam Fräulein N. N. mitten in der Nacht von der Straße.
Die frühere Lehrerin saß gerade am Bette ihres Sohnes, dem heute die Brust sehr schmerzte. Soeben war er – in Schweiß gebadet – eingeschlafen.
Die zwei Frauen flüsterten miteinander:
»Ich werde heute nicht mehr ausgehen. Es ist kalt, es regnet, und niemand kommt.«
»Niemand kommt?«, fragt die Blinde.
»Niemand. Die lachenden Mädchen werden weggeholt, mich läßt man in meiner Ecke stehen.«
»Nein, nein – es ist besser, heute nicht mehr zu gehen.«
»Es ist häßlich kalt und Regenwetter, und sie lassen mich in der Ecke zurück. Die Jungen, die lachen können, nehmen sie mit sich. Ich möchte mich am liebsten gleich in die Kammer legen und dort verhungern, ehe ich noch einen Schritt auf das nasse Pflaster setze.«
Stille; in der blinde Augen lautlos weinten, eine kranke Brust pfiff. Kerzenlicht flackert in der Finsternis auf. Eine Stimme spricht:
»Wir müssen morgen den Doktor holen, er fiebert. Medizin, Lebertran muß gekauft werden. – Vorwärts, ich gehe wieder.«
VARIETÉ
Im Vorzimmer des Theateragenten.
Zwei junge Mädchen in Seidenkleidern warten; sie plaudern miteinander. Die eine erzählt von dem Städtchen N., wo sie zuletzt war. Die Sätze überstürzten sich.
»Ach N., dieses Nest!«, sagt die andere. »Da lasse ich mich lieber gleich begraben; ich gehe nur in große Städte, am liebsten ins Ausland.«
»Ins Ausland? Da kommt man doch nicht hin. Mir ist es einerlei. Jung und schön muß man sein!«
»Und können muß man auch etwas – sonst ist man nur dafür – –«
»Man muß sich mit Vernunft verlieben.«
»Ach was«, sagt die eine, »ich bin achtzehn Jahre alt« (sie war achtundzwanzig), »nun bleibe ich zwanzig Jahre lang jung; das ist in unserem Beruf eine Möglichkeit.«
Eine Dame ist eingetreten; sie ist ungemein aufrecht und stolz; man merkt aber, daß es eine einstudierte Haltung ist. Der Diener ersucht sie, zu warten, es sei jemand im Zimmer bei Herrn Sänger. Sie sieht an dem Diener vorbei und sagt laut, aber mit gebrochener Stimme:
»Ich bitte, nur meinen Namen zu nennen.«
»Jawohl, meine Gnädige, aber nach der Reihe, die zwei Fräuleins warten auch.«
Das war das Ende. Man ließ sie im Vorzimmer warten.
Sie ging in eine Ecke, setzte sich, das Gesicht der Wand zugekehrt, sank in sich zusammen. Tränen kamen ihr in die Augen – jetzt, da niemand sie sah. Nach einigen Minuten stand sie auf, ging zur Tür, kehrte unentschlossen zurück. Der Diener kam, ließ einen Herrn eintreten.
Der Herr sah sie an, lächelte ein wenig, ging an ihr vorüber; er setzte sich fröstelnd und zitternd – obwohl es warm war – in den bequemsten Lehnstuhl und betrachtete die beiden jungen Mädchen.
Aber seine Blicke waren zerstreut. Die Muskeln seines Gesichtes zuckten; es war etwas über ihn gekommen. –
Die Dame nahm sich endlich zusammen, riß nochmals die Tür auf und sagte dem Diener: »Gehen Sie hinein und sagen Sie Herrn Sänger, Mitzi Schürer ist da!«
In dem Augenblick kam Herr Sänger mit einer Dame und einem Herrn aus seinem Sprechzimmer. Es war, wie man auf den ersten Blick sah, eine junge Künstlerin mit ihrem Gönner oder Freund.
Die zwei Fräuleins gingen hinein: »Wir sind gleich fertig, unterschreiben nur unsere Verträge.«
Die Dame und der Herr blieben im Vorzimmer. Hartnäkkig, mit abgekehrten Gesichtern, saßen sie sich gegenüber, als kennten sie einander nicht. Beide schämten sich, zitterten vor schmerzlicher Scham, einander hier getroffen zu haben: zwei alte, ausgemusterte »Künstler«, abgetane Größen, die eine Stelle suchten. Nun kamen sie als Nächste an die Reihe.
Zuerst die Dame. Der Agent erkannte sie, sagte seine Artigkeiten. Das war Mitzi Schürer, die wieder auftreten wollte. Als junger Mensch hatte er ihren Ruhm miterlebt, heute war er selbst grauhaarig, beinahe alt. Hübsch war sie ja nie gewesen und ihre Stimme nicht besonders schön, aber sie war ein »Temperament«, ein »Brettl-Genie«, und sie hatte diese paar frechen Wiener Lieder einst gesungen, daß es die Leute verrückt gemacht hatte. Was heute vor ihm steht, ist ein häßliches, altes Weib, derb geschminkt, verschwitzt, ängstlich, die Clownnase sitzt grotesk in dem schwammigen Gesicht. Mitzi Schürer von einst ist spurlos dahin.
»Was werden Sie singen?«, fragte der Agent
»Die Lieder von damals«
»Passen die heute noch?«
»Mein Name wird ziehen.«
»Ja, ja, es ist wahr.«
Der Agent kennt das: Mitzi Schürer – der Traum – die Erinnerung –
»Alles wollen Sie wieder singen? Auch das:
… und die weißen Madeln
in kurze Kladeln
und dünne Wadeln
– – – – – – – – – – – – – – –«
»Ja, das auch!«
Es ist wie ein Aufschrei; packt sie wie ein starrer Schrecken. Sie ist wie aus dem Grabe auferstanden.
»Vielleicht singen Sie mir etwas vor.«
Der Agent ist vielseitig. Er begleitet sie selbst. Sie singt.
»Ja, es geht noch«, sagt er. »Aber in großen Varietés ist nichts mehr frei. Nur noch in einem Café in der Vorstadt. Café Royal. Das Engagement dauert einen Monat. Die Gage ist nicht groß, aber mehr als nichts« – er nennt die Summe.
»Könnte ich nicht etwas mehr bekommen?« will sie fragen – schweigt aber – denn was würde sie hören! Wenn man sechsundfünfzig Jahre alt ist, unter der blonden Perücke sein weißes Haar hat, kann man keine Ansprüche machen. Sie hätte beinahe nicht mehr daran gedacht, irgendwo unterzukommen, hatte sich schon mit dem Gedanken vertraut gemacht, bald ins Armenhaus zu gehen. Mit all den Mitteln und Medikamenten wird es einen Monat lang gehen. Wird es gehen? ist aber die bange Frage.
»Traurig ist es«, sagt sie zu sich, während sie das Zimmer verläßt, »daß man im Alter noch arbeiten muß, um nicht zu verhungern«, und zieht ihren dichten Schleier herab, damit man ihre weinenden Augen nicht sehe. – –
Dann wird der Herr gerufen.
Lebhafte Begrüßung. O natürlich – die einstige Berühmtheit! »Letztes Auftreten war wo? Ach so – im Wintergarten in B. Nun, B. war jedenfalls ein Nest – hier immerhin Großstadt. Nur nicht bange sein – wir haben schon etwas – nur keine Sorge – Carlo Carloni – ein Café besten Ranges, Café Royal – die berühmte Mitzi Schürer wurde eben für dort engagiert.«
Also Carlo Carloni bekommt etwas mehr Gage. Er ist ein Mann, man muß es berücksichtigen – ein Mann hat immer mehr Ausgaben.
»Und was werden Sie singen, Meister?«
»Die alten Sachen.«
»Auch dieses:
Ein so ein Schleicher,
so Schleicher, so schleichlerisch schön,
nur muß man auch das Tanzen, das Tanzen verstehn.«
»Ja, auch dieses.«
»Gut«, denkt der Agent »der Name. Und dann – er wird durch seine Gespensterhaftigkeit wirken – sieht er nicht geradezu mystisch aus, wie eine Erscheinung aus der Apokalypse: Klapperdürr, mit der schwarzen, vor Alter grünen Scheitelperücke, dem entsetzlich mageren Vogelkopf, dem dünnen Halse mit vorspringendem beweglichen Adamsapfel? Ja, elegant sah er noch immer aus mit gewendeten und gebügelten Kleidern, mit hellgrauen Gamaschen, Monokel, Stock – Hut schief auf dem Kopfe – –
»Engagiert!«, sagt der Agent.