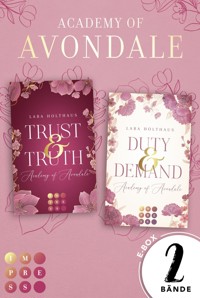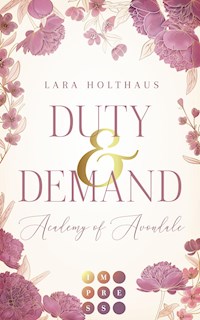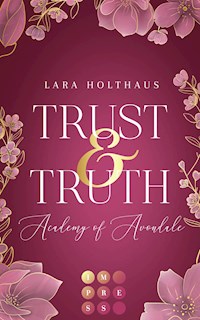
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
**Wie weit würdest du für Gerechtigkeit gehen?** Emilia Sullivan kann ihr Glück kaum fassen: Sie hat eines der wenigen Stipendien für die renommierte Avondale-Academy ergattert. Als sie am ersten Abend auch noch auf den attraktiven Lucas trifft und dieser ihr Herz augenblicklich höherschlagen lässt, scheint sie ihre unglückliche Vergangenheit endlich hinter sich lassen zu können. Umso tiefer sitzt der Schock, als sie erfährt, dass ausgerechnet das Unternehmen seiner Eltern an einem tragischen Vorfall in ihrer Vergangenheit beteiligt war. Der Anziehung des faszinierenden Engländers kann Emilia dennoch kaum entgehen und ein nervenaufreibendes Spiel um Liebe, Vertrauen und Wahrheit beginnt … »In ihrem Debütroman ›Trust & Truth‹ entführt Lara Holthaus uns von der ersten Seite an in ein aufregendes Academy-Setting und schenkt uns eine Geschichte zum puren Verlieben.« – Spiegel-Bestsellerautorin und Buchbloggerin Antonia Wesseling //Der Liebesroman »Trust & Truth« ist der erste Band der gefühlvollen »Academy of Avondale«-Reihe. Jeder Roman dieser Serie steht für sich und kann unabhängig von den anderen gelesen werden.//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Lara Holthaus
Trust & Truth (Academy of Avondale 1)
**Wie weit würdest du für Gerechtigkeit gehen?**
Emilia Sullivan kann ihr Glück kaum fassen: Sie hat eines der wenigen Stipendien für die renommierte Avondale-Academy ergattert. Als sie am ersten Abend auch noch auf den attraktiven Lucas trifft und dieser ihr Herz augenblicklich höherschlagen lässt, scheint sie ihre unglückliche Vergangenheit endlich hinter sich lassen zu können. Umso tiefer sitzt der Schock, als sie erfährt, dass ausgerechnet das Unternehmen seiner Eltern an einem tragischen Vorfall in ihrer Vergangenheit beteiligt war. Der Anziehung des faszinierenden Engländers kann Emilia dennoch kaum entgehen und ein nervenaufreibendes Spiel um Liebe, Vertrauen und Wahrheit beginnt …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Danksagung
© privat
Lara Holthaus wurde 1996 geboren und lebt seit einigen Jahren in der schönen Hansestadt Hamburg. Neben ihrer Tätigkeit als Kinder- und Jugendpsychotherapeutin verbringt sie jede freie Minute mit Schreiben. Schon als Kind verschenkte sie zu Geburtstagen am liebsten selbst geschriebene Geschichten. Laras schreibt emotional über große Gefühle, jedoch ohne dabei die Leichtigkeit und eine Prise Humor außer Acht zu lassen.
Für Simon, weil du alles in mir siehst und alles für mich bist.
Kapitel 1
Emilia
Im Van meines Bruders Jake fuhren wir die Küstenstraße entlang. Besser gesagt, wir ächzten. Das monotone, viel zu laute Brummen des Motors hüllte mich in einen einschläfernden Kokon, während vor dem Autofenster die Landschaft Cornwalls vorbeizog.
Eigentlich war sie wunderschön. Nahezu atemberaubend, mit ihren saftig grünen Felsen, den meterhohen Klippen und dem azurblauen Atlantik, der in spritzenden Wellen dagegenschlug. Eigentlich war alles wundervoll. Alles hell. Alles perfekt. Die perfekte Sonne, die am perfekten Himmel auf dem perfekten Meer glitzerte. Eigentlich.
Ihr Strahlen erreichten mich nicht, obwohl ich gerade an diesem Tag vor Euphorie brennen und mit weit aufgerissenen Augen alles begeistert in mich hätte aufnehmen müssen. Schließlich verfolgte ich einen Traum, dem ich gerade einen Schritt näher kam
Ein ungewohnt jaulender Laut des Motors riss mich aus meinen düsteren Gedanken.
»O nein, nicht jetzt«, stöhnte Jake. »Wir haben es doch fast geschafft.« Besorgt sah er auf das Armaturenbrett des Vans, den er im letzten Jahr in liebevoller Kleinstarbeit zu einem gemütlichen Campingbus ausgebaut hatte.
»Du verunsicherst ihn noch«, warf ich ihm vor und strich behutsam über das Handschuhfach. »Lass dich nicht unter Druck setzen, Bobby. Ich habe volles Vertrauen in dich.«
»Du hast einen Knall«, zog mein Bruder mich lachend auf. »Mal ehrlich, Em, du -«
»Vorsicht, links!«, unterbrach ich ihn laut und deutete auf ein Schild am Straßenrand.
Port Ivy – zwei Meilen
Bobbys Reifen quietschten. Jake riss fluchend das Lenkrad herum, um in einen schmalen, hinter einer großen Eiche versteckten Weg abzubiegen. Ich hielt den Atem an, kniff die Augen zu und flehte Bobbys alten Motor an, dies unbeschadet zu überstehen. Der Wagen zeigte sich angesichts des abenteuerlichen Manövers glücklicherweise recht unbeeindruckt und tuckerte zuverlässig brummend weiter über die holprige Straße.
Erleichtert ließ ich die Luft aus meinen Wangen entweichen. Danke, mein Freund, sagte ich innerlich zu Bobby. Vielleicht hatte ich wirklich einen Knall. Ich musste grinsen.
Aus den blechernen Boxen des Radios drang I Gotta Feeling von den Black Eyed Peas. Jake summte mit. Ich kurbelte das Fenster der Beifahrertür herunter und hielt meine Hand hinaus in den Fahrtwind. Für einen Moment schloss ich die Augen und ließ mich in die Unbeschwertheit fallen. In die Leichtigkeit. Eine Leichtigkeit, wie ich sie immer verspürte, wenn Jake und ich mit Bobby auf den Straßen unterwegs waren. Ich versuchte sie einzufangen, das Gefühl irgendwie festzuhalten. Den Geruch nach Holz. Nach Benzin. Nach Leder und nach Freiheit. Dieses Alles-ist-möglich-Gefühl. Ich wollte es in meinem Herzen speichern wie auf einem USB-Stick, damit ich es hervorholen konnte, wenn die Schatten zurückkamen. Doch ich wusste, dass es nicht funktionieren würde. Ein Gefühl konnte man nicht abfotografieren. Das hatte ich schmerzlich erfahren müssen.
Ein Kloß wuchs in meinem Hals. Verzweifelt bemühte ich mich, gegen ihn anzuschlucken.
»Bobby und du, ihr werdet mir fehlen.« Meine Stimme war belegt von Schwere und Sorge und Abschied. Ich wandte mich zu meinem Bruder und lächelte Jake traurig an. Er drehte die Musik leiser.
»Muss ich mir Gedanken machen, dass du den Namen meines Autos vor meinem nennst?«, fragte er spöttisch und streckte mir die Zunge raus.
»Blödmann!« Ich verdrehte stöhnend die Augen. Jake nahm seine Hand vom Lenkrad und knuffte mich in die Seite.
»Ich werde dich auch vermissen, Schwesterherz.« Jetzt glitzerte auch in seinen Augen der nahende Abschied. Für einige Minuten verharrten wir in Schweigen. Wir sahen uns nicht an, sondern schauten – jeder in sich und seinen Emotionen versunken – aus dem Fenster. Ein immer undurchsichtiger werdender Tränenschleier verhinderte, dass ich die Landschaft draußen wirklich sah.
»Ich glaube, wir sind da«, durchbrach Jake schließlich das Schweigen. Er deutete auf ein großes weißes Schild, auf welchem in geschwungenen Lettern der Name unseres Ziels stand: The Academy of Avondale.
Es war vor einem hohen eisernen Tor positioniert, das wir nun passierten. Wir fuhren eine lange, von dicken Bäumen flankierte Auffahrt hinauf. Dann sah ich sie. Die Academy. Majestätisch ragte sie mit ihren spitzen Türmen, den alten backsteinernen Mauern und sicher einer Million Fenstern vor uns auf. Für einen Moment vergaß ich, wie man atmete. Sie war größer, königlicher, als ich mir sie vorgestellt hatte. Und doch fügten sich die alten Mauern so nahtlos in die felsige Küstenlandschaft ein, als wären sie schon immer dort gewesen.
Ein flaues Gefühl schoss bei dem Anblick durch meinen Körper und sammelte sich in meiner Magengegend. Ich wollte Jake sagen, dass er umdrehen musste. Zurück nach Hause. Das hier war eine miese Idee. Die mieseste aller Ideen. Ich blieb trotzdem stumm, weil ich wusste, dass diese miese Idee wichtig war. Sie würde mich nach Cambridge bringen. Und das war alles, was für mich zählte. Also starrte ich weiter geradeaus, auf das royale Gebäude, das immer näher kam. Mit jedem weiteren Meter verdoppelte sich das flaue Gefühl und quetschte meinen Magen ein bisschen mehr zusammen.
Irgendwann kam Bobby auf einem gepflasterten Parkplatz zum Stehen. Zwischen vielen weiteren Autors wuselten bereits einige junge Menschen mit ihren Koffern herum. Ich blieb sitzen, noch nicht in der Lage auszusteigen. Nicht in der Lage, den vertrauten Van, der mir so viel bedeutete, zu verlassen.
Hinter dieser Autotür wartet ein neues Leben. Mein neues Leben. Ja, ich hatte ein quälend langes Jahr auf diesen Moment gewartet. Ja, ich hatte hart dafür gearbeitet. Ja, es würde mich nach Cambridge bringen. Ich wusste das alles. Doch jetzt, nur einen Schritt, einen Augenblick von mir entfernt, jagte mir das alles eine Heidenangst ein. Ein noch nie dagewesener Gefühlscocktail machte sich in mir breit. Angst, Abschiedsschmerz und Nervosität, aber auch Entschlossenheit. Entschlossenheit zu kämpfen. Entschlossenheit vorwärtszukommen. Mein Ziel zu erreichen.
Der Kloß in meiner Kehle hatte mittlerweile die Größe eines Tennisballs erreicht. Ich zwang meine Lunge, meinen Atem zu kontrollieren.
»Bereit?«, fragte Jake und nahm meine Hand.
Nein. Ich war so was von nicht bereit. Ich hätte nicht weniger bereit sein können. Und doch nickte ich.
Ein letztes Mal strich ich über Bobbys mit Stickern beklebtes Armaturenbrett und inhalierte den Geruch nach abgewetztem Leder und Zuhause. Dann gab ich mir einen Ruck und bemühte mich um eine feste Stimme.
»Bereit!«
Die Autotür quietschte leise, als ich sie zaghaft öffnete. Sofort schmeckte ich salzige Küstenluft und ein Lächeln schlich sich augenblicklich auf meine Lippen. Dann sprang ich aus dem Van.
Obwohl es erst Ende März war, hinterließ die Sonne eine angenehme Wärme auf meinem Gesicht. Wieder sah ich hoch zur Academy of Avondale. Das musste ein Traum sein. Mit Sicherheit war es das. Ich würde jede Sekunde aufwachen und all das hier würde wie eine Seifenblase zerplatzen. Meine Chance würde zerplatzen. Unmöglich konnte ich wirklich hier stehen. Mit allem, was ich immer gewollt hatte, nur noch zwölf Monate entfernt.
Die Academy of Avondale kann mit Stolz verkünden, dass über neunzig Prozent unserer Absolventen und Absolventinnen einen Platz an den von ihnen präferierten Colleges bekommen, rief ich mir die Worte der Homepage ins Gedächtnis.
Während es in Kanada und den Vereinigten Staaten völlig normal war, an den Highschoolabschluss ein Post-Graduate Year anzuschließen, suchte die Avondale in Großbritannien ihresgleichen. Innerhalb des Development Years, kurz Dev, wurden die hier aufgenommenen Studierenden bei der Suche nach dem passenden College unterstützt und auf Aufnahmeprüfungen sämtlicher, auch internationaler, Colleges vorbereitet. Das Jahresprogramm umfasste Seminare, die über den gewöhnlichen Unterrichtsstoff in der Highschool hinausgingen, Diskussionsrunden mit beeindruckenden Persönlichkeiten und Prüfungssimulationen. Aber nicht nur das. Die Avondale hatte zudem ein breites Sport-, Musik- und Kunstangebot, pflegte enge Beziehungen zu Talentscouts und kooperierte mit Kunst- und Sportakademien auf der ganzen Welt.
Die Aufnahmekriterien waren hart. Sehr hart. Abend um Abend hatte ich lernen müssen, Essays zu schreiben und mich mit komplizierten Rechenmodellen auseinanderzusetzen. Seit ich den Entschluss gefasst hatte, mich für das Jahr an der Academy zu bewerben, hatte ich keine Schulparty mehr betreten. Und es hatte sich gelohnt. Ich hatte es geschafft. Ausgerechnet ich.
Und nicht nur das: Mein Motivationsschreiben hatte im Zusammenspiel mit meinen perfekten Noten in den Ohren des Aufnahmekomitees offenbar so motiviert geklungen, dass ich zudem eines der wenigen sehr begehrten Stipendien bekommen hatte. Anders hätte ich die horrenden Gebühren auch nicht aufbringen könne. Doch jetzt hatte ich eine Chance. Eine Chance, nach Cambridge zu kommen. Eine Chance, die sich in der Sekunde meiner Zusage auf neunzig Prozent erhöht hatte. Das Stipendium war mein Hauptgewinn und ich durfte es auf keinen Fall vermasseln. Nicht jetzt, wo ich so nah dran war.
Mein Verstand weigerte sich noch immer zu realisieren, dass ich tatsächlich hier war. Ehrfürchtig blickte ich auf all das, was seit einem Jahr der Mittelpunkt meiner Gedanken und Gefühle war und für den Antrieb gesorgt hatte, der mich daran gehindert hatte, den Boden unter den Füßen zu verlieren.
»Nobler Schuppen!«, hörte ich Jake hinter mir, der ebenfalls aus dem Auto gestiegen war. Er drückte den Rücken durch, streckte die Arme und stöhnte. Nach der langen Fahrt schmerzte sein Rücken vermutlich genauso wie meiner.
Ich liebte Bobby. Mehr als das. Jake hatte den Innenraum des Wagens mit viel Mühe zu einer überraschend modernen Wohnkabine umgebaut. Das Fahrerhäuschen war allerdings das alte geblieben. Das ist Vintage-Look, hatte Jake seine Entscheidung begründet. Eben jener Vintage-Look hatte jedoch zur Folge, dass die Sitze so zerschlissen und in die Jahre gekommen waren, dass sie mit zunehmender Kilometeranzahl doch ihre Spuren in Form von Rückenschmerzen hinterließen.
Während Jake meinen großen Wanderrucksack und mehrere Taschen aus dem Kofferraum holte, schaute ich mich nach allen Seiten um. Ich wollte so viele Eindrücke wie möglich in mich aufzunehmen.
Etwas abseits des Hauptgebäudes sah ich Tennisplätze, auf denen sich einige Studierende ein hitziges Doppel lieferten. Eine Zeit lang schaute ich ihrem Ballwechsel zu und lauschte den angestrengten Rufen, bis ich meinen Blick zu einem großzügigen Pferdestall wandern ließ, an dem ein Reitplatz und eine Koppel angeschlossen waren. Da sich auf dem Parkplatz allerhand Autos mit Anhängern befanden, vermutete ich, dass einige der Neuankömmlinge ihre eigenen Pferde mitgebracht hatten. Reitunterreicht und Turniervorbereitung gehörte ebenfalls zu den zahlreichen Angeboten der Academy.
Auf der anderen Seite des Geländes glitzerte das Wasser eines Schwimmbeckens, das von langen rot-weißen Leinen durchzogen war, die das Becken in mehrere Bahnen teilten, in der Sonne.
Das Hauptgebäude lag auf einem Felsvorsprung in etwa dreißig Meter Höhe, dahinter erstreckte sich das offene Meer. An den Mittelteil des Hauses schlossen sich links und rechts Flügel mit hohen Fenstern an, in denen ich die Unterkünfte für die Studierenden vermutete. Das Gebäude hatte einen antiken Charme und schien eher in einen Jane-Austen-Roman zu gehören als in das einundzwanzigste Jahrhundert.
Als ich sah, wie der strahlend blaue Himmel und das azurblaue Wasser sich am Horizont berührten, fügte sich alles zusammen wie ein Puzzle, dessen letztes Teil ich gewesen war. Schlagartig verflüchtigten sich die Zweifel. Ich wusste ich es: Ich gehörte hierher. Ich würde es schaffen.
Der Trubel auf dem davorliegenden Parkplatz wollte jedoch nicht so recht in die malerische Landschaft passen und zerstörte regelrecht das Bild der romantischen Umgebung. Ich betrachtete die Menschen, Koffer und Autos auf dem Parkplatz. Mit einem mulmigen Gefühl in der Magengegend fiel mir auf, dass Jakes Van zwischen den vielen teuer aussehenden Autos mit poliertem Lack und abgedunkelten Scheiben herausstach wie ein Halloweenkostüm auf einer Beerdigung.
Mit einer Mischung aus Unbehagen und Faszination beobachtete ich ein blondes Mädchen, das tatsächlich aus einer langen Limousine stieg. Eine echte Limousine. Ein Wagen, den ich noch nie von innen gesehen hatte. Ein Chauffeur öffnete gerade den Kofferraum. Selbstverständlich hatte sie auch einen Chauffeur. Stilecht mit schwarzer Kappe und weißen Handschuhen. Um Himmels willen. Noch nie zuvor war ich einem Chauffeur begegnet, von Uber-Fahrern mal abgesehen. Sie musste zweifelsohne aus einer reichen, nein stinkreichen Familie stammen.
Alles an ihr schien in perfekter Harmonie zusammenzupassen und sah geschmackvoll und unwahrscheinlich elegant aus. Sie trug schlichte, aber bestimmt zehn Zentimeter hohe schwarze Schuhe und ein lockeres schwarzes Blusenkleid. Natürlich ohne eine einzige Falte. Ihr kühler Gesichtsausdruck war ebenso glatt wie das Kleid. Ihr Auftritt wirkte perfekt einstudiert. Die langen blonden Haare fielen wie ein seidener Vorhang über ihren Rücken, aus dem nicht eine Strähne zerzaust aus der Reihe tanzte. Ich hatte keinen Zweifel daran, dass sie morgens schon genauso elegant aufwachte, wie sie jetzt ihre Handtasche vom Beifahrersitz nahm. Sie war scheinbar makellos. Scheinbar perfekt. Und doch spiegelten sie und all das an ihr, was nach Geld stank, das wider, was ich verabscheute.
Sie lächelte ihrem Chauffeur zum Abschied höflich zu. Obwohl sie einige Meter von mir entfernt stand, konnte ich sehen, dass das Lächeln ihre Augen nicht erreichte. Als sie sich umdrehte, trafen sich unsere Blicke und sie blitzte mich verächtlich an. Jäh bemerkte ich, dass ich sie immer noch anstarrte, und wandte peinlich berührt den Blick ab.
Der Parkplatz war voller Neuankömmlinge. Beklommenheit breitete sich in mir aus. Schmerzlich wurde mit bewusst, dass mein Erscheinungsbild – verglichen mit den jungen Frauen, die ich bisher zu Gesicht bekommen hatte – beinahe heruntergekommen aussah. Es sollte mich nicht kümmern. Schließlich wollte ich so nicht sein. Nicht wie sie. Und doch konnte ich nicht verhindern, dass das Gefühl, hierherzugehören, das letzte Puzzleteil zu sein, so abrupt abebbte, wie es gekommen war.
Zähneknirschend begutachtete ich mich in der spiegelnden Scheibe des Vans. Ich verfluchte mich dafür, mir bei der Kleiderwahl nicht etwas mehr Mühe gegeben zu haben. Aufgrund der langen Fahrt hatte ich vor allem auf Bequemlichkeit gesetzt. Ich trug Mums in die Jahre gekommene Lieblingsjeans, die ich vor der Altkleidersammlung gerettet hatte, und ein weißes Oversized-Shirt, dessen Stoff von der langen Fahrt ziemlich zerknittert war. Hastig versuchte ich es glatt zu streichen. Vergeblich. Die Locken meines rotblonden Haars waren zerzaust und hatten damit nichts mit den kunstvollen Frisuren meiner zukünftigen Kommilitoninnen gemein. Schnell band ich sie zu einem lockeren Knoten im Nacken zusammen.
Ich durfte über den vermeintlichen Reichtum, der nahezu jeden hier wie Parfum umgab, eigentlich nicht überrascht sein. Eigentlich hatte ich damit gerechnet. Schließlich galt die Academy of Avondale als eine der elitärsten und begehrtesten Einrichtungen des vereinigten Königreiches und darüber hinaus. Töchter und Söhne von Politikern, Unternehmern und Prominenten in jeglicher Hinsicht gehörten zu den Absolventen. Gerüchten zur Folge bereitete sich traditionell sogar der Nachwuchs der Royal Family an der Academy auf sein Studium vor.
Und zwischen all diesen Nachkommen einflussreicher, in Geld schwimmender Persönlichkeiten stand nun also ich, Emilia Sullivan, und war all das nicht. Nicht reich. Nicht einflussreich. Nicht makellos. Sondern nur ein absolut unbekanntes und vor allem absolut nicht vermögendes Farmergirl aus dem Südwesten Irlands. Ich hatte nichts mit diesen Leuten gemeinsam. Ich wollte auch nichts mit ihnen gemeinsam haben. Eigentlich war die Avondale ein elitärer Spießerschuppen, in den ich vor einem Jahr nicht mal einen Fuß gesetzt hätte. Heute war es anders, denn heute wusste ich es besser. Ich musste dieses Jahr überstehen, um da hinzukommen, wo ich hinwollte: Jura-Studium. Anwältin werden. Es genau diesen feinen, stinkreichen Menschen zeigen. Menschen, die mir und meiner Familie alles genommen hatten.
»Schwesterherz!«, riss mich mein Bruder aus den düsteren Gedanken. »Ich habe jetzt lange versucht, es zu überreden, aber das Gepäck weigert sich, allein hereinzuspazieren.«
Ich musste grinsen. »Unerhört«, zeigte ich mich entrüstet und warf den Taschen einen missbilligenden Blick zu.
Lachend schnappte ich mir eine von ihnen, hängte sie mir ächzend über die Schulter und ging – mit vor Aufregung wummerndem Herzen – in Richtung des Haupteingangs. Jake folgte mir, beladen mit meinem großen Wanderrucksack und einem Jutebeutel voll mit kleinen Leckereien und viel selbst gekochter Marmelade, die Dad mir vor meiner Abreise eingepackt hatte.
Als ich schließlich die Stufen erklommen und die Eingangshalle betreten hatte, blieb ich schlagartig stehen. Mir klappte der Mund auf.
»Cool bleiben, Em«, sagte Jake feixend. Er hatte leicht reden.
Mit weit geöffneten Augen betrachtete ich jeden Winkel des imposantesten Gebäudes, in das ich jemals einen Fuß gesetzt hatte. Die breite weiße Treppe, die einem sofort ins Auge fiel, wenn man die Halle betrat, war links und rechts von zwei großen Säulen flankiert. Sie verbanden den Boden mit der hohen Decke, die mit kunstvollen Ornamenten in Gold und Pastelltönen bemalt war wie ein königlicher Palast. Die Treppe endete vor einer schweren Flügeltür aus dunklem Holz. Sie war geschlossen, doch es fiel mir leicht, mir dahinter eine Bibliothek voller staubiger Bücher und vergilbter Pergamente vorzustellen, in denen schon die bedeutendsten Wissenschaftler unseres Landes für ihre Prüfungen gebüffelt hatten. Ich konnte kaum glauben, dass ich ab dem heutigen Tag auf dem Weg war, eine von ihnen zu werden.
Entschlossen, mich von der prunkvollen Umgebung nicht einschüchtern zu lassen, steuerte ich auf eine junge Frau zu, die offensichtlich für die Einweisung der Neuankömmlinge zuständig war. Sie trug ein dunkelblaues Kostüm und hielt ein Klemmbrett sowie ein Tablet in der Hand. An ihrer hellblauen Bluse war ein Namensschild befestigt, welches sie als Ms Greenwood auszeichnete. Hektisch fuchtelte sie mit einer Hand vor einer Studierenden herum.
»Hey, äh, ich meine, hallo«, sprach ich sie unbeholfen an, als das Gespräch mit dem anderen Mädchen offenbar beendet schien. Sie kritzelte auf ihrem Klemmbrett herum, bis sie aufblickte und mich höflich, aber distanziert anlächelte.
»Hallo, ich bin Leyla Greenwood«, stellte sie sich geschäftig vor. »Ich bin die Jahrgangssprecherin der letzten Devs und heute für die Einführung der neuen Studierenden zuständig.« Ihre Worte klangen routiniert und so, als hätte sie diese gerade zum hundertsten Mal abgespult. »Wie heißt du?«, fragte sie.
»Emilia Jean Sullivan«, nannte ich ihr meinen vollen Namen.
Sie suchte kurz auf ihrer Liste, dann nickte sie. »Du bist in Wohneinheit zwölf, diese besteht aus zwei Schlafzimmern und einem Wohnzimmer. Außer dir werden also noch drei weitere Studierende dort wohnen. Das Gemeinschaftsbad liegt außerhalb der Wohneinheit und wird von allen Devs des jeweiligen Flures benutzt.« Sie überreichte mir einen klobigen Schlüssel, an welchem ein kleiner silberner Anhänger mit einer eingravierten Zwölf baumelte.
»Der Unterricht beginnt erst am Montag. Du hast demzufolge noch zwei Tage, um hier alles etwas kennenzulernen.« Sie schlug eine Mappe auf, die sie unter den Arm geklemmt hatte. »Dein individualisierter Stundenplan müsste dir vorab per E-Mail zugeschickt worden sein.« Fragend sah sie mich an, wartete dann jedoch nicht auf meine Zustimmung, sondern fuhr hastig fort. »Für sportliche oder musische Aktivitäten kannst du dich bis Ende der Woche verbindlich anmelden. Die Listen findest du vor dem Sekretariat.« Sie reichte mir zudem einen Geländeplan, erklärte mir Details zu den Mahlzeiten und beschrieb mir den Weg zu meinem Apartment.
»Zwei Garnituren der Uniform hängen bereits in deinem Zimmer. Sie sind außerhalb deiner Wohneinheit zu tragen. Immer.« Sie betonte dies so eindringlich, als ob mir sonst eine Strafe von sehr hohem Ausmaß drohen würde. »Außer an den Wochenenden natürlich. Die stehen dir zur freien Verfügung. Einmal in der Stunde fährt vorne an der Straße ein Bus nach Port Ivy. Es gibt kaum Hausregeln. Auch keine Sperrstunde oder Sonstiges. Ihr seid alle volljährig. Die Academy setzt auf euren gesunden Menschenverstand. Solange du dich im Rahmen der Gesetze bewegst, brauchst du nicht mit Konsequenzen rechnen. Noch Fragen?«
Benebelt von all den Informationen, die mein Hirn in kürzester Zeit verarbeiten musste, konnte ich nur stumm den Kopf schütteln.
»Sehr gut. Dann wünsche ich dir eine tolle Zeit an der Academy of Avondale.« Sie schenkte mir ein breites Lächeln und wandte sich in derselben Sekunde schon dem nächsten Studierenden zu. Mein gemurmeltes »Danke« schien sie nicht mehr zu hören.
Suchend hob ich den Blick, um in dem Getümmel von Menschen, die in der Eingangshalle versammelt waren, Jake zu entdecken. Ich schmunzelte, als ich ihn erblickte. Er hatte pinkes Haar. Seine Arme waren mit vielen Tattoos übersät. Das, gepaart mit einem weiten Tour-Shirt einer Indie-Rock-Band, ließ ihn in der Masse aus Anzügen und Etuikleidchen hervorstechen wie ein Papagei unter lauter Pinguinen. Würde Jake bleiben, dann würde er diesen vor Prunk und Spießigkeit strotzenden Ort gehörig durcheinanderwirbeln. Schade, dass er noch heute wieder abreisen würde.
Bepackt mit Jutebeutel und Tasche bahnte ich mir meinen Weg durch die Menge auf ihn zu. Durch einen Blick auf den Geländeplan konnte ich erkennen, dass sich meine Wohneinheit im rechten Flügel befand. Wir gingen aus der Eingangshalle und betraten den breiten Flur. Durch die hohen Fenster fiel Sonnenlicht herein und ich versuchte im Vorbeigehen einen Blick durch die leicht geöffneten Türen zu erhaschen, die sich gegenüber der Fensterreihe befanden. Ich sah vor allem Seminarräume und Studiersäle, aber auch ein Kunstatelier und einen Raum voller verschiedener Musikinstrumente.
Ich musste mich dazu zwingen, weiterzugehen und nicht jeden der Räume genaustens zu begutachten. Das alles hier passierte wirklich. Im kommenden Jahr würde ich in diesen Räumen lernen oder mich auf die Bewerbungsinterviews der Universitäten vorbereiten. Vielleicht würde ich es mir an anderen Tagen mit meinem Notebook an einem der alten Eichentische gemütlich zu machen, um einen Essay zu schreiben.
Vor der Tür mit einer großen goldenen Zwölf blieben wir schließlich stehen. Aufgeregt steckte ich den Schlüssel ins Schloss und atmete tief ein. Ja, ich war an der Academy, um meinen Traum von Cambridge zu erreichen. Alles andere spielte eine untergeordnete Rolle. Trotzdem. Hinter dieser Tür erhoffte ich mir vielleicht kein Zuhause, aber immerhin einen Ort, an welchen ich nach einem anstrengenden Tag gern zurückkommen würde.
Langsam öffnete ich die Tür, die leise knarrte, und wir betraten einen kleinen Flur. Drei weitere Türen gingen jeweils zu den anderen Seiten des Raumes ab. Sie waren geschlossen. Ich lauschte. Es war ruhig. Außer mir schien noch keine meiner künftigen Mitbewohnerinnen da zu sein. Ein leichter Geruch nach Holz und einem blumigen Raumerfrischer stieg mir in die Nase.
Ich entschied mich schließlich für die Tür direkt vor mir. Behutsam drückte ich die Klinke herunter und schnappte nach Luft. Der Raum war viel behaglicher, als ich es mir vorher ausgemalt hatte. Vor mir lag ein gemütliches Wohnzimmer. Auf einem cremefarbenen Teppich stand ein breites hellblaues Sofa. An der gegenüberliegenden Wand war ein Flachbildfernseher montiert.
»Jake, sieh dir das an.«
Mein Bruder stieß einen überraschten Laut aus und deutete beeindruckt auf den Kamin, der in die Wand eingelassen war. Jetzt im Frühling war er kalt und dunkel, aber trotzdem konnte ich mich wunderbar in den kommenden Herbst und Winter hineinträumen. Kurz verlor ich mich in der Vorstellung. Ich vor diesem Kamin. Vielleicht mit einem Buch. Vielleicht mit einer Menge Peanut Butter Cups. Draußen alles kalt und nass, drinnen alles warm und geborgen. Vielleicht würde alles gut werden. Vielleicht konnte das hier ein Neuanfang sein. Vielleicht würde es mir gelingen, den Schatten kleiner werden zu lassen. Den Schatten, der wie ein dicker schwarzer Teppich auf meinem Herzen lag und alles irgendwie abdämpfte. Jedes Gefühl verschluckte wie einen winzigen Kekskrümel, der in die verschlingenden Fasern eines Ikea-Teppichs gefallen war. Vielleicht würde er verschwinden. Vielleicht.
»Ems, dein Rucksack wird nicht gerade leichter«, beschwerte mein Bruder sich. Er bugsierte mich durch den Türrahmen und stellte stöhnend meine Taschen auf den Boden. Dann drehte er sich einmal rundherum und ließ seinen Blick prüfend über die Einrichtung gleiten. Auf seinem Gesicht konnte ich Verblüffung und einen Hauch Stolz erkennen.
»Verglichen mit der Abstellkammer auf der Farm, die du Schlafzimmer nennst, ist das hier das reinste Fünf-Sterne-Hotel«, bemerkte er anerkennend. Er legte den Kopf schief. »Ich vermute nur, dass es nicht lange dauern wird, bis du dein Chaos hier überall versprüht hast.«
Ich warf eins der Sofakissen nach ihm. Es verfehlte ihn knapp und landete zum Glück vor und nicht im Kamin.
»Siehst du. Es geht schon los«, gluckste er.
Ich wusste, dass er recht hatte. Aus irgendeinem Grund hatten meine Klamotten die Angewohnheit, ständig auf dem Boden herumzuliegen.
Jake ging zurück in den Flur und deutete auf die beiden übrigen Türen. »Ich vermute, dass sich dahinter Eure Gemächer befinden, Hoheit.«
An den Türen waren jeweils zwei Zettel befestigt. Auf dem rechten standen mein Name und Neyla Montgomery. Neyla … Mit ihr würde ich mir also die nächsten zwölf Monate ein Zimmer teilen.
Bitte, sei cool, flehte ich den Zettel mit ihrem Namen an. Jedoch hatte sich ein Großteil meiner Hoffnung darauf bereits auf dem Parkplatz in Luft aufgelöst. Die Studierenden und damit meine potenziellen Mitbewohnerinnen, die mir bis jetzt über den Weg gelaufen waren, hatten einen mehr als überheblichen Eindruck gemacht. Einige hatten mir abschätzige Blicke zugeworfen, als würde ich Zutritt zu einem Club verlangen, dessen Mitglied ich offensichtlich nicht war und auch nie sein würde.
Mir war bewusst, dass ich vermutlich eine andere Kindheit und Schulzeit gehabt hatte als die meisten hier. Jake und ich waren mit viel Wärme und Liebe aufgewachsen, materieller Reichtum hatte bei uns keine große Rolle gespielt. Die Apfelfarm unserer Eltern hatte mit den Jahren zunehmend weniger eingebracht. Im Zuge der ansteigenden Globalisierung setzten immer mehr Supermärkte auf Obst aus Neuseeland, Südamerika oder Südafrika. Trotzdem hatte ich nie das Gefühl gehabt, etwas zu vermissen. Ich liebte es, wenn im Frühling die Apfelbäume strahlend weiß blühten, wenn ich im Sommer den ganzen Tag barfuß herumlaufen konnte und der Geruch nach frisch gemähtem Gras in der Luft lag.
Ich betrachtete wieder den Namen an meiner Tür. Neyla Montgomery war mit ziemlicher Sicherheit nie barfuß über Wiesen gelaufen, sondern hatte schon in schicken Designerschuhen laufen gelernt. Ihren sechzehnten Geburtstag hatte sie gewiss in einem edlen Londoner Club, in einem exquisiten Cocktailkleid und mit einer Menge Champagner gefeiert.
Meinen hatte ich in der alten Scheune der Pettersons gefeiert. Mum und Dad hatten hinter der Theke gestanden und Getränke ausgeschenkt, und Jake war als DJ eingesprungen. Der Strom war immer wieder ausgefallen, wodurch die Musik verstummt war und die Partygäste gezwungen waren, im Dunkeln weiterzutanzen. Nichtsdestotrotz hatte ich großartige Erinnerungen an diesen Abend. Ich schmunzelte bei dem Gedanken an Dad, der bei einem der Stromausfälle die Pause überbrückt hatte, indem er auf den Tresen gesprungen war und mit voller Inbrunst I’m Still Standing von Elton John geschmettert hatte.
Als ich meine Hand auf die Türklinke legte, warf ich einen letzten Blick auf die geschwungenen Buchstaben von Neyla Montgomerys Namen und entschied, ihr eine Chance zu geben. Wir waren ab jetzt Zimmergenossinnen an einer der exklusivsten Akademien des Landes, an einem der schönsten Orte Englands, und ich war fest entschlossen, es zu genießen.
Das Zimmer war klein, aber gemütlich. Zwei Betten aus hellem Holz, an denen zwei Nachttische angegliedert waren, standen an den beiden Außenseiten des Raumes. Ebenso waren zwei Schreibtische und zwei Kleiderschränke vorhanden. Obwohl letztere so mickrig waren, dass sie die Bezeichnung Schrank kaum verdienten. Gut, dass ich den Umzug als Anlass genommen hatte, meine Kleidung auszusortieren und nur meine liebsten Teile einzupacken. Was wohl das Mädchen aus der Limousine mit ihren tausend Koffern machen würde? Ich kicherte bei der Vorstellung, wie sie verzweifelt versuchte, tonnenweise Markenklamotten und Luxushandtaschen in den winzigen Kleiderschrank zu stopfen.
»Ems, das musst du sehen!« Jake hatte die Vorhänge des hohen Fensters beiseitegezogen, sodass Sonnenlicht das Zimmer durchflutete.
Als ich ans Fenster trat, blieb mir jedes Wort vor Ehrfurcht im Hals stecken. Vor mir lag die Weite des Atlantiks. Ich sah das Meer Dutzende Meter unter mir schäumen und tosen, als die Wellen gegen die Felsen schlugen. Die Nachmittagssonne spiegelte sich im Wasser und ließ es flimmern und funkeln. In diesem Moment prasselte die Vollkommenheit des Augenblicks wie ein Monsun auf mich ein. Stolz und Freude, nach all der harten Arbeit endlich hier zu stehen, machten sich in mir breit. Ich war angekommen. In diesem Zimmer. An diesem Ort. Mit Hoffnungen, Möglichkeiten und einer Zukunft, wie ich sie mir wünschte, in greifbarer Nähe.
Im nächsten Moment fuhr ein Stich blitzartig in meinen Magen und eine mir bekannte tiefschwarze Dunkelheit durchdrang mich. Tränen stiegen mir in die Augen und die wunderschöne Aussicht vor meinem Fenster verschwamm zu einem bunten Farbenmeer.
»Hey, Schwesterherz«, sagte Jake sanft und schlang einen Arm um mich. Er schien meinen plötzlichen Stimmungsumschwung und meine Traurigkeit zu spüren. Beruhigend drückte er mir einen Kuss aufs Haar und gemeinsam schauten wir für einen kurzen Augenblick schweigend auf den Horizont.
»Es ist nur …« Meine Unterlippe fing verdächtig an zu beben. »Weißt du, es ist überwältigend, hier zu sein, und ich weiß, dass ich gerade unendlich glücklich sein sollte und alles …« Ich rang nach Luft. »Aber … jetzt gerade … ich …« Meine Stimme zitterte und ich hatte Schwierigkeiten, zusammenhängende Sätze zur formulieren.
Mein Bruder fuhr mir übers Haar. »Ich weiß.«
Ich sah zu ihm auf und in seinen glasigen Augen erkannte ich meinen Schmerz. Den nahezu unaushaltbaren Schmerz, der seit einem Jahr meine Gefühlswelt und alles, was ich war, kontrollierte. Ein Schmerz, der mir ohne Vorwarnung den Boden unter den Füßen wegreißen und mich in einen schwarzen Schlund stürzen lassen konnte.
Ich wusste nicht, wie lange wir so standen. Irgendwann räusperte Jake sich und knuffte mir behutsam in die Seite. Dann sah er auf die Uhr und stieß einen tiefen Seufzer aus.
»Ich sollte mich langsam auf den Weg machen, sonst verpflichtest du mich noch dazu, mit dir gemeinsam auszupacken, und in dein Chaos möchte ich wirklich nicht involviert werden«, neckte mein Bruder mich. Da ich wusste, dass dies ein Aufmunterungsversuch sein sollte, zwang ich mich zu einem zaghaften Lächeln.
Jake hatte heute noch eine fünfstündige Fahrt nach London vor sich, wo er seit Kurzem gemeinsam mit seinem Mitbewohner Paul in einer WG wohnte. Ich hatte ihn für eine Woche dort besucht und die Zeit mit meinem Bruder genossen, bevor wir uns ab heute für eine lange Zeit nicht mehr sehen würden. Heute früh hatten Jake und ich gemeinsam Bobby beladen und waren von London bis an die Küste in die gemütliche Stadt Port Ivy gefahren, in deren unmittelbarer Nähe die Academy lag.
Als ich ihn zum Abschied noch einmal fest umarmte, konnte ich nicht verhindern, dass mir erneut die Tränen in die Augen schossen. Ich war noch nie länger als zwei Wochen von meiner Familie und meinem Zuhause getrennt gewesen und nun würde ich bis zu den Sommerferien im August nicht mehr auf die Farm zurückkehren können.
»Mach’s gut, Ems«, verabschiedete er sich mit ruhiger Stimme. »Genieß die Zeit hier und gib dir wenigstens ein bisschen Mühe, nicht nur zu büffeln, sondern ab und zu etwas Spaß zu haben.«
Spaß. Na klar. Ich verdrehte die Augen.
Jake bemerkte es nicht, sondern grinste plötzlich bis über beide Ohren und deutete vielsagend aus dem Fenster. »Wenn ich mich hier so umschaue, gibt es einiges, mit dem du eine Menge Spaß haben kannst.«
Misstrauisch folgte ich seinem Blick und entdeckte eine Gruppe recht hübscher Kerle, die allesamt nur in Badehosen bekleidet den Weg zum Strand entlanggingen und dabei jeder ein Surfbrett unter den Arm geklemmt hatten.
Ich verdrehte die Augen. »Du bist unverbesserlich!«
»Ich weiß«, sagte Jake mit einem verschlagenen Lächeln, bevor er mein Zimmer verließ und mit einem letzten Winken die Tür hinter sich zuzog.
Kapitel 2
Lucas
»Ruf uns bitte zwischendurch an, damit wir wissen, ob bei dir alles in Ordnung ist«, sagte Mum angespannt, während sie nervös in meinem neuen Zimmer auf und ab ging. Sie redete seit nun mehr zwanzig Minuten auf mich ein.
»Mach ich, Mum«, versuchte ich sie zu beruhigen. »Und bevor du fragst: Ja, ich weiß, auf wie viel Grad ich meine Wäsche zu waschen habe, und ich verspreche auch, mich nicht nur von Tiefkühlpizza zu ernähren.« Ich warf ihr einen spöttischen Blick zu, woraufhin sie mich stürmisch umarmte.
»Tut mir leid, Lucas«, sagte sie, das Gesicht in meiner Schulter vergraben, sodass ich ihre Stimme leicht dumpf durch mein T-Shirt hörte. »O Gott!«, sie löste sich von mir und vergrub stattdessen ihr Gesicht in den Händen. »Ich benehme mich wie eine dieser Helikoptermütter. Wieder schlang sie ihre Arme um mich. »Ich will doch nur, dass es dir gut geht«.
»Katherine, du erdrückst ihn noch«, schaltete sich mein Vater ein, der dabei war, meinen Koffer auf das schmale Bett zu hieven. »Außerdem sind wir doch ganz in der Nähe und können jeder Zeit zur Stelle sein, sollte Lucas den Toaster in Brand stecken.«
»Siehst du, Mum, sollte ich versehentlich was anzünden, seid ihr in dreißig Minuten hier und könnt der Feuerwehr höchstpersönlich zu Hilfe eilen.« Bei der Vorstellung, wie Mum, bewaffnet mit Feuerwehrhelm und Schlauch, auf einen brennenden Toaster zurannte, gluckste ich. Dads Mundwinkel zuckten ebenfalls, was sie wiederum an den Rand der Verzweiflung brachte.
Vor meiner Bewerbung für das Dev Year hatte ich lange überlegt, ob ich wirklich so nah bei meiner Familie wohnen bleiben wollte. Ob es nicht besser wäre, mal rauszukommen und den eigenen Horizont zu erweitern. Woanders wirklich zu leben und nicht nur teuren Urlaub zu machen. Vielleicht in den USA oder in Kapstadt. Aber nein. Schlussendlich musste ich mir eingestehen, dass mir der Gedanke gefiel, jederzeit zum Anwesen meiner Eltern fahren zu können, um sie zu besuchen. Und ohne meine Schwester Alice, die in der Nähe arbeitete, wäre ich ohnehin ziemlich aufgeschmissen gewesen. Etwas, das ich ihr gegenüber selbstverständlich nie zugegeben hätte.
Mein Blick huschte zu meinen Eltern und ich musste grinsen. Mum ignorierte Dads Der-Junge-schafft-das-alleine-Protest und ließ sich nicht davon abhalten, meine Hemden und Jacketts auf Kleiderbügel zu drapieren und ordentlich in den Schrank zu hängen. Dad rollte daraufhin mit den Augen, setzte sich auf den Bürostuhl vor dem Schreibtisch und drehte sich verspielt hin und her. Es war mir – wie so oft – ein Rätsel, wie diese zwei ein Millionenimperium anführen und zahlreiche Mitarbeiter leiten konnten.
Obwohl sie in ihrer Firma ziemlich eingespannt waren, hatten meine Eltern es sich nicht nehmen lassen, mich an meinem ersten Tag an die Academy of Avondale zu begleiten. Ich hatte nicht versucht zu protestieren. Klar, andere hätten es vielleicht peinlich gefunden, noch von den eigenen Eltern bis ins Zimmer eskortiert zu werden, und das mit achtzehn. Aber eigentlich war ich ziemlich dankbar dafür, dass sie hier waren und ich mich nicht allein auf dem riesigen Gelände der Academy zurechtfinden musste. Und auch wenn ich theoretisch die Möglichkeit hatte, sie jedes Wochenende zu besuchen, wusste ich, dass sie mir fehlen würden.
Sie alle würden mir fehlen, und doch war ich froh, in Zukunft den durchdringenden Blicken meiner Eltern ausweichen zu können. Den Blicken, in denen eine Million Sorgen steckten, obwohl sie sie nie aussprachen. Keinen Druck machten. Aber ihre stummen Fragen bohrten sich dennoch in mich hinein und drohten mich von innen zu zerfressen.
Wo willst du hin im Leben, Lucas? Was willst du mit deinem Leben anfangen, Lucas? Was tust du jetzt, wo du eine zweite Chance hast, Lucas?
Und das war genau das Problem. Ich hatte keinen blassen Schimmer. Ich wusste nicht, wohin mit mir und meinem verfluchten Leben. Es gab keinen Plan. Keinen Weg. Kein Ziel. Nichts, was mein Leben von seiner Belanglosigkeit befreite. Zumindest noch nicht.
Als Mum auch noch anfing, meine Socken aus dem Koffer in den Schubladen zu verstauen, entschied ich, der Sache ein Ende zu bereiten.
»Mum, das schaff ich schon. Ich find’s super, dass ihr mich hergefahren habt, aber ich glaube, ihr solltet langsam den Rückweg antreten.« Ich nahm sie in die Arme, gab ihr einen Kuss auf die Wange und erstickte damit ihren Protest. Dad warf ich über ihre Schulter einen Hilfe suchenden Blick zu.
»Der Junge hat recht. Wir sollten ihm die Chance geben, sein neues Zuhause ohne zwei Mittvierziger im Schlepptau zu erkunden«, sprang mir mein Vater zur Seite.
Dad war vor dreißig Jahren selbst Schüler an der Avondale gewesen und schien zu wissen, was als Neuling auf mich zukam. Auch er schloss mich in eine Umarmung und klopfte mir auf die Schulter.
»Wir sind so stolz auf dich, Lucas. Du wirst eine fantastische Zeit haben, da bin ich sicher«, sagte Mum, während Dad sie liebevoll aus der Tür schob und mir zum Abschied zuwinkte.
Nachdem die beiden gegangen waren, räumte ich etwas verloren die restliche Kleidung in den winzigen Schrank. Skeptisch zog ich die Schuluniform heraus und stöhnte innerlich. Eine Krawatte in der Farbe von Himbeermarmelade baumelte über einem weißen Hemd mit dem Wappen der Academy auf der Brust. Dazu passend fand ich eine graue Hose und ebenfalls ein Himbeermarmeladen-Jackett. Seufzend hängte ich sie zurück auf die Kleiderstange. Eigentlich hatte ich gehofft, mich nach meinem Highschoolabschluss nicht mehr in so etwas hineinzwängen zu müssen. Immerhin passte meine Gitarre samt Koffer gerade so unter das Bett. Shampoo, Rasierer und Zahnbürste ließ ich achtlos auf dem Schreibtisch liegen. Das hatte Zeit bis später.
Mit Schwung warf ich mich aufs Bett und betrachtete die weiß gestrichene Zimmerdecke. Was mich wohl im kommenden Jahr erwarten würde? Ich stöberte verträumt durch die Broschüren, die mir bei meiner Ankunft jemand in die Hand gedrückt hatte, konnte mich aber auf nichts richtig konzentrieren.
Plötzlich riss mich ein Geräusch aus meinen Tagträumen. Ich hörte, dass jemand den Schlüssel in die Eingangstür der Wohneinheit steckte und polternd die Tür öffnete.
»Man drehe die Musik auf und reiche mir ein Bier«, hallte eine mir sehr vertraute Stimme durch die Wohneinheit. Lachend stand ich auf und lief aus meinem Zimmer. Im Türrahmen lehnte ein braun gebrannter Junge, in dessen dunkelbraunem Haar eine Sonnenbrille steckte. Er trug ein lockeres weißes T-Shirt, eine rote Badehose und Badelatschen an den Füßen.
»Bist du sicher, dass dein Outfit dem vorgegebenen Dresscode entspricht?«, begrüßte ich lachend meinen besten Freund Aaron. »Das hier ist eine hoch seriöse Einrichtung. Nicht Baywatch.«
»Du kennst mich, Alter. An Dresscodes habe ich mich noch nie gehalten«, wandte er ein und schob seine Koffer ins Wohnzimmer.
»Du meinst, die Shepards haben nicht explizit darum gebeten, dass du in einem weißen Kleid auf ihrer Hochzeit erscheinst?«
»Ach, das hatte ich ohnehin nicht lange an.« Aaron zwinkerte mir verschwörerisch zu. Dann schmiss er sich mit einem Sprung auf das geordnete Sofa und streckte die Beine über die Lehne aus.
Aaron war wie ich in einer Kleinstadt in der Nähe aufgewachsen. Beide hatten wir die St. Benedict’s Middle School besucht. Eine Schule, die sehr privat, sehr spießig und für sehr reiche Leute war. Aaron wiederum war zwar reich, aber auch laut, unangepasst und brach mehr als einmal die Regeln. Ich hatte ihn vom ersten Tag an gemocht und spätestens seit ich ihm ein falsches Alibi gegeben hatte, als er das Klo im Lehrerzimmer mit den Seiten des Klassenbuches verstopft hatte, vertrauten wir einander blind. Da er in Sachen Zukunft genauso viele Pläne hatte wie ich – nämlich gar keine –, kam uns das Vorbereitungsjahr an der Academy sehr gelegen.
Aaron stand vom Sofa auf und schlenderte auf unser Zimmer zu. »Hier lässt es sich doch aushalten«, sagte er mit Blick auf die Weite des Atlantiks. »Das wird ein großartiges Jahr, Lucas! Wir beide, Sonne, Strand, Surfen, Partys und vor allem Frauen.« Er sah mich verschmitzt an und wackelte mit den Augenbrauen.
»Vergisst du da nicht etwas? Seminare, Lernen, Übungsinterviews? So viel Zeit für Partys und Flirten bleibt da bestimmt nicht«, stellte ich seine Pläne infrage.
»Okay. Regel Numero uno.« Aaron hob missbilligend einen Finger in die Höhe. »Wir gehen auf jede Party, die uns über den Weg läuft, und verbringen außerdem so viel Zeit wie möglich auf dem Brett.« Während er das sagte, tat er, als würde er bereits eine nicht existente Welle reiten.
»Das sind schon zwei Regeln, du Holzkopf«, bemerkte ich kopfschüttelnd, konnte aber nur grinsen.
Aarons Leben war seit jeher eine einzige Party. Er ließ keine Möglichkeit aus zu feiern und jettete dafür nicht selten in sämtliche Metropolen der Welt. Er hatte diese ganz bestimmte unbekümmerte Ausstrahlung, die Frauen auf der ganzen Welt anzog wie Motten das Licht. Ein Zustand, den er in vollen Zügen genoss.
Manch eine seiner meist überdurchschnittlich attraktiven Verehrerinnen erhoffte sich ohne Zweifel mehr. Eine echte Beziehung oder – und das galt für die meisten – Eintritt in die verlockende Welt des Reichtums und Glamours, die Aaron umgaben wie ein betörendes Parfum. Wer mit ihm gesehen wurde, hatte es schon mehr als einmal in die Boulevardblätter geschafft. Alle Hoffnungen mussten sie jedoch spätestens nach ein paar wenigen Nächten mit Aaron begraben. Mein bester Freund liebte sein Leben und die damit verbundene Freiheit, weshalb er den Frauen sofort ein Ticket nach Hause spendierte, sobald es ernst wurde.
»Was ist? Gehen wir jetzt an den Strand oder willst du den ganzen Sommer darin verbringen?« Aaron deutete vorwurfsvoll auf meine lange Stoffhose und das Polohemd. »Da draußen sind es mindestens achtunddreißig Grad«.
»Es sind höchstens zweiundzwanzig Grad und ich halte mich eben an den Dresscode«, verteidigte ich mein Outfit.
Aaron schlug sich stöhnend eine Hand vor die Stirn. »Jetzt komm schon, Luke. Ich will mich auf der Stelle in die Wellen stürzen und ich will, dass du mitkommst!«, quengelte er.
»Schon gut, schon gut. So, wie du jammerst, könnte man meinen, du wärst acht und nicht achtzehn.«
Nachdem auch ich mich meiner Kleidung entledigt hatte und in einen Neoprenanzug geschlüpft war, machten wir uns auf den Weg zum Strand. Wir stoppten bei einem hölzernen Schuppen, der laut Lageplan die Surfbretter der Academy verwahrte und eine beachtliche Auswahl vorweisen konnte. Wir schnappten uns zwei davon, bevor wir mit schnellen Schritten auf die Treppe zuliefen, die die felsigen Klippen mit dem Strand verband.
Ich war an der Küste aufgewachsen und hatte schon mit fünf den Sand nach Muscheln und Steinen abgesucht. Obwohl ich mittlerweile an die Schönheit Cornwalls hätte gewöhnt sein müssen, war ich doch jedes Mal aufs Neue fasziniert, wenn die endlosen Weiten des Strandes, die dahinterliegenden steinernen Felsen und das tosende Meer sich vor mir erstreckten.
Ich hielt für einen Moment inne. Spürte den Wind, der an meinem Haar zog. Atmete die salzige Luft ein, die nach Kindheit und Abenteuer schmeckte. Für eine Sekunde, für einen Zeitsplitter, war ich vollkommen ruhig. Für einen Zeitsplitter waren die Last auf meinen Schultern, die Stimme, die bohrenden Blicke, die mich bis in meine Träume verfolgten, weg. Und dann war er vorbei und alles kam zurück.
Ich sah mich um. Versuchte mich von der Faust abzulenken, die sich immer tiefer in meinen Magen bohrte. Außer uns entdeckte ich nur zwei andere Surfer. Sie lagen neben ihren Brettern auf großen Handtüchern in der Sonne. Wir steuerten auf sie zu und trafen auf zwei Jungen unseres Alters, die Reggaemusik aus einer Bluetooth-Box hörten und Bier tranken, das sie in einer Kühlbox aufbewahrten. Zack und Fabio, wie sie sich vorstellten, waren mir beide sofort sympathisch. Sie boten uns jeweils eins der Biere an und um gleich auf unser Kennenlernen anzustoßen, ließen wir die Flaschen aneinanderklirren.
»Auf neue Freundschaften und den Anfang des besten Jahres aller Zeiten«, stieß Aaron einen Toast aus.
Es dauerte nicht lange, bis wir in Gespräche vertieft waren. Zack strebte ein Wirtschaftsstudium in Harvard an. Nicht ohne ein stolzes Lächeln zeigte er uns außerdem das Foto eines hübschen dunkelblonden Mädchens, das seit zwei Jahren seine Freundin war und ihn nach Harvard begleiten würde. Still hörte ich zu, wie Zack mit strahlenden Augen von ihr schwärmte. Ich beneidete ihn. Wieder spürte ich den Stein, der meinen Magen füllte und sich bei seinen Worten unerträglich schwer anfühlte. Ich beneidete ihn um seinen glasklaren Zukunftsplan und um seine Freundin. Um die Konstanten in seinem Leben. Etwas, für das es sich lohnte zu kämpfen.
»So, genug geredet«, entschied Aaron nach einer Weile und stand auf. »Die Wellen da draußen warten darauf, von uns geritten zu werden«. Kurzerhand schnappte er sich sein Surfbrett, klemmte es sich gekonnt unter den Arm und rannte mit großen Schritten auf das Wasser zu.
Fragend sah ich Zack und Fabio an, doch diese lehnten dankend ab. Ich zuckte mit den Achseln und folgte meinem besten Freund in die tosenden Wellen.
Das Wasser war kalt, aber herrlich. Ich schmeckte das Salz auf meinen Lippen und spürte die Sonne auf meiner Haut. Während ich mir einen Weg durch das Wasser bahnte, fühlte ich mich unvorstellbar leicht. Jeder störende Gedanke wurde von den Wellen aus meinem Kopf gespült. Da waren keine Zweifel. Keine Ängste. Keine Bedeutungslosigkeit. Sie würden zurückkommen, das wusste ich. Sobald ich den Ozean verließ, würden sie zurückkommen und mich erneut daran erinnern, dass ich mein Leben vergeudete.
Kapitel 3
Emilia
Unschlüssig öffnete ich meinen großen Rucksack und beförderte die Kleidung ordentlich gefaltet in meinen Schrank, auch wenn ich wusste, dass die Ordnung nicht von Dauer sein würde. Kurz sah ich mir die Uniform an. Sie war hübsch. Grauer Rock, beerenfarbener Blazer, weiße Bluse. Entgegen der Meinung vieler anderer mochte ich Schuluniformen, vor allem hier. Hier an der Academy, wo Louis-Vuitton-Taschen, Prada-Kleidchen und diese Schuhe mit der roten Sohle, deren Markennamen ich immer vergaß, zu jeder normalen Garderobe gehörten. Durch die Uniform würde meine fehlende Kreditkarte vielleicht nicht sofort auffallen.
Das Bett bezog ich mit meiner Lieblingsbettwäsche. Schließlich kramte ich ein gerahmtes Foto von Mum, Dad, Jake und mir aus einer der Taschen und schob es unsicher auf dem Schreibtisch hin und her. Als ich in unsere lachenden Gesichter sah, fühlte ich mich plötzlich unglaublich einsam.
Das ist doch lächerlich. Einen Platz an der Academy of Avondale habe ich mir seit einem Jahr sehnlichst gewünscht, erinnerte ich mich selbst. Außerdem war ich gerade mal zwanzig Minuten hier. Es ist eindeutig zu früh für Heimweh, entschied ich bestimmt und schnappte mir kurzerhand die vielen Broschüren und Unterlagen der Academy.
Neben einigen Infos zu den einzelnen AGs und Gruppen entdeckte ich einen Wochenplan, der auf mein persönliches Profil zugeschnitten war. Ich hatte mich primär für politische, philosophische und literarische Fächer entschieden. Die interessierten mich zwar nicht gerade brennend, passten aber am besten zu einem Jurastudium und somit in meine Collegebewerbung. Nach dem, was mir und meiner Familie widerfahren war, gab es für mich nur diesen einen Weg. Nur so konnte ich der ungerechten Welt die Stirn bieten. Ich würde für Gerechtigkeit eintreten und nie, nie wieder zulassen, dass sich mein Schicksal wiederholte.
Auf meinem Handy öffnete ich meinen Stundenplan. Ich hatte meist drei Seminare am Tag. Fächer wie Politische und wirtschaftliche Grundlagen, Englische Literatur und Kultur und Geschichte. Hinzu kamen auf die jeweiligen Universitäten angepasste Vorbereitungskurse, in denen die einzelnen Auswahlverfahren der Colleges besprochen und Interviews geprobt wurden.
Ich seufzte. Das Jahr würde mit Sicherheit kein Spaziergang werden, sondern meine volle Aufmerksamkeit erfordern. Das hatte ich aber erwartet. Und ich würde alles geben, was ich hatte.
Mir fielen die Infos einer Fotografie-AG und die des Tennisteams in die Hände, denen ich jedoch wenig Beachtung schenkte. Ich wusste genau, wonach ich suchte. Nach einigem Stöbern fand ich sie: die Broschüre der Tanzkurse. Mein Herz machte einen freudigen Hüpfer, als mein Blick durch die glänzenden Seiten flog.
Mit dem Tanzen hatte ich begonnen, als ich kaum mehr als drei Schritte hatte gehen können. Als Kind war ich zum klassischen Ballettunterricht gegangen, weil ich die Tutus und die Kostüme so schön fand. Und auch ein bisschen, weil Barbie in: Die 12 tanzenden Prinzessinnen mein absoluter Lieblingsfilm gewesen war. Vor ein paar Jahren hatte ich mich jedoch entschieden, zum Modern Ballett zu wechseln, da dieses mir mehr Individualität und mehr Raum für eigene Ideen ermöglichte. Das unvergleichliche Gefühl war jedoch immer dasselbe geblieben.
Sobald die Musik einsetzte und ich tanzte, war ich unbesiegbar, schwerelos und befreit. Nicht mal die dunkelsten Erinnerungen und Gedanken, die wie schwarze langfingrige Hände nach mir greifen und mich zu Boden ziehen wollten, hatten dann eine Chance. Auch wenn es meine ohnehin schon kaum vorhandene freie Zeit an der Academy auf ein Minimum reduzieren würde, konnte ich es kaum erwarten, wieder richtig ins Training einzusteigen.
Während ich mir Raum und Zeit des passenden Tanzkurses notierte, hörte ich, dass jemand mit lautem Krachen die Wohneinheit betrat. Mein Puls beschleunigte sich. Offensichtlich war es jetzt an der Zeit, eine meiner Mitbewohnerinnen kennenzulernen. Nervosität kroch durch meine Beine. Ich atmete tief durch und lugte aus der Zimmertür.
Hinter einem sperrigen und offensichtlich ziemlich schweren Gegenstand konnte ich zunächst nur eine Stimme ächzen hören. Kurz danach kam eine blonde Lockenmähne zum Vorschein, die nach allen Seiten abstand. Auf dem Rücken der Person konnte ich einen ähnlichen Reiserucksack erkennen, wie ich ihn vor wenigen Minuten ausgepackt hatte. Die Lockenmähne schwankte und drohte unter der Last ihres Gepäcks das Gleichgewicht zu verlieren. Schnell eilte ich auf sie zu.
»Äh, brauchst du vielleicht Hilfe?«
»Dich schickt der Himmel. Hier, halt mal bitte«, forderte sie mich auf. Gemeinsam trugen wir die ominöse Gerätschaft zu einer der Kommoden, die sich im Flur befanden, und versuchten uns beim Abstellen nicht die Finger einzuklemmen. Als das weiße Ding sicher stand, konnte ich endlich ihr Gesicht sehen.
Ein Grinsen stahl sich auf meine Mundwinkel und ich hoffte, dass mir mein Erstaunen nicht zu stark ins Gesicht geschrieben war. Ihre stahlgrauen Augen wurden durch einen geschwungenen schwarzen Lidstrich betont und beeindruckt bemerkte ich, dass ein goldener Ring in ihrer Nasenscheidewand steckte. Sie trug eine abgewetzte Jeansjacke, darunter ein eng anliegendes schwarzes Kleid und Lederboots. An ihrem Handgelenk erkannte ich ein tätowiertes Ahornblatt. Kurzum: Sie war all das, womit ich an einem Ort wie diesem nicht gerechnet hätte.
»Hi, ich bin Neyla«, stellte sie sich mit einem breiten Lächeln vor. Ich glaubte, einen kanadischen Akzent herauszuhören.
»Emilia« Ich lächelte zurück. Dann deutete ich auf das weiße Was-auch-immer-es-war, das wir soeben auf die Kommode manövriert hatten, und sah sie fragend an. »Sollte ich wissen, was für eigenartige und furchtbar schwere Dinge du hier reinschleppst? Oder ist es zu meiner eigenen Sicherheit besser, wenn ich im Unklaren gelassen werde?«
»O nein.« Sie riss weit die Augen auf und sah mich bestürzt an. »Du hast noch nie eine Nähmaschine gesehen? Also bist du eins dieser verwöhnten Kids, das schon mit vier in Designerklamotten gesteckt wurde und nur in Läden shoppen geht, wo keine Preisschilder an den Klamotten hängen?« Spielerisch griff sie sich ans Herz und tat, als würde sie gleich in Ohnmacht fallen. »Und dabei habe ich gedacht, du wärst cool.«
»Ich weiß sehr wohl, wie Nähmaschinen aussehen, aber keine der mir bekannten hat Ähnlichkeit mit diesem Ding hier«, verteidigte ich mich kichernd.
Sie sah mich erneut entgeistert an und schüttelte fassungslos den Kopf. »Dieses Ding hier ist nicht irgendeine Nähmaschine. Das ist eine Brilund2000«.
»Klingt wie ein Gegenstand aus Harry Potter.«
»Das ist die beste Nähmaschine auf dem Markt. Sie hat eine besondere Form der Stichführung und …« Sie unterbrach sich. »Den Rest erspare ich dir.«
»Und was nähst du so?«, fragte ich neugierig. Alles, was ich bisher hervorgebracht hatte, waren nicht sehr symmetrische Kissenbezüge.
»Eigentlich alles!«, antwortete sie wie aus der Pistole geschossen. »Ich liebe es, Kleidungsstücke in sämtlichen Farben und Formen zu entwerfen«, beschrieb sie mit leuchtenden Augen. »Versprich mir, dass du nie wieder irgendwas aus deinem Kleiderschrank in den Müll wirfst, nur weil es nicht mehr passt! Ich schwöre dir, dass ich aus jedem noch so kaputt aussehenden Teil noch etwas zaubern kann.«
Ich versprach es ihr, immer noch kichernd, und führte sie in unser gemeinsames Zimmer, wo sie sich stöhnend auf ihr Bett fallen ließ.
»Und du, Emilia, woher kommst du?«, fragte sie, während sie sich die schweren Boots von den Füßen zog.
»Ich bin auf einer Farm in Irland aufgewachsen«, beantwortete ich ihre Frage und zwinkerte ihr zu. »Ich habe mit vier also eher Matschhose und Gummistiefel getragen. Keine Designerklamotten.«
»Gott sei Dank, ich kann diese verwöhnten Barbies nicht ausstehen«, erwiderte sie erleichtert. »Du bist also eine Stipendiatin?« fragte sie dann.
»Schuldig.« Ich zuckte mit den Schultern. »Du auch? Ehrlich gesagt wirkst du ebenfalls wie das komplette Gegenteil einer dieser verwöhnten Barbies.«
»Das stimmt zwar, aber die Familie meiner Mum hat ein Flugunternehmen.« Sie erwähnte dies so beiläufig, als würde es für ihr Leben eine ähnlich wichtige Rolle spielen wie ihr gestriges Frühstück.
»Etwa Montgomery Airways?« Ich war baff. Werbespots über die Airline liefen im Fernsehen rauf und runter. Wenn ich mich recht erinnerte, handelte es sich um ein kanadisches Unternehmen, welches eher kleine Maschinen besaß, die aber als erstklassig und luxuriös galten.
»Ja, genau«, stimmte sie mit immer noch gleichgültigem Unterton zu. »Aber als meine Mum ihrer Familie eröffnete, dass sie ihren Verlobten für eine Frau verlassen würde, wurde ihr nahegelegt, ihre Anteile zu verkaufen und sich aus der Firma zurückzuziehen«, fügte sie augenrollend hinzu.
»Shit. Das tut mir leid für deine Mum. Unglaublich, wie rückschrittig es in den Köpfen mancher Menschen zugeht.«
Neyla nickte zustimmend. »Na ja, sie hat für ihre Anteile einen Haufen Kohle bekommen und ihre große Liebe, meine Mama.« Sie drückte mir ein gerahmtes Foto in die Hand, auf dem Neyla zusammen mit zwei Frauen mittleren Alters zu sehen war.
»Seit sich offenbar jede Institution der Welt Diversity auf die Fahne schreibt, will mich jeder als Aushängeschild.« Sie zuckte die Schultern und fuhr mit verstellter Stimme fort. »Seht her, wir sind so weltoffen und liberal. Wir dürfen sogar die Tochter zweier Lesben zu unseren Studierenden zählen. Wir sind ja so modern.« Sie seufzte. »Was vermutlich auch der Grund dafür ist, dass ich an dieser Academy aufgenommen wurde. An hervorragenden Noten in der Highschool kann es jedenfalls nicht liegen.« Sie grinste verschlagen. »Aber was soll’s. Und die Farm? Was machen deine Eltern da genau?« Zu meiner Überraschung wirkte sie ehrlich interessiert.
»Es ist eine Apfelfarm«, begann ich etwas kleinlaut. Im Gegensatz zu einer verschmähten Fluggesellschaft klang das irgendwie lahm. Doch Neyla sah mich mit einem so wachen und aufmunternden Blick an, dass ich etwas selbstbewusster fortfuhr. »Nach der Ernte verkauft Dad einen Teil der Äpfel an die Supermärkte. Aus dem anderen Teil stellt er Apfelsaft und – was das Beste ist – Cider her.« Ich warf ihr einen verschwörerischen Blick zu.
»O mein Gott!« Neyla sprang auf. »Meine Mitbewohnerin Schrägstrich neue beste Freundin hat ein Weingut. Du könntest mal ein paar Flaschen mitbringen und wir machen ein Tasting, mit Käse, Trauben und all diesen Dingen, die spießige Leute so machen.« Sie sprudelte beinahe über.
»Es ist nur ein kleiner Betrieb und wir haben gerade mal drei verschiedene Sorten. Ich bezweifle auch, dass man bei einem Apfelwein-Tasting hochwertigen Käse zu sich nimmt«, gab ich schmunzelnd zu bedenken. »Aber ich wäre bereit, die Regeln zu brechen.«
»Oh, wir sind so unkonventionell und rebellisch«, stellte Neyla fest. Beide prusteten wir los.
»Was ist mit deiner Mum?«, riss sie mich aus meinen Gedanken.
Ich zuckte zusammen. »Was meinst du?« Meine Stimme wackelte.
»Du hast gesagt, dass dein Dad den – wovon ich ausgehe, absolut grandiosen – Apfelwein herstellt. Ist deine Mum auch an der Farm beteiligt?«
Kälte legte sich um mich wie eine frostige Decke. Ich spürte, wie sich eine eisige Enge in meiner Brust ausbreitete und mir das Atmen plötzlich schwerfiel. Bitte nicht jetzt, flehte ich meinen Körper an.
»Alles okay?« Neyla schien besorgt.
Ich konnte nicht antworten, zu sehr war ich damit beschäftigt, mit aller Macht meinen Atem zu kontrollieren. Ein. Aus. Ich sah zu Boden und ballte die Hände zu Fäusten. Die Kälte breitete sich unerbittlich von meiner Brust bis in die Fingerspitzen aus. Dunkelheit waberte am Rand meines Blickfeldes. Bedrohliche, alles verschlingende Schwärze. Ich kannte sie bereits.
Mein Herzschlag verdreifachte sich, hämmerte unerbittlich gegen meinen Brustkorb, als würde das Organ jeden Moment erliegen und davor die Schläge eines gesamten Lebens innerhalb einer Minute ausführen wollen. Blut rauschte in meinen Ohren.
Luft. Ich brauchte Luft. Ich würde sonst ersticken. Luft. Aber da war keine Luft mehr. Kein Sauerstoff, der meine Lungen füllte und mich am Leben hielt.
»Hey! Schau mich an!« Neylas Stimme drang wie ein verzerrtes, rauschendes Radio an mein Ohr, kaum zu verstehen. Sie legte mir eine Hand auf die Schulter und suchte meinen Blick. Es kostete mich alles, was ich hatte, um ihn zu erwidern.
»Wir atmen jetzt gemeinsam. Mach mir nach.«
Atmen. Luft. Leben.
Ich bemühte mich, ihr zu folgen, auch wenn die schwarze Welle immer näher kam. Sie ließ die Luft für circa vier Sekunden geräuschvoll und kontrolliert entweichen. Dann sah sie mich auffordernd an. Zumindest glaubte ich das. Die Schwärze hatte beinahe mein gesamtes Sichtfeld eingenommen. Doch irgendwie schaffte ich es. Ich zwang meine Lunge, ebenso kontrolliert auszuatmen.
»Und jetzt für drei Sekunden ein«, erklärte sie weiter. Wir holten gemeinsam Luft, während Neyla mit ihren Fingern drei Sekunden abzählte. »Und jetzt fünf.«