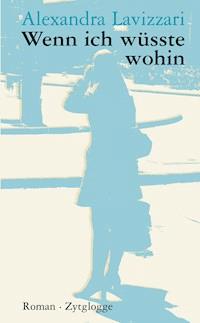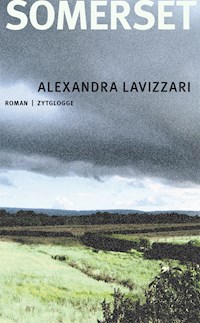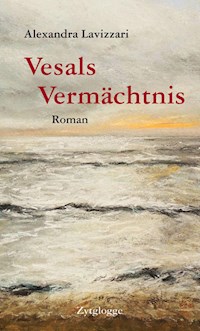22,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Zytglogge Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Atmosphärisch dichter Roman um ein rätselhaftes Verbrechen Atemlose Suche nach dem Seelenheil Hintergründiges Spiel mit den Gattungskriterien des Detektivromans Eine Siebenjährige erlebt, wie ihr Vater erschossen wird. Aufgeschreckt Weniger durch den Schuss selbst – es ist Jagdsaison im Tessin – als durch die anschliessende Stille, läuft sie in den Garten des Ferienhauses, wo er tot vor den Sträuchern liegt, die er eben noch geschnitten hat. In der Hand hält er ein eigenartiges Holzpferdchen, das sie reflexhaft einsteckt und der Polizei später verheimlicht. Der Mord bleibt ungeklärt, das Trauma ihrer Kindheit lässt sie nicht mehr los. Längst erwachsen geworden, nimmt sie von Basel aus die Ermittlungen wieder auf. Die Holzfigur sowie ein altes Foto, das ihren Vater in jungen Jahren mit einem ihr unbekannten Mann zeigt und auf der Rückseite den Vermerk «Mit Harry, Pentyrch/Cardiff 1949» trägt, weist schliesslich nach Wales. Liegt hier der Schlüssel für das Verbrechen? Wer ist Harry? Weiss er etwas und wo ist er zu finden?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Ähnliche
ALEXANDRA LAVIZZARI
UND HARRY?
Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2016–2020 unterstützt.
© 2017 Zytglogge Verlag AG, Basel
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Thomas Gierl
Coverbild: Thomas Gierl
Gesamtherstellung: Schwabe AG, Muttenz/Basel
ISBN: 978-3-7296-0966-2
ISBN ePUB: 978-3-7296-2204-3
ISBN mobi: 978-3-7296-2205-0
E-Book: Schwabe AG, www.schwabe.ch
www.zytglogge.ch
Alexandra Lavizzari
UND HARRY?
Roman
Für Britta
Seien Sie ehrlich: Wenn ich beginne mit ‹Mein Vater starb, als ich sieben Jahre alt war›, werden Sie die Augen verdrehen und denken, ach, schon wieder eine, die ihre Kindheit auf uns abwälzen will, ein Trauma vielleicht, wer weiss, was für schreckliche Dinge mich auf den nächsten Seiten erwarten, das Heim, der böse Stiefvater und dergleichen, nein, wirklich, muss das sein, wo ich ja selbst noch an den eigenen Vergangenheitsbrocken zu würgen habe, das brauche ich jetzt nicht, Literatur, die mich runterzieht, im Gegenteil; ich möchte mich lieber in was Heiteres vertiefen, das rein gar nichts mit meinem Alltag zu tun hat, was Leichtes; hier kann ich jedoch Gift darauf nehmen, dass die Sache ihren tristen Lauf nimmt und die Erzählerin mich spätestens ab Seite zwanzig mit ihrer Traurigkeit anstecken wird. Nein, danke, keinen Satz mehr von dem Zeug, weg damit!
Das kann besagte Erzählerin gut verstehen, ihr ginge es wahrscheinlich genauso. Also vergessen wir diesen Satz, das heisst, Sie vergessen ihn, während ich mir einen neuen ausdenke, der weniger selbstmitleidig daherkommt, aber ungefähr dasselbe sagt – ja, doch, das soll er, denn ich habe mir in den Kopf gesetzt, meine Geschichte mit Vaters Tod beginnen zu lassen, davon will ich nicht abrücken, es scheint mir von allen möglichen Anfängen der logischste, und ich halte mich nun mal, was das Erzählen betrifft, gern an die Logik, wie wäre es also, bevor Ihr Geduldsfaden reisst, mit ‹Als ich sieben Jahre alt war, fand ich meinen Vater tot vor der Gartentenne liegen, das Gesicht im Gras und die Amboss-Schere in der rechten Hand›?
Ich möchte hier vorwegnehmen, dass ich den Begriff ‹Amboss-Schere› als Kind nicht kannte, klar nicht, und dass ich nicht einmal sicher bin, ob ich dieses Utensil damals überhaupt wahrnahm. Ich stand wie von Blödheit geschlagen neben Vater und schaute auf ihn hinab. Sein Hemd sehe ich, wenn ich mir die Szene vergegenwärtige, es war blau-weiss gestreift, dann ein Kleenex, das aus der Hosentasche hing, und die linke Faust umklammerte etwas Haariges, darauf komme ich noch zurück, jedenfalls starrte ich ihn lange an, ohne mich zu rühren und ohne einen Laut auszustossen, weder Schrei noch Ruf, nichts kam. Ich muss annehmen, dass es der berühmte lähmende Schrecken war, der mich eine Ewigkeit an Vaters Seite festnagelte, Stillstehen war sonst nicht meine Art, ein Zappelkind nannte mich Mutter, wobei Ewigkeit wohl übertrieben ist, das Zeitgefühl trügt in solchen Momenten, wahrscheinlich bin ich nur ein paar Sekunden dagestanden, bevor ich mich gebückt habe, um an seiner Schulter zu rütteln und ihm zuzureden, er solle jetzt bitte, bitte aufstehen.
Die Amboss-Schere habe ich übrigens der Zeitung entnommen, die seinerzeit ausführlich über Vaters Tod berichtete. Wenn Sie mich fragen, handelte es sich um eine hundsgewöhnliche Gartenschere, aber der Journalist, der über den Fall schrieb, nahm die Dinge sehr genau und war obendrein, wie mir später zu Ohren kam, selbst Hobbygärtner, und zwar ein obsessiver, der sich mit Scheren und anderen Gartenartikeln bestens auskannte. In den folgenden Wochen verfasste er lange, pedantische Artikel, die Mutter in einer Mappe sammelte und die ich im Laufe der Jahre mit ihr oder allein immer wieder gelesen habe, so dass ich sie heute auswendig kenne und bisweilen mit den eigenen Erinnerungen verwechsle. Es kann gut sein, dass ich die Amboss-Schere erst gesehen, ich meine, dazu gedacht habe, als ich Jahre später die Zeitungsberichte las. Doch abgesehen von der Schere – Vater wollte an diesem Morgen die Haselnusssträucher zurückstutzen –, liegt mir daran, den Augenblick, in dem mein Leben eine schlagartige, unvorhergesehene Wendung nahm, möglichst so zu schildern, wie ich sie erlebt habe, oder wenigstens rückblickend glaube, erlebt zu haben. Wollte ich meinerseits pedantisch sein, müsste ich nun das Wetter einbeziehen (der 16. September 1960 war kühl), die Uhrzeit (laut Zeitung kurz vor zehn) und den Ort (Bigna, ein Dorf im oberen Leventinatal), aber diese zeitlichen und räumlichen Koordinaten, die zwar eine Geschichte verankern, nicht aber das fluktuierende Gedächtnis, sie spielten für mich in jenem Moment überhaupt keine Rolle, ich hätte irgendwo stehen können, im Schnee oder unter der Sonne, es hätte Winter sein können oder Sommer, Tag oder Nacht, denn ich sah zuerst nichts ausser meinem Vater und kämpfte mit aller Kraft gegen die keimende Einsicht, und die war unaufhaltsam, dass zu meinen Füssen ein Toter lag. Ich wollte nicht, dass dem so war, Vater war damals mein Ein und Alles, mein Freund, mein Vorbild, mein Gott, mein Bruder, wirklich alles, und so hoffte ich, allein mit meinem Wollen die Szene wegdenken zu können, in der ich mich selbst sowohl als Mittepunkt als auch als Zuschauerin empfand, sie war allzu absurd. Siebenjährige glauben noch halbwegs an derartige Zaubereien, doch als nichts geschah, begann ich mir einzureden, dass Vater sich wenigstens bald umdrehen und zu mir hoch lächeln würde, ein bisschen beschämt vielleicht, dass er am helllichten Tag eingeschlafen war, aber munter und gesund; es musste so sein, ich brauchte nur lange genug zu warten, alles war doch nur ein grosser Irrtum, der sich mit Vaters Augenaufschlag klären würde.
Vielleicht brennt Ihnen jetzt die Frage auf der Zunge, warum man damals über Vaters Tod in der Zeitung berichtete. Die Frage ist berechtigt, und die möglichen Antworten darauf, die Sie sich selbst schon ausgedacht haben werden, sind beschränkt: Entweder handelte es sich bei meinem Vater um einen berühmten Politiker, Sportler, Schauspieler oder Fernsehansager, dessen Gesicht man auf der Strasse erkannte, oder es waren Art und Umstände seines Todes, denen man Sensationswert zuschrieb. Letzteres trifft zu. Das kann ich heute einigermassen gelassen sagen, aber damals wollte ich meinen Augen und meiner Ahnung nicht trauen, selbst dann nicht, als ich bemerkte, dass Vaters Haare im Nacken verklebt waren und seltsam glänzten. Schweiss? Vater schwitzte nie. Blut? Richtig. Und deshalb müsste ich eigentlich mit zwei Sätzen beginnen; in etwa so: ‹Ich fand meinen Vater am 16. September 1960 erschossen im Garten unseres Ferienhauses im Tessin. Ich war sieben Jahre alt.› Klingt nicht toll, zwei aufeinanderfolgende Sätze mit demselben Einleitungswort, und von allen möglichen Wörtern erst noch das egomanische ‹Ich›, als wäre ich der Mittelpunkt des Universums, das merke ich selber, doch wenigstens enthält die Eröffnung im Kern genau die beiden Informationen, die ich Ihnen auf einen Schlag zuspielen möchte, damit Sie von Anfang an und buchstäblich im Bild sind.
Und wie steht’s mit dem Tatort?, höre ich Sie nun fragen. Nicht so wichtig, glauben Sie mir, alles, was ich hier schildere, hätte auch anderswo passieren können, doch es passierte halt in Bigna, weil wir immer dort Ferien machten, und mit ‹immer› meine ich Ostern, Sommer, Weihnachten mitsamt verlängerten Wochenenden. Mutter hatte ihre Jugend in diesem Dorf verbracht und das Haus geerbt, sie bestand auf häufige Besuche und klagte zu ihrer Rechtfertigung, dass im fernen Basel das Heimweh nur so an ihr nage, ja, so drückte sie sich aus, meine Mutter, und wenn sie das sagte, was oft war, sah ich einen Hamster vor mir, der an ihren Zehen knabberte, und musste mir das Lachen verkneifen. Auch vom Sauerstoff redete sie gerne. Er fehle in Basel, sei jenseits der Alpen aber umso reichlicher vorhanden, behauptete sie allen Ernstes, man spüre das doch, sobald man in Airolo aus dem Zug steige, was wiederum Vater zum Schmunzeln brachte, denn ihm erging es überhaupt nicht so, er fand den Sauerstoff schweizweit gerecht verteilt und sagte, was jeder in diesem Fall sagen würde, nämlich, dass es sich überall gleich gut atme in unseren Breitengraden, aber weil er eine gute Seele sei (das war er wirklich), verzichte er in Gottes Namen auf die Costa Brava oder Rimini, wo der Rest der Welt Ferien mache und wo auch die Kleine, das war ich, zur Abwechslung bestimmt gern mal hinginge. Wie recht er hatte, mein Papa, und wie taub sich Mutter stellte.
Denken Sie sich diesen Exkurs ruhig in Klammern, ich wollte damit nur erklären, warum wir als Familie gerade in Bigna weilten und dass es sich keinesfalls um einen einmaligen Aufenthalt handelte.
Der 16. September 1960 war ein Freitag, Mutters Ausgehtag. An Freitagen fuhr sie jeweils mit dem Postauto nach Airolo hinunter, nahm den Zug nach Lugano und traf sich dort mit ihren Schulfreundinnen im Café Vanini, bevor sie sich von Marco frisieren liess, Schecks einzahlte und allerlei andern Kram erledigte und gegen fünf, beladen mit Zeitschriften und Marrons glacés – klebrige Dinger und nicht gerade mein Geschmack –, wieder nach Bigna zurückkehrte. Genau dies tat sie auch an jenem 16. September.
Vater hatte für den Nachmittag eine kleine Wanderung ins Hochmoor geplant, er wollte mir fleischfressende Pflanzen zeigen, die am Rande von Sümpfen gedeihen, und sich mit mir hinter bestimmten Bäumen verstecken, um seltene Vögel zu beobachten. Dazu hatte ich zwar nicht sonderlich Lust, schon einmal hatte er mir den Feuersalamander zeigen wollen, der sich just an jenem Tag nicht hatte blicken lassen, doch ich willigte ein unter der Bedingung, dass ich am Morgen in Ruhe mein ‹Grosses Werk› weiterführen dürfe: ein Heft, in das ich alle Tiere der Welt hineinzeichnen wollte, irgendwann also auch den scheuen Feuersalamander. Katze, Hund, Kuh, Wolf und Schlange hatte ich bereits porträtiert, als Nächstes kam das Zebra an die Reihe.
Mutter hatte es an diesem Tag eilig und nahm ausnahmsweise den früheren Bus, warum, ist mir entfallen, jedenfalls verliess sie das Haus gegen halb zehn, ohne den Frühstückstisch abgeräumt zu haben, was sonst gar nicht ihre Art war, sie bildete sich auf ihre hausfraulichen Qualitäten mächtig was ein, doch an diesem Morgen musste ich Milch, Zucker, Cornflakes und Marmelade selbst wegräumen und dann noch das Wachstischtuch mit dem Schwamm abwischen, bevor ich mich an die Arbeit machen konnte.
Vater und ich waren guter Dinge. Immer, wenn Mutter aus dem Haus ging, und zwar schon vom Augenblick an, in dem sie hinter der Wegbiegung verschwand, bildete sich zwischen uns eine Kumpelfreundschaft, die bis zu ihrer Rückkehr andauerte und ohne grosse Worte eine Insel der Zufriedenheit bildete in unserem an Tumult und Drama reichen Alltag zu dritt. Er zeigte mir, wie man einen Gartenzaun streicht und Figuren aus Ästen schnitzt, und wenn ich kleckerte oder mich am Finger verletzte, beruhigte er mich, dass es nicht das Ende der Welt sei, auch ihm passiere das manchmal: ‹Schau dir diese Narbe an, gross, nicht wahr, aber hindert sie mich, anderntags wieder das Messer in die Hand zu nehmen? Nicht doch. Wo kämen wir hin, wenn wir gleich aufgäben? Komm, machen wir weiter.› Seine Unbekümmertheit empfand ich als wohltuend, denn Mutter reagierte auf solche Missgeschicke ganz anders und bestimmt hätte sie auch unsere geheime Gewohnheit missbilligt, mitten am Nachmittag Westernfilme zu schauen, egal ob die Sonne schien oder nicht. An jenem 16. September aber stand, trotz Kühle und grauem Himmel, das Hochmoor auf dem Programm, wie gesagt, kein sonderlicher Spass für mich, ich hasste es, in Gummistiefeln durch den Sumpf zu waten, wobei ich an jenem Morgen nicht ausschloss, dass Vater seinen Plan aufgeben würde, als wir, kaum sass Mutter im Postauto, die ersten bedrohlichen Wolken vom Gebirge übers Tal ziehen sahen.
Eine Weile schnippelte und klebte ich zufrieden vor mich hin, während Vater im Wohnzimmer weiss Gott was tat und dazu ‹Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strand Bikini› sang. Sie ziehen die Augenbrauen hoch, denken, dass ich meinem Vater frivolen Musikgeschmack andichte? Tue ich nicht! Sie dürfen mir glauben, das habe ich nicht erfunden, darauf käme ich beim besten Willen nicht, so hiess nun einmal der Ohrwurm der Saison, wir alle sangen ihn in jenem Sommer, sogar Mutter, wenn sie gut drauf war. Heute finde ich es schade, und, ja, zugegeben, auch irgendwie idiotisch, dass ‹Bikini› das letzte Wort sein musste, das ich von meinem Vater hörte. Ich hätte mir ein anderes, gehaltvolleres gewünscht und könnte ihm nun irgendwas in den Mund legen. ‹Bis gleich, mein Schatz› oder ‹Hab dich lieb, mein Mäuschen›, solche Sachen sagte er manchmal. Sie würden gar nicht merken, wenn ich löge, doch das will ich nicht. ‹Bikini› war das letzte Wort, ich kann es nicht ändern. Als er durch die Küche in den Garten ging, um die Haselnusssträucher zu stutzen, er hatte es zuvor am Frühstückstisch angekündigt, lächelte er mir beim Vorbeigehen wirklich nur zu, und ich sagte auch nichts, weil ich so beschäftigt war, die Streifen des Zebras richtig hinzukriegen. Es bleibt also bei ‹Bikini›.
Wenige Minuten später fiel der Schuss. Niemand achtete darauf, selbst ich nicht, obwohl er nur wenige Meter von unserem Haus abgefeuert wurde, ein Schuss wie alle Schüsse während der Jagdsaison, laut, aber unauffällig, es war an ihm nichts Besonderes, das mich hätte hellhörig machen müssen. Ich dachte mir entsprechend wenig dabei, malte einfach weiter in der Annahme, dass Vater seine Sträucher schnitt und der Jäger im nahen Wald nach seiner Beute Ausschau hielt. Ich arbeitete langsam und mit angespanntem Körper, bedacht, die Streifen nicht zu gerade, aber auch nicht zu gewellt entlang der Flanke meines Zebras verlaufen zu lassen, und hatte wohl den Mund wieder mal halb offen, diese Tendenz habe ich eben, wenn ich mich konzentriere, doch da Mutter nicht da war, um zu nörgeln, und Vater nie nörgelte, war es mir egal, wie ich aussah.
Was mich schliesslich aufhorchen liess, war die Stille. Plötzlich war es zu still. Kennen Sie dieses Gefühl, wenn alles um einen mit einem Mal erstarrt und man vor lauter Stille das Rauschen des eigenen Blutes im Körper spürt und das Herz gegen die Rippen schlägt, als wollte es sein Gefängnis sprengen, und man meint, jetzt, jetzt gleich zerschlägt es, ich sterbe, nein, noch ein Schlag, also lebe ich noch, Gott, ich halte das nicht aus, warum höre ich nichts ausserhalb meines Körpers, wo ist die Welt geblieben? Ja, kennen Sie das auch? Dann wissen Sie, dass der Bruchteil einer Sekunde zur Ewigkeit wird und man einfach nur blöde dahocken und warten kann, dass es vorbeigeht. Es ging auch vorbei, irgendwie, dann legte ich den Stift nieder und spitzte die Ohren; anfangs hörte ich nichts, keine Fliege, die surrte, keinen Rasenmäher, kein Rauschen der Haselnusssträucher, kein Gezwitscher, rein gar nichts. Ich dachte zuerst, die Welt sei untergegangen und unser Ferienhaus stünde in einem grossen Trümmerfeld und dass ich das einzige Lebewesen sei, das von Gott oder dem Teufel, oder beiden, übersehen worden sei, eine schreckliche Vorstellung, die mich am Tisch festnagelte.
Später soll ich zu Protokoll gegeben haben, dass ich weinend in den Garten hinausgerannt sei. Aber so trug es sich nicht zu. Ich trippelte erst auf Zehenspitzen bis zur Tür, öffnete sie einen Spaltbreit und spähte mit einem Auge hinaus. Was ich sah, ist Ihnen inzwischen bekannt, Vater stand nicht bei den Haselnusssträuchern, er döste auch nicht in seinem alten Korbstuhl, sondern lag bäuchlings im Gras. Tod durch einen Schuss in den Hinterkopf, so lautete dann der lakonische Obduktionsbefund.
Und jetzt das haarige Ding. Erinnern Sie sich daran? Ich erwähnte es gleich am Anfang in einem Nebensatz, aber vielleicht geschah es zu nebensätzlich, so dass ich es Ihnen wieder ins Gedächtnis rufen muss, obwohl ich am liebsten darüber schweigen würde. Aber es geht nicht, ohne diese seltsame Ingredienz funktioniert meine Geschichte nicht, ich muss es an diesem Punkt beschreiben und auch beichten, was ich damit getan habe. Eine unglückliche Geste war das, die, wie ich hier mal ganz ohne weinerlichen Unterton vermerken möchte, einen langen Schatten auf mein Leben geworfen hat. Ich rede von ‹Schatten›, weil mir kein besseres Wort einfällt, um zu erklären, welcher Art die dumpfe Bedrückung ist, die mich seit jenem Tag begleitet, nie von mir weicht und mich in ein paar Tagen – sage und schreibe fast ein halbes Jahrhundert später – zur Tat treiben wird. Nicht dass ich selbst mich einer Waffe bedienen werde, glauben Sie das bitte nicht, dazu wäre ich viel zu feige, aber ich werde … doch nein, greifen wir nicht vor, bleiben wir beim Kind, das ich war und das, nachdem es eine Weile gegafft und vergeblich gehofft hat, es könnte Vater aus seinem Schlaf rütteln, plötzlich etwas Ungewöhnliches in dessen linker Hand bemerkte.
Wie kann ich Ihnen beschreiben, was diese Entdeckung in mir auslöste? Ich verstehe meine damalige Reaktion selbst auch nicht und schäme mich ihrer noch heute. Statt Vater beizustehen oder Hilfe zu holen, was von jedem einigermassen normalen Kind zu erwarten gewesen wäre, hatte ich mit einem Mal nur noch Augen für das seltsame Ding. Zuerst dachte ich an Menschenhaar. Stellte mir vor, Vater habe im Stürzen einer Frau die Haare ausgerissen, der alten Tina vom Dorfladen zum Beispiel, die hatte so grau gelbliche Haare wie jene, die ich nun zaghaft berührte, wenn auch nicht so drahtige. Aber warum Tina? Was hätte die plötzlich hier zu tun gehabt? Ausserdem gab es da mehr als Haare, etwas Weisses lugte zwischen Vaters Fingern hervor, grober Stoff mit loser Franse, der meine Neugier nur weiter schürte. Kurzum: Was ich damit sagen will, ist, dass ich überhaupt nicht mehr an Vater dachte, die Faszination hatte alles andere ausgeblendet ausser diesem Ding, von dem ich vermutete, dass es besonders und kostbar sei und obendrein ein grosses Geheimnis. (Ganz falsch sollte ich damit nicht liegen, doch darüber später mehr.) Als ich Vaters Finger löste, der ‹rigor mortis› hatte noch nicht eingesetzt, kamen weder ein Schmuckkästchen noch irgendwelche zusammengerollten Geheimdokumente zum Vorschein, sondern, Wunder aller Wunder: ein Spielzeug, und zwar, wie ich präzisieren muss, nicht eines, das mir gehörte. Sind Sie enttäuscht? Begreiflich, ich war es auch, umso mehr als dieses Spielzeug, ein geschnitzter Pferdeschädel übrigens, nicht einmal unversehrt war: Der Körper fehlte. Was ich in Händen hielt, war bloss ein kleiner, vom Rumpf abgehackter Kopf, nein, nicht einmal ein Kopf, wirklich nicht, sondern: ein Schädel. Wie gross? Nun, gemessen habe ich ihn nie, aber über den Daumen gepeilt würde ich sagen: 10, 12 cm. Ich vermute heute, dass die Mähne aus echtem Pferdehaar war, sie schimmerte wie Seide im Morgenlicht, doch waren es nicht diese übertrieben langen Haare, die dem Pferdeschädel etwas Unheimliches verliehen, auch nicht, dass ihm Bauch und Beine fehlten, sondern der Tuchfetzen, den man hinter den Ohren mit winzigen Nägeln befestigt hatte. Sie müssen sich eine Miniatur-Maria in einem weissen statt blauen Mantel vorstellen, aber nicht so lieblich und weiblich, sondern scheusslich und tierisch, wobei sich jemand die Mühe gemacht hatte, Metallglöckchen, bunte Kordeln und Papierblumen an den Stoff zu nähen. So was hatte ich noch nie gesehen, und wenn Sie diesen vermummten Schädel jetzt sehen könnten, statt bloss darüber zu lesen, würde ich wetten, dass Sie so was auch noch nie gesehen haben. Er war abstrus, dieser Knochenkopf, fremd und von unheimlicher Hässlichkeit. Ich hatte jedoch keine Zeit zu überlegen, wie er in Vaters Hand gelangt war, denn allmählich dämmerte mir wieder, in welch misslicher Lage ich mich befand, Vater, der reglos dalag, und ich kniend daneben mit diesem kaputten Spielzeug in der Hand, und weit und breit kein Mensch, dem ich mich zuwenden konnte: Ja, richtig, ich musste doch endlich was tun.
Dann fingen irgendwann die Kirchenglocken an zu läuten, und daraus folgerte die Polizei später den ungefähren Zeitpunkt des Schusses, kurz vor zehn soll er gefallen sein, mit ärgerlichen plus/minus fünf Minuten Spielraum, weil ich mich nicht eindeutig äussern konnte, wie lange ich allein neben Vater geblieben war, bevor ich weglief, um Hilfe zu holen.
Von der abgeschiedenen Lage unseres Ferienhauses im Dorf und den Nachbarn habe ich noch nicht gesprochen, das hole ich hier nach, damit Sie verstehen können, wie es damals überhaupt möglich war, dass ich eine Weile ungestört mit dem Toten allein bleiben konnte. Heute wäre dies nicht mehr denkbar, das Haus ist seit dem Bauboom der Siebzigerjahre umringt von Villen und sogenannten Appartementhäusern, die sich besonders während der Jagd- und Skisaison füllen, die Strasse ist asphaltiert und führt zu einem von Wanderern und Sportlern gleichermassen beliebten Hotel, was bedeutet, dass jahrein, jahraus Leute mit Rucksack oder Skiern an unserem Ferienhaus vorbeigehen oder -fahren, wir kennen inzwischen viele und reden auch über den Gartenzaun mit ihnen, aber von der damaligen Ruhe und Abgeschiedenheit kann nicht mehr die Rede sein. Das ist vielleicht gut so. Um die Ruhe war es gerade bei uns ohnehin nie besonders gut bestellt gewesen, wir mussten sie damals mit Dottor Scalzi teilen, einem eigenbrötlerischen Wissenschaftler, dessen Haus an das unsrige angebaut war und der auf uns herabschaute, als wären wir Ungeziefer, was ja noch zu tolerieren gewesen wäre, wenn er nicht auch noch bei offenem Fenster Opern zu hören beliebt hätte, die vor allem Vater die Wände hochgehen liessen. Mein Vater hörte, wie Sie richtig vermuten, lieber Songs wie ‹Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strand Bikini› als ‹Madame Butterfly›.
Bigna selbst ist ein Kaff, und wenn es nicht läge, wo es liegt, nämlich malerisch auf gut tausendsiebenhundert Metern Höhe in einer von Felsen umringten Mulde, würde kein Hahn danach krähen. Man erreicht es von der Abzweigung der A2 bei Rodi nach einer schlaufenreichen Fahrt, was den Vorteil hat, dass man am Schluss zwar bleich, aber erleichtert aus dem Wagen steigt, bereit, alles wunderbar zu finden, was sich einem nach der erlittenen Mühsal präsentiert. So erging es mir jedenfalls als Kind, aber vielleicht übertreibe ich ein bisschen, für Erwachsene ist die Fahrt nicht so schlimm, und Lage und Natur verblüffen auch jene, die vom Maggiatal über den Pass hinuntergewandert sind und also keinerlei Übelkeit von den zweiunddreissig Kurven verspüren (ich habe sie einmal gezählt). Die Luft soll in Bigna klarer sein als unten im Leventinatal, mag sein, ich selbst habe nie einen Unterschied bemerkt, aber tatsächlich scheinen die Berge, die je nach Blickwinkel das Häuserhäufchen von Bigna schützen oder bedrohen, zum Greifen nah, ein Beweis, so die Einheimischen, dass zwischen Felskolossen und Dorf keine dieser verdächtigen Partikel in der Luft herumschweben, die weiter unten vor allem im Sommer für trübe Sicht sorgen. Und damit wären wir wieder bei Mutter mit ihren Luftvergleichen, aber lassen wir das; abgesehen von der Luft, deren Reinheit ich gar nicht bestreiten möchte, gibt Bigna trotz wahllos in die Landschaft hineingesetzten Betonklötzen noch immer eine tolle Schweizer Idylle ab. Weiden mit Kühen, ein über glitzerndem Granit schäumender Fluss, die Kirche vor dem Hintergrund eines Sturzbaches, Tannen- und Lärchenwälder ringsum, alles wirklich sehr schön, ideal als Postkartensujet – und vielleicht auch sonst.
Doch ich schweife ab, nicht wahr? Ich wollte ja nur erzählen, was sich zutrug, nachdem ich Vater tot im Gras gefunden hatte, und schon beginne ich die Werbetrommel für ein Dorf zu rühren, dem ich heute, mit all den dunklen Erinnerungen und dem Wissen, was sich bald zutragen wird, am liebsten den Rücken kehre würde. Und, ach ja, beichten wollte ich auch; nicht einfach, das Beichten, lassen Sie es mich also kurz und schmerzlos hinter mich bringen: Ich habe, als ich neben Vater kniete und nicht ihm, sondern diesem dummen Pferdeschädel meine Aufmerksamkeit schenkte, kurz links, kurz rechts geschaut und das Ding unauffällig (so glaubte ich wenigstens) in meiner Rocktasche verschwinden lassen. Diebstahl! Ja, sagen Sie ruhig ‹Das Kind hat gestohlen›, es stört mich nicht, denn ich finde den Anspruch auf Eigentum ohnehin fragwürdig, hab ihn schon immer fragwürdig gefunden, aber das ist ein anderes Kapitel, ich mag jetzt nicht darauf eingehen, bleiben wir also bei der Sache und nennen sie beim Namen: Es war Diebstahl, eindeutig, und, jawohl, ich stehe dazu. Heute könnte ich noch Störung der Totenruhe hinzufügen, doch zweifle ich, dass ich mir damals von der Totenruhe eine Vorstellung hätte machen können, geschweige denn von deren Störung. Ich hatte nicht das Gefühl, Vater zu stören, und auch kein schlechtes Gewissen, als ich diesen seltsam dekorierten Schädel stahl, bloss gesehen wollte ich dabei nicht werden, darum die Blicke nach allen Seiten. Was ich damals nicht vorhersah, war, dass ich mit meinem Diebstahl die Ermittlungen der Polizei erschweren würde, indem ich ihr ein Indiz vorenthielt, das sie vielleicht – aber auch nur vielleicht, sage ich heute – auf die richtige Fährte gesetzt hätte. An die Polizei dachte ich damals überhaupt nicht.
Als ich mich schliesslich erhob und auf die Strasse rannte, kam mir nur Mutter in den Sinn, die ahnungslos in Lugano unter der Trockenhaube sass oder Marrons glacés kaufte, und ich malte mir aus, wie sich später bei der Nachricht ihr Gesicht versteinern würde, ich fürchtete, auf immer. Gleichzeitig dachte ich aber auch an den Ausflug ins Hochmoor, der nicht stattfinden würde, an das zu Dreivierteln fertig gemalte Zebra, an den doofen Bikini-Song und dass es zu Hause noch nach dem Hasenpfeffer roch, den Vater am Vortag in den Himmel gepriesen hatte. Alle diese Dinge und mehr wirbelten in meinem Kopf herum, als ich Grazia, die auf dem Weg ins Stella Alpina gerade bei der Posthaltestelle vorbeistöckelte, in die Arme lief. Wer Grazia ist, brauchen Sie nicht zu wissen, sie spielt für die Geschichte keine Rolle und wird kaum mehr vorkommen, war nur zufällig zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, um mich aufzufangen und im Restaurant, wo sie als Kellnerin arbeitete, bis zu Mutters Rückkehr zu hüten. Sie hatte immer schief aufgeklebte falsche Wimpern und weigerte sich, den lokalen Dialekt zu sprechen, obwohl sie jeden Sommer für die Saison aus Italien hochkam, mehr weiss ich auch nicht über sie. Oder doch: Ihr Nachname lautete Pocchettino, was so viel heisst wie ‹ein kleines bisschen›, und das passte wegen ihrer Fülle überhaupt nicht zu ihr.
Dank Grazia verbrachte ich den Rest des Tages in einem Raum voll Jagd- und Skitrophäen und trank Ovomaltine auf Ovomaltine, während eine Polizistin mir die Würmer aus der Nase zu ziehen versuchte. Wann? Was? Wie? Sie tat es behutsam, das will ich nicht leugnen, Polizistinnen sind geschult, bei Befragungen von Kindern einen besonders süssen Ton anzuschlagen, und sie beherrschte diese Kunst durchaus, aber ihr Wissensdurst war so unstillbar und verlieh ihren Fragen eine derartige Dringlichkeit, dass ich mich fast schon auf der Anklagebank fühlte. Alles wollte sie hören und aufschreiben, den geplanten Ausflug, das Zebra, ‹Bikini›, den Schuss, restlos alles, und sie bohrte so lange, bis ich mich in Widersprüchen verhedderte und zu weinen anfing. Das mächtige Hirschgeweih über mir trug nicht zu meiner Beruhigung bei, unheimliche Schatten streckten sich von ihm über Tisch und Boden aus, Fühlern gleich, die mich zusammen mit den auf mich herabprasselnden Fragen zunehmend lähmten − bis ich die Lippen zusammenpresste und beschloss, das Ende dieser Qual in stoischem Schweigen abzuwarten.
Die Schilderung der folgenden Tage erspare ich Ihnen, es war eine Durcheinanderzeit, keine Regeln galten mehr, Mutter, deren Gesicht sich übrigens versteinerte, wie ich befürchtet hatte, ass nicht, sprach nicht, weinte nicht einmal, sass nur steif im Ohrsessel und stand der Polizei mit grossem Widerwillen Rede und Antwort. Ich sah sie oft die Achseln zucken und den Kopf schütteln, Kunststück, sie war ja den ganzen Tag in Lugano gewesen und hatte keine Ahnung, was sich in ihrer Abwesenheit zugetragen hatte. Ob es Zeugen gebe? Dutzende, antwortete sie und nannte den Friseur, die Freundinnen und Verkäuferinnen; sogar einen Unbekannten musste sie beschreiben, mit dem sie über dessen Pudel ins Gespräch gekommen war. Ein ‹Forestee›, fügte sie hinzu, ein Ausländer, worunter sie alle Menschen ausser den Tessinern verstand. Sie gab sich wenig Mühe, meine Mutter, und hilfreich waren ihre Aussagen kaum. Wenn ihr nichts mehr einfiel, nickte sie in meine Richtung und sagte was in der Art von: ‹Die Kleine müsst ihr fragen, nicht mich, sie hat ihn schliesslich gefunden, aber es ist hart für sie, ein Schock, weiss Gott, wie sie das verkraften wird, nein, lasst sie lieber in Ruhe, ach, was soll ich sagen, es ist nicht zu fassen, uns musste so was passieren. Warum ausgerechnet uns?› An dieser Frage fiel mir damals nichts Besonderes auf, aber heute, während ich sie niederschreibe, erkenne ich darin die Ungeheuerlichkeit von Mutters Denkweise: Alles, und damit meine ich so ungefähr das ganze Weltgeschehen von den schlechten Ernten in Utah bis zur Wahl eines neuen − selbstverständlich katastrophalen − Schweizer Bundesrates, empfand sie als Angriff auf ihr persönliches Wohlergehen, und sie empfindet es heute noch so, wenn auch nicht mehr mit derselben Vehemenz. Vaters Tod war genauso eine vermischte Meldung, er ging vielleicht eine Spur tiefer, aber auch nur, weil er konkrete Veränderungen in ihr Leben brachte. Das war für sie das Unfassbare, und nicht die Tatsache, dass der Mensch, den sie einst geliebt hatte, auf brutalste Weise gestorben war. ‹Einst› sage ich, denn längst ist es mir kein Geheimnis mehr, dass meine Eltern sich in jener Zeit auseinandergelebt hatten und Mutter bereits ein Auge auf einen andern Mann geworfen hatte. Dies nur so ‹en passant› gesagt, damit Sie schon mal im Bild sind, wie die Dinge damals standen, aber eigentlich gehört es nicht hierher, und ausserdem widerstrebt es mir, diesen anderen und Vater in einem Atemzug zu nennen.
Armer Vater. Sein ganzes Leben wurde unter die Lupe genommen und schonungslos der Öffentlichkeit preisgegeben, aber was in den Zeitungen breitgewalzt wurde, war ein Leben ohne Dunkelstellen und von derartiger Geradlinigkeit, dass ihm selbst die begabtesten Journalisten nichts Aufregendes abgewinnen konnten. Und dito er selbst, sein Charakter, seine Neigungen und was alles noch einen Menschen besonders macht: Bis nahezu zur Unglaubwürdigkeit verkörperte er den Menschen in seiner vollkommensten Durchschnittlichkeit. Niemand konnte es demnach wundern, dass Vater weder privat noch auf der Arbeit Feinde gehabt hatte oder wenigstens Neider. Wen immer die Polizei befragte, sie sagten immer dasselbe, nämlich wie beliebt und gewinnend er gewesen war, wie umgänglich, der Letzte, dem man etwas hätte zuleide tun wollen.
Irgendwo aber gab es jemanden, der anders dachte. Und er war auf freiem Fuss. Nachts hatte ich Albträume, dass dieser Unbekannte, den ich mir wie die Bösen in den Wildwestfilmen vorstellte, zurückkommen würde, um den Rest der Familie auszulöschen, das heisst Mutter und mich und dann in Chiasso noch Mutters Schwester mitsamt Mann und neugeborenen Zwillingen und in Winterthur Vaters Vater, der ohnehin schon mit einem Bein im Grab stand. Der Mörder, ein Profi vielleicht, hatte im Dorf keine Spuren hinterlassen, Strasse und Garten wurden abgeriegelt und Zentimeter für Zentimeter unter die Lupe genommen, doch fand man weder verdächtige Reifen- noch Schuhabdrücke noch irgendwelche Stoffasern, die sich in irgendwelchen Zweigen verfangen hätten, nichts. Der Fahrer des Postautos erinnerte sich nicht, wen er an diesem Tag und tags zuvor nach Bigna hoch gefahren hatte, Gruppen von Ausflüglern hätten sein Fahrzeug gestürmt, laute Scharen, die alle gleich aussahen mit ihren bunten Socken, Wollmützen, Sonnenbrillen und karierten Hemden, da hätte sich einer mühelos darunter mischen können, ehrlich, keine Sau hätte es gemerkt, wo käme man da hin, wenn man sich noch jeden einzeln merken müsste, schliesslich schaue unsereiner auf die Strasse und nicht auf die Fahrgäste. Der Fahrer war kaum zu beruhigen.
Die Überprüfung von Mietwagenfirmen und Hotelregistern im oberen Leventinatal ergab auch nichts. Der Täter schien wie vom Erdboden verschwunden zu sein, denn selbstverständlich ging man in den ersten Tagen noch davon aus, dass er von auswärts gekommen war. Wohl wurden die Dörfler befragt, ihre Aussagen protokolliert und verglichen, aber – so schien es mir, und ich fand das Ordnung – man tat es eher halbherzig. Jeder hatte ein Alibi, und an keinem liess sich rütteln. Unser Nachbar, Dottor Scalzi, zum Beispiel weilte an diesem Tag in Zürich, es gab Zeitungsartikel mit Fotos von einer Tagung, auf denen man ihn unter andern Koryphäen sitzen sah, kein Zweifel, er war’s, man musste ihn trotz des Gerüchtes eines jahrelangen Zwists mit meinem Vater wegen Ruhestörung und Grundstückgrenzen aus der Liste der Verdächtigen streichen. Auch Scalzis Sohn Enzo, den ich noch nicht erwähnt habe, war über jeden Verdacht erhaben, er suchte an jenem Morgen Pilze im Wald, fast möchte ich ein ‹angeblich› hinzufügen, denn er konnte nur einen angenagten Steinpilz und ein paar Eierschwämme vorweisen, nicht viel für die Saison, eigentlich verdächtig wenig, doch da er erst dreizehn Jahre alt war, liess man ihn nach einem Blick in sein Körbchen in Ruhe. Scalzis älterer Sohn Salvi, nun, das ist eine ganz andere Sache, ihm muss ich extra Platz widmen, das kommt noch, er spielt im Unterschied zu Grazia eine zentrale Rolle in meinem Leben, demnach auch in diesem Text, doch weiss ich noch nicht, wie ich ihn angehen soll, geben Sie mir etwas Zeit, das Thema ist heikel, der Kerl unmöglich, und ich bin alles andere als gelassen oder unparteiisch, wenn es um ihn geht.
Sie werden jetzt denken, dass ich endlich mit meinem Fund herausrückte, um der Polizei auf die Sprünge zu helfen, doch weit gefehlt, daran dachte ich nicht im Traum. Mutter konnte ich nicht trauen, beim Anblick des Pferdeschädels hätte sie sich sogleich in einen Drachen verwandelt, das konnte sie nämlich, Mutter, immer wenn sie mich auf frischer Tat ertappte, ich rede von Lügen und heimlichem Naschen, weiteten sich ihre Nasenflügel zu Nüstern und fing sie an, dumpf zu beben und zu grollen, bevor, unweigerlich, ihre Hand gegen meine Wange klatschte. Dieser Drachenauftritt flösste mir früher Angst ein, um nichts in der Welt hätte ich ihn freiwillig ausgelöst, also versteckte ich das Ding am sichersten Ort, den ich mir denken konnte: in der Kiste unter meinem Bett, wo ich Puppen, Stofftiere und Legos aufbewahrte. Die Kiste entging der minutiösen Hausdurchsuchung nicht, damit rechnete ich auch und beobachtete von der Zimmerecke aus ziemlich beklommen, wie man mit Plastikhandschuhen darin wühlte, doch kam letztlich niemand auf die Idee, ein kaputtes Spielzeug mit dem Mord in Zusammenhang zu bringen.
Ja, wenn Sie meinen, dass die Ermittler auf der Stelle traten und mit jedem vorbeigehenden Tag die Wahrscheinlichkeit einer Lösung in weitere Ferne rückte, dann sehen Sie das richtig. Genauso war es, einstweilen jedenfalls. Journalisten strömten aus der ganzen Schweiz und der Lombardei herbei und fotografierten den Garten, das Haus und, kaum wagten wir uns ans Fenster, auch Mutter und mich, so dass wir uns wie unter Hausarrest fühlten. Auch im Fernsehen wurde über den Mord berichtet, anfangs jeden Abend, dann in immer grösseren Abständen, bis es auf den Frühling zu nichts mehr Neues zu sagen gab.
Die Ferien, die keine gewesen waren, neigten sich dem Ende zu, ewig konnten Mutter und ich nicht im Tessin bleiben, ich musste wieder zur Schule gehen und Vater bestattet werden, was Wochen später ebenfalls im Blitzlicht der Presse in Basel geschah.
Jetzt muss ich aber Salvi ins Spiel bringen, er ist längst fällig, leider, und ohne Schimpfwörter wird es nicht gehen, auch leider, denn solche gehen mir dank mütterlicher Zensur nur schwer von der Zunge und noch schwerer von den Tasten, aber in Salvis Fall muss ich über meinen Schatten springen und auf ein Vokabular zurückgreifen, das in meinem Hirn unter Schichten von Nettigkeiten vor sich hinschlummert; der Kerl war, ich bringe es auf den Punkt: ein Arsch! Ja, Sie lesen richtig, Arsch, das ist das treffende Wort. Ich wünschte mir, es gäbe einen Superlativ von Arsch, er wäre perfekt auf Salvi gemünzt, doch gibt es ihn nicht, also weiter: Eigentlich hiess der Arsch Salvatore, aber wer ausser seinem Vater nannte ihn schon so? Wegen seines Nachnamens drängte sich das Kürzel geradezu auf, Salvi Scalzi, das liegt wunderbar auf der Zunge, und entsprechend echote es im Dorf, wo immer er auftauchte.
Damals war er fünfzehn und eine bleiche Bohnenstange wie der Vater, aber im Unterschied zu diesem immer etwas schmuddelig, schwarze Fingernägel, fettiges Haar und so, nicht zu reden von den Pickeln an den Nasenflügeln, die er sich am liebsten in meiner Gegenwart auspresste, denn, schwer nachzuvollziehen, aber so war es: Mein Ekel bereitete ihm den grössten Spass; wenn ich mich fast übergab, verzog er den Mund zu einem schrägen Grinsen und entblösste kleine spitze Zähne wie die eines Wolfs. Wegschauen? Nicht möglich! Ich hab’s versucht, aber er drückte mich mit seinem ganzen Körper gegen die Wand von Marios Schuppen und hielt mit einer Hand mein Kinn fest, während er mit der andern an seinen Pickeln herumzwickte, bis der Eiter spritzte.
Eklig, nicht wahr? Und irgendwie krank, ja, da gehe ich mit Ihnen einig, Salvi war wohl etwas pervers in seiner Jugend, einer, der sich am Quälen von Schwächeren ergötzte und besonderen Genuss darin fand, sich spezielle Torturen einfallen zu lassen. Ein Fusstritt war nicht interessant genug, ein Stellbein vielleicht mal, dazu mochte er sich hin und wieder aufraffen, aber was ihn wirklich begeisterte, war das Austüfteln kleiner Grausamkeiten, die nicht einmal nach solchen aussahen und die er dann rasch und präzise ausführte, wenn keiner hinsah.
Ich weiss nicht, ob sein Vater je geahnt hat, was er unter seinem Dach grosszog, niemand klärte ihn auf. Der Bruder war ganz anders, ein zurückhaltendes scheues Kerlchen mit den blondesten Haaren, die man sich denken kann, und einer fast schon weiblichen Anmut, wobei ich heute überzeugt bin, dass Enzos Scheu eben daher rührte, dass er vom Bruder genauso drangsaliert wurde wie ich. Es würde Sinn ergeben. Salvi war kein zimperlicher Mensch, Schreien, Brüllen, Schubsen und dergleichen gehörten zu seiner natürlichen Verhaltensweise, keiner im Dorf wollte sich mit ihm anlegen, also wich man ihm aus, Mensch, Hund und Katze, auch ich tat das, ging auf die andere Strassenseite, wenn ich ihn kommen sah, oder versteckte mich hinter einem Baum, wie auch immer − bis zu jenem unglücklichen 16. September 1960, als es für mich kein Entrinnen mehr gab. Buchstäblich über Nacht wurde alles anders zwischen uns, und davon muss ich nun erzählen, auch wenn es schmerzt und mir bei der Erinnerung daran noch immer die Galle hochkommt.