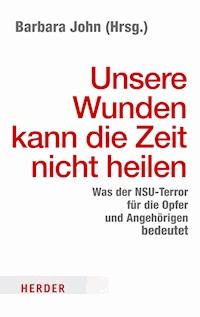
Unsere Wunden kann die Zeit nicht heilen E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: HERDER spektrum
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Der NSU-Prozess hält die deutsche Öffentlichkeit in Atem. Der Fokus der Journalisten liegt dabei vor allem bei den Tätern und deren Helfern. Die Opferfamilien blieben dagegen bislang weitgehend im Hintergrund, so als wären die Nebenkläger nur am Rande Beteiligte des Prozesses. Die Rede ist vom "Staatsterror"durch den NSU, aber für die Betroffenen geht es um eine ganz individuelle Katastrophe. In diesem Buch kommen die Hinterbliebenen erstmals selbst zu Wort. Sie schildern, was die Mordserie und deren öffentliche Wahrnehmung für sie bedeutet, wie sie ihr Leben verändert hat. Eindrucksvoll berichten sie von ihrem Verhältnis zu zu Deutschland, das für viele von ihnen zur Heimat geworden ist - und in dem sie auch nach der Mordserie ihre Zukunft sehen. "Unsere Wunden kann die Zeit nicht heilen" ist ein außergewöhnlicher Einblick in die Geschichten der Opfer und ein einzigartiger Beitrag zur Verarbeitung eines deutschen Traumas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Unsere Wunden kann die Zeit nicht heilen
Was der NSU-Terror für die Opfer und Angehörigen bedeutet
Herausgegeben von Barbara John
in Zusammenarbeit mit Vera Gaserow und Taha Kahya
Impressum
Originalausgabe
© Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 2014
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Verlag Herder
E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN (E-Book): 978-3-451-80160-0
ISBN (Buch): 978-3-451-06727-3
Inhalt
Vorwort der Bundeskanzlerin
Einleitung der Herausgeberin
Das Leben danach – Überlebende und Hinterbliebene der Opfer berichten
»Ohne meine Religion wäre ich in Hass versunken« Abdulkerim Şimşek, Sohn Enver Şimşeks, erzählt
»Manche Wunden sind einfach zu tief« Eine Betroffene des Sprengstoffanschlags in der Kölner Probsteigasse erzählt
»Wir gehörten doch dazu!« Tülin Özüdoğru, Tochter Abdurrahim Özüdoğrus, erzählt
»Lasst uns einfach in Ruhe« Ayşen Taşköprü, Schwester Süleyman Taşköprüs, erzählt
»Was gebt ihr uns, um eine Zukunft aufbauen zu können?« Habil Kılıçs Ehefrau erzählt
»Sie haben meinen Eltern den Sohn und die Heimat geraubt« Mustafa Turgut, Bruder Mehmet Turguts, erzählt
»Das war ein Angriff auf unser Land« Kemal Gündoğan, Opfer des Bombenanschlags in der Kölner Keupstraße, erzählt
»Ich fühle mich so heimatlos« Kerem Yaşar, Sohn Ismail Yaşars, erzählt
»Niemand wollte mehr Kontakt mit uns haben« Gavriil Boulgarides, Bruder Theodoros Boulgarides', erzählt
»Ich habe mein Herz schon begraben« Elif Kubaşık, Ehefrau Mehmet Kubaşıks, erzählt
»Ich will nicht ewig Opfer sein« Gamze Kubaşık, Tochter Mehmet Kubaşıks, erzählt
»Wir haben an Deutschland geglaubt« Familie Yozgat erzählt
»Es vergeht kein Tag, an dem sie uns nicht fehlt« Familie Kiesewetter erzählt
Ergänzende Beiträge
»Nicht nur eine juristische Aufgabe« – die Vertretung der Opfer im NSU-Prozess von Seda Başay-Yıldız, Rechtsanwältin, Vertreterin der Nebenklage
Eine Niederlage für die Sicherheitsbehörden – warum die Suche nach dem NSU-Trio scheiterte von Clemens Binninger, Obmann der CDU im Untersuchungsausschuss »Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund« des Deutschen Bundestages
Vorwort der Bundeskanzlerin
Als im Herbst 2011 ans Licht kam, dass Mitglieder einer rechtsextremen Terrorgruppe jahrelang unentdeckt morden und Anschläge verüben konnten, war dies mit einem doppelten Schock verbunden. Zum einen sorgte das Ausmaß an Hass, Menschenverachtung und Gewalt für tiefe Betroffenheit. Zum anderen stand die bittere Frage im Raum, warum die Hintergründe für die grausamen Taten so lange im Verborgenen bleiben konnten.
Was all dies für die Opfer der Anschläge und die Angehörigen der Ermordeten bedeutete, spiegelt das vorliegende Buch wider. Es bietet ihren Erinnerungen, Gefühlen und Zweifeln Raum. Dadurch gewährt es einen tiefen Einblick in ihr Leid. Familien der Mordopfer berichten, dass einige von ihnen zu Unrecht Beschuldigungen und Verdächtigungen ausgesetzt waren und sie keine Ruhe für ihre Trauer fanden. Manche erlebten, dass Freunde und Verwandte ihnen den Rücken zukehrten. Andere verloren ihre Gesundheit, ihre Arbeit oder ihre Wohnung. Viel Vertrauen in unser Land ging verloren. Und einige Erzählungen geben ein beredtes Zeugnis davon, wie schwer Vertrauen wiederzugewinnen ist.
Es ist wahrlich nicht leicht, über derartige Erlebnisse und die tiefe Verunsicherung zu sprechen, die der Verlust eines nahen Menschen durch grausame Gewalt hinterlässt. Ich erinnere mich sehr gut an die Begegnung mit NSU-Opfern und deren Angehörigen im Bundeskanzleramt. Die Gespräche mit ihnen haben mich tief bewegt. Umso dankbarer bin ich, dass dieses Buch ihre Erfahrungen nun einer breiten Leserschaft zugänglich macht.
Das Leid der Opfer und der Schmerz ihrer Angehörigen müssen uns eine stete Mahnung sein. Wir dürfen niemals vergessen, was geschehen ist. Wir müssen verhindern, dass sich solche Taten jemals wiederholen. Wir müssen aufklären und vorbeugen. In Deutschland ist kein Platz für Rechtsextremismus, Rassismus und Hass. Wir sind ein vielfältiges Land. Menschen unterschiedlicher kultureller und religiöser Traditionen sind hier zu Hause. Ihr Zusammenleben muss von gegenseitigem Respekt geprägt sein. Niemand darf sich anmaßen, andere zu verunglimpfen, herabzuwürdigen oder auszugrenzen.
Mein besonderer Dank gilt der Ombudsfrau für die Opfer des NSU-Terrors und die Hinterbliebenen, Frau Professor Barbara John. Ehrenamtlich und mit unermüdlichem persönlichem Einsatz kümmert sie sich um die Belange der Betroffenen. Sie hört sich ihre Sorgen an und gibt Ratschläge. Sie unterstützt sie bei Entschädigungsanträgen und Behördengängen. Vor allem vermittelt sie ihnen Gewissheit, dass sie nicht alleine sind. Die vorliegende Publikation, deren Herausgeberin sie ist, unterstützt dieses Anliegen. Sie dient dazu, das Leid, das die rechtsextreme Terrorgruppe NSU verursacht hat, fest in unserem Bewusstsein zu verankern.
Daher hoffe ich, dass das Buch viele aufgeschlossene Leserinnen und Leser findet. Allen, die an seiner Entstehung mitgewirkt haben, danke ich. Besonders weiß ich den Beitrag der vom NSU-Terror Betroffenen zu schätzen. Ihnen wünsche ich von Herzen alles Gute.
Angela Merkel
Einleitung der Herausgeberin
Warum dieses Buch?
Nachdem ich schon fast zwei Jahre als Ombudsfrau der Bundesregierung für die Opfer und Hinterbliebenenfamilien der NSU-Gewalttaten tätig war, fiel mir auf, dass etwas Wichtiges fehlte in allen Diskussionen, Reden, Untersuchungsausschüssen. Es fehlte das Leben der Opfer des NSU. In den Medien und Akten war zwar viel über sie zu lesen: wann und wie sie ermordet wurden, welche Tätigkeiten sie ausübten, warum sie von den Ermittlern verdächtigt wurden, selbst irgendwie in die Taten verwickelt gewesen zu sein, welche Verletzungen sie als Opfer der Bombenanschläge erlitten hatten. Fakten und Tatsachen in Fülle. Das war's dann auch schon. Doch was hatte das mit ihrem Leben zu tun?
Sie alle hatten ein ganzes, ein unverwechselbares Leben, auch die jüngsten Opfer Halit Yozgat (21) und Michèle Kiesewetter (22). Für sich selbst sprechen, das können sie nicht mehr, aber ihre Familien und Freunde können es. Also bat ich sie darum. Und als sie begannen für dieses Buch vom gemeinsamen Leben mit ihrem Ehemann, ihrem Sohn, ihrer Tochter, ihrem Vater oder Bruder zu erzählen, sprachen sie auch über ihr eigenes Leben: Wie es war, als sie noch alle zusammen waren, und wie es jetzt, im Bewusstsein des Verlustes, für sie allein weitergeht. Verloren hatten sie einen geliebten Familienangehörigen, das Grundvertrauen in ihre neue Heimat Deutschland, und nicht zuletzt ihre materielle Existenzgrundlage. Das zu schildern und sich mit ihren Berichten persönlich zu öffnen, ist vielen Familien schwergefallen. Aber sie alle wollten mitwirken, als es darum ging, erstmals gemeinsam in einem Buch die Stimme zu erheben. So haben sie ein einmaliges Zeitdokument geschaffen mit ihrer persönlichen Sicht auf die grausamste rechtsextreme Gewaltserie in der deutschen Nachkriegsgeschichte und das verantwortungslose Handeln der Sicherheitsbehörden bei der Aufklärung. Ein Dokument von anhaltender Trauer, jahrelanger Verletzung, finanziellem Ruin und verwundetem Heimatgefühl. Es zeigt, wie sich die Familien dem Trauma stellen, wie sie der naheliegenden persönlichen Verbitterung ausweichen und für eine unbeschwertere Zukunft in Deutschland kämpfen. Der Titel dieses Buches, Unsere Wunden kann die Zeit nicht heilen, ist auf den ersten Blick nur die Umkehrung der oft gedankenlos bei Traueranlässen dahingesagten Trost-Formel »Die Zeit heilt alle Wunden«. Manche Trauernde mögen sich das auch wünschen. Nur weit weg sein von dem düstersten Kapitel in meinem Leben. Aber längst nicht alle denken so. Auch wenn sie nicht dauernd an ihren Verlust erinnert werden wollen, so sind sie doch manchmal eher erschrocken als erleichtert, wenn die Erinnerung verblasst. Bei den Familien der Opfer ist das bisher kein Thema, müssen sie sich doch als Zeugen und als Nebenkläger im Prozess gegen die Angeklagte Zschäpe und ihre Helfer immer wieder mit der Vergangenheit aktuell auseinandersetzen. Von jüngeren Mitgliedern der Familien wird das oft als Belastung empfunden, denn für sie schreibt sich Zukunft größer als Vergangenheit.
Doch nicht nur für die Familien, sondern für uns alle steht nach diesen Morden und Bombenanschlägen »zum Schutz der deutschen Nation«, wie es die Täter ausdrückten, ein Imperativ: Diese Wunden dürfen nicht heilen im kollektiven Gedächtnis Deutschlands! Es sind Deutschlands Wunden. Der Schmerz der Familien ist auch unser Schmerz, eingebrannt in die Nachkriegsgeschichte unseres Landes.
Das klingt nach den üblichen Sonntagsreden von folgenloser Richtigkeit. Und ist es nicht fast immer so, dass, nach einem gewissen Abstand zum Geschehen, selbst tiefes Leid bald in Vergessenheit gerät, zur Nichtigkeit wird, jedenfalls in der Öffentlichkeit? Das kollektive Gedächtnis verdrängt unbequeme Tatsachen, ganz ohne amtliche Vorgaben. Ob wir uns diesem Mechanismus auch überlassen wollen, wenn es um die NSU-Morde geht, ist jedoch eine Frage der politischen Verantwortung und Kultur. Denn Vergessen und Verdrängen wäre eine zwar unbeabsichtigte, aber nachträgliche Bestätigung der rechtsextremistischen Täter und ihrer Helfer. Sie wollten Leben auslöschen, vergessen machen. Und was wollen wir? Dieses Buch ist deshalb auch eine Schrift gegen das Vergessen.
Wie können wir den Opfern eine Hilfe sein?
Der Gedanke, den Familien eine Ombudsperson zur Seite zu stellen, stammt vom ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff. Jedes Mal, wenn die Familien vom Treffen im Bundespräsidialamt am 23. November 2011 berichten, tun sie es mit Dankbarkeit. Die Einladung kam zustande, nachdem Anfang November 2011, durch die Selbsttötung von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos in Eisenach, der rechtsextremistische Hintergrund der Morde an neun Einwanderern und einer Polizistin aufgedeckt worden war. Woran sich die Eingeladenen noch genau erinnern, ist die hohe Aufmerksamkeit des Bundespräsidenten und die Dauer des Gesprächs. Die Teilnehmer saßen von 18.00 Uhr bis in die Nacht hinein zusammen. Endlich, so empfanden es die Familien, konnten sie dem Staat ihr Herz ausschütten. Nach Jahren totalen Schweigens und Misstrauens der staatlichen Stellen bot sich dazu die erste Gelegenheit – und was für eine hochrangige. Erstmals erzählten die Angehörigen auch von ihren massiven sozialen Problemen und baten um Unterstützung. Anwesend bei dem Treffen waren auch die Bundesjustizministerin, Frau Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, die Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration, Frau Prof. Maria Böhmer, und der damalige Bundesinnenminister Hans-Joachim Friedrich. Die Öffentlichkeit erfuhr wenig über dieses Zusammentreffen. Doch hinter den Kulissen wurden Nägel mit Köpfen gemacht.
Am 13. Dezember rief mich Frau Böhmer an und fragte, ob ich die Aufgabe der »Ombudsfrau der Bundesregierung für die Opfer und Opferangehörigen der sogenannten Zwickauer Zelle« übernehmen würde. Ich überschlief die Anfrage und sagte zu. Wie meine Arbeit strukturiert sein musste, das war gleich klar: schnell, persönlich, unbürokratisch, formularfrei. Kein Büro in einer Verwaltung mit festen, eingegrenzten Sprech- und Dienstzeiten inklusive Zuständigkeitsgehabe und Mitarbeitern, die sich (wahrscheinlich) bei der Personalvertretung beschweren würden, falls der Dienstherr sie anwiese, außerhalb der Sprechzeiten auf dem Handy erreichbar zu sein. Das alles war den schwer geprüften Familien nicht zumutbar. So schlug ich vor, mein Büro beim Paritätischen Wohlfahrtsverband Berlin zu nutzen, wo ich Vorstandsvorsitzende bin. Über eine Aufwandsentschädigung musste nicht verhandelt werden, auch nicht über ein Diensthandy, denn ich wollte weder das eine noch das andere. Schon nach wenigen Wochen war mir auch klar, dass ich die Anrufe und die schriftlichen Kontakte nicht delegieren konnte. Sollte ich den Familien sagen, sie könnten am Dienstag mit Person X sprechen und am Donnerstag mit Person Y? Was wäre wohl dabei rausgekommen? Problemkenntnis und zuverlässige Erreichbarkeit, ganz abgesehen vom Vertrauen, sind nur zu gewährleisten, wenn eine einzelne Person für die Kontakte zuständig ist.
Am 20. Dezember erhielt ich die offizielle Beauftragung für die Ombudsaufgabe durch das Justizministerium. Einen Tag später ging der erste Brief an die Opfer der Kölner Bombenanschläge und die Hinterbliebenen der Ermordeten. Die mir vom Ministerium überlassene Anschriftenliste umfasste dreiunddreißig Familien, davon dreiundzwanzig Betroffene der Kölner Bombenanschläge und zehn Hinterbliebenenfamilien. Zusammen waren es mehr als siebzig Personen mit Anschriften in Deutschland und in der Türkei. Dann ergab sich alles wie von selbst: Sofort kamen Anrufe und Anfragen, nicht nur von den Familien, sondern auch von Medien, staatlichen Stellen und von Personen, die ehrenamtlich ihre Hilfe anboten. Meine Kontakt- und Bürozeiten? Total gewerkschaftsfremdelnd: zu jeder Zeit, an jedem Ort. Ich brauchte dann aber jemanden, der mir half, all die Schreiben zeitnah zu erledigen und die Kontakte mit den Familien, besonders auch denen in der Türkei, in der Muttersprache aufrechtzuerhalten. Taha Kahya war der richtige Mann dafür.
Würde ich detailliert über meine Arbeit berichten, es würde sich wie eine Litanei lesen. Immer wieder Anträge und Verhandlungen, um kleine und größere Probleme zu mildern oder zu lösen. Meine Ansprechpartner waren unter anderem Opferberatungsstellen, Kommunen, Ministerien auf Bundes- und Länderebene und ihre nachgeordneten Einrichtungen, der Bundesrechnungshof, Justiz- und Polizeibehörden, Entschädigungsämter, Berufsgenossenschaften, türkische Einrichtungen wie Ministerien, die Botschaft und diverse Konsulate, aber auch Rechtsanwälte und Nebenkläger-Anwälte sowie das Oberlandesgericht in München.
Mir wurde dabei klar, wie vielfältig und schwierig die Arbeit klassischer Opferberatungsstellen ist, die mit geringen Mitteln wirksam helfen. Übernähmen staatliche Stellen diese Aufgabe, wären sie allein schon wegen ihrer engen Spezialisierung und ihres Zuständigkeitsdogmas komplett überfordert. Mein Vorteil war, dass die Beauftragung durch die Bundesregierung meine Arbeit bei vielen Stellen erleichterte.
Schnell stellte sich heraus, dass in der Zeit zwischen dem Mord an Enver Şimşek im September 2000 und der Zuordnung der Taten zur sogenannten Zwickauer Zelle von Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe im November 2011 hilfemäßig fast totaler Stillstand geherrscht hatte. Ohne den Weißen Ring, der in dieser Zeit tat, was er konnte, und ohne einige zuständige Ämter für das Opferentschädigungsgesetz wären die Familien total im Stich gelassen worden. Warum dieser lange Stillstand? Zwar gab es seit 1999 beim Bundesamt für Justiz das Referat für die »Entschädigung der Opfer terroristischer Anschläge«. Doch das rührte sich erst, nachdem bekannt wurde, dass die Mordserie nicht das Werk von Mafiabanden mit Migrationshintergrund war, sondern von ostdeutschen Heranwachsenden mit ihrer nationalsozialistischen »Heimatschutz-Mission«. Also rechtsextremer Terror. Nach der Enttarnung legte das Amt los, zügig und mit Herzblut.
Bei den Berufsgenossenschaften gab es wieder andere Gründe fürs Abwarten. Da aufgrund der in die falsche Richtung geführten Ermittlungen jahrelang offen blieb, ob die Morde nicht doch einen familiären Hintergrund hatten, gar Eifersuchtsdramen zugrunde lägen, wurde in keinem Fall eine Versicherungsleistung gezahlt. Denn allein betriebliche Gründe können eine Zahlungsverpflichtung auslösen. Auch an dieser Stelle also keine Bewegung. Alle vertragsüblichen Zahlungen wurden erst einmal storniert. Ohnehin kamen sie nur für wenige Betroffene in Frage. Die Kleinunternehmen waren zwar alle versichert, doch kaum einer hatte eine Zusatzversicherung. Die braucht man aber, damit im Todesfall durch Unfall oder Gewalt die Familie eine Rente erhalten kann. Weil das teuer war, hatten fast alle darauf verzichtet. Angestellte dagegen haben Versicherungsschutz, auch ohne zusätzliche Zahlung. Aber wer konnte es sich leisten, einen Angestellten zu beschäftigen? Einen Fall gab es. Am Tag der Mordtat blieb der Ladeninhaber auf dem Weg zu seinem Kiosk im Stau stecken. Sein Angestellter hatte den Döner-Verkauf dann schon begonnen, als Böhnhardt und Mundlos kamen, um zu töten. Der ermordete Verkäufer war jedoch weder legal in Deutschland noch sozialversicherungspflichtig angemeldet, also auch nicht existent für die Berufsgenossenschaft. So viel Unglück auf einmal durfte es nicht geben. Es gelang schließlich, für die in elenden Verhältnissen lebenden Eltern des Opfers mit der Berufsgenossenschaft eine Kulanzregelung auszuhandeln. Ein Lichtblick im Dickicht des Versicherungswesens.
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass alle Familien total unterversorgt waren, was notwendige, ihnen zustehende und angemessene Hilfeleistungen betraf. Und sie waren alleingelassen mit der Aufgabe, ihr Leben wieder neu aufzubauen. Außer Rechtsanwälten und Opferentschädigungsämtern, zuständig für die Notversorgung von Opfern, gab es bis 2012 keinerlei direkte Anlaufstellen für die gesamte Gruppe. Für die Familien, die schon in den Jahren 2000 und 2001 ihren Ernährer verloren hatten, waren das mehr als zehn Jahre.
Was nun die konkrete Arbeit der Ombudsstelle angeht, beschränke ich mich auf wenige Beispiele, die zugleich das Grundkonzept unserer Arbeit illustrieren, nämlich situationsgerecht zu handeln. Ein abstrakter Begriff für eine einfache Grundregel. Was zählte, war, die konkrete, oft ausweglose Situation der Familien vor Augen zu haben, in die sie ohne jedes Zutun geraten waren und aus der sie sich wieder befreien mussten. Also konnte unser Ansatz nur lauten: Jedes Anliegen und jedes Problem ist wichtig. Da konnte es bei Verhandlungen mit staatlichen Stellen nicht ausbleiben, dass sich Bürokratie und menschliche Maßstäbe ab und zu in die Quere kamen.
So war es auch gleich bei einer der ersten Hilfen. Einem Opfer des Bombenanschlags in der Kölner Keupstraße 2004 war die Brieftasche mit allen Papieren abhandengekommen. Der Mann war gerade aus einer anderen Stadt zurück nach Köln gezogen und brauchte gesundheitliche und finanzielle Unterstützung. Ich drängte deshalb bei türkischen (Pass) und deutschen (Jobcenter) Stellen auf schnelle Wiederbeschaffung der Dokumente. Da hörte ich oft die Frage, was das denn mit dem Anschlag zu tun habe, der liege doch schon acht Jahre zurück. Derlei Abwiegelungsversuche wiederholten sich nicht selten. Meine Reaktion: Ich berichtete von der aktuellen Lebenssituation der Opfer. Wer auf diese Weise aus der Bahn geworfen worden war, der war grundsätzlich als Härtefall anzusehen. Das Argument wirkte oft für den Moment, aber ich bin nicht sicher, ob es auch überzeugte.
Für die meisten Anliegen gab es jedoch bei staatlichen wie auch nicht-staatlichen Stellen Verständnis und zügige Unterstützung. Einige Beispiele: Beziehern von staatlichen Transferleistungen wie Hartz IV wurde von Jobcentern angedroht, die Leistungen würden eingestellt, weil auf ihren Bankkonten ja gerade Geld eingegangen war – nämlich das Schadensgeld vom Justizministerium für Opfer terroristischer Gewalt. Musste das nicht angerechnet werden, fragten sich die Jobcenter. Das Bundesarbeitsministerium bestätigte jedoch auf Anfrage unverzüglich die Nichtanrechenbarkeit. Wieder ein Hindernis beseitigt.
Bei einigen Angehörigen ging es um Einbürgerung unter Hinnahme der türkischen Staatsbürgerschaft, also um eine doppelte Staatsbürgerschaft. Der Wunsch danach war nur allzu verständlich. Die neue Heimat Deutschland, das ihnen vor den Morden als Land ohne Fehl und Tadel im Vergleich zum Herkunftsland gegolten hatte, büßte bei den meisten türkischstämmigen Familien an Grundvertrauen ein. Plötzlich erschien die Türkei wie ein Rettungsanker, falls man sich hier nicht mehr sicher fühlen konnte. Zusätzlich gab es jetzt eine neue Bindung an die alte Heimat. Alle Familien hatten ihre ermordeten Angehörigen in der Türkei begraben lassen, meist in der Obhut von Verwandten. Das verstärkte die Kontakte und Beziehungen in die Türkei.
Ausbildung und Studium der Kinder, deren Väter plötzlich nicht mehr für sie sorgen konnten, wurden zur kaum überwindbaren Hürde, als es für die Hinterbliebenenfamilien darum ging, gesellschaftlich und wirtschaftlich wieder Fuß zu fassen. Als die Väter starben, steckten viele Kinder noch mitten in der Schulausbildung. Das galt auch für einige der jungen Männer und Frauen, die bei den Kölner Bombenanschlägen verletzt wurden. Plötzlich war alles anders: Alle Sicherheiten waren weg; die traumatische Erfahrung hatte sich wie eine Betondecke auf ihr bisheriges Leben gelegt. Die Überzeugung, ein gutes und sicheres Leben in Deutschland führen zu können, schwand. Das Geld fehlte. Statt das Abitur zu machen und ein Studium zu beginnen, wurde der Taxischein gemacht, um die Familie über Wasser zu halten. Mit den vom Justizamt gezahlten »Schadensregulierungen« mussten häufig andere Löcher gestopft werden. Ein Stipendium für Härtefälle musste her. Wenige kleine Stiftungen reagierten offen und flexibel, halfen konkret; andere, die großen und bekannteren, verwiesen uns formalistisch auf eine Internetbewerbung, die jedoch eine Berücksichtigung von speziellen Härtegründen (Alter, soziale Lage) gar nicht vorsah.
Außergewöhnliches leistete der Bundesrechnungshof. Er fragte bei den zuständigen Stellen in den einzelnen Bundesländern an, ob und wie sie den Opfern und Hinterbliebenen nach den Bestimmungen des Opferentschädigungsgesetzes finanziell geholfen hätten. Jeder einzelne Fall wurde analysiert und bewertet. So konnten die Familien, an die ich die Fall-Beurteilungen, mit einem Kommentar versehen, weiterleitete, beurteilen, ob die ihnen zustehenden Hilfen auch tatsächlich gewährt worden waren. Zitieren möchte ich einige abschließende Empfehlungen aus dem Abschlussbericht: »Opfer und Angehörige dürfen in Fällen wie diesen nicht als bloße ›Antragssteller‹ angesehen werden, die ein Verwaltungsverfahren in Gang setzen (oder – mangels ›Antrag‹ – auch nicht). Die Versorgungsverwaltung muss sich vielmehr mit der besonderen Lage dieser Menschen auseinandersetzen. Ein Rückzug auf formale Positionen der ›Normallage‹ wird dem nicht gerecht.«
Am meisten abgestoßen dagegen hat mich eine Frage, die mir einige (wenige) hochrangige Politiker und Beamte anfangs stellten, nämlich, ob es die Ombudsstelle auch gäbe, wenn die zehn Opfer Deutsche gewesen wären. Da war er wieder, der sich ungerecht behandelt fühlende Deutsche, der selbst noch in dieser eindeutigen Situation das an Einwanderern begangene Unrecht zu relativieren versuchte.
Ein Leben lang Opfer sein?
Auf der Gedenkveranstaltung der Bundesregierung für die Opfer des NSU am 23. Februar 2012 sagte Semiya Şimşek, Tochter des ersten Mordopfers der Terrorgruppe: »Elf Jahre durften wir nicht einmal reinen Gewissens Opfer sein.« Und sie ergänzte dann in einem Interview, wie erleichternd es sei, dass die Familien nach der Identifizierung des Tätertrios endlich auch öffentlich als Opfer angesehen würden. Mehr als zwei Jahre später schreibt Gamze Kubaşık, Tochter des in Dortmund getöteten Mehmet Kubaşık, in ihrem Beitrag für dieses Buch: »Ich will nicht ewig Opfer sein!« Erinnert dieser Appell nicht an das Verhalten von Überlebenden des Holocaust, die ihren Kindern ein Leben lang verschwiegen, dass sie Opfer der Nazi-Diktatur geworden waren? Sie wollten ihren Nachkommen die Zuschreibungen von außen ersparen, die Menschen erfahren, wenn sie als Opfer angesehen werden. Sie wollten, dass sie ihr Leben unbelastet von der Vergangenheit anpacken konnten. Ist das aber bei den Familienangehörigen, die ja selbst Zeitzeugen der an ihren Vätern, an ihrem Bruder, an ihrer Schwester begangenen Verbrechen geworden waren, überhaupt möglich? Und ist es überhaupt richtig, bewusst Distanz zu diesen Ereignissen zu schaffen? Wäre es nicht gerade im Interesse des gesellschaftlichen Kampfes gegen Rechtsextremismus wichtig, nicht nur der ermordeten Opfer zu gedenken, sondern auch unaufhörlich, geradezu penetrant auf die überlebenden Verletzten und die Hinterbliebenen und das ihnen zugefügte Unrecht und Leid hinzuweisen? Nein, dreimal nein! Die Opferecke ist kein Ort, wohin Menschen auf Dauer abgeschoben, wo sie, wie in einer Falle, festgehalten und vorgeführt werden dürfen. So richtig es war, nach dem 4. November, als die Täter und die Tathintergründe bekannt wurden, sich den Hinterbliebenen und Verletzten als Opfer zuzuwenden, so richtig ist es nun, alles zu tun, ihnen den Weg aus dieser Extremsituation in die Normalität zu ebnen.
Mein Eindruck ist, dass viele Kölner Opfer und auch viele Familien, die durch den NSU-Terror Angehörige verloren haben, einen eigenen Weg suchen. Sie wollen sich nicht in der Vergangenheit festnageln lassen. Sie ahnen, dass sie eine zentrale Aufgabe vor sich haben, nämlich sich nicht ein Leben lang vom erlittenen Trauma bestimmen zu lassen und es schon gar nicht auf ihre Kinder und Enkel zu übertragen. Das ist Schwerstarbeit, denn es bedeutet, das Leid zu akzeptieren – aber niemals die Ursachen dafür. Es bedeutet auch, das grauenvolle Ereignis hinter sich zu lassen, und es sich nicht wie auf Knopfdruck immer wieder zu vergegenwärtigen.
Viele können das Erlittene nicht verzeihen, sie bestehen darauf, dass den Tätern die Schuld nachgewiesen wird, haben kein Verständnis, dass die Ermittler folgenlos elf Jahre lang beharrlich die falschen Spuren verfolgt haben, um schließlich die zehn Morde zu »cold cases« zu erklären, sie also zu den Akten zu legen. Sie hören aber nicht auf zu betonen: Wir wollen, dass keine Familie in Deutschland je wieder das Leid erfährt, das uns getroffen hat.
Werden sie nach ihrem wichtigsten Wunsch gefragt, dann ist zu hören, dass Deutschland ein gerechtes Land sein möge. Ein Land, in dem rechtschaffene Menschen unterstützt und geschützt werden. Sie sehen sich selbst als Teil dieses Landes. Sie wollen nicht aufgeben. Das wäre in ihren Augen wie ein nachträglicher Triumph für die Täter. Deshalb begannen sie gegen alle Widrigkeiten, ihr zerstörtes Leben schrittweise wiederaufzubauen und wollen das fortsetzen. Damit mussten sie beginnen, lange bevor die Öffentlichkeit im November 2011 überhaupt auf sie aufmerksam geworden war. Ohne die bitteren Erfahrungen zu vergessen oder zu verdrängen. Diese Erfahrungen werden immer Teil ihres »Lebens danach« bleiben.
Wir als Gesellschaft sollten diesen Familien zeigen, wie wichtig es für uns alle ist, dass sie sich aus der jahrelangen sozialen Isolation lösen können. Das gelingt nicht immer. Ein Beispiel: Schon bei den ersten Kontakten sprach ich mit den Opfern und Hinterbliebenen über Gedenkorte, die sowohl Stätten der Erinnerung als auch der Mahnung in der Öffentlichkeit sein könnten. Im März 2012 trug ich diesen Wunsch in einer Anhörung beim zweiten Untersuchungsausschuss des Bundestages vor. Für die betroffenen Städte war das eine Selbstverständlichkeit. So weit, so gut. Enttäuschend war dann allerdings die Umsetzung, denn die Familien wurden nicht kontaktiert, als es um die Inschriften ging. Eine versäumte Gelegenheit, ihre Meinung zu hören, ihnen Mitsprache zu ermöglichen, sie als aktive Mitgestalter zu gewinnen. Umso beeindruckender ist ihr Engagement für eine Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Auch die Gespräche im Jahr 2013 beim Bundespräsidenten, bei der Kanzlerin und im Bundestag bei der Beschlussfassung über den Bericht des NSU-Untersuchungsausschusses wurden von den Familien dazu genutzt. Sie sprachen nicht nur über das erlittene Unrecht, sondern auch über ihre berufliche und familiäre Situation. Vor allem aber – und das unisono – drängten sie die politischen Repräsentanten, Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Menschenhass in Deutschland wirksam zu bekämpfen.
Brüchige deutsche Gewissheiten
Stefan Aust und Dirk Laabs beschreiben und analysieren in ihrem Buch Heimatschutz (erschienen 2014), welche Rolle der Staat bei der Mordserie des NSU gespielt hat. Seit ich für die Familien als Ombudsfrau arbeite, beschäftigt diese Frage auch mich, allerdings in abgewandelter Form, nämlich: Warum hat der Staat seine Wächterfunktion nicht ausgeübt, obwohl der Schutz der Bürger vor Gewalt zu seinen zentralen Aufgaben gehört? Erst wenn wir das wissen, könnten wir ähnliche Fehler zukünftig vermeiden.
Um eine erste Antwort zu finden, bin ich von einer strukturell ähnlichen, aber anderen Fallkonstellation ausgegangen, habe also die Perspektive verschoben: Nehmen wir an, neun Gewerbetreibende mit deutschen Wurzeln, also ohne Migrationsgeschichte, wären nach dem bekannten Muster ermordet worden. Immer mit derselben Waffe an wenig frequentierten Tatorten in sechs Städten, die in fünf verschiedenen Bundesländern liegen. Hätten die Ermittler, darunter Landes- und Bundespolizei, Staats- und Verfassungsschutz sowie Staatsanwaltschaften von Beginn der Untersuchungen bis zum Abschluss ebenfalls darauf bestanden, dass jeder der Erschossenen und ihre Familien ganz sicher irgendwie mit dem Tätermilieu verbandelt wären? Hätten die Ermittler – als keine Spur ergiebig war – erklärt, der Grund für ihre erfolglosen Ermittlungen läge bei den Opferfamilien selbst und bei ihrem Umfeld, weil man dort grundsätzlich nicht mit der Polizei zusammenarbeiten würde? Hätten sie schließlich, wie man den Ermittlungsakten entnehmen kann, geschlussfolgert, solche brutalen Tötungen entsprächen dem kulturellen Milieu der Opfer? Und nicht zuletzt: Wären die Medien, wären wir alle, einschließlich der politischen Eliten, den Deutungen der Ermittler in diesem Fall ebenso widerspruchslos gefolgt?
Auch wenn wir alle es nicht wahrhaben wollen, aber diese Morde und das Scheitern der Behörden bei deren Aufklärung sind deutsche Eigengewächse. Sie bringen ans Licht, auf welche brüchigen Gewissheiten wir uns eingelassen haben, welche Selbsttäuschungen wir viele Jahre pflegten, von denen wir uns jetzt verabschieden sollten: Erstens von der Erwartung, die Verfassungsschutzbehörden würden die abstrakte Aufgabe des »Schutzes der Demokratie« als konkreten »Schutz unserer Freiheit und unserer Sicherheit« verstehen, wie es etwa Bundesinnenminister Thomas de Maizière anlässlich des Festaktes zum 60-jährigen Bestehen des Bundesamtes für Verfassungsschutz im Dezember 2010 sagte. Zweitens von dem Vertrauen, die Polizei agiere frei von Vorurteilen gegenüber jedermann. Und drittens von dem Glauben, für die gewaltigen Fehler, die lange Zeit in der deutschen Migrationspolitik gemacht wurden, zahle niemand je einen Preis.
Der Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtags zum NSU hat in seinem Abschlussbericht vom August 2014 auf fast zweitausend Seiten indirekt offenbart, was aus den Sicherheitsbehörden über die Jahre geworden ist: verbrauchte Interessengruppen, die gar nicht mehr zu wissen scheinen, wozu sie existieren. Sie folgen ihrer eigenen Behördenlogik, indem sie sich abgrenzen von anderen Diensten, ihren Vorteil suchen und ihre Sonderinteressen verteidigen. Erstarrte Organisationen. Sie scheinen nicht einmal mehr zu wissen, was für den Schutz der Unschuldigen zu tun ist, sondern funktionieren nur noch bei Standardfällen. So erkennen sie auch nicht mehr, wie entschlossen die besonders Gefährlichen sind, insbesondere Heranwachsende mit Neo-Nazi-Phantasien, und wie gefährdet ihre potenziellen Opfer.





























