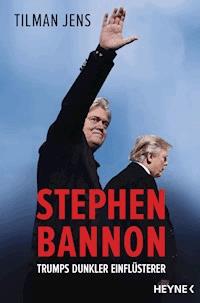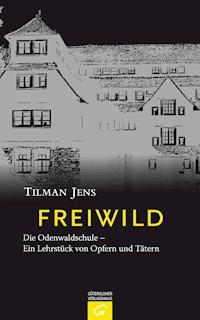Inhaltsverzeichnis
Widmung
Inschrift
I. STATT EINER UNTERLASSUNGSKLAGE
II. ÖDIPUS IN INNSBRUCK
III. EIN DENKVERBOT FÄLLT
IV. WENN VÄTER TÖTEN
V. FAMILIENSPRECHSTUNDE
VI. FÜR IMMER SOHN
VII. ZU GUTER LETZT: EIN VATER MIT WUCHT UND WONNE
Danksagung
LITERATURVERZEICHNIS
Copyright
Für Hannah – nachgerufen
Ja, ich hör mit blutgem Beben,Wie der ewge Richter spricht:Allen Sündern wird vergeben -Nur dem Vatermörder nicht.
Franz Grillparzer, Die Ahnfrau, Trauerspiel, 1817
I. STATT EINER UNTERLASSUNGSKLAGE
Nein, ich habe meinen Vater nicht auf dem Gewissen. Aber hat einer wie ich überhaupt ein Gewissen? Oder ist da nur ein schwarzes, verödetes Loch? Ich selber weiß es nicht mehr in jenen Tagen. Ein Kollege vom Zürcher Tagesanzeiger aber weiß: Walter Jens’ größte Strafe ist sein Sohn. Der beteuere zu allem Überfluss auch noch, dass er ihn liebe, sekundiert donnernd ein alter Kumpan meiner Eltern, Friedrich Schorlemmer, Pfarrer zu Wittenberg, zu DDR-Zeiten ein mutiger Mann, in seiner Predigt zum Karfreitag und fügt, tagesaktuell über die Nachfolger des Verräters Judas sinnend, hinzu, dass ein so liebender Sohn im Hause den Scharfrichter erspart.1 Dagegen ist Marcel Reich-Ranicki, der einmal der engste Freund meines Vaters war, fast schon wohltuend zurückhaltend. Für ihn ist das Buch über das Demenzleiden des einstigen Mitstreiters einfach nur geschmacklos. Ob er es denn gelesen habe, will der Interviewer Matthias Döpfner wissen. Nein. Ich finde es unanständig, ein solches Buch zu schreiben. Er braucht nicht einmal einen Text, um dem Autor die Meinung zu geigen.
Der alte Mann in Tübingen kann sich derlei Bezeugungen des Mitgefühls nicht mehr verbitten. Ob er es getan hätte? Das Grübeln hat keinen Zweck. Er kann kaum noch sprechen und die anderen haben ihr Urteil gefällt.
Schau in den Spiegel, Du ewiger Sohn. Siehst Du die Fratze des Ödipus? Des Vaters Kind und Mörder doch zugleich. Der Vater hat die Tragödie des Sophokles, die ganze Thebanische Trilogie, doch selbst übersetzt. Im November 2007 – da war er schon schwerkrank – haben wir noch einmal alle zusammen den dritten Teil gesehen. Die Inszenierung der Antigone am Heidelberger Stadttheater war, formulieren wir es behutsam, ein wenig schrill: Kreon mit einer Kokosnuss statt des obligaten Zepters in der Hand, Ismene radelte auf einem Mountain-Bike über die Bühne und der Totenwächter trug eine rote Verdi-Warnstreik-Weste. Aber all das zog gnädig an ihm vorüber.
Mein Vater, ein letztes Mal im dunklen Anzug, saß am linken Rand der ersten Reihe, damit er, wenn ihm das muntere und recht lautstarke Treiben auf der Bühne zu viel werde, jederzeit den Saal verlassen und nach Tübingen heimfahren könne. Er war nicht mehr in der Lage, der Handlung, dem tödlichen Streit um ein Begräbnis, ein ehrenvolles Totengedenken zu folgen – und schien doch eigentümlich entspannt an diesem Abend, so heiter wie schon lang nicht mehr. Er hielt meist die Augen geschlossen, ab und an zog ein Lächeln über das schmal gewordene Gesicht, so als hätte er gerade eine der Textzeilen wiedererkannt, die er vor weit über 40 Jahren aus dem Griechischen übertragen hatte. Komm. Komm und erscheine schönster Tag, du letzter meines Lebens. Komm! Komm jetzt. Lass mich die Sonne nicht mehr sehen. Vorhang. Beifall. Anders als bei der Ödipus-auf-Kolonos-Premiere in der vergangenen Spielzeit, nur ein knappes halbes Jahr zuvor, schafft er es nicht mehr auf die Bühne. Er erhebt sich einen Moment von seinem Sitz, winkt noch einmal ins Publikum, eine kleine Verbeugung, zufrieden, aber sichtlich erschöpft. Das Spiel ist aus. Er hat nie wieder ein Theater besucht.
Im Februar 2009 wird der Ödipus-Mythos im deutschen Feuilleton finster fortgeschrieben. Den Mörder zu bestrafen ist Apolls Befehl. Laios späte Rächer nehmen den Auftrag genau und formen aus dem antiken Familiendrama ein grausiges Boulevard-Stück. Selbst Gert Ueding, nun wahrlich kein Freund meines Vaters, scheint dabei eine späte Affinität zu seinem Vorgänger auf dem Tübinger Lehrstuhl für allgemeine Rhetorik zu entdekken und fühlt sich berufen, dessen Ältesten in der Welt des literarischen Vatermordes schuldig zu sprechen. Aus Rachemotiven – wofür bleibt offen – habe der Spross seinen Altvorderen über den Jordan, die Wupper oder den Neckar gewünscht. Tilman Jens begräbt den lebendigen Vater. Das berührt die Urängste der Leser. Taphephobie, das ist der Alptraum der Menschheit: als Scheintoter zu Grabe gelassen zu werden, dämmernd im Sarg und dort schließlich qualvoll erstickend. Schlimmer kann der Tod kaum sein, grausamer kein Sohn.
Das Schurkenstück vom verkommenen Filius, der seinen lebenden Vater begräbt, ist einschlägig bekannt, ein schauriges Zitat. Unter Schillers Räubern macht’s Ueding nicht, der Poeten-Versteher aus dem schlesischen Bunzlau, der 1990 für allgemeine Heiterkeit sorgte, als er sich anschickte, die Hervorbringungen der Weltliteratur wie Herakles den Augias-Stall auszumisten, der lästigen Seitenstränge zu entledigen und das, was den Kürzungen, dem furiosen Streichkonzert trotzte, in einer Taschenbuch-Reihe namens Studio Klassik zu verramschen. Ein hemmungsloser Klippschulkurs von Boccaccio bis Flaubert – für alle Leser, die eine neue Dimension der Literaturvermittlung mit einem spannenden Leseabenteuer verbinden wollen. Zurück blieben versehrte Dichter.
Das monumental angelegte Projekt fand mit Band 12 bald ein gnädiges Ende – ungebrochen indes scheint des Literaturkundlers schweißtreibender Drang, die Klassiker nach eigenem Gusto neu zu frisieren. Jetzt also schreibt er im Feuilleton der Welt auch noch die Räuber fort. Dramatis personae: Mein Vater als der alte Moor, ich als die Kanaille Franz, die Missgeburt, der Sohn ohne Charakter, dessen zur Schau gestellte Fürsorglichkeit (Aber ist Euch auch wohl, Vater? Ihr seht so blaß.) schiere Heuchelei ist. Franz wie Tilman wollen ihrem Senior nichts Gutes, sie wollen ihn lebendig begraben. Endlich aus dem väterlichen Schatten treten! Ueding hört den Groschen fallen: Das Modell, die Methode Franz, hat längst nicht ausgedient. Sie wird – erraten, durch mich! – fortgesetzt. Infam ist die Methode und infam das Porträt, das dabei herauskommt. Ein feiger Anschlag auf den Übermächtigen eben, der schon Schillers Karl, den edlen Mooren-Sohn, der Antipode zum schändlichen Franz, zu einer Verwünschung veranlasste, die zorniger kaum sein könnte. Höre mich dreimal, schröcklicher Gott […] Hier schwör ich, das Licht des Tages nicht mehr zu grüßen, bis des Vatermörders Blut gegen die Sonne dampft. Einem wie Franz bleibt schon bei Schiller nur noch der Strick. Danke!
Was treibt Ueding, was seine Mitstreiter, die mich im Frühjahr 2009 zum Mörder meines Nächsten schreiben? Geht es hier noch um ein Buch? Mit Verrissen hat ein Autor zu leben – und, wer das nicht kann, sollte vielleicht besser vom Schreiben lassen. Die Angriffe der vergangenen Wochen aber zielen nicht auf einen Text, sondern auf die Person des Verfassers, der den Mann, dem er sein Leben verdankt, verraten, der Lächerlichkeit preisgegeben habe. Die Anklage wiegt schwer. Als mein Buch Demenz – Abschied von meinem Vater im Februar 2009 erscheint, die Krankengeschichte eines Mannes, der nach einem biographischen Schock sein Gedächtnis verlor, sehe ich mich, obgleich es durchaus auch freundlich differenzierende Beurteilungen gab, von weiten Kreisen des deutschen Feuilletons zur Fahndung ausgeschrieben, als geltungssüchtiger Judassohn, als degenerierter Schänder der anverwandten Lichtgestalt. Ganz offensichtlich bin ich meinen Eltern gründlich misslungen.
Focus druckt eine Vorab-Rezension und stellt sie ins Netz. Das Buch ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Handel erhältlich, aber die Schar der anonymen Schreiber im Kommentar-Forum weiß bereits, was von dieser ehrlosen Hinterhältigkeit, dieser Höchstform der Verkommenheit zu halten ist. Da scheint, jenseits des Feuilletons, ein Nerv getroffen. Der Autor soll sich schämen und möglichst bald den Begriff Sohn und den Namen Jens ablegen. An guten Ratschlägen ist dieser Tage kein Mangel. Walter Jens wird nicht mehr lange leben. Die Miterben sollten schon jetzt die Erbunwürdigkeit des Sohnes gerichtlich feststellen lassen. Ich bin, so muss ich schließen, ein Fall für die Justiz. Die wäre gut beraten, meint ein Zeitgenosse, der sich martialisch Lattenknaller nennt, Tilman Jens auf den Index zu setzen. Und ein Günther ergänzt: Wer sein Buch erwirbt, ist ohnehin krank.
Vatermord! Mir klebt also Blut an den Händen. Da darf man im Umgang schon einmal die Gangart verschärfen. Ein Mann namens Mischke, Rezensent unter anderem der Heidelberger Rhein-Neckar-Zeitung, der meinen Beruf als Journalist und Denunziant angibt, tituliert mich, ebenso knapp wie justiziabel, als Mördersohn. Das könnte allerdings auch Sohn eines Mörders bedeuten. Sei es, wie es wolle: Auf Mord steht nun einmal lebenslänglich. Ich muss dankbar sein, dass die Fahnder aus dem Feuilleton nicht gleich noch meine Privatadresse veröffentlichen.
Der Anwalt unserer Familie ist eigentlich ein recht friedliebender Zeitgenosse. Seit den Mutlanger Tagen ein Freund meiner Eltern, die in ihrem langen Leben nicht eben häufig den Kadi bemühten, nur dann und wann wegen einer unbotmäßigen Sitzblockade oder des Versteckens US-amerikanischer Kriegs-Deserteure vor den Richter zitiert wurden. Lukrative Dauermandanten aber waren sie nie. Konflikte, da hatten sie wenig Zweifel, lassen sich anders regeln, meine Mutter bevorzugt in einem auf Kompromiss-Lösungen abzielenden Dialog, mein Vater gern auch im offenen Schlagabtausch, publizistisch. Aber Klagen vor Gericht ist irgendwie kleinlich. Holger, Advokat, Pazifist und bekennend widerspenstiger Kleinaktionär des Daimler-Konzerns, wird vornehmlich für andere Probleme benötigt: für Ratschläge beim Aufsetzen des Testaments, fürs Ausfeilen einer juristisch unangreifbaren Vorsorge- und Patientenverfügung vor allem. Er ist ein Mann von Besonnenheit.
Jetzt aber gibt selbst er den Gang in die Offensive zu bedenken. Ob mir die juristische Dimension der Anschuldigungen der vergangenen Wochen bewusst sei? Gegen die öffentliche Verdächtigung müsse man eigentlich vorgehen. Die Tat, die sie Dir vorhalten, ist, genau genommen, ein Schwerverbrechen. Die Ausführenden – meist in tiefster Verzweiflung – neigen dabei zu besonderer Brutalität. Das sind keine gewöhnlichen Giftmischer oder Heckenschützen, nein, Vatermörder, das zeigen die einschlägigen Polizeiberichte, die greifen zu Messer, Beil oder Hammer und überschütten ihr Opfer, um ganz sicher zu gehen, bisweilen noch mit Benzin. Da bahnt sich blanker, neurotischer Hass seinen Weg. Und fast immer sind Motive der Rache im Spiel: Der Vater hat den Sohn nie beachtet oder, weit häufiger noch, er hat die Mutter misshandelt, geschlagen. Lang schon haben sich beim Delinquenten die Emotionen angestaut. Endlich Satisfaktion! Die Vernichtung des Unterdrückers scheint die letzte Chance der Befreiung. Vatermörder sind Triebtäter der besonderen Art.
All das kennzeichnet das Profil dieses Verbrechens, das sie mir unterstellen. Immerhin weiß ich nun, die weitere Verbreitung des ungeheuerlichen Verdachts ließe sich gerichtlich unterbinden. Der Gedanke ist tröstlich. Es lebt sich nicht gut mit dem Kainsmal, seinen wehrlosen Nächsten entehrt, entwürdigt, gemordet zu haben. Der gebannte Blick auf den Nabel, die Exploration der eigenen Befindlichkeit ist meine Sache nicht. Aber die Attacken hinterlassen Spuren.
Anfang März kann ich von einem Tag auf den anderen nicht mehr laufen: Schon der Gedanke an einen Intercity, der, wie ich auf einmal merke, beim Einstieg eine Trittstufe weniger hat als etwa der ICE, macht Angst, bereits am Vorabend der Reise. Ein Bahnhof, der weder über Rolltreppen noch über Fahrstühle verfügt, eine Anschluss-Verbindung in Braunschweig werden, jedenfalls mit Gepäck, zum schier unüberwindbaren Hindernis. So also kann sich Behinderung anfühlen. Die Beine verweigern den Befehlen des Gehirns ihren Gehorsam. Ich falle Treppen hinunter und stolpere ungelenk durch den Alltag.
Berufsstand Denunziant? Ich bin Fernsehjournalist und muss – oder darf – sehr viel reisen. Humpelnd, jeden zweiten Morgen von einem kugelrunden Pfleger im Hospital mit Cortison halbwegs schmerzarm gespritzt, schleppe ich mich, weil eine lang schon vereinbarte Produktion zu Ende zu bringen ist, durch die Wälder am Rande von Ushuaia. Dort, am Ende der Welt, hat ein chilenischer Bildhauer einen gewaltigen Walfisch aus Lehm modelliert. Am Tag darauf versucht ein Kommando mit 13 Feuerlöschern den alten Hangar der argentinischen Militärs in den Nebel des gnädigen Vergessens zu tauchen. Aus einstigen Untaten wird Kunst. Feuerland ist Schauplatz der südlichsten Biennale des Globus: welch gigantische Expedition! Aber so geht es nicht mehr. Werde ich künftig überhaupt noch Arbeit finden? Wer beschäftigt schon einen, der als Vatermörder Schlagzeilen macht? Mein Kameramann entdeckt im Netz eine kurze Notiz. In Novosibirsk werden Deutschlehrer gesucht.
Doch statt der Welt ruft erst einmal das Krankenhaus. Wie ein Kleinkind erlerne ich – mit 55 Jahren – noch einmal mühsam das Laufen. Das linke Bein durchdrücken und hoch mit der Ferse! Die betont sanfte Stimmlage des Therapeuten verheißt nicht eben Beruhigendes. Die elenden Übungen, erst stationär, dann ambulant, ziehen sich über mehr als ein halbes Jahr. Eine Herzensbindung zerbricht darüber. Wir hatten uns eine Menge vorgenommen. Angeschlagen wie ich bin – immer um die eigene Achse, um den einen ungeheuren Vorwurf humpelnd, den keine Verfügung eines Amtsgerichts aus der Welt wird schaffen können – bin ich in der Tat schwer zu ertragen … halt es doch selber kaum mit mir aus.
Die lieben Kollegen indes schildern den Frevel, dessen sie mich bezichtigen, in immer neuen Facetten. Die Akribie, ätzt der Tagesspiegel noch im Herbst 09, mit welcher der Autor den zunächst schleichenden, dann immer drastischeren geistigen und körperlichen Verfall des Vaters inszeniert (und ihr die eigene Erinnerungsfähigkeit triumphierend entgegensetzt), hat etwas Perfides. Spaß hat er also auch noch, das Schwein, ein wohliges Gefühl des Triumphs im Anblick des krepierenden Vaters! Der Feuilleton-Chef der Welt hatte sich ja bereits über ein pubertäres Vatermord-Spiel erregt. Diesmal ein Spiel also, aha! Mein Abschied von dem Mann, dem ich meine Existenz verdanke, die Beschreibung einer Altersdemenz und ihrer Begleitumstände: der Zeitvertreib eines bis ins 55. Lebensjahr Unreif-Gebliebenen, den es eigentlich gleich am Tübinger Hauptbahnhof abzufangen und wieder nach Frankfurt zurückzuschicken gelte. Die Stadt sollte ihren nun dahinscheidenden Großen beschützen, notfalls auch gegen den Sohn, räsoniert ein Anonymus vom Tübinger Wochenblatt – gewiss keine Zeitung von überragendem Einfluss, aber, als Medium, das sich ausschließlich aus Anzeigen finanziert, eben doch in jeden Briefkasten meiner Heimatstadt geschmissen.
Der so allgegenwärtige Kolumnist wähnt im Öffentlichmachen eines Hirnleidens den absurden und widerwärtigen symbolischen Vatermord seines charakterlich ziemlich missratenen Sohns. Die Überschrift verzichtet auf das überflüssige Beiwort symbolisch. Macht doch eh keinen Unterschied. Gibt es einen symbolischen Mörder, einen symbolischen Schänder, einen symbolischen Räuber? Das Stigma bleibt: Hier treibt ein Gewalttäter sein Unwesen, der aus innerem Zwang den kranken Vater gemordet hat. Der soll sich in Schwaben, wo der Geist noch zählt und mit Leidenschaft beschützt wird, bloß nimmer blicken lassen. Am Neckar kennt man seinen Ödipus. Mich aber soll die Stadt, die väterliche, niemals lebend – einen Bürger unter Bürgern – sehen: das sei nicht von ihr verlangt.
Mein einstiger Englisch-Lehrer am Tübinger Uhland-Gymnasium, den ich als eher trägen Freund des Gerstensafts erinnere und der sich beim Korrigieren der Klassenarbeiten gern Zeit ließ, hat es auf einmal mächtig eilig. Noch bevor mein Buch überhaupt erschienen ist, schickt er, aufgeschreckt durch eine Vorab-Rezension, einen Leserbrief an die heimische Tageszeitung: Leider werde ich es aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr erleben, wie Sie sich in 30 Jahren in eine Demenz flüchten müssen, um die Schuld gegenüber Ihrem wehrlosen Vater zu verdrängen. Leider. Schuldig! Schämen und Setzen! Was will der pensionierte Pauker? Woher rührt all der unverhohlene Hass, der mir da entgegenschlägt? Ist etwas dran am schweren Verdacht? Habe ich mich, und sei es aus unbewussten Motiven, an meinem kranken Nächsten vergangen? Das in der Tat wäre schrecklich. Oder aber ist der gemutmaßte Patrizid ein tumber Generalverdacht, die Vatermord-Keule eine altbewährte Waffe aus der Asservatenkammer der Küchenpsychologie?
Eine Klage vor Gericht, so reizvoll sie wäre, ist kein Weg, um Klarheit zu gewinnen – aber das Delikt, seine gesellschaftlichen Bezüge, seine Geschichte beginnen mich zu interessieren.
Gerade wegen seiner Allgegenwärtigkeit eignet sich der Ödipuskomplex nicht zu einem Schluß auf die Täterschaft.
Sigmund Freud, in: Neue Freie Presse: »Das Fakultätsgutachten im Fall Halsmann«, 1930
II. ÖDIPUS IN INNSBRUCK
Nein! Das kann nur ein Komplott sein. Damit hat er nichts zu tun. Hier geschieht ein Justizmord, hat er zur Geschworenenbank geschrien, als sie ihn, an den Händen gefesselt, nach der Urteilsverkündung aus dem Gerichtssaal abführen. Zurück in die Zelle. Er versteht die Welt nicht mehr. Das grausige Missverständnis muss sich doch endlich klären. Vor gut einem Vierteljahr, in den frühen Morgenstunden des 10. September 1928, haben sie den 22jährigen in der Dominikushütte festgenommen und nach Innsbruck verbracht. Seitdem hockt er in diesem nassen, kalten Loch, kauert auf seinem harten Strohsack, an dem er vor Wut nagen möchte, und grübelt über die Symbolik des Lorbeerblatts in der Gefängnissuppe. Irgendeinen Sinn muss das Ganze doch geben. So lang der Weg durch die Revisions-Instanzen nicht ausgeschöpft ist, darf er wenigstens nach Belieben lesen. Er lässt sich Kafkas Schloss in die Zelle bringen. Dem Landvermesser K. fühlt er sich nah, in ihm ist kaum mehr als absolut hilflose Empörung. Im Nebentrakt, schreibt er seiner Freundin aus dem Knast, weint jemand ununterbrochen, tagelang.
Der junge Mann mit den modisch-runden Brillengläsern und dem akkurat gestutzten Schnauzer – sein Name ist Philipp Halsmann – muss, bis die Verurteilung rechtskräftig wird, keine Sträflingskleidung tragen. Noch im Kerker legt er Wert auf Jackett und Krawatte. Er verlangt nach Papier und Bleistift. Er verfasst bittere Aphorismen. Das schafft ein wenig Luft. Was den Unterschied zwischen Folter und Haft ausmacht? Er besteht nur in der Konzentration der Qual und darin, dass bei der zweiten das Schreien verboten ist. Nicht aber das Jodeln des Zellennachbarn, das ihn in den Wahnsinn treibt. Um acht Uhr in der Früh eine Stunde Hofgang: Im Kreis im Gänsemarsch. Genau wie man es im Kino sieht … Vor mir geht einer wegen Mordversuch, hinter mir einer wegen Diebstahl.
Den Rest des Tages stiert der Student der Elektrotechnik an der Technischen Hochschule Dresden auf ein vergittertes Fenster, das er, um die Zeit totzuschlagen, in Versen zu vermessen sucht: Drei Stäbe gehen in Quere / Vier Stäbe sind vertikal / Und draußen ist leuchtende Leere / Und drinnen ist einsame Qual. Zehn Jahre soll die Pein dauern. Zehn Jahre Kerker. Die Geschworenen haben mit neun zu drei auf schuldig plädiert. Das Urteil, ist in der Neuen Freien Presse zu lesen, erscheint geeignet, ein junges Leben vollständig zu vernichten.
Zeitungsredaktionen aus halb Europa hatten ihre besten Korrespondenten entsandt, die bis zu drei Sonderseiten pro Ausgabe aus dem Innsbrucker Schwurgerichtssaal lieferten, in dem einer der wohl rätselhaftesten und spektakulärsten Fälle der Kriminalgeschichte verhandelt wurde. Die Indizien, schrieb der Schriftsteller und begnadete Gerichtsreporter Theodor Lessing im Prager Tagblatt, deuteten auf ein unlösbares Für und Wider, die Tat selber versprach einen Blick in die Tiefen des menschlichen Abgrunds. Angeklagt: Philipp Halsmann, der älteste Sohn eines jüdischen Zahnarztes aus Riga, bezichtigt eines Meuchelmords, wie er ehrloser kaum sein könnte.
Auf einer gemeinsamen Bergtour durch die Tiroler Alpen soll er den Vater den Hang hinab gestoßen und den gestürzten Murdoch Halsmann dann, als der wehrlos, verletzt im Zamserbach lag, auf bestialische Art mit einem Stein erschlagen haben. Der Schädel des 49-jährigen Dentisten, von der Gerichtsmedizin vom Körper abgetrennt und als Beweisstück in Formalinspiritus konserviert, ist von Spuren roher Gewalt übersät. Mindestens zwanzig Mal, so rekonstruieren die Pathologen, muss der Täter auf sein Opfer eingeschlagen haben. Auch der Anwalt des Angeklagten spricht von einer fürchterlichen Metzgerei. Wieviel Hass hat sich da entladen!
Der Sohn beharrt darauf: Es war ein Unfall. Murdoch Halsmann sei rücklings vom Saumweg gestürzt. Der schlecht befestigte Pfad bedeute, so stand es wenige Tage zuvor in der Zeitung, geradezu eine Lebensgefahr für die Passanten – für die beiden nicht eben gebirgserfahrenen, alles andere als alpingerecht gekleideten Familienausflügler im Besonderen. Ein verhängnisvolles Unglück in den Bergen! Er selbst, beteuert Philipp, sei unter Gefährdung des eigenen Lebens augenblicklich zum Vater hinunter geklettert, rund 15 Meter in die Tiefe, habe den Schwerverletzten notdürftig aus dem Wasser geborgen. Den Kopf konnte ich etwas auf die Seite drehen, ganz aus dem Wasser brachte ich den Körper nicht, weil er mir zu schwer war. Dann sei er, so schnell es irgend ging, zum Ort ihrer letzten Rast zurückgerannt. Die Dominikushütte liegt nur eine Viertelstunde entfernt. Er will Hilfe holen. Ein Arzt muss her. Weiß er nicht, dass der Vater zu diesem Zeitpunkt bereits tot ist?
Nach den genauen Geschehnissen befragt, verwickelt er sich in Widersprüche, sagt einmal, er sei ein paar Meter vor dem Vater, ein andermal, er sei hinter ihm gelaufen. Einmal sagt er: Ich sah meinen Vater abstürzen – ein andermal, er habe nur einen leisen Wehruf gehört. Den Absturz über den Hang konnte ich nicht sehen, da ich auf diesen keinen Ausblick hatte. Er deutet – kaum ist der Tote geborgen, mit Zweigen und Farnen bedeckt – auf die angebliche Absturzstelle. Er hat keinen Zweifel. Hier muss es gewesen sein.