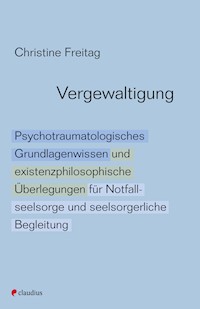
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Claudius Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Nur ein Drittel der Frauen, die Opfer sexueller Gewalt wurden, sucht professionelle Hilfe. Der häufigste Grund für Schweigen ist Scham. Noch immer lastet die Gesellschaft den Betroffenen häufig eine Mitschuld am Verbrechen an. Dieses Buch will das Erleben und die Auswirkungen einer Vergewaltigung sichtbar machen, um Seelsorgerinnen und Seelsorgern die Chance zu geben, die Gefühlslage einer betroffenen Frau zu verstehen und ihr konkrete und individuell passende Hilfe anzubieten. Es ist aber auch eine Handreichung für diejenigen, die sich (noch) nicht an Hilfseinrichtungen wenden wollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 275
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Copyright © Claudius Verlag, München 2020
www.claudius.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Umschlaggestaltung: Weiss Werkstatt, München
Layout: Mario Moths, Marl
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2020
ISBN 978-3-532-60064-1
Vorwort
Die Annäherung an eine Hilfestellung zur Bewältigung einer Vergewaltigung wirft zunächst die Problematik auf, dass Frauen ein solches Schreckenserlebnis sehr individuell wahrnehmen und verarbeiten. Während einige Frauen relativ schnell in den Alltag zurückfinden, weil die Vergewaltigung ein einmaliges Geschehen war, sie über gute Resilienzen verfügen und sie zudem innerhalb ihres sozialen Bezugsgeflechts auf viel Verständnis stoßen, leiden andere Frauen massiv unter den Folge- und Langzeitbeeinträchtigungen einer Vergewaltigung.
Psychotherapeutische Hilfsangebote zur Verarbeitung einer Vergewaltigung lassen jedoch häufig die Wahrnehmungssensibilität für die betroffene Frau als selbstkompetente Gestalterin des Heilprozesses und/oder die Würdigung ihrer inneren Weisheit, als Ausgangspunkt des Heilgeschehens, vermissen. Betrachtet man jedoch diese beiden Aspekte als grundlegend für Heilung und nutzt diese Hintergrundbedingungen, um sie in Zielformulierungen für ein seelsorgerliches Hilfeverfahren umzuwandeln, wird deutlich, warum es bei der Begleitung von Frauen nach Vergewaltigung aus seelsorgerlicher Perspektive niemals ein Manual im klassischen Sinn geben kann, das auf konkreten Handlungsanleitungen fußt: Heilung, die nicht nur auf Symptomreduktion abzielt, sondern den fühlenden Menschen in den Mittelpunkt rückt, kann nur über einen existenzgeleiteten Prozess des Heil-Werdens befördert werden, der die Entfaltung des Selbst der Frau in den Mittelpunkt stellt. Das bedeutet, die Frau wird in der bewussten Gestaltung ihres Sein-Könnens, Wert-Seins, So-Sein-Wollens und im sinngesetzten-Sein begleitet.
Trotz der Notwendigkeit einer individuellen Gestaltung seelsorgerlicher Begleitung scheinen mir aber dennoch Konturen für die Hilfestellung zur Bewältigung einer Vergewaltigung notwendig zu sein, wenn auf die konkreten Gefühlslagen der Frauen passgenau eingegangen werden soll. Dass sich eine solche Hilfeplanung jedoch nicht einfach aus einer Kombination klassischer Modelle der traumaorientierten Psychotherapie mit der Notfallseelsorgepraxis ableiten lässt, wird offenbar, wenn die Notwendigkeit einer Betrachtung, die die Frau als verletzte Einzelne wahrnimmt, für den Heilungsprozess verstanden wird: Um in das Heilungsgeschehen positiv einwirken zu können, bedarf es einer Hinwendung zu einer Frau, die alleine und höchst individuell in eine Extremsituation geraten ist und um zu überleben einen Bruch mit sich selbst und der Welt vollziehen musste. Mehr noch, diese einzelne Frau lebt seit diesem Schreckensereignis nicht nur in einer traumabedingten Selbst- und Weltentfremdung, sondern auch in einer ihr eigentümlichen destruktiven Beziehung zu ihren inneren Ressourcen, die gerade jetzt nicht als Kraftquelle für die Aktivierung der Selbstheilung genutzt werden können.
Professionelle Begleitung von Frauen nach Vergewaltigung steht daher in einem Spannungsfeld aus Praxiskönnen und Fachwissen: Nicht ein umfassender Rückgriff auf wissenschaftlich belegte theoretische Kenntnisse der Psychotraumatologie ist notwendig, um der Frau professionell zu helfen, vielmehr gilt es zu klären, welches Fachwissen bedeutsam ist, um eine geeignete Handlungs- und Reflexionsgrundlage im seelsorgerischen Kontext sicherstellen zu können. Gefordert sind also stets individuell-verschränkte Zugänge, die ausgewählte therapeutische Interventionen mit seelsorgerlichem Handeln, das sich durch eine spezifische Haltung gepaart mit wissensgeleitetem Können auszeichnet, in Einklang bringen lässt, um so die Themenkomplexe, die eine Frau nach Vergewaltigung beschäftigen, durcharbeiten zu können. Grob umrissen erfordert eine solche auf die persönliche Welt der Frau abgestimmte Verknüpfung von Psychotraumatologie und Seelsorge, dass in der dialogischen Auseinandersetzung die Selbst- und Weltdeutung gewichtet und in den Mittelpunkt einer existenzorientierten Heilungsarbeit gerückt wird.
Dieses Buch versucht einen Beitrag zu dieser Problematik zu leisten, indem zunächst psychotraumatologisches Grundlagenwissen vermittelt wird, um es anschließend in existenzphilosophische Überlegungen für die seelsorgerliche Begleitung zu überführen, ohne dabei die Seelsorgepraxis, die sehr viel methodische Beweglichkeit und ein empfindsames Gespür für individuelle Entwicklungs- und Heilungsprozesse erfordert, zu beschweren. Das Ziel ist, Notfallseelsorger_innen und Berater_innen aus seelsorgerlicher Begleitung zu ermutigen, sich mit der Beschaffenheit der Bedingungen auseinanderzusetzen, vor welchen das Erlebte durch korrigierende Seins-Erfahrungen verarbeitet werden kann. Denn erst durch tiefe Auseinandersetzung mit den Hintergründen des Selbst- und Welterlebens der Frau und durch Beleuchtung der Quelle ihrer inneren Kraft und Weisheit kann ein Beziehungsraum geschaffen werden, in dem heilsame Begegnungen erfahrbar werden und folglich Heil-Werdung stattfinden kann.
Graz, im November 2019
Amo: volo ut sis. (Augustinus)
Für die Abfassung vorliegender Arbeit unternahm ich den Versuch, durch Betrachtung des augustinischen1Amo: volo ut sis einer neuen Spur, durch die zu den Bedingungen der Möglichkeit von Seelenheilung nach einem Vergewaltigungstrauma gefunden werden kann, nachzugehen.
Als Augustinus durch diese Worte die Bedeutung der Liebe für den Menschen erläuterte, fasste er mit der Spannweite der Interpretationsmöglichkeiten nachfolgender Existenzphilosoph_innen bereits den Kern vorliegender Arbeit zusammen: Während Martin Heidegger mit „Ich will, dass Du seiest, was Du bist“ die Möglichkeiten des Selbst in den Kanon der Selbstdeutung fächert, verknüpft Hannah Arendts „Ich will, dass du bist“ den Einzelnen mit dieser Welt.
Ich bin überzeugt davon, dass beide Deutungen in die Grundhaltung der Notfallseelsorger_innen und seelsorgerlichen Begleiter_innen übergehen müssen, damit Heilung für Frauen nach sexualisierten Gewaltereignissen möglich wird.
INHALT
Vorwort
I.
Belastende und traumatische Lebensereignisse – Symptome und Behandlung
1.
Hinführung zum Thema
2.
Vergewaltigung
2.1
Akute Belastungsreaktion (ABR)
2.1.1
Orientierungslosigkeit
2.1.2
Kontrollverlust
2.1.3
Dissoziation
2.2
Anpassungs- und Krisenphase
2.2.1
Vermeidung
2.2.2
Überwältigung
2.2.3
Weltentfremdung
2.2.4
Selbstentfremdung
2.3
Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)
2.3.1
Prävalenz und Verlauf
2.3.2
Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung (KPTBS)
2.3.3
Symptomatik im Überblick
3.
Intervention und Therapie
3.1
Akuthilfe durch Krisenintervention und Notfallseelsorge
3.1.1
Sicherheit durch Beziehung
3.1.2
Stabilität durch Struktur
3.1.3
Selbstbestimmung durch Handlungsfähigkeit
3.1.4
Gesprächsabschluss und Psychohygiene
3.2
Trauma in der Psychotherapie
3.2.1
Verhaltenstherapeutische Therapieformen
3.2.2
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
3.2.3
Dialogische Traumatherapie
4.
Zusammenfassung des Forschungsstands und richtungweisende Schlussfolgerungen
II.
Seelsorge nach Vergewaltigung
5.
Grundlagen der Seelsorgearbeit
5.1
Aufgaben des seelsorgerlichen Handelns
5.2
Grenzgänge zwischen Seelsorge und Psychotherapie
5.3
Seelsorge als Ereignis durch Begegnung
5.3.1
Seelsorgerliche Haltung: Hinwendung zum Menschen
5.3.2
Seelsorgerliches Können: Gesprächsführung
5.4
Beichtgeheimnis und seelsorgerliche Schweigepflicht
6.
Existenzphilosophische Überlegungen für die seelsorgerliche Begleitung nach Vergewaltigung
6.1
Erste Kontur: Sicherheit vermitteln
6.1.1
Stabilität durch Beziehung
6.1.2
Beruhigung durch Gegenbilder und Rituale
6.1.3
Herstellung von Kontrollierbarkeit durch Distanzierung
6.2
Zweite Kontur: Annäherung an das traumatische Ereignis
6.2.1
Der verletzten Frau begegnen
6.2.2
Bildhermeneutische Überlegungen für die Seelsorge
6.3
Dritte Kontur: Integration des Erlebten
6.3.1
Körperorientierte Seelsorge für Frauen
6.3.2
Verstehen und dialogische Bearbeitung
6.3.3
Arbeit an der Selbst- und Weltbeziehung
6.4
Vierte Kontur: Loslösung
6.4.1
Hoffnung im Heilgeschehen
6.4.2
Die Paarbeziehung als Heilungsraum nutzen
6.4.3
Biografiearbeit mit Frauen
7.
Besondere Herausforderungen für Seelsorger_innen
7.1
Sexualität im Seelsorgegespräch
7.2
Opfer-Täter-Beziehung
7.3
Gemeinschaft, Ritual und Zugehörigkeit
8.
Existenzphilosophisches Nachdenken über Selbst- und Weltentfremdung
8.1
„In welchem Sinne betrifft mich der Andere?“ – Emmanuel Lévinas
8.2
„Über sich verzweifeln und verzweifelt sich selbst los sein wollen“ – Søren Kierkegaard
8.3
„Warum ist es so schwer, die Welt zu lieben?“ – Hannah Arendt
9.
Perspektiven einer Christlichen Seelsorge nach Vergewaltigung
9.1
Heilung als unverfügbare Heil-Werdung
9.2
Die mit Gott im Traumageschehen verstrickte Frau
9.3
Christlich-feministische Seelsorge in der Praxis
9.4
Die Schutzmantelmadonna als Identifikationsfigur
9.5
Trauma in der Bibel
9.5.1
Das Hiob-Buch: Was bedeutet Gottes Schweigen?
9.5.2
Das Ezechiel-Buch: Was darf der Mensch hoffen, wenn er glaubt?
10.
Möglichkeiten und Grenzen der Seelsorgearbeit nach Vergewaltigungstrauma
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Anhang
Anhang 1: ‚Anamnesefragebogen nach Vergewaltigung‘
Anhang 2: ‚Ablauf der Untersuchung nach Vergewaltigung‘
Anhang 3: ‚Tests und Sammeln von Beweismaterial‘
Anhang 4 – Übung: ‚Innerer sicherer Ort‘
Anhang 5 – Übung: ‚Entleerte Bilder‘
Anhang 6 – Übung: ‚Vorbeiziehende Wolken‘
Anmerkungen
I. Belastende und traumatische Lebensereignisse – Symptome und Behandlung
1. Hinführung zum Thema2
Die European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) publizierte im Jahr 2014 erstmals Ergebnisse der Umfrage Violence against Women; An EU-wide Survey: Main Results, die Frauen aus achtundzwanzig EU-Mitgliedsstaaten zu ihren Erfahrungen mit psychischer, physischer und sexualisierter Gewalt befragte. Deutlich wurde, dass etwa 11 Prozent der befragten Frauen vor ihrem fünfzehnten Geburtstag wenigstens ein Mal sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren. Fast jede zwanzigste Frau, das entspricht bei achtundzwanzig Millionen Frauen aus dem Raum der Europäischen Union einer Anzahl von fast 1,5 Millionen Frauen, wurde Opfer einer Vergewaltigung. Zudem gaben weitere sechs Prozent der Befragten an, dass sie nach dem fünfzehnten Lebensjahr mindestens einer versuchten Vergewaltigung entkamen oder sexuellen Handlungen nur aus Angst zugestimmt hatten. Diesen erschreckenden Ergebnisse steht die Zahl jener Frauen gegenüber, die nach Vergewaltigung tatsächlich Hilfe suchen: Nur etwa 30 Prozent der Frauen, die Vergewaltigung und andere Formen von sexualisierter Gewalt in ihren Lebensgeschichten haben, suchen professionelle Hilfe. Als häufigsten Grund für ihr passives Verhalten und Schweigen nannten sie Scham.3
Derartige Reaktionen auf vollzogene oder versuchte Vergewaltigungen sind nicht ungewöhnlich, denn die Bewertung sexueller Übergriffe hängt stark mit der gesellschaftlichen Wahrnehmung der Opfer zusammen. Wie Grubb & Harrower (2009) in ihrem Artikel Understanding attribution of blame in cases of rape: An analysis of participant gender, type of rape and perceived similarity to the victim im Journal of Sexual Aggression postulieren, kursieren immer noch hartnäckig Vergewaltigungsmythen, die Frauen wenigstens unterschwellig die Mitschuld am Geschehen geben und bestimmte Charakterfehler der Frauen als Ursache für sexualisierte Gewaltverbrechen benennen.4 Die häufigsten Vorstellungen über Vergewaltigung beziehen sich dabei auf typische Geschlechterstereotypen, nach welchen Männer durch aufreizende, attraktive Frauen so weit in Erregung gebracht werden, dass sie sich nicht mehr zurückhalten können. In diesem Zusammenhang ist der Mythos, dass Frauen eigentlich ja meinen, wenn sie nein sagen, bis heute ungebrochen.5
Zudem schwingt im Vergewaltigungsdiskurs, und speziell in religiösen Sozialisationsumgebungen, immer noch die Vorstellung von der verletzten Ehre der Frauen mit. Auch das daraus resultierende Konzept der Schande findet immer noch Resonanzen in der Bevölkerung, denn ursprünglich war klar, dass verletzte Ehre Schande bedeutet, der Einzelne daher mit Scham zu reagieren hat.6
Vor diesem Hintergrund entzündet sich die Geschichte der Vergewaltigung immer wieder neu: Frauen, die sexualisierte Gewalt erfahren, beurteilen sich anhand eingeschriebener gesellschaftlicher Normen, die ihnen eine Mitschuld für dieses Verbrechen anlasten, negativ. Folglich nehmen sie kaum Hilfe in Anspruch, was mit einer drastischen Verschlechterung ihrer psychischen und seelischen Gesundheit einhergeht. Zudem scheuen sich Frauen davor, in der Seelsorge – die im kirchlichen Kontext zumeist von männlichen Kirchenvertretern angeboten wird – Trost zu suchen, daher liegen kaum Erfahrungswerte vor, wie Frauen nach Vergewaltigung durch seelsorgerliche Begleitung unterstützt werden können. Außerdem fehlt es in der Seelsorgearbeit an konkreten Ansätzen, die Heilungsprozesse nach Vergewaltigungstraumata befördern. Folglich müssen die wenigen Frauen, die tatsächlich Hilfe suchen, auf nüchterne Interventionsprogramme zurückgreifen, die ihre spirituelle Ausrichtung unberücksichtigt lassen.
Vorliegende Arbeit verfolgt daher das Ziel, das Erleben und die Auswirkungen von Vergewaltigung sichtbar zu machen, um Angehörigen der Seelsorgearbeit die Möglichkeit zu eröffnen, konkrete und passgenaue Hilfsangebote auszusenden.
Dieses Buch ist aber kein Manual im klassischen Sinne, sondern stellt im ersten Teil Grundlagenwissen und Ergebnisse aus Forschungsliteratur der Psychotraumatologie vor, die im zweiten Teil in Konturen, als strukturgebende Praxisorientierungen, überführt werden. Dabei soll nicht die Anwendung bloßer Arbeitstechniken der Psychotraumatologie den Umgang mit hilfesuchenden Frauen nach Vergewaltigung in der Seelsorge bestimmen, vielmehr zeigt vorliegende Auseinandersetzung, welche Verletzungen besonderer Aufmerksamkeit bedürfen und sensibilisiert so für die Themenbereiche, die es zu bearbeiten gilt: Beleuchtet wird einerseits die Bedeutung von Vergewaltigung für das Selbstbild der Frauen, andererseits findet darauf aufbauend auch die damit verbundene Frau-Welt-Beziehung Beachtung. Herausgearbeitet wird, weshalb Vergewaltigung nicht nur ein demütigendes Schreckenserlebnis ist, sondern vor allem die existenziellen Wurzeln einer Frau in dieser Welt beschädigt. Dieser Bruch mit der Welt ist einerseits ein Konflikt mit dem Selbst, weil es verlassen werden muss, um zu überleben, und andererseits mit den Menschen, die dieses Leid entfacht und/oder zugelassen haben. Die Hoffnung, dass die Welt Gutes für den Menschen bereithält, scheint für die betroffene Frau im Rekurs auf das Erlebte abwegig zu sein. Daher müssen Seelsorger_innen mit viel Feingefühl zunächst die Reflexion der Selbst- und Weltdeutung ihrer Klient_innen anregen, um anschließend eine Hinwendung zu ihrer inneren Heilkraft wieder möglich zu machen. Konkret soll anhand der Konturierungen im zweiten Teil dieser Arbeit deutlich werden, dass Heil-Werdung durch eine Verschränkung einer Hinführung zu eigenen inneren Ressourcen mit seelsorgerlichem Fachwissen und Praxiskönnen gelingen kann – insbesondere indem eine dialogische Grundhaltung mit ressourcen- und symbolorientierten Arbeitsmethoden forciert wird.
2.Vergewaltigung
Im Handwörterbuch Sexueller Missbrauch wird Vergewaltigung als „traumatisches, existenziell bedrohliches Ereignis, von denen Mädchen und Frauen objektiv am stärksten bedroht sind“7 beschrieben. Unter Vergewaltigung wird dabei jedes gewalttätige, sexuelle Eindringen in den Körper eines anderen ohne dessen Einwilligung verstanden, wobei in Deutschland vaginale, anale und orale Vergewaltigungen sowie Vergewaltigung mit Gegenständen auch durch Ehepartner strafbar sind, und folglich auch strafrechtlich verfolgt werden können.8
Typischerweise wird also im Deutschen Strafgesetzbuch das Erzwingung eines Beischlafs durch Eindringen in den Körper als Vergewaltigung bezeichnet, alle anderen Handlungen sind, im juristischen Sinne, Formen sexueller Nötigung9. Aus Perspektive einer Frau kann Vergewaltigung folgendermaßen zusammengefasst werden:
„[Vergewaltigung ist] ein sexuelles, gewaltsames Eindringen in den Körper, ein Einbruch in den privaten, persönlichen Innenraum, ohne dass die Frau ihr Einverständnis dazu gegeben hätte – kurz, ein gegen das Innere gerichteter schwerer körperlicher Angriff auf einem von mehreren Zugangswegen und mittels einer von mehreren Methoden. Dieser Gewaltakt stellt eine bewusste Verletzung der emotionalen, körperlichen und geistigen Integrität dar und ist eine feindselige, entwürdigende, brutale Handlung.“10
Der zentrale Aspekt für die Nutzung des Begriffs Vergewaltigung bezieht sich hier nach Teubner (1989) in ihrem Artikel Über die langen Folgen der Vergewaltigung und die systematische Verkennung von Gewalt gegen Frauen, ähnlich wie in den deutschen Rechtstexten, auf die missachtete sexuelle Selbstbestimmung der Frau. Vergewaltigung ist also eine Grenzüberschreitung „bei der der Mann sich über den Willen der Frau hinwegsetzt und die Frau seiner Macht und Willkür ausliefert, indem er sie zu bestimmten Handlungen benutzt“11. Wichtig ist daher die Betonung, dass Vergewaltigung, wie alle Formen der sexualisierten Gewalt, ein Gewaltakt ist, der „den Intimbereich mit einbezieht, zumeist weniger, um eine sexuelle Befriedigung des Täters zu erzielen, sondern um eine Demütigung der (verletzten) Person zu bewirken.“12 Daraus ergeben sich zwei konkrete Schlussfolgerungen: Erstens liegt Vergewaltigung nicht „in den Genen“, denn Gewaltverbrechen und aggressive Akte, die darauf abzielen, die Würde der Mitmenschen zu verletzen, können nicht (mehr) durch einen evolutionsbasierten Biologismus gerechtfertigt werden. Diese Theorie wäre auch aus sozialpsychologischer Sicht nicht haltbar, denn es handelt sich bei einem Vergewaltigungsakt nicht um feindselige Aggression, die typischerweise aus einem Empfinden negativer Gefühle oder einem Unterdrücken von Trieben herrührt, sondern um instrumentelle Aggression, die zwar dem Gegenüber ebenso Schaden zufügt, jedoch als Mittel zum Zweck eingesetzt wird, beispielsweise um Macht über eine Gesellschaftsgruppe zu erlangen. Außerdem ist die Triebtheorie, die die Vergewaltigungstat des Täters abzuschwächen versucht, indem sie durch Etikettierung als „Überlaufen und Erhitzen der naturgegebenen Triebe“ bagatellisiert wird, stets damit verknüpft, dass Sexualität – wenn sie nicht penibel genau kontrolliert wird – zu einem menschenverachtenden Geschehen wird. Eine solche Kennzeichnung der Sexualität hat fatale Auswirkungen für junge Männer, denn um nicht auf diese „destruktive“ Seite der Sexualität zu rutschen, kann sie nur abgespalten werden. Somit bleibt ein gesunder Zugang zu Sexualität, vor allem aber zu den aggressiven – im Sinne von bewegenden, ungeordneten, lebendigkeitsbefördernden – Anteilen, verwehrt. Solange solche Facetten der Sexualität ausgeblendet und mit sexualisierter Gewalt in eine negative Verbindung gebracht werden, wird die Sexualität zu einem unheimlichen Ort, an dem ungleiche Geschlechterverhältnisse zementiert werden, weil sie zu Diffamierungszwecken und einseitigen Moralisierungen missbraucht wird.
Aufgrund der neueren Definition der Vergewaltigung als Gewaltakt anstatt als triebgesteuertes Verhalten, wurde zugleich mit der Neufassung des dreizehnten Abschnitts des deutschen Strafgesetzbuches, das Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (§§ 174–184j) behandelt und am 10.11.2016 in Kraft getreten ist, der Schutz eines Menschen auf sexuelle Selbstbestimmung verbessert. Zwar konnte in der zuvor gültigen Fassung aus dem Jahre 1861 die sexuelle Nötigung bzw. Vergewaltigung ebenfalls mit Freiheitsstrafe bestraft werden, jedoch fehlten konkrete Erläuterungen, was unter sexueller Selbstbestimmung zu verstehen ist. Im gegenwärtigen Gesetzestext findet sich unter dem §177 folgende Definition von sexuellen Übergriffen, sexueller Nötigung und Vergewaltigung:
„Wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einem Dritten bestimmt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. (1) Ebenso wird bestraft, wer sexuelle Handlungen an einer anderen Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einem Dritten bestimmt […] (2)“13
Deutlich wird bei Vergleich der beiden Gesetzesfassungen, dass in der neueren Bestimmung der Wille der Person in den Mittelpunkt gerückt wird, so heißt es, dass der Täter nicht ausnutzen darf, dass „die Person nicht in der Lage ist, einen entgegenstehenden Willen zu bilden oder zu äußern“14 und der Täter zudem weder Überraschungsmomente, noch eine Lage herstellen bzw. ausnutzen darf, in der dem Opfer „bei Widerstand empfindliches Übel“15 droht.16
Die vorgesehenen Freiheitsstrafen für das Vergehen der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung reichen, je nach Schweregrad des Tathergangs, von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Letztere Zeitspanne bezieht sich auf besonders schwere Fälle, beispielsweise wenn die Tat unter Waffengebrauch stattgefunden hat, das Opfer schwer misshandelt wurde oder das Leben des Opfers auf andere Art in Gefahr war.17
Durch die Formulierung des seit 2016 gültigen Gesetzestextes wird zudem deutlich betont, dass Vergewaltigung stets ein Akt personaler Gewalt ist und immer in einem gewalttätigen Bezugsrahmen stattfindet18, es kann also keine Vergewaltigung geben, ohne psychische oder physische Gewalt anzuwenden. Spezielle Formen von gesellschaftlich konstruierten Machtgefällen, etwa ein Erwachsenen-Kind-Machtgefälle oder Mann-Frau-Machtgefälle wurden als häufige Rahmenbedingung benannt, vor welcher Gewalt und sexualisierte Gewalt überhaupt erst stattfinden kann.19 Somit ist Vergewaltigung, als Extremausdruck personaler Gewaltformen, nach den Überlegungen von Röhr (2010) in Missbrauch überleben. Heilung nach sexueller und emotionaler Gewalt auch nicht zwangsläufig das Problem einer sozial schlechter gestellten Gesellschaftsschicht, sondern eine Auswirkung von strukturellen Machtungleichheiten, die sich gleichermaßen durch alle Gesellschaftsschichten ziehen.20
Wohl aber sind durchgehend fast ausschließlich Mädchen und Frauen von Vergewaltigung betroffen, so belegt die im Jahre 2013 vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugendliche veröffentlichte Studie Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland, dass 99 Prozent der sexualisierten Gewalt von Männern verübt wird, während der Anteil der Täterinnen bei unter einem Prozent liegt. Auch sexuelle Belästigung findet in 97 Prozent aller Fälle durch Männer und an Frauen statt.21 Die Täter sind dabei in 49,3 Prozent der Fälle Partner oder Expartner, 22 Prozent der Befragten nannten flüchtige Bekannte als Täter und in 19 Prozent gaben Mädchen und Frauen an, die Täter zuvor im Freundes-und Bekanntenkreis gehabt zu haben.22 Entsprechend wird sexualisierte Gewalt gegen Frauen auch seltener im öffentlichen Raum verübt als in der eigenen Wohnung, wie 71 Prozent aller Mädchen und Frauen mit sexualisierten Gewalterfahrungen in dieser Studie bestätigen.23 Zusammenfassend macht die Studie deutlich, „dass Gewalt gegen Frauen überwiegend häusliche Gewalt durch männliche Beziehungspartner ist“.24
Ähnliches geht auch aus der polizeilichen Kriminalstatistik hervor. Fraas und Müntel (2014) berichten in So werden die Spuren gesichert. Vergewaltigung und sexuelle Nötigung, dass im Jahr 2012 insgesamt 8031 Straftaten, die Vergewaltigung und sexuelle Nötigung beinhalteten, angezeigt wurden. Davon fielen aber nur 1536 Taten unter die Kategorie „überfallartige Vergewaltigung durch Einzeltäter“,25 von denen 83 Prozent aufgeklärt werden konnten. Auch in dieser Statistik zeigt sich ein deutliches Geschlechterverhältnis: 93 Prozent der Opfer waren weiblich und 99 Prozent der Tatverdächtigen männlich.26
Alle Formen sexualisierter Gewalt können erhebliche physische, psychische und psychosoziale Folgeschäden nach sich ziehen. Der Grad der Auswirkungen hängt dabei von der Schwere und Häufigkeit der Übergriffe und der Nähe zum Täter und der Zeitspanne, in der die Gewalt stattgefunden hat, ab.27 Auch ein einmaliges Erfahren von schwerer sexualisierter Gewalt in Form einer Vergewaltigung kann, nach den Sexualmedizinern Beier, Bosinski, Hartmann & Loewit (2001) in Sexualmedizin neben den körperlichen Folgen,28 die in etwa 59 Prozent zu extragenitalen und in 24 Prozent der Fälle zu gynäkologischen Verletzungen führen,29 tiefgreifende psychische Auswirkungen nach sich ziehen. Im Anhang 1 befindet sich ein Anamnesebogen, der von Ärzt_innen nach Vergewaltigungstaten für die Erstuntersuchung genutzt wird. Da die Untersuchungen für die Opfer sehr belastend, jedoch – im Hinblick auf ein mögliches Strafverfahren – unbedingt notwendig sind, werden für untersuchende Ärzt_innen und Rechtsmediziner_innen spezielle Fortbildungen angeboten, damit ein sensibler Umgang mit der betroffenen Frau gewährleistet werden kann. Wichtig zu wissen ist für Akutbetreuer_innen, dass in jedem Fall eine genaue Ganzkörperuntersuchung durchgeführt werden muss, um alle Beweisspuren (Bissspuren und Abwehrverletzungen am Körper, auf Unterarmstreckseite, behaarter Kopfhaut, hinter den Ohren, Oberschenkelinnenseite, Labien etc.) dokumentieren zu können.30
Im Folgenden soll nun, bevor gezielte Interventions- und Postventionsstrategien erläutert und diskutiert werden, näher auf das psychische Erleben einer Vergewaltigung eingegangen werden, indem mögliche Akut-, Anpassungs- und posttraumatische Belastungsreaktionen der Opfer voneinander unterschieden werden.
2.1Akute Belastungsreaktion (ABR)
In der Forschungsliteratur finden sich mehrere Längsschnitt-Untersuchungen, die einen phasenhaften Verlauf der frühen psychischen Reaktionen auf eine Vergewaltigung beschreiben.31 Nach der von der Weltgesundheitsorganisation herausgegebenen Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) wird die Akute Belastungsreaktion (ABR) als „vorübergehende Störung, die sich bei einem psychisch nicht manifest gestörten Menschen als Reaktion auf eine außergewöhnliche physische oder psychische Belastung entwickelt, und die im Allgemeinen innerhalb von Stunden oder Tagen abklingt“32 beschrieben. Die Symptomatik zeigt sich typischerweise durch ein „gemischtes und wechselndes Bild, beginnend mit einer Art von ‚Betäubung‘, mit einer gewissen Bewusstseinseinengung und eingeschränkten Aufmerksamkeit, einer Unfähigkeit, Reize zu verarbeiten und Desorientiertheit.“33
In der unmittelbaren Phase während der Tat treten also oft Gefühle der Lähmung und die Blockierung der Wahrnehmung auf, zugleich werden Gefühle der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins in den Vordergrund geschoben, was zu abwechselnd aktivem und passivem Gegenwehrverhalten führen kann.34 Fälschlicherweise nehmen Außenstehende daher manchmal an, dass die Frau während der passiven Sequenzen einer Vergewaltigung dem Geschehen zustimmt und/oder sogar Lust empfindet. Vielen Menschen ist nicht klar, dass der Verzicht auf Widerstand keine bewusste Entscheidung des Opfers, sondern eine körperlich gesteuerte und lebensrettende Maßnahme ist.
Im Anschluss an die Tat wirken die in der Vergewaltigung erlebten Gefühle oft so massiv nach, dass die Verhaltensweisen der Betroffenen große Schwankungen aufweisen. Dies kann vor allem im Zuge einer Tatanzeige zu Problemen führen, da die Frauen ihre Aussagen immer wieder revidieren.35
Die Traumaforscher Butollo, Hagl und Krüsmann (2003) setzen sich in Kreativität und Destruktion posttraumatischer Bewältigung. Forschungsergebnisse und Thesen zum Leben nach dem Trauma mit den Mechanismen nach einem belastenden Ereignis auseinander. Sie erläutern, dass diese Überflutung mit Gefühlen der Angst und Ohnmacht während und unmittelbar nach dem Schreckensereignis zu einem hohen emotionalen Erregungsniveau führt, das in der Fachsprache auch als hohes Arousal bzw. Hyperarousal bezeichnet wird.36 Diese Übererregung geht, wie Butollo und Hagl (2012) in Dialogische Traumatherapie. Manual zur Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung erläutern, oft mit Schlafstörungen, erhöhter Schreckhaftigkeit, Reizbarkeit, dem Fehlen emotionaler Reaktionsfähigkeit und Konzentrationsstörungen einher.37
Da die Erstreaktionen nach dem belastenden Ereignis bis zu achtundvierzig Stunden ansteigen und zudem mehrere Tage konstant bleiben können, kann die Diagnose Akute Belastungsstörung innerhalb von vier Wochen nach dem Ereignis gestellt werden. Halten die Symptome danach weiterhin an, wird von einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) gesprochen. Kritiker_innen fordern zudem die Aufnahme einer weiteren Kategorie in das Diagnosemanual, da nur so auch komplexeren Störungsverläufen, etwa nach besonders extremen und wiederholten Vergewaltigungen, Rechnung getragen werden kann.38
Nachfolgend soll nun auf die Gefühlslage der Opfer nach der Vergewaltigung eingegangen werden, indem die Symptome der ersten Phase nach Vergewaltigung näher beleuchtet werden.
2.1.1Orientierungslosigkeit
Wie bereits erläutert wurde, wird eine Vergewaltigung von vielen Frauen als Ohnmachtssituation erlebt. Sofern sie nicht im Vorfeld mit bewusstseinstrübenden Substanzen betäubt wurden, sind die Frauen bei vollem Bewusstsein in einer Situation, in der keine Kontrolle über das eigene Verhalten erzielt werden kann. Kotzlowska, Walker, McLean und Carrive (2015) belegen in Harvard Review of Psychiatry in Fear and the Defense Cascade: Clinical Implications and Management, dass die Überwältigung in einer Vergewaltigungssituation zu extremer Angst führt, die oftmals mit Erstarrung einhergeht. Das Erstarren entsteht unbewusst über einen komplexen Prozess im Gehirnareal der Amygdala, die über den Hirnstamm in den Angstschaltkreis eingebunden ist. Ziel dieser Reaktion des Körpers auf einen Angriff ist zunächst das Wachsamwerden, um reagieren zu können. Daher werden zeitgleich auch die Pupillen durch das Aufreißen der Augen erweitert und das Gehör aktiviert. Da dem Körper beide mögliche Reaktionen auf einen Angriff, nämlich Flucht oder Verteidigung, im Vergewaltigungsgeschehen nicht möglich sind, spült der Angstschaltkreis durch den Mechanismus des Erstarrens einen großen Schwall an Hormonen in den präfrontalen Cortex, der für das emotionale Erleben zuständig ist.39
Das Erleben von Vergewaltigung ist für die meisten Opfer mit enormem Stress verbunden und bringt sie in gefühlte Todesnähe. Die Überflutung an Stresshormonen in der Akutsituation setzt alltägliche emotionale Bewältigungsstrategien außer Kraft und bedingt so ein hohes Erleben von Ohnmacht, eigener Wirkungslosigkeit und extremer Hilflosigkeit.41 Die Folge sind abwechselnde Gefühlszustände der Panik und Erschöpfung, die sich auch in einem orientierungslosen Verhalten, das durch die Bewusstseinseinengung des Vergewaltigungsopfers entsteht, während der ersten Tage nach dem Geschehen widerspiegeln. Orientierungslosigkeit kann sich durch die Symptome
•eingeschränkte Aufmerksamkeit,
•Hyperaktivität bzw. Unruhezustände und
•vegetative Übererregung, wie panische Angst, Schweißausbrüche, Herzrasen und Zittern.42
äußern. Zudem ist das Erinnerungsvermögen der Opfer in den ersten Tagen nach dem belastenden Ereignis oft nur selektiv verfügbar, d.h. die Einzelheiten der Vergewaltigung können nur schwer oder gar nicht von den Mädchen und Frauen abgerufen werden. Die Ursache für diese dissoziative Amnesie43 ist die Wahrnehmungseinengung, die der Körper in dieser extremen Ohnmachtssituation wählen musste, um die überlebensnotwendigen Funktionen aktivieren zu können. Diese Erinnerungslücken tragen maßgeblich zu einer Orientierungslosigkeit bei, denn hierdurch zweifeln die Betroffenen immer wieder an der eigenen Wahrnehmung des Geschehens.44
Fallbeispiel: Eine junge Frau wird von drei männlichen Mitschülern zu einem gemütlichen Beisammensitzen am Abend eingeladen. Nichts ahnend – da sie ihren Klassenkameraden vertraut – trifft sie sich mit ihnen an dem vereinbarten Ort. Noch bevor der jungen Frau die Gefährlichkeit der Situation klar ist, bieten ihr die Kollegen ein Gläschen Wein an, das die Frau unvorsichtigerweise trinkt. Die nächste Erinnerung skizziert die junge Frau ohne Kleidung auf dem Boden sitzend. Die drei Schulkameraden lachen sie an und bedanken sich bei ihr für die großartige Party. Sie zieht sich an, fährt zur Schule und besucht wie üblich den Unterricht, obwohl sie sich sehr schwach und müde fühlt. In den folgenden Tagen treten immer wieder Unterleibsschmerzen auf, das Einschlafen fällt ihr zunehmend schwerer. Sie kann kaum noch essen, es scheint, als würde jeder Bissen im Halse stecken bleiben. Erst Jahre später, während ihrer ersten Schwangerschaft, kommen Bruchfetzen von Erinnerungen hoch, die sie schwer belasten. Die junge Frau registriert erst jetzt, dass ihr damals bewusstseinstrübende Substanzen verabreicht wurden, um sie zu vergewaltigen.
2.1.2Kontrollverlust
Während des Vergewaltigungsgeschehens erleben Frauen sich als ohnmächtig und hilflos, weil ihnen jegliche Handlungsmöglichkeit genommen wurde, daher nur ein Aushalten-Müssen der Situation möglich ist. Dieser Verlust der Kontrolle über eigenes Handeln und Fühlen nährt zusätzlich Ohnmachts- und Demütigungsgefühle.
Nach der Tat klingt das Gefühl der Ohnmacht, das aus dem Kreislauf von Demütigung und Handlungsunfähigkeit entsteht, weiter nach und erzeugt in der betroffenen Frau einen Zustand des Schamgefühls. Entscheidend für diese Entstehung und Aufrechterhaltung der Scham ist vor allem der Gedanke, wie ihr Umfeld sie nach diesem Ereignis bewerten würde. Hat die Frau durch Sozialisationsprozesse in ihrer Kindheit schon früh die Erfahrung gemacht, dass der Frau die Rolle der hinterlistigen, bösen Verführerin zugeschrieben wurde, wird sie sich mit eben diesen negativen Affirmationen behandeln. Die Scham ist daher stets ein Ausdruck, wie die Person meint, von anderen beurteilt zu werden. Entscheidend ist dabei der Gedanke, dass Menschen aus ihrem Umfeld sie als (weibliche) Person abwerten für das Geschehene.
Neben diesen mentalen Belastungen sind ganz lebenspraktische Themen relevant für die betroffene Frau. So bestimmen nach Nikendei (2012) in Psychosoziale Notfallversorgung. Praxisbuch Krisenintervention insbesondere in den ersten Tagen nach dem Ereignis oft Ärzt_innen, Rechtsmediziner_innen und Polizist_innen das Geschehen, wenn Befragungen, Untersuchungen und Tatortbegehungen notwendig sind.45 Neben diesem Funktionieren-Müssen ringen Betroffene aber weiterhin um Kontrolle über ihren Körper und ihr Leben:
„Die Betroffenen machen die Erfahrung, dass sie die eigene Gestaltung der Situation aus den Händen geben müssen – aufgrund des eigenen Gelähmtseins und aufgrund der Erfordernisse, die sich für die beteiligten Einsatzkräfte ergeben. So bestimmen andere zwangsläufig und momentan über ihr Leben.“46
Das Gefühl des Gelähmt-Seins durch das Schreckensereignis erfordert oft professionelle Hilfe, wodurch das Gefühl des Fremdbestimmt-Seins aufgrund der Anwesenheit von Kriseninterventionsmitarbeiter_innen und Notfallseelsorger_innen zusätzlich befördert wird.
Der von den Frauen erlebte Kontrollverlust während der Tat, und unmittelbar danach in der Akut- und Anpassungsphase, wird, sofern diese Belastung nicht abgemildert werden kann, in der posttraumatischen Belastungsstörung chronisch. Die Selbstwahrnehmung der Betroffenen verändert sich dann dahingehend, dass sie sich selbst bei kleinsten Veränderungen ihrer Lebensumwelt als hilflos und wirkunfähig erfahren. Das Gefühl, selbst wenig Einfluss auf ihr Leben zu haben, verfolgt komplex traumatisierte Menschen häufig für den Rest ihres Lebens.47
Zudem führt die mit dem Kontrollverlust einhergehende Scham bei Betroffenen oft zu einer Bewertungsangst. So haben Menschen mit intensiven Erfahrungen von Ohnmacht und Demütigung „aufgrund von Schamgefühlen große Schwierigkeiten damit, sich anderen Menschen so zu zeigen, wie sie sind“48, weil sie sich „im Fall der Scham für einen schlechten Menschen und nicht nur für jemanden, der etwas Schlechtes getan hat“49 halten.
2.1.3Dissoziation
Neben den Akutreaktionen Orientierungslosigkeit und Kontrollverlust berichten viele Frauen auch von dissoziativen Zuständen, das sind Zustände, in welchen die Betroffenen Teile von sich selbst und/oder ihrer Wahrnehmung abspalten. Dissoziative Erscheinungsformen sind an Depersonalisierungs- und Derealisationszuständen erkennbar, die als Erstreaktion auf ein belastendes Ereignis auftreten.50 Von Depersonalisierung spricht Huber (2012) in ihrer Publikation Trauma und die Folgen, wenn Menschen Teile von sich selbst nicht vollständig wahrnehmen, beispielsweise „neben sich stehen“51 oder partiell schmerzunempfindlich sind. Derealisierung bezieht sich auf die Wahrnehmung der Umgebung, die beispielsweise akustisch nicht mehr erschlossen werden kann, obwohl die Sinnesorgane gesund sind.52
Fallbeispiel: Frauen mit dissoziativer Symptomatik berichten nach Vergewaltigung manchmal, dass sie während des Geschehens als Geist aus ihrem Körper herausgingen und sich selbst von oben betrachtet haben, um den Schmerz nicht fühlen zu müssen. Begleitet werden diese Prozesse häufig von den Worten „Das bin nicht ich, das passiert nicht mir …“. Manchmal beschreiben Frauen auch den Moment, in dem sie wieder in den Körper zurückkehren als besonders schmerzintensiv.
Auch nach der unmittelbaren Tat treten dissoziative Zustande auf, erkennbar für professionelle Hilfskräfte daran, dass die Frauen in Gesprächen manchmal, ohne es zu merken, in die dritte Person wechseln, wenn sie von dem Ereignis berichten. Sie beschreiben dann die Vergewaltigung als etwas, das einer anderen Frau passierte, und nicht ihr selbst. Sie formulieren Sätze wie „Sie ist dann dort gelegen…“ oder „…dann konnte sie sich an nichts mehr erinnern …“.
Wie genau eine Dissoziation entsteht, ist, wie Rothschild (2002) in Der Körper erinnert sich. Die Psychophysiologie des Traumas und der Traumabehandlung erläutert, bislang ungeklärt. Vermutet wird ein durch starken Stress ausgelöstes neurobiologisches Phänomen, das die Bewusstseinsebenen beeinflusst. Ob der Körper dieses Phänomen nutzt, um die Wirkung einer Vergewaltigung zu mildern, oder ob die Dissoziation als Sekundärreaktion auf ein extremes Stressereignis gesehen werden muss, konnte jedenfalls nicht befriedigend erklärt werden. Grob umrissen kann die Dissoziation als „eine Art Flucht des Geistes, die initiiert wird, wenn ein körperliches Entkommen nicht möglich ist“53 betrachtet werden.54
Kapfhammer (2011) thematisiert in Trauma und Erinnerung – Zur Psychopathologie des autobiographischen Gedächtnisses die Spannung zwischen verlorenem oder unvollständigen Zugriffsmöglichkeiten auf „zentrale Ausschnitte des autobiografischen Gedächtnisses in einer bewussten Erinnerung einerseits, und unwillentlicher intrusiver Erinnerung in der Form desorganisierter und oft nur schwer verbalisierbarer Erinnerungseindrücke andererseits“. Er betont, dass dieses Dilemma von Klient_innen häufig vorkommt im Zuge der Entwicklung einer schweren Posttraumatischen Belastungsstörung. Zudem gilt dieses Spannungsfeld der Betroffenen als Basis für kontroverse Diskussionen um die Begriffe der falschen (false memories) oder wiederentdeckten (recovered memories) Erinnerungen.55
Untersuchungen in diesem Zusammenhang legen jedenfalls nahe, dass Dissoziation ausschließlich bei extremer Stressbelastung, die durch schwere Misshandlung entsteht, auftritt, daher das Auftreten des Symptoms der Dissoziation während der Vergewaltigung, die sogenannte peritraumatische Dissoziation, positiv mit der Entstehung einer Posttraumatischen Belastungsstörung korreliert.56 Zudem ist die Neigung und Fähigkeit zur Dissoziation in Extremsituationen von Mensch zu Mensch unterschiedlich, sie wird daher von Psycholog_innen als Persönlichkeitsmerkmal bestimmt.57 Jedoch ist die Tendenz zur schwersten Form der Dissoziation, der dissoziativen Identitätsstörung, fast ausschließlich bei Opfern wiederholter sexualisierter Gewalt vorzufinden, denn hier entstehen nicht, wie bei einem einmaligen Schreckenserlebnis, lediglich „Risse in der Persönlichkeit“58, sondern Aufspaltungen der Persönlichkeit in unterschiedliche Persönlichkeitsanteile, die autonom agieren können.59 Bei der dissoziativen Identitätsstörung verselbstständigen sich also die geistigen Zustände („Das bin nicht ich. Das passiert nicht mir.“), die ursprünglich dabei behilflich waren, die Situation ertragen zu können.60





























