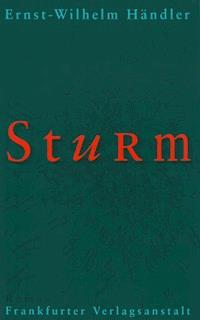9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Literatur kann dem Menschen zu Erkenntnissen verhelfen, die die Wissenschaften nicht liefern können. Insbesondere der Roman als umfassendste Literaturgattung eröffnet uns einen forschenden Blick auf uns selbst und die Gesellschaft. Zur Klärung der Frage, was der Roman für uns leisten kann, zieht Ernst-Wilhelm Händler Ideen und Begriffe aus der Systemtheorie, der Logik, Neurologie und Robotertechnik heran. In kompakter und hochkonzentrierter Form klärt er zunächst die Voraussetzungen des menschlichen Erkenntnisstrebens – Bewusstsein, Sprache, Erinnerung, Wahrnehmung und Gefühle –, um zu einer ganz eigenen, hoch inspirierenden Kulturtheorie zu finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 247
Ähnliche
Ernst-Wilhelm Händler
Versuch über den Roman als Erkenntnisinstrument
FISCHER E-Books
Inhalt
Vorbemerkungen
Literatur generiert Erkenntnis, die Wissenschaft nicht produzieren kann. Die Erkenntnisse, die Prosa und Dichtung ermöglichen, sind für die menschliche Existenz nicht weniger wichtig als diejenigen, die von den Wissenschaften geliefert werden. Hier wird der grundsätzliche Versuch unternommen, den Roman als Erkenntnisinstrument zu positionieren. Es geht nicht darum, wie ein Roman gemacht wird oder gemacht werden soll, und auch nicht um die Geschichte und Entwicklung des Romans. Dies ist weder eine Eigenpoetik noch eine literaturwissenschaftliche Untersuchung. Es wird auch keine Typologie vorgeschlagen.
Die Naturwissenschaften sind in bestimmten Bereichen so erfolgreich, weil man dort in der Lage ist, Einflussfaktoren zu isolieren und zu standardisieren. Für die isolierten Größen können dann möglicherweise Gesetzmäßigkeiten formuliert werden. Den Inhalten des Einzelbewusstseins und den gesellschaftlichen Ideen ist dagegen gemeinsam: Sie sind jeweils untereinander nicht strikt abgrenzbar. Niemand kann verlässlich angeben, ob sich zwei Personen denselben Gegenstand vorstellen, ob sie das gleiche Gefühl haben. Verwandtes gilt für die in der Gesellschaft kursierenden Ideen. Der Fall, dass sich alle darüber einig sind, wo genau sich etwa zwei philosophische Begriffe überschneiden und wo nicht, stellt die seltene Ausnahme dar.
Die Agenten der Erkenntnis sind der Einzelne und die Gesellschaft. Die Gesellschaft ist ohne Einzelne nicht denkbar, aber sie besteht nicht notwendigerweise aus Einzelnen. Weiter muss der Status der Gesellschaft und derjenige des Einzelnen für den gegenwärtigen Zweck nicht geklärt werden. In jedem Fall werden der Einzelne und die Gesellschaft als gleichgeordnete Entitäten behandelt.
Für den und im Roman spielen Bewusstseinsinhalte Einzelner einerseits und andererseits Ideen, die in der Gesellschaft kursieren, eine herausragende Rolle. Kognitionen und Gefühle bilden den Inhalt des Einzelbewusstseins. Die meisten Bewusstseinsinhalte haben sowohl einen kognitiven als auch einen Gefühlsanteil, sie lassen sich in einem Kontinuum mit den Endpunkten Gefühl und Kognition verorten.
Der Einzelne wie auch die Gesellschaft ist darauf angewiesen, irgendeine Form von Ordnung in die Bewusstseinsinhalte beziehungsweise die gesellschaftlichen Ideen zu bringen und deren Wandel zu managen. Weil es nicht möglich ist, Bewusstseinsinhalte und gesellschaftliche Ideen hinreichend zu isolieren und zu standardisieren, kann dies auf keinen Fall nach dem Vorbild der klassischen Naturwissenschaft geschehen. Die Kommunikation zwischen den Einzelnen und in der Gesellschaft muss nach naturwissenschaftlichen Maßstäben immer in hohem Maß unscharf sein. Der Ansatzpunkt der Literatur für die Ordnung von Bewusstseinsinhalten und gesellschaftlichen Ideen ist die Lebenssituation des Einzelnen. Die innere Lebenssituation umfasst den biologischen Zustand des Einzelnen und die jeweils damit verbundenen Gefühle und Kognitionen. Die äußere Lebenssituation ist ein Ausschnitt aus der gemeinsamen Wirklichkeit, welche die Mitglieder einer Gesellschaft durch ihre aufeinander bezogenen Handlungen erzeugen. Der Roman nimmt immer die Lebenssituation des Einzelnen als Ausgangspunkt. Er verbindet die innere mit der äußeren Lebenssituation. Auf diese Weise bildet er eine wichtige Schnittstelle zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft: Wie keine andere Form bezieht sich der Roman auf die Lebenssituation des Einzelnen und auf die Situation der Gesellschaft, indem er beide in ihr Recht setzt.
Der Unterschied zwischen dem Roman und wissenschaftlichen Darstellungen liegt nicht etwa darin, dass der Roman etwas erfinden würde, was es nicht gibt, wogegen wissenschaftliche Theorien lediglich anführen, was es gibt oder geben wird. Nicht nur konkurrierende wissenschaftliche Theorien widersprechen sich oft genug in ihren Grundannahmen, so dass nach der einen Theorie genau das existiert, was es nach der anderen Theorie nicht geben darf. Der Unterschied hat auch nichts mit dem Gegenstandsbereich zu tun. Alles, womit sich Wissenschaft beschäftigt, kann im Roman vorkommen. Der entscheidende Unterschied liegt in der Art der Verknüpfung, genau: im Gefühl. Gefühle sind Gegenstand von Wissenschaft, aber sie sind weder Methode noch Kriterium für die Auswahl von Untersuchungsgegenständen und für die Verknüpfung von wissenschaftlichen Inhalten. Ganz anders der Roman, der immer von einer Lebenssituation ausgeht: Gefühle kommen im Roman nicht nur vor, sie organisieren den Roman.
Diese Betrachtung steht unter dem Leitgedanken: Ein Roman ist ein Transportmittel für Handlungsmöglichkeiten. Sprechen und Schreiben heißt handeln. Sprache ist keine mehr oder weniger gelungene Verknüpfung von Namen. Einen Gegenstand mit einem Namen zu belegen, einen Namen anzuführen, das sind nur zwei spezifische sprachliche Handlungsmöglichkeiten. Die Sprache, insbesondere die der Literatur, birgt so unendlich viel mehr Handlungsmöglichkeiten, als nur jeweils ein bestimmtes Wort mit einem bestimmten Gegenstand zu verbinden.
Der Roman ist die umfassendste Literaturgattung. Ein Roman kann eine Novelle, ein Gedicht oder eine dramatische Szene enthalten. Eine Novelle, ein Gedicht, ein Theaterstück kann keinen Roman enthalten. Vieles, was über den Roman zu sagen ist, gilt deshalb für die Literatur insgesamt. Es geht hier auch nicht darum, den Roman von dem, was nicht Roman ist, abzugrenzen, die spezifischen Unterschiede zwischen dem Roman und anderen literarischen Gattungen herauszuarbeiten. Wer Ort und Funktion des Romans bestimmt, positioniert immer auch die Literatur als Ganzes.
Einen stringenten Zusammenhang zwischen dem Roman und dem Einzelnen einerseits und zwischen dem Roman und der Gesellschaft andererseits herzustellen bedeutet automatisch, die Gesellschaft und den Einzelnen zu konstruieren. Wobei die Konstruktion natürlich mit erheblichen Freiheitsgraden erfolgt. In diesem Sinn ist die nachstehende Betrachtung auch eine Kulturtheorie, in der besonderen Ausprägung einer literarisch verfassten Kulturtheorie.
1. Sprache
Die engere Umwelt des Romans ist die Sprache, in der er geschrieben ist. Die Sprache, die der Einzelne spricht, beeinflusst seine kognitiven Operationen genauso wie seine emotionalen Reaktionen. Gesellschaft in einem anspruchsvollen Sinn ist ohne Sprache nicht denkbar. Es ist nicht möglich, den räumlichen und zeitlichen Zusammenhang der Gesellschaft ohne Sprache zu begründen.
Die modernen Neurowissenschaften legen nahe, dass es im menschlichen Körper für die kognitiven und die Gefühlsprozesse verschiedene Schaltkreise gibt. Der Begriff Schaltkreis dient dabei lediglich als unzureichende Metapher für das im Kern ungeklärte Verhältnis zwischen der biologischen Hardware und dem, was sie beobachtbar leistet. Das Wissen über das Zusammenspiel der kognitiven und emotionalen Schaltkreise ist spärlich, Vermutungen dominieren das Feld. Weder über den Zusammenhang zwischen Sprache und kognitiven Operationen noch über das Verhältnis der Sprache zum Gefühlsbereich existieren mitreißende experimentelle Ergebnisse. Beim Hören von bestimmten emotional aufgeladenen Wörtern lassen sich Aktivitäten in bestimmten Gehirnarealen nachweisen, und es gibt etwa Hinweise, dass Sprecher unterschiedlicher Sprachen Farben unterschiedlich wahrnehmen.
Spannender wird es, wenn man Zusammenhänge zwischen Sprache und Gesellschaft untersucht. So existiert zum Beispiel eine deutliche inverse Korrelation zwischen der Komplexität der Gesellschaft und derjenigen der inneren Struktur von Wörtern: Je einfacher, je weniger differenziert die Gesellschaft, desto mehr abgrenzbare und im Prinzip voneinander unabhängige Informationen vermittelt das einzelne Wort, je komplizierter die Gesellschaft, desto mehr wird das einzelne Wort zum Etikett. Im ersten Fall spielt die Zusammensetzung des Wortes eine entscheidende Rolle, im zweiten Fall ist sie nicht mehr wichtig. In einfacheren Gesellschaften ist für zwei Sprachbenutzer die Wahrscheinlichkeit eines gemeinsamen Vorwissens groß, sie können sich darauf beziehen und sich kurz fassen. Entsprechende verweisende Ausdrücke verschmelzen und werden zu Wortbestandteilen, auf diese Weise werden im einzelnen Wort mehr verweisende Informationen untergebracht. In komplexeren, stärker differenzierten Gesellschaften ist die Schnittmenge des Vorwissens zweier Sprachbenutzer geringer, die mitzuteilende Information muss extensiver, durch Benutzung einer größeren Anzahl von Wörtern und unter Verzicht auf unverständliche Verweise, entwickelt werden.
Der überwiegende Teil der Sprachphilosophie von den Ursprüngen bis in die jüngere Gegenwart hinein fasst die Sprache als eine kognitive Großstruktur auf, die dem Einzelnen übergeordnet ist und die über das in ihr verkörperte Wissen und über von ihr generierte konventionelle Praktiken den Zusammenhang der Gesellschaft stiftet. Die Möglichkeit eines präverbalen Denkens wird verworfen, es gebe kein Denken ohne private oder öffentliche Sprache. Das Bewusstsein des Menschen sei sprachlich strukturiert. Ohne sprachliche Artikulation gebe es auch keine Moral. Eine Trennung zwischen Sprache und Denken sei nicht wirklich vorstellbar.
Der Ursprung der kognitiven Großstruktur Sprache wird entweder als natürlich oder als transzendent gesehen. Bei Beschränkung auf die Immanenz entsteht Sprache evolutionär, in Analogie zur Entwicklung der biologischen Attribute des Menschen in einem darwinistischen Prozess. Der literarisch interessantere Fall ist natürlich die Transzendenz. Die theologische Variante betrachtet die Sprache als Geschenk Gottes. Das Schlüsselwort in diesem Zusammenhang ist logos. Die Sprache sei aus dem Wort Gottes hervorgegangen, alle logischen sowie grammatischen Operationen und das Denken überhaupt verdankten sich allein diesem Ursprung. Selbst das einfachste sprachliche Artefakt sei göttlicher Natur. In den nichttheologischen Varianten wird zwar Gott geleugnet, aber es bleibt bei seinen geheimnisumwehten Wirkungen.
Sind die säkularisierten Menschen frei, über das Geschenk aus der Transzendenz zu verfügen? Selbst die Aufklärer und ihre unmittelbaren Nachfolger verteidigten noch glühend den transzendenten Ursprung der Sprache: Zuerst war der logos und dann der Mensch. Aber sie sahen die Sprache auch als Ressource, als das universale Werkzeug der Erkenntnis. Die Sprache ermögliche es dem Menschen, Künste und Wissenschaften hervorzubringen und auf diese Weise seine Stellung im Universum zu definieren. Ein breiter Strang der Sprachphilosophie und der Literatur über Literatur – nicht zuletzt Gott selbst – verneint jedoch die Möglichkeit, dass der Mensch die Sprache als Werkzeug benutzen kann. Der Mensch sei nicht Herr der Sprache, sondern ihr Diener. Nicht der Mensch spreche die Sprache, die Sprache spreche den Menschen. Die Poesie, die Rede von Gott und von allem, was jenseits unserer Existenz ist, und als Spätkommender auch der Roman, seien nicht Früchte einer menschlichen Fähigkeit oder Fertigkeit, die darin bestünde, die Sprache zu beherrschen. Dergleichen anzunehmen wäre pure Hybris. Vielmehr regiere die Sprache den Menschen. Sie wähle einzelne Menschen aus, deren Privileg es sei, ein Sklavendasein zu führen: Der Seher, der Dichter, als neuzeitliche Kombination aus beiden auch der Romancier führe das aus, was ihm die von Gott gegebene Sprache sage.
Gemäß dem Meister aus Deutschland ist allein der Mensch in der Lage, das Problem des Seins anzugehen. Der Philosoph verlangte, dass sich der Mensch bedingungslos der Sprache unterwerfe. Geschehe das nicht, gerate die unüberbrückbare Differenz zwischen Sein und Dasein, zwischen Essenz und Existenz, in Vergessenheit. Diese Seinsvergessenheit habe zu zahllosen Irrtümern geführt, darunter als die schwerwiegendsten sowohl der Humanismus als auch die Wissenschaftsgläubigkeit. Wenn sich der Mensch der Sprache nicht verweigere, höre er, wie aus ihr das Sein selbst spreche. Wahrheit ist die Selbstaussage des Seins, alêtheia. In der Gestalt des logos begegne das Sein dem Menschen und enthülle sich ihm. Diese Enthüllung sei jedoch eine so radikale, dass sie zugleich auch wieder ein Verbergen darstelle. Der Mensch sei der Hüter des logos, er höre auf ihn. Der Mensch ist nur, wenn er sich in Passivität der Ankunft der Sprache öffnet, wenn er sich aufnahmebereit der Lichtung des Seins stellt. Die Worte der poetischen Rede können jeweils nur diese und niemals andere sein, genau wie ihre Aneinanderreihung nur so und niemals anders geschehen kann. Wie die Sprache insgesamt ein Geschenk an den Menschen sei, stellten die Worte der poetischen Rede ein Geschenk an den Dichter dar. Nicht der Dichter spreche, er werde von der Sprache gesprochen. Die Sprache spreche, immer und allein sie.
Der zur selben Zeit in England erfolgreiche österreichische Transzendenzphilosoph benutzte hingegen keine ungewöhnlichen Komposita, auf sein Konto gehen auch keine Neologismen. Weil sein Begriff von logos zunächst die Logik war, später revozierte er, wurde er zu Unrecht als analytischer Philosoph geführt. Dabei klagte er, alles, was er besitze, sei Prosa, die zu einem bestimmten Punkt gelange. Das Ideal seiner Sprache war eingestanden dasjenige der Dichtung. Wäre es praktizierbar gewesen, hätte er seine Untersuchungen Gott gewidmet. Den Teil seines Werkes, den er nicht geschrieben hatte, betrachtete er als den wichtigeren. Ihn trieb die Frage um: Kann der Mensch so leben, dass das Leben aufhört, problematisch zu sein? Dass er im Ewigen lebt und nicht in der Zeit? Aber er betrachtete diesen Wunsch nach gottgleicher Teilhabe am Unendlichen, an der Ewigkeit, auch als den eigentlichen Sündenfall. Der Wünschende musste dafür abzählbar unendlich oft bestraft werden. Als Dienerin einer Transzendenz, die sie niemals erfassen kann, sollte die Philosophie für die Bestrafung sorgen, indem sie dem Menschen per Analyse zuerst künstlicher Sprachen und später der Umgangssprache die Endlichkeit seiner Welt aufweist: dass die Grenzen seiner Sprache die Grenzen seiner Welt bedeuten.
Derselbe Philosoph hat ein gänzlich nicht-analytisches Bild für die Sprache vorgeschlagen: Man solle die Sprache ansehen als eine alte Stadt, ein Gewinkel von Gässchen und Plätzen, alten und neuen Häusern sowie solchen mit Zubauten aus verschiedenen Zeiten, umgeben von einer Menge neuer Vororte mit geraden und regelmäßigen Straßen und mit einförmigen Häusern. Die Sprachbenutzer wohnten in ihrer Sprache, einer neben dem anderen, getrennt durch tragende oder nichttragende Wände, von denen keiner angeben könne, wer sie errichtet hat.
Der Meister aus Deutschland und sein Pendant aus Österreich haben die Grenzen der Sprache behauptet, aber nicht markiert. Das ist wohl auch nicht möglich. Die Sprache zieht Grenzen, aber es scheint keine Grenzen für die Art und Weise zu geben, wie sie das durchführt. So können etwa räumliche Relationen durch ein egozentrisches oder durch ein geographisches Koordinatensystem ausgedrückt werden. Egozentrische Koordinaten hängen vom Körper des Sprachbenutzers ab, das Koordinatensystem bewegt sich mit dem Sprecher. Das geographische Koordinatensystem verwendet die Himmelsrichtungen und ist unabhängig vom Sprecher. Sprachen nicht-technischer Gesellschaften verwenden häufig ausschließlich oder schwerpunktmäßig das eine oder das andere Koordinatensystem. In den Sprachen moderner, technikbasierter Gesellschaften hat der Sprachbenutzer die Wahl. Es ist kein Zwang wirksam, sich auf ein bestimmtes Koordinatensystem festzulegen. Nur die ultimative Festlegung auf ein bestimmtes Koordinatensystem würde eine Grenze bedeuten.
In Zeiten, zu denen keine oder sehr beschränkte Aufzeichnungsmöglichkeiten existierten, verkörperten die Sprachen, so wie sie gesprochen wurden, tatsächlich einen großen Anteil des Weltwissens. Aber diese Zeiten waren schon lange vorbei, als die Philosophen die Sprache als transzendente Baulichkeit träumten. Die Sprache ist keine kognitive Großstruktur, die nur an der Oberfläche veränderlich wäre. Die Philosophen würden so gern ewig leben. Aber die Ewigkeit ist nicht durch den Trick zu haben, Sprache mit Ewigkeit gleichzusetzen und dann in der Sprache Wohnung zu nehmen. Verfasser von Romanen und Gedichten sind gleichfalls nicht Hausbesitzer oder Mieter im Zentrum oder der Banlieue einer transzendenten Stadt. Das Bild einer steinernen Gegenwart, die sich unübersehbar aus der Vergangenheit unabsehbar in die Zukunft erstreckt, mutet mittlerweile wie Fantasy an.
Es sieht so aus, als könne man in den modernen Sprachen so ziemlich alles ausdrücken, was man will. Man muss es nur wollen. Die Linguistik zeigt auf: Die verschiedenen Sprachen unterscheiden sich weniger durch die Informationen, die der Benutzer vermitteln kann, als durch die Informationen, die er im Korsett seiner Sprache übermitteln muss. Wenn ein Amerikaner berichtet: I was hangin’ out with a friend, dann bleibt bekanntlich erst einmal offen, ob er in männlicher oder weiblicher Begleitung war. Der Deutsche muss in derselben Situation sofort kundtun, ob er mit einem Freund oder mit einer Freundin ausging. Insofern die Sprache den Benutzer zwingt, grundsätzlich bestimmte Eigenschaften der Welt vermehrt und andere vermindert zu artikulieren, übt das natürlich Einfluss auf Denkgewohnheiten und damit auf Wahrnehmung und Erinnerung aus. Aber es werden keine Grenzen gezogen, denen man sich nur von einer Seite nähern und die man nicht überschreiten kann.
Sprachliche Artefakte beziehen sich auf etwas: auf Außersprachliches und auf andere sprachliche Artefakte. Wie bezieht sich ein sprachliches Artefakt auf Außersprachliches? Kann man überhaupt sinnvoll behaupten, dass sich ein sprachliches Artefakt auf Außersprachliches bezieht? Die Linguisten sprechen in diesem Zusammenhang vom symbol grounding problem.
Kein Entwicklungspsychologe kann angeben, warum die Phase des Spracherwerbs mit ungefähr zwölf Monaten beginnt und nicht mit sechs Monaten oder drei Jahren. Wenn sich ein Kind eine Sprache aneignet, muss es lernen, mit den sprachlichen Artefakten etwas zu verbinden. Ein Kind in diesem Alter hat naturgemäß zunächst keine Möglichkeit, etwa Überlegungen anzustellen und abzuwägen, wer was warum sagen will und worauf genau der in Frage stehende Ausdruck Bezug nimmt. Das würde die kognitiven Fähigkeiten in dieser Entwicklungsphase weit übersteigen. In der gegebenen Situation ist es nützlich, davon auszugehen, dass sprachliche Artefakte direkt auf Dinge und Vorgänge in der Welt zeigen. Die Annahme, dass sprachliche Artefakte Bestandteile der Welt bezeichnen, ist nichts weiter als eine Heuristik, ohne die sich die kognitive Ausstattung des Menschen nicht formieren kann. Die Konzeption des Bezeichnens ist tief in den Anfängen der kognitiven Entwicklung des Einzelnen verankert. Die Art und Weise, wie sich diese Entwicklung vollzogen hat, wird jedoch regelmäßig aus dem Gedächtnis des Einzelnen getilgt. Dieses Vergessen ist dafür verantwortlich, dass Menschen Namen und Worten gern magische Eigenschaften zugeschrieben und die Sprache insgesamt als transzendente Schöpfung betrachtet haben.
Der Prozess des Spracherwerbs ist erstaunlich robust. Dabei ist die Verbindung zwischen der akustischen beziehungsweise optischen Gestalt eines sprachlichen Artefakts und dem, worauf es sich bezieht, bis auf wenige Ausnahmen höchst arbiträr. Empirische Untersuchungen haben gezeigt: Kinder lernen Wörter auch ohne das strikt gleichzeitige Auftreten von Wort und Bezug. Insbesondere ist es keineswegs unerlässlich, den Bezug eines Wortes gezielt hervorzuheben, etwa auf einen Gegenstand zu zeigen. Kinder isolieren den Bezug eines Wortes zum Beispiel aus einer Anweisung. Oft können sie den Bezug eines Wortes nach einmaligem Hören korrekt ausmachen und im Gedächtnis speichern. Der Gebrauch der neu erlernten Wörter muss nicht notwendigerweise gezielt korrigiert werden, es gibt Gesellschaften, in denen die Erwachsenen die Kinder so gut wie nie sprachlich verbessern, trotzdem verhalten sich die Heranwachsenden sprachlich korrekt. Auch ist nicht der uneingeschränkte Gebrauch aller Sinne notwendig, um Sprache zu erlernen. Das Sprachverhalten blinder Dreijähriger unterscheidet sich nicht wesentlich von demjenigen Gleichaltriger mit einem günstigeren Schicksal.
Ein Kind, das einen Ausdruck zum ersten Mal hört, muss sich sowohl dessen Struktur als auch dessen Bezug merken. Dabei geht das Kind natürlich nicht alle in der Situation grundsätzlich denkbaren Möglichkeiten durch. Die Möglichkeiten werden wirkungsvoll eingeschränkt durch weitere heuristische Annahmen. Die erste und wichtigste ist die whole object assumption: Die Umgebung wird eingeteilt in Dinge. Hervorspringende, Aufmerksamkeit heischende Teile der Umgebung werden jeweils als ein Ding betrachtet. Damit etwas für einen Säugling beziehungsweise für ein Kleinkind ein Objekt ist, müssen vier Bedingungen erfüllt sein:
Kohäsion: Eine verbundene und begrenzte Ansammlung von Materie bleibt verbunden, wenn sie in Bewegung ist.
Kontinuität: Die Materieansammlung bewegt sich stetig durch Zeit und Raum, sie verschwindet nicht an einem Punkt und taucht an einem anderen unvermutet wieder auf.
Solidität: Zwei Objekte durchdringen sich nicht gegenseitig.
Kontakt: Unbelebte Objekte bewegen sich nur, wenn sie berührt und bewegt werden.
Natürlich gibt es jede Menge Begriffe, die nicht als Objekte im definierten Sinn aufgefasst werden können. Mit diesen einfachen, aber auch mit komplexeren empirischen Erkenntnissen über den Spracherwerb wird das symbol grounding problem freilich nicht gelöst.
Insoweit die Sprache auf etwas verweist, erzeugt sie zu einem bestimmten Zeitpunkt jeweils einen bestimmten morphologischen Raum: Dieser enthält die Menge aller möglichen Gegenstände und Vorgänge, auf die sich ein Benutzer zu einem bestimmten Zeitpunkt mittels der Sprache zu beziehen in der Lage ist. Die Verweisung variiert gemäß unendlich vieler Kategorien, sie kann alltagssprachlich, fachsprachlich oder nach irgendeinem Maßstab poetisch ausgeführt sein. Der Möglichkeitsraum kann auf verschiedene, äquivalente Weisen aufgespannt werden, die prominentesten Alternativen sind die Einteilung nach Gegenständen und Vorgängen einerseits und die Ordnung in komplette mögliche Welten andererseits. Wenn nur ein Gegenstand oder ein Vorgang anders ist, hat man bereits zwei mögliche Welten, betrachtet man einen ausgesuchten Gegenstand oder Vorgang, dann kann man ihn durch die Gesamtheit der möglichen Welten beschreiben, denen dieser Gegenstand oder Vorgang gemeinsam ist.
Der morphologische Raum einer Sprache ist die Gesamtheit aller möglichen Welten, auf die sich die Sprache beziehen kann. Im morphologischen Raum sind die Stellen unabhängig davon definiert, ob sie ausgefüllt werden oder nicht. Eine Leerstelle ist ausgefüllt, wenn ein sprachliches Artefakt geäußert wird, das sich auf die Leerstelle bezieht. Die Ausfüllung einer Stelle im morphologischen Raum bedeutet keineswegs automatisch, dass der entsprechende Gegenstand oder Vorgang in irgendeinem Sinn als real qualifiziert wird. Eine wissenschaftliche Theorie bezieht sich auf eine Menge möglicher Welten, und zwar auf diejenigen, in denen die wissenschaftliche Theorie gilt. Die Bezugnahme ist mit der Behauptung verbunden, dass sich unter diesen wirkliche Welten befinden. Ein Roman wählt eine mögliche Welt oder vielmehr eine Menge von möglichen Welten aus, die mit dem Roman vereinbar sind. Durch das korrespondierende sprachliche Artefakt wird die Welt, auf die sich der Roman bezieht, nicht wirklich. Aber alle mit ihm vereinbaren Welten werden herausgehoben, gegenüber anderen Welten ausgezeichnet.
Die Sprache erschöpft sich nicht in der Bezugnahme auf Gegenstände und Vorgänge, die bereits existieren. Eine gleichberechtigte Funktion der Sprache besteht darin, Gegenstände und Vorgänge ins Leben zu rufen, die es ohne Sprache nicht geben kann. Die Sprechakttheorie untersucht sprachliche Äußerungen, die unmittelbar bestimmte, von der Gesellschaft gewollte Beziehungen zwischen den beteiligten Einzelnen stiften. Befehle, Versprechen und Warnungen sind sprachliche Handlungen, die gezielt andere Handlungen hervorrufen sollen. Auf diese Weise erschafft Sprache Sachverhalte, die ohne Sprache nicht existieren würden.
Die Sprache ist keine starre Großstruktur, sondern ein Befehlsmenü. Jeder Einzelne kann über das Befehlsmenü verfügen, dessen Zweck darin besteht, zu einem anderen Einzelnen ohne körperliche Berührung Verbindung aufzunehmen und sie zu halten oder wieder abzubrechen. Alle sprachlichen Artefakte, nicht nur diejenigen, die unverzichtbare Bestandteile von Sprechakten sind, bilden potentiell Glieder von Handlungszusammenhängen. Sprechen ist grundsätzlich Handeln, auch wenn kein Sprechakt im engeren Sinn beabsichtigt ist.
2. Evolution
Die biologische Evolution folgt keinem Plan. Ihr Verfahren ist denkbar einfach: Eine Entität, die zu einem bestimmten Zeitpunkt existiert, die übrig geblieben ist, verändert sich. Die Naturgesetze und die Ausgangsbedingungen legen deterministisch die Änderung oder stochastisch die Menge der möglichen Änderungen fest. Dann kommt es zu einer Verzweigung: Die neue Entität bleibt übrig oder nicht, sie existiert eine Zeitlang weiter oder nicht. Existieren bedeutet für einen biologischen Organismus immer das Verbrauchen von Energie. Ob die Entität übrig bleibt, hängt von den Ressourcen ab, auf die die Entität angewiesen ist, und von der Art und Weise, wie die Entität die Ressourcen nützt. Somit auch davon, ob andere Entitäten ebenfalls auf diese Ressourcen zugreifen. Die biologische Evolution ist die logische Folge von bestimmten Regelmäßigkeiten des Geschehens im Universum, insbesondere von Naturgesetzen, und der Tatsache, dass überhaupt etwas existiert. Das ist alles.
Das Argument gegen die biologische Evolutionstheorie ist immer ein Wahrscheinlichkeitsargument: Die Wahrscheinlichkeiten dafür, dass sich selbst reproduzierende Lebensformen spontan auf der Erde entstanden seien und dass sich aus diesen durch Mutation und Selektion die jetzt lebenden Organismen gebildet hätten, seien nach den bekannten physikalischen und chemischen Gesetzen zu gering. Das Problem dieser Betrachtungsweise ist, dass sie sich im Leeren abspielt. Die bekannten Naturgesetze liefern zumindest einen Maßstab für Wahrscheinlichkeiten. Aber wer sollte die Wahrscheinlichkeit für intelligent design, für einen Schöpfergott festlegen? Welche wären die alternativen Gesetze – es müssten ja keineswegs Naturgesetze sein –, die den Entwicklungspfad des Lebens auf der Erde wahrscheinlicher machten? Regelmäßigkeiten im Geschehen des Universums müssen nicht unbedingt mit hohen Wahrscheinlichkeiten verbunden sein. Außerdem spielen isolierte Ex-post-Wahrscheinlichkeiten für den Menschen in der Regel keine Rolle. Der Lottogewinner muss sein Leben mit Lottogewinn meistern, nicht ohne.
Dabei ist die Beschreibung der biologischen Evolution als struggle for survival schlichtweg falsch, die Rede von survival of the fittest höchst irreführend. Nur die allerwenigsten Lebensformen haben die Möglichkeit, gegen irgendetwas oder irgendjemanden zu kämpfen. Stattdessen konkurrieren die biologischen Entitäten in einer bestimmten Umgebung um Ressourcen. Lediglich im Ausnahmefall nehmen die Entitäten diese Wettbewerbssituation überhaupt wahr und wissen um ihr mögliches eigenes Ende. Die überwiegende Anzahl der biologischen Entitäten besteht nicht aus Sportlern, die gegen Konkurrenten Wettbewerbe gewinnen wollen, oder aus Kaufleuten, die zahlungsfähig bleiben müssen. Wo kein Bewusstsein des möglichen eigenen Endes besteht, suggeriert die Wettbewerbsmetapher außerdem fälschlicherweise einen Betrachter, der einen God’s eye point of view einnimmt und einen Plan sieht, den es niemals gab und niemals geben wird.
Lebendes Gewebe muss sich in einem bestimmten physiologischen Zustand befinden, damit es überlebt. Ein Zustand außerhalb des homöostatischen Bereichs von längerer Dauer führt unweigerlich dazu, dass das Gewebe abstirbt. Abweichungen vom Homöostasebereich müssen registriert und korrigiert werden, wenn das Gewebe überleben soll. Bei einfachen Organismen geschieht dies über elementare chemische Regelkreise. Bei höher entwickelten Organismen werden die Abweichungen im Gehirn registriert und gemessen. Die Abweichungen setzen dann im Gehirn Korrekturmechanismen der verschiedensten Art und Fristigkeit in Gang. Die Gehirne der am höchsten entwickelten Organismen verfügen über ein Gedächtnis, das die entsprechenden Abläufe aufzeichnet. Auf dieser Basis können auch Voraussagen über zukünftige Verhältnisse gebildet werden. Alles, was die Homöostase fördert, verlängert die Existenz, ermöglicht Überleben. Die Biologen sprechen vom biologischen Wert.
In einem Gehirn, das über ein Gedächtnis für innere und äußere Zustände verfügt, das möglicherweise die Kriterien für Bewusstsein erfüllt, sind den Parametern des Homöostasebereichs Empfindungen, Erlebnisse von Gefühlen zugeordnet: Optimale Bereiche der Homöostase sind mit angenehmen Gefühlen wie Freude und Befriedigung assoziiert, gefährliche Bereiche mit unangenehmen Gefühlen wie Unwohlsein, Schrecken, Schmerz. Das Gefühl Gleichgültigkeit signalisiert eine Homöostase im neutralen Bereich. Wenn die Gleichgültigkeit zu weit geht, ist sie Symptom einer Depression. Diese Gefühle sind gewissermaßen Barometerstände des inneren und äußeren Wetters. Hochentwickelte Gehirne gewährleisten die Homöostase ihrer Träger ganz wesentlich mit Hilfe eines komplexen Zusammenspiels von Trieben und Motivationen.
Komplexere biologische Organismen schließen sich häufig zusammen. Unter bestimmten Bedingungen bleibt der entstandene Verbund eher übrig als die einzelnen Einheiten, aus denen er zusammengesetzt ist. Der primäre evolutionäre Vorteil von Sprache besteht nicht darin, dass ihre Erzeugnisse sich auf etwas beziehen, was es gibt oder nicht gibt. Sprache ermöglicht die unkörperliche Verbindung zwischen ihren Benutzern.
Der Begriff des biologischen Wertes ist sinnvoll nur anwendbar auf eine existierende biologische Entität, wobei es keine Rolle spielt, wie komplex diese ist. Der biologische Wert kann keinen Beitrag leisten, wenn es darum geht zu erklären, warum sich neue Einheiten bilden oder warum sich bestehende Einheiten zu neuen zusammenschließen.
Das, worauf sprachliche Artefakte verweisen, und die Art, wie sie verweisen, muss sich einem Ziel unterordnen: Die Einzelnen müssen genügend viele Verbindungen miteinander halten, damit von einer Gesellschaft die Rede sein kann. Indem die Einzelnen sprachliche Artefakte verwenden, werden diese zu Elementen des Handlungsgeflechtes zwischen den Einzelnen. Zuerst kommt die Verbindung zwischen den Sprechern, dann der Bezug der sprachlichen Artefakte. Diese Priorität ist experimentell eindrucksvoll bestätigt: Der Versuchsleiter lässt ein achtzehn Monate altes Kind mit einem Objekt spielen, ein anderes Objekt hat er vor sich gelegt. Während das Kind auf das Objekt blickt, mit dem es spielt, richtet der Versuchsleiter seinen Blick auf das Objekt vor sich und sagt ein neues, ein Phantasiewort. Das Kind sieht nicht mehr das Objekt an, mit dem es gespielt hat, sondern den Versuchsleiter und das Objekt, das dieser fixiert. Später zeigt der Versuchsleiter dem Kind beide Objekte und fragt, welches Objekt dasjenige ist, das er mit dem Phantasiewort belegt hat. Das Kind weist auf das Objekt, das der Versuchsleiter fixierte, während er das Phantasiewort aussprach, nicht auf das Objekt, das es selbst in diesem Moment anblickte.
Die Sprachbenutzer verhalten sich und handeln, immer. Die Sprache handelt nicht und verhält sich nicht. Die Benutzer verweisen und befehlen, indem sie sich sprachlich äußern. Die Sprache verweist nicht und befiehlt nicht. Die Sprache strukturiert weder Raum noch Zeit oder irgendetwas, auch nicht ihren eigenen Möglichkeitsraum. Insofern die Sprache auf etwas verweist, sind es immer die Benutzer, die den Möglichkeitsraum strukturieren und ihn durch Markierungen der verschiedensten Art erschließen.
Wenn der Körper eines Einzelnen in irgendeiner Form mit der Welt zu tun bekommt, hinterlässt das Spuren: Der äußere beziehungsweise der innere Zustand des Körpers ändert sich, je nachdem, auf welche Weise der Körper mit der Welt zu tun hat. Ein Teil des inneren Zustands bezieht sich auf die Wechselwirkung mit der Umwelt, hält diese fest. Der innere Zustand des Körpers wird durch das Gehirn verwaltet.
Das menschliche Gehirn erzeugt unablässig Kombinationen von Sinnesempfindungen und von konkreten und abstrakten Gedanken zu Vorstellungen, um sich selbst zu informieren. Es gibt keinen Sammelbegriff, welcher der Vielfalt der Hervorbringungen des Gehirns gerecht würde. Die Neurowissenschaftler sprechen hier gern von Karten. Der Begriff ist unbefriedigend, das Gehirn ist kein Zeichner, und es gehört nicht zum üblichen Begriffsinhalt, dass sich die Karte permanent ändert. Aber der Vorteil der Karten-Metapher besteht darin, dass sie nur eine geringfügige philosophische Vorbelastung aufweist. Alles, was sich außerhalb des Gehirns befindet, wird erfasst: die Zustände des eigenen Körpers und seiner Organe als Befindlichkeiten, die Außenwelt mit allen Objekten, so wie sie die Sinnesorgane wahrnehmen. Alle Formen der sinnlichen Wahrnehmung gehen in die Karten ein. Niemals wird allein das registriert, was mit dem Körper in Beziehung getreten ist. Festgehalten wird immer, wie der Körper auf die Außenwelt reagiert oder in Bezug auf sie agiert hat. Niemals bilden die Karten eine äußere Landschaft ab, immer beziehen sie sich zugleich und untrennbar auf die äußere und die innere Landschaft. Eine wichtige Unterklasse von Karten besteht in Bildern, wenn die Karten von optischen Einflüssen dominiert werden.