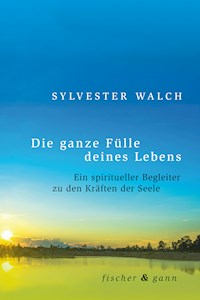21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: O.W. Barth eBook
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Das "universale Selbst" entdecken Der Mensch hat sein geistiges Potenzial bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Der Psychotherapeut Sylvester Walch zeigt, dass Erfahrungen erweiterten Bewusstseins oder subtile Energiezustände für jeden erlebbar sind. Als Vermittler zwischen Psychologie und Spiritualität überzeugt er durch ein wissenschaftlich fundiertes, ganzheitliches Menschenbild. Seine Anleitungen zur Selbstreflexion und zahlreiche Meditationsübungen begleiten einen durch das Buch und laden zum Innehalten ein. Am Ende hat jeder eine klare Vorstellung davon, was das "universale Selbst" ist, und das heißt zu wissen, wer man selbst eigentlich ist. Vom Ego zum Selbst von Sylvester Walch: im eBook erhältlich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 438
Ähnliche
Sylvester Walch
Vom Ego zum Selbst
Grundlinien eines spirituellen Menschenbildes
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Vorwort
Die intensive Beschäftigung mit dem Thema Ego und Selbst wurde zu einem aufregenden Abenteuer. Immer wenn ich an Grenzen stieß, öffnete sich ein neuer Horizont.
Ein möglicher Anspruch, der für viele Bereiche des Lernens zutrifft, könnte lauten: Wer andere dazu anregen möchte, am Ego zu arbeiten, sollte eigentlich selbst diese Hürde genommen haben. Angesichts der Unvollkommenheit und Verletzlichkeit des Menschen wäre es eine Illusion oder Hybris, anzunehmen, dass die Transformation des Ego so einfach zu bewältigen wäre. Diese Tatsache wurde mir umso klarer, je tiefer ich in die Materie eindrang. Auch wenn die Konfrontationen mit eigenen Schwächen manchmal äußerst schmerzlich verliefen, führten sie doch letztlich zu einer wunderbaren Erfahrung. In jedem Moment unseres Lebens gibt es die Möglichkeit, für kurze Zeit in die Stille zu gehen. Es ist nur ein kleiner Schritt, der aber große Wirkungen hat. Wenn wir etwas Ruhe finden, kann eine Tür nach innen aufgehen. Gehen wir hindurch, treten die alltäglichen Belastungen in den Hintergrund. Dann werden wir etwas Größerem begegnen, von dem wir uns getragen fühlen. Die Schicht des universalen Selbst ist jederzeit zugänglich, unabhängig davon, in welcher Situation wir uns befinden oder welchen Entwicklungsweg wir bisher zurückgelegt haben. Hinter unseren Prägungen und Problemen existiert ein harmonischer Ort, von dem enorme Impulse ausgehen. Das durfte ich im Verlauf dieser Arbeit immer wieder erfahren. Jede morgendliche Meditation war kräftigend und inspirierend. Deshalb gilt mein besonderer Respekt dem All-Einen in uns, das mich in außergewöhnlicher Weise geführt und unterstützt hat. Gerne möchte ich auch allen Seminarteilnehmern, Klienten und Assistenten, die mir großzügig ihr Vertrauen schenkten, von ganzem Herzen danken. Ohne sie hätte dieses Buch nicht geschrieben werden können. Mein besonderer Dank gilt auch meinem Lektor Herrn Andreas Klaus, der mir einfühlsam und kompetent zur Seite stand. In diesem Zusammenhang denke ich auch an meine Frau Edeltraud. Seit nunmehr drei Jahrzehnten ist sie eine liebevolle, verlässliche, anregende und spirituelle Weggefährtin. Meinen Kindern Nicolai und Johannes danke ich für ihre Liebe und Achtung, die sie mich immer spüren lassen. Danke auch meiner Mutter, die bedingungslos meinen Weg förderte, und meinem Vater, der sich, trotz vieler schwieriger Umstände, wahrhaftig dem Leben stellte.
Allen, die dieses Buch lesen, möchte ich für ihr Vertrauen danken.
Einleitung
Dieses Buch möchte der Entwicklung des Menschen neue Impulse geben. Die bahnbrechenden Erkenntnisse aus der Arbeit mit veränderten Bewusstseinszuständen zeigen auf, dass das Leben von außergewöhnlichen Kräften bestimmt wird, zu denen wir normalerweise keinen Zugang haben. Wenn wir uns jedoch dafür öffnen, etwas durchlässiger werden und uns davon tragen lassen, können wir den Alltag besser bewältigen, ungeahnte Potenziale erschließen und in die Tiefe des Seins eintauchen.
Drei Perspektiven sollen auf dem Weg zur Ganzheit berücksichtigt werden: die Auflösung einengender Lebensmuster, die transformative Kraft veränderter Bewusstseinszustände und die Weisheit spiritueller Einsichten. Dadurch wachsen die Liebe zum Leben, das Vertrauen in die innere Weisheit und der Mut zum Neuen. Davon profitiert nicht nur das Individuum, sondern es ist von großem gesellschaftlichem Nutzen, weil Mitgefühl und Mitmenschlichkeit von der Person in die Welt hineinstrahlen.
Die großen Fragen des Seins, denen die Psychologie ausgewichen ist, um nicht als unwissenschaftlich zu gelten, sind in jedem Menschen irgendwann präsent: Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Was ist der Sinn des Lebens? Wie können wir Angstfreiheit und Zufriedenheit im Leben erlangen? Antworten darauf sind nur in unserem Inneren zu finden. Man kann die Wahrheit der nichtphysikalischen Realität keinesfalls äußerlich beobachten, messen, wägen oder empirisch beweisen; wir müssen unseren Blick nach innen wenden und das Herz öffnen. Wenn wir das Leben verstehen wollen, sind wir gezwungen, tief in die Existenz einzutauchen, uns durchdringen zu lassen und mit ihr eins zu werden. Spirituelles Erkennen ist intim, ganzheitlich und legt den Sinn des Lebens frei.
Da es sich im vorliegenden Buch um eine Beschreibung von Lebensprozessen handelt, fließen natürlicherweise auch persönliche Erfahrungen mit ein. In kurzen Berichten soll gezeigt werden, dass die geschilderten Einsichten nicht nur gedanklich herausgearbeitet wurden, sondern auf Erlebtes verweisen. Wer auf sein Leben zurückblickt, kann erkennen, wie sich unterschiedliche Lebensstränge sinnvoll ergänzen, als habe eine unsichtbare Regie mitgewirkt. So lässt sich erahnen, dass, trotz vieler Hindernisse, jedem Leben eine Bestimmung innewohnt, die sich allmählich herausschält. Eine ganzheitliche Entwicklung muss immer verschiedene Ebenen beinhalten, in denen sich seelische Heilung und spirituelle Fortschritte ergänzen. Dabei sollten wir uns kleine Ziele stecken, die Triebkräfte der menschlichen Natur nicht unterschätzen und Krisen als notwendige Transformationsdrehpunkte anerkennen. Die vorgestellten Übungen sollen den inneren Prozess unterstützen und die Inhalte durch die persönliche Erfahrung nachvollziehbar machen.
Das Bewusstsein ist fähig, seine bisherigen Grenzen auszudehnen – in die Breite und in die Tiefe. Das lässt uns gewahr werden, dass die individuelle Persönlichkeit von einer Wesensnatur getragen ist, die über Biographie, Zeit und Raum hinausgeht. Durch intensive Prozessarbeit, veränderte Bewusstseinszustände und spirituelle Übungen können wir in diesen Bereich gelangen, von dem enorme Impulse ausgehen, und erkennen, wer wir wirklich sind. Erst wenn wir uns aufmachen – im doppelten Sinne –, erspüren wir, dass wir von einer feinstofflichen Welt umgeben sind, die uns durchdringt und trägt. So ist der Körper nicht mehr alleine ein biologisch-physikalischer Ort, sondern stets verbunden mit der Kraft des Göttlichen und der Weite des All-Einen. In jedem Menschen will der göttliche Funke leuchten. Er wartet nur darauf, entzündet zu werden, um unserem Leben den Geschmack des universalen Seins zu bringen. Die innere Weisheit wirkt in uns und begleitet uns, in guten und in schlechten Tagen, um unserem psychospirituellen Wachstum zu dienen.
Dabei vollzieht sich ein Prozess, der mit der bekannten Wendung »Stirb und werde« am besten charakterisiert werden kann. Wenn wir das Ego abbauen, alte einengende Muster lösen und die Ich-Persönlichkeit transzendieren, werden wir zu unserer wahren Natur durchdringen. Dieser Prozess wird oft von starken Erschütterungen begleitet, die nur bewältigt werden können, wenn wir gut gerüstet sind. Die inneren Fundamente müssen eine neue Ordnung finden, um diesen Kräften standhalten zu können. Mit einem gut funktionierenden Ich, mit Wahrhaftigkeit und Disziplin können wir unbeschadet die Grenzen öffnen und uns dem weiteren Geschehen vertrauensvoll überlassen. Dabei müssen wir auch loslassen lernen, um dem Selbst oder der inneren Weisheit zum Durchbruch zu verhelfen. Durch den Tod des Ego entstehen neue Seinsqualitäten, die unser Leben außerordentlich befruchten.
Ganz zu werden gelingt jedoch nur, wenn wir möglichst alle Bereiche des Menschseins bewusst entwickeln. Dazu gehört, dass wir uns mit kränkenden Lebenserfahrungen auseinandersetzen, Ängste abbauen, Gefühle zulassen und das Leben, so wie es ist, annehmen. Die wiedergewonnene Lebendigkeit und die daraus erwachsene Risikobereitschaft befähigen uns dann, unsere Existenz in größeren Zusammenhängen zu begreifen. Dabei begegnen uns auch fremde Welten, kollektive Archetypen und außergewöhnliche Energiepotenziale, die für uns, wie selbstverständlich, verfügbar werden. Wir erleben uns auch nicht mehr als isolierte Persönlichkeit, sondern mit allem verbunden.
Die Aufrechterhaltung einer in dieser Weite begründeten Seinsweise kann nur glücken, wenn wir bewusst und achtsam durchs Leben gehen. Die spirituelle Praxis bereitet dafür den Boden. Nur wer regelmäßig und nachhaltig übt und sich auf die schrittweise Erneuerung einlässt, wird öffnende Erfahrungen in den Alltag einfließen lassen können. Die Grundübung aller spirituellen Richtungen ist die Meditation, denn erst durch die Stille werden wir transparent. Das Loslassen von Gedanken, Empfindungen und inneren Konzepten transzendiert die engen Grenzen des Bewusstseins und schafft Freiräume, in denen die universellen Kräfte wirksam werden. Die Stabilisierung eines achtsamen und mitfühlenden Lebensstils gelingt nur, wenn wir bewusst das Spirituelle in unserem Alltag verankern. Manchmal helfen uns Krisen und Hindernisse, von der Oberflächlichkeit wieder in die Tiefe zurückzukommen und Prioritäten neu zu ordnen. Dann bemerken wir auch, dass schwierige Umstände nicht Feinde des Menschen sind, sondern helfende Freunde oder anregende Milieus, die zum Lernen herausfordern. Es ist eine ungewohnte Sprache, die wir lernen müssen, wenn wir uns darauf einlassen. Unser eigener Geist wird dann zum Ort radikaler Veränderung. Gelingt dies, so ändern sich auch die Umstände. Wenn wir diese Einstellung, die mit dem Satz »Alles ist zum Besten« ausgedrückt werden kann, inmitten des Alltags verwirklichen, werden Furchtlosigkeit, Gelassenheit und tiefer Frieden unser Leben mit neuen Qualitäten bereichern. Das Leben mit seinen Krisen und Übergängen wird dann zu einem täglichen Abenteuer, getragen von einem universalen, zeitlosen und beständigen Wesensgrund, von dem her sich Polaritäten und Bewertungen in das Ganze einordnen und ihre Gegensätze auflösen. Das individuelle Leben existiert nicht mehr für sich alleine, sondern ist mit dem Seinsganzen verwoben, das beständig in die Wesensnatur des Menschen einfließt und sich durch ihn verwirklicht. So erscheint auch das Schicksal in einem anderen Licht, denn es will den Menschen darauf vorbereiten, dem Ganzen zu dienen, was seine eigentliche Lebensaufgabe ist. Im Dasein verwirklicht sich das Sein, und in der Person entfaltet sich die innere Weisheit, die Kraft des Universalen. Wenn wir dem vertrauensvoll zustimmen, vollzieht sich im Alltag der schöpferische Wille.
Die Weisheit liegt im Inneren
Herausragende Erfindungen, künstlerische Werke, psychotherapeutische Prozesse oder spirituelle Übungen sind das Ergebnis vielfältigster Erkenntnisprozesse. Ohne die Fähigkeit, zu erkennen, gäbe es keine kulturelle Entwicklung. Um aus Erfahrung zu lernen, Erlebnisse zu verarbeiten und sich seiner selbst bewusst zu werden, braucht es den Blick nach innen.
Wenn wir etwas verstehen wollen, sollten wir es nicht nur beobachten, sondern müssen tief hineintauchen, es durchdringen und mit ihm eins werden. Im gewöhnlichen Erkennen werden die Sinnesorgane von Reizen erregt und die Empfindungen mit Hilfe von Bewusstseinsakten interpretiert und in einen größeren Zusammenhang integriert. So können wir unser Leben vortrefflich organisieren und funktional einrichten. Ohne lange nachzudenken, steigen wir beispielsweise ins Auto, fahren eine bestimmte Strecke, achten dabei auf die Verkehrsregeln, und legen die letzten Meter zum Büro zu Fuß zurück. Dass dabei unzählige Eindrücke verarbeitet werden, beschäftigt uns nicht weiter. Erst wenn Schwierigkeiten auftreten, wird bewusst, wie viele automatisierte Routinen unseren Alltag steuern. Die Evolution hat den Menschen mit Anlagen, Ressourcen und Potenzialen ausgestattet, die sein Überleben sichern können. Nur jene Informationen, die dafür benötigt werden, passieren die inneren Filter. Das, was wir von der Welt und uns selbst mitbekommen, ist nur ein Bruchteil dessen, was sich wirklich ereignet, und somit immer begrenzt und selektiv. Nie erfassen wir die ganze Wirklichkeit. Würden alle verfügbaren Informationen auf uns einströmen, wäre das eine Überforderung. Wenn wir jedoch vor komplexeren Lebensfragen stehen, wie etwa Berufsentscheidungen oder der Wahl eines Partners, führt erst eine Erweiterung und Vertiefung von Wahrnehmungsprozessen zu guten Resultaten. Dazu muss ich meine Fähigkeiten, Schwächen und Talente kennen, über mein Temperaments- und Persönlichkeitsprofil Bescheid wissen und herausfinden, wohin sich meine Interessen richten. Erst durch die Fähigkeit zur Selbsterkenntnis sind wir in der Lage, den richtigen Lebensweg einzuschlagen. Es ist nur dem Menschen möglich, sich selbst zu erforschen und über sich selbst nachzudenken. Die älteste aller Wissenschaften, die Philosophie, ist eine Frucht der Selbsterkenntnis. Sie war der Ausgangspunkt für die Entstehung von Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, Kunst und Kultur. Ganzheitlich betrachtet, sind Mensch und Natur miteinander verbunden, so dass sich Selbst- und Naturerkenntnis ergänzen.
Will man herausfinden, wie wir genau erkennen, stößt man jedoch auf unüberwindliche Hürden. Wir können die Bedingungen, die auf die Erkenntnis einwirken, nicht gänzlich hinter uns lassen, so wie wir mit der rechten Hand nicht die rechte Hand ergreifen können. Wenn es unmöglich ist, die Erkenntnisse von den sie bedingenden Strukturen zu befreien, tappen wir im Grunde im Dunkeln. Um redlich zu sein, müssen wir uns das eingestehen, denn sonst ergeht es uns wie den vier Blinden, die unabhängig voneinander einen Elefanten beschreiben wollen. Der eine hat einen Fuß in der Hand, der andere den Kopf, ein weiterer den Rüssel und der vierte den Bauch, und jeder schließt von seiner Sichtweise auf den ganzen Elefanten. Dies ist gerade im Umgang mit weitreichenden und ganzheitlichen Seinskonzepten zu berücksichtigen, um der Gefahr dogmatischer oder ideologischer Verengung entgegenzuwirken. Erkennen kann sich auf äußere Dinge, auf andere Menschen und auf unser Inneres richten.
Der Blickwinkel, von dem aus Erkenntnisse gewonnen werden, kann in zwei Hauptrichtungen unterschieden werden: die Erste-Person-Perspektive und die Dritte-Person-Perspektive, die wir uns im nächsten Kapitel ansehen werden.
In der Erste-Person-Perspektive erkennt jemand etwas, von einer Sache oder von sich selbst, alleine durch den Blick nach innen. Ich denke, ich fühle, ich nehme wahr und ich erkenne. Im weiteren Verlauf werden vor allem introspektive Erkenntnisse und Erlebnisse, die mit dem Menschsein zu tun haben, in den Vordergrund rücken. Eine wichtige Rolle dabei spielen veränderte Bewusstseinszustände, Träume, Glücksmomente und auch schwere Krisen, weil an den Grenzen der Normalität, wenn die gewohnten Raum- und Zeitkoordinaten transzendiert werden, wertvolle Seinserfahrungen bereitliegen.
Je mehr wir uns auf diese Welten einlassen, desto wichtiger wird die Innenperspektive für das Verstehen, denn wir verlassen den Bereich des Gelernten und öffnen einen Zugang zum Raum des Universalen, zu intuitivem Wissen und berührenden Grundwahrheiten des Lebens.
Vorübergehend kann dies auch von Ängsten und Erschütterungen begleitet sein, weil die gewohnten Interpretationsschemata nicht mehr greifen. Aussagen aus der Erste-Person-Perspektive sind achtsam anzuerkennen, so wie sie sind, ohne sie durch vorgefertigte Meinungen und gewohnte Erklärungsraster zu verfälschen. Die Herausarbeitung impliziter Botschaften mit Hilfe eines Therapeuten oder spirituellen Begleiters kann die Erfahrungen weiter vertiefen und erweitern. Dabei entsteht ein gemeinsamer Resonanz- und Entwicklungsraum, eine tiefer gehende Schwingung, die das Innere berührt.
Natürlich können subjektive Erlebnisschilderungen auf ähnliche Bilder, Formen und Inhalte hin untersucht und systematisch zusammengefasst werden, um andere Suchende zu unterstützen. So haben etwa überlieferte persönliche Berichte von Mystikern eine öffnende Wirkung, die sogar spirituelle Erfahrungen beim Lesen initiieren können. Mystische Einsichten werden so auf subtile Art und Weise weitergegeben. Ein Schüler sah ein Foto von Muktananda, einem Siddha-Yoga-Meister, auf dem Einband von dessen Autobiographie und fiel daraufhin in tiefe Versenkung. Spirituelle Entwicklung ist nur über den Weg nach innen möglich.
Das naturwissenschaftliche Paradigma
Die Dritte-Person-Perspektive möchte, von einem distanzierten und äußeren Standpunkt aus, zu möglichst objektiven Erkenntnissen gelangen. Sie nützt dabei vor allem die experimentelle Beobachtung, die sinnliche Wahrnehmung, computergestützte Analysen und die Erhebung von intersubjektiven Daten. Die Bezeichnung »wissenschaftlich begründet« wird heute vor allem auf diese Form von Erkenntnisgewinnung angewendet.
Der technische Fortschritt der Menschheit in den letzten Jahrzehnten spiegelt sich in vielen Wissensgebieten wider. In der Medizin wird darüber diskutiert, wie man die Erbanlagen so umprogrammieren kann, dass dem Menschen schwere Krankheiten erspart bleiben und eine bestmögliche Intelligenzausstattung effizientere Lebensentscheidungen hervorbringt. In der Astronautik wird die Ausdehnung des Lebensraumes auf fremde Planeten hin erkundet. Im Bereich der Computertechnologie sind Roboter mit »Bewusstsein« und »Emotionen« keine Fiktion mehr. Zurzeit macht vor allem auch die Hirnforschung von sich reden. Sie hat uns darauf hingewiesen, dass der freie Wille weitgehend eine Illusion ist. Bewusstsein, Ich und Selbst sind nach ihrer Ansicht auch nicht als überdauernde Strukturen aufzufassen, sondern nur im Sinne temporärer kohärenter Hirnströme zu verstehen. Inzwischen sieht sich die Neurobiologie nicht mehr als eine Teildisziplin der Medizin, sondern mehr und mehr als Leitwissenschaft. Es gibt kaum noch Fragen zum Menschen, zur Gesellschaft, zu Religion oder Kultur, zu der sie nicht wortreich Stellung bezieht und darauf pocht, dass ihre Ergebnisse miteinbezogen werden.
So ist auch nicht verwunderlich, dass im modernen wissenschaftlichen Menschenbild immer mehr die Gewichte zugunsten der biologischen Determiniertheit verschoben werden. Auch der publizistische Boom rund um das Thema Evolution, der anlässlich des 200. Geburtstages von Charles Darwin entfacht wurde, ist dieser Tendenz geschuldet. In dem naturwissenschaftlichen Menschenbild verbirgt sich die Illusion, bald die Regie über die Schöpfung übernehmen zu können. Je näher nämlich der Mensch in Richtung Materie gerückt wird, desto formbarer erscheint er. Die Tendenz, den Menschen nur noch als biologisch determinierte Maschine zu sehen, ist würdelos, genauso wie es überheblich ist, davon abzuleiten, dass der Mensch dadurch Schöpfer seiner selbst ist.
Will man die Vormachtstellung des naturwissenschaftlichen Paradigmas verstehen, lohnt sich ein Blick zurück. Galileo Galilei wurde für seinen genialen Beweis, dass sich nämlich die Erde um die Sonne dreht und nicht das Zentrum des Universums bildet, heftig angegriffen. Die Kirche, die damals über Staat und Wissenschaft herrschte, fürchtete, ihre Vormachtstellung und Autorität zu verlieren. Auch ist es eine massive Kränkung des Ego, die Stellung des Menschen fortan in diesem Maße zu relativieren.
Diese Konfrontation begann im Hochmittelalter, mit dem sogenannten »Universalienstreit«, der sich damit befasste, ob allgemeine Begriffe oder Sätze wie »der Mensch ist die Krone der Schöpfung« real oder nur ein Kunstprodukt des menschlichen Geistes sind. Der Nominalismus ging von der zweiten Annahme aus und betonte, dass es sich hierbei um Namen (nomen) handelt, die lediglich Schall und Rauch seien und denen kein eigentlicher Wirklichkeitscharakter zugrunde liege. Nur das, was man mit den Sinnen wahrnehmen kann, also das materielle Einzelding sei real. Diese Idee fußt indirekt auch auf dem Atomismus, eine antike Anschauung (Demokrit), nach der die Welt aus kleinsten, nicht weiter teilbaren und mit bestimmten Kräften ausgestatteten Teilchen zusammengesetzt ist. Will man verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält, muss man sie auf ihre kleinstmöglichen Elemente zurückführen. Das Kleine und Molekulare wird damit als fundamentaler angesehen als das Große und Molare. Diese Denkart wird heute als Reduktionismus bezeichnet.
Gegen Ockham, den Begründer des Nominalismus, und seine Anhänger wurde 1340 das sogenannte »Nominalistenstatut« verfasst, das sich gegen diese neuen Lehren wandte. Die kulturgeschichtliche Erosion, die von dieser Bewegung ausging, war jedoch nicht mehr aufzuhalten: Widersinnige Dogmen wurden in Frage gestellt, die Autorität der kirchlichen Ideologie wurde untergraben und die Unterdrückung des Menschen zunehmend problematisiert. Dieser kulturgeschichtliche Konflikt inspirierte spätere politische Bewegungen, die für Demokratie, Feminismus, Auflösung der Klassengesellschaft und Befreiung der Sexualität eintraten. In gegenwärtigen islamistischen »Gottesstaaten« zeigt sich in dieser Hinsicht eine eigenartige Ambivalenz. Einerseits wird die technische Entwicklung mit immensen Mitteln vorangetrieben, andererseits werden aber wissenschaftliche Ergebnisse, die dem Koran widersprechen, als nicht mit dem »wahren Glauben« vereinbar abgetan.
Eine weitere wichtige Leitfigur in der Entwicklung der modernen Wissenschaftstheorie kann in René Descartes gesehen werden. Er förderte durch seine fundamentale Unterscheidung von Naturding (res extensa) und Geistesding (res cogitans), die wie zwei parallel laufende Uhren nichts miteinander zu tun haben, die Unversöhnlichkeit zwischen Natur- und Geisteswissenschaften, die bis in die Gegenwart fortdauert. So werden auch heute noch körperliche Leiden erst dann nach ihrer psychodynamischen Bedeutung befragt, wenn die Apparatemedizin keine Heilung mehr verspricht.
Aus dem galileisch-cartesianischen Weltbild entwickelten sich nach und nach die wissenschaftstheoretischen Konzepte des Positivismus und Empirismus, die bis ins 20. Jahrhundert die Bedingungen bestimmten, was als wissenschaftlich zu gelten habe und was nicht. Zusammengefasst fordert der Positivismus, nur solche Sachverhalte zu untersuchen, die durch das Wort »positiv«, also positiv vorhanden, charakterisiert sind. Davon ausgehend müssen, nach den Grundsätzen des Empirismus, Untersuchungsgegenstände objektiv und zuverlässig beobachtet, gemessen und überprüft werden können, also alles, was wir wiegen, sehen, tasten oder hören können.
Erst bei genauerer philosophischer Analyse erkennt man, dass in diesen Forderungen verdeckte Widersprüche aufzuspüren sind. Wenn es nämlich wahr sein soll, dass wirkliche Erkenntnis nur durch Beobachtung zugänglich wird, wie kann dieser Satz einer Beobachtung zugeführt werden?
Gödel (vgl. Hofstadter, 1985) hat darüber hinaus aufgezeigt, dass wissenschaftliche Theorien schon ihrem Wesen nach begrenzt sind, denn man kann beispielsweise auch in der Mathematik nicht alle Aussagen formal beweisen oder widerlegen. Sein berühmter Unvollständigkeitssatz besagt, dass jedes große formale System entweder widersprüchlich oder unvollständig ist. Wenn wir wieder zur Erläuterung des naturwissenschaftlichen Denkens zurückkehren, dann können Theorien ihre Gültigkeit nur dann nachweisen, wenn sich aus ihren Basissätzen Beobachtungsdaten ableiten lassen.
Wenn dabei das Spektrum der Sinnesorgane nicht mehr ausreicht, müssen empfindliche Geräte dazwischengeschaltet und die Ergebnisse am Computer dargestellt werden. So können Lichtjahre entfernte Sternensysteme ausfindig gemacht und Blicke in die Mikrostruktur der Elementarteilchen geworfen werden. Wenn man an die europäische Organisation für Kernforschung (CERN) in der Schweiz denkt, dann wird schnell klar, dass ein immenser Aufwand an Technik und Rechenleistung erforderlich ist, um mit Hilfe eines kilometerlangen Teilchenbeschleunigers tief in die Struktur der Materie einzudringen und sie durch unzählige Rechenoperationen sichtbar zu machen. Aufgrund des Aufwandes ist das Großforschungsprojekt ein international finanziertes Projekt, an dem sich mindestens zwanzig führende Nationen beteiligen. Natürlich soll hier nicht unerwähnt bleiben, dass diese Forschungen für die Menschheit in vielerlei Hinsicht nutzbringend sind und den technischen Fortschritt beschleunigt haben.
Theorien müssen also immer, neben ihrer Widerspruchsfreiheit, einer empirischen Überprüfung standhalten. Dabei sollte jeder Forscher, an jedem Ort der Welt, bei gleichen Bedingungen zu gleichen Ergebnissen kommen können. Experimente müssen wiederholbar und prognostizierbar sein. Hat man sich, so die implizite Annahme, einmal der objektiven Wahrheit angenähert, sei sie bei gleichen Laborbedingungen jederzeit wieder herstellbar. Das bedeutet auch, dass man den Erkenntnisgegenstand aus seinem Kontext herauslösen und isolieren muss, um die Daten nicht durch persönliche Einflüsse zu verfälschen. Doch schon die Mikrophysik hat die nicht kontrollierbare Interaktion zwischen Beobachter und Messergebnis erkannt und der künstlichen Trennung von Erkenntnissubjekt und Erkenntnisgegenstand eine Absage erteilt, da sie die natürliche Verbundenheit des Menschen mit der Welt nicht ausreichend berücksichtige. Gleichzeitig nimmt man stillschweigend an, dass es ein objektives Universum außerhalb des Geistes gebe, was erforschbar und erkennbar sei, und zwar ebenfalls nur mit rein materiellen Mitteln.
So wird die Materie zum Grundbaustein des Lebendigen, was in letzter Konsequenz nur heißen kann, dass sich alles Geistige auf materielle Ursachen zurückführen lässt. Unser derzeitiger Wissensstand rechtfertigt wohl kaum eine solch weitreichende Schlussfolgerung. Vielleicht ist diese Haltung einem Bedürfnis nach Kontrolle geschuldet, denn kleinste Stoffe können leichter manipuliert, funktionalisiert und umgestaltet werden. Es ist ja noch zu verstehen, wenn in den Naturwissenschaften diese Denkweise vertreten wird, doch je mehr man das Rätsel Mensch entschlüsseln möchte, umso problematischer wird es, wenn man sich nur darauf stützt. Die einseitige Betonung experimenteller Zugänge in den Humanwissenschaften muss zwangsläufig Fragen wie etwa nach dem Sinn von Krankheiten oder dem Weiterleben nach dem Tode ausklammern. Die Gefahr dabei ist, dass man die Lebenswelt aus den Augen verliert, obwohl man sie eigentlich erforschen möchte.
Probleme des Erkennens in der Psychologie
Gerade in der Problemgeschichte der Psychologie ist man sich immer wieder darüber uneinig, ob sie nun im Bereich der Naturwissenschaft oder der Geisteswissenschaft anzusiedeln sei. Die jeweilige Entscheidung führt zu weitreichenden Konsequenzen, ob nämlich eher ein zergliedernd-reduktionistisches oder ein subjektiv-beschreibendes Vorgehen propagiert wird. Für die naturwissenschaftlichen Vertreter galt deshalb die beschreibende Psychologie als wissenschaftlich wenig vertrauenswürdig. Empfinden, Fühlen und Innerlichkeit wurden operationalisiert, in Beobachtungsbegriffe übersetzt und auf ihre physiologischen Bedingungen reduziert. Subjektive Beschreibungen wurden als Fehlerquelle aussortiert.
Wenn man jedoch versucht, Erlebnisinhalte ausschließlich über Beobachtungsbegriffe, die streng von Methoden abgeleitet werden, zu definieren, sagt das mehr über die Methoden als über das zu Erkennende aus. Deshalb bezeichneten die deskriptiven Psychologen die Untersuchungen ihrer naturwissenschaftlichen Kollegen als seelenlos, denn nur über die Innenschau kann man tiefere Einsichten in das Wesen des Menschen erlangen. Will die Psychologie aber der Doppelnatur ihres Faches wirklich gerecht werden, muss beides möglich sein, denn dann kann sie sowohl die psychophysischen Grundlagen als auch die Motivations- und Sinnzusammenhänge erforschen. Erst wenn unterschiedliche Weisen des Sehens anerkannt werden, brauchen sich Fragestellungen nicht mehr Methoden unterzuordnen. Abhängig davon, was ich untersuchen möchte, wähle ich den jeweils richtigen Zugang aus.
Methoden sind nur Hilfsvorrichtungen, die zur Exploration, Sicherung und Ermöglichung künftiger Begründungen dienen. Seelische Zustände sind aber gerade nicht messbar und wägbar, diskret, räumlich und zeitlich voneinander getrennt. Wenn sich zum Beispiel Forschungen über die Liebe damit begnügen würden, den Hautwiderstand zu messen, würde man sicherlich das Wesentliche aus den Augen verlieren. Befragt man jedoch vier oder fünf Menschen, wie sie Liebe empfinden, dann werden nicht nur unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Antworten kommen, sondern derselbe Mensch würde zu unterschiedlichen Zeitpunkten eine jeweils andere Antwort geben, je nachdem, wie sich gerade seine Beziehungen gestalten. Ein enttäuschter Liebhaber würde die Liebe als eine vorübergehende Illusion beschreiben, während für ein Paar, das inzwischen goldene Hochzeit gefeiert hat, die Hauptmerkmale der Liebe in Verlässlichkeit und Geborgenheit bestehen. Haben nicht beide Beschreibungen mehr Gehalt, auch wenn sie subjektiv sind? Außerdem kann die Tatsache, dass der Forscher selbst einmal verliebt war, die Untersuchung positiv beeinflussen. Erklärt man die Eigenschaften der Liebe nur über die Pulsfrequenz, chemische oder physikalische Prozesse, verliert sich ihr Zauber; vor allem aber reduziert sich die Qualität der Aussagen.
Lebensweltliche Analysen sind unvollständig, wenn sie wegen der Forderung nach Neutralität die Beziehung zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt opfern. Der Versuch, Bewusstseinsaktivitäten gänzlich neurobiologisch zu erklären, scheitert schon bei elementaren subjektiven Erlebnissen. Wie jemand einen stechenden Schmerz in der Brustgegend empfindet, kann nur von der betreffenden Person selbst unmittelbar erlebt und ausgedrückt werden. So, wie es für jemanden ist, wird nur über die Erste-Person-Perspektive zugänglich und kann nicht über Hirnbilder sichtbar gemacht werden.
Wird Erfahrungswissen nicht zugelassen, muss im Verhältnis zur Fragestellung ein riesiger experimenteller Aufwand geleistet werden, um zu plausiblen Erklärungen zu kommen. Eine längst bekannte Tatsache, dass nämlich Psychotherapeuten mit den geschilderten Problemen ihrer Klienten weniger identifiziert sind als Bekannte oder Freunde, wurde nun auch noch mit komplizierten technischen Mitteln hirnphysiologisch nachgewiesen. In der Fachterminologie heißt das, dass Selbstbezüglichkeit und Empathie in therapeutischen Beziehungen weniger nahe beieinanderliegen als in freundschaftlichen Beziehungen. Darauf hat Freud schon vor vielen Jahrzehnten in der Beschreibung der Behandlungstechnik hingewiesen.
Auch Bestrebungen, therapeutische Behandlungen dadurch effektiver zu gestalten, dass man die sprachliche Beteiligung des Klienten reduziert, die Gedanken ausliest und neu programmiert, sind schon von vorneherein zum Scheitern verurteilt. Das wäre so, als würde man glauben, dass ein teurerer Fernseher das bessere Programm übertragen würde. So ist es auch nicht verwunderlich, dass man Gewaltverbrecher durch die Aktivierung toter Hirnregionen, die für Empathie zuständig sind, wieder gesellschaftsfähiger machen möchte.
Die komplexe Entwicklung zu mitfühlendem Verstehen, dessen Wurzeln bis in den Mutterleib zurückreichen, wird in solchen Vorschlägen jedoch bedenkenlos außer Acht gelassen. Die Ursachen von Reifungsprozessen allein in physiologischen Strukturen zu suchen verkürzt die daran beteiligten Interaktionen bis zur Unkenntlichkeit. Dies führt zwangsläufig zu falschen Schlüssen über Sein und Werden des Menschen. Es besteht dabei die Gefahr einer Oberflächenkultur, in der der Mensch nur noch über Hirnbilder oder einfache Reaktionsmuster definiert wird.
So ist auch die Diskussion über die Willensfreiheit zu verstehen. Sie bezieht sich dabei auf ein einfaches Experiment von Libet. Versuchspersonen wurden veranlasst, mit dem Finger zu schnipsen. Gleichzeitig wurde das sogenannte Bereitschaftspotenzial über die gemessenen Hirnströme herausgefiltert. Dadurch kann man herausfinden, zu welchem Zeitpunkt die Handlung im Gehirn vorbereitet wurde. Erstaunlicherweise entdeckte man dabei Folgendes: Das »Bereitschaftspotenzial« trat etwa eine halbe Sekunde vor der bewussten Entscheidung des Probanden auf. Daraus schloss man, dass der Mensch nicht aus freien Stücken handele, sondern einfach biologischen Abläufen folge. Wenngleich das bei automatisierten Routineaufgaben sicherlich zutreffen mag, so ist es unzulässig, dies auf komplexe Handlungen auszudehnen. Auf die Gefahr der Überinterpretation von Hirnbildern wird in letzter Zeit mehrfach hingewiesen. Zu welchen absurden Schlüssen das führen kann, machte Craig Bennett mit folgendem Experiment deutlich. So legte er einen toten (!) Lachs in den Hirnscanner und wertete die Ergebnisse aus. In einem bestimmten Bereich des Gehirns wurde eine erhöhte Hirnaktivität gemessen. Aufgrund der Ausgangsfrage wäre der Fisch demnach in der Lage gewesen, auf menschliche Emotionen zu reagieren (SZ, 24.9.2009, S.18). Die reinen Daten, die Forscher aus einem Hirnscanner beziehen, sind grauweiße, grob verpixelte Bilder, die dann durch statistische Rechenoperationen in farbige Hirnbilder übersetzt werden. Dadurch wird der Eindruck von Eindeutigkeit und Klarheit vermittelt.
Die Hybris der wissenschaftlichen Möglichkeiten wird durch die kometenhafte Entwicklung der Computertechnologie begünstigt. Aus komplexen Rechenvorgängen entspringen farbige Simulationsmodelle, die scheinbar die Wirklichkeit exakt abbilden, ohne zu bedenken, dass mathematische Annäherungen nur durch die bisher bekannten Variablen erzeugt werden. Das Internet wirkt dabei multiplikatorisch, denn in den Tiefen der virtuellen Kommunikationswelten bleibt nichts mehr verborgen. Jeder und jedes kann zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort in Sekundenschnelle abgerufen werden. Das birgt die Gefahr in sich, dass das »Verfügen-Wollen«, das »Schneller-und-Besser«, das »Haben-Wollen«, kurz die Effizienzsteigerung um jeden Preis zur Maxime erhoben wird. Humanität und Innerlichkeit müssen zwangsläufig auf der Strecke bleiben, wenn der Lebensrhythmus nur noch von außen vorgegeben wird. Wir verlieren uns dabei selbst und hören nicht mehr, was von innen kommt, denn die Stille wird zur Zeitverschwendung. In der virtuellen Scheinwelt wird Intimes vergesellschaftet. Die uns überflutende, sich selbst ständig multiplizierende Informationsredundanz führt zu einer oberflächlichen und floskelhaften Kommunikation. Die Folgen sind fragmentarisierte Beziehungen, innere Leere und Langeweile.
In diesem Spannungsfeld, in dem gleichzeitig Hektik und Inaktivität zunehmen, vermindert sich die Resonanzfähigkeit, also auch die Schwingung mit sich selbst. Dadurch geht allmählich das Gefühl für die eigene Wesensnatur verloren. Ein Mensch, der dauerhaft sein Inneres vernachlässigt und sein Entfaltungspotenzial zurückstellt, erkrankt durch sich selbst. Die Krise der Moderne hat genau damit zu tun. Wenn nämlich äußeres Erkennen, reduktive Strategien, Scheinobjektivität, Rationalität, Effektivität und eindimensionales Denken den Kanon der Wissenschaften bilden, wird nicht berücksichtigt, wie wenig eigentlich über die Natur des Menschen bisher klargeworden ist. Emanzipatorische Prozesse werden dadurch behindert, obwohl deren Förderung beabsichtigt ist. Es ist sicherlich nicht überraschend, dass dieser einst revolutionäre Aufbruch eine autoritäre Wissenschaftsdoktrin hervorgebracht hat. Wenn sich ein neues Paradigma erst einmal durchsetzt, fungiert es selbst als Machtfaktor.
Es ist gar nicht so lange her, dass sich die psychologische Forschung noch der Bedeutung der Introspektion bewusst war. Der fatale Versuch, als naturwissenschaftliches Fach Anerkennung zu finden, brachte diesen Erkenntnisweg in Misskredit. Nicht nur in der Psychologie, sondern auch in vielen anderen Wissenschaften schmälerte ein einseitiger und monopolisierender Wissenschaftsbegriff, dem ein materialistisches Weltbild zugrunde liegt, deren Ertrag. Das Ich-Bewusstsein ist durch objektivierende Ansätze allein nicht zu verstehen. Es setzt die Innenperspektive als Erfahrung aus erster Hand voraus. Es ist kurzschlüssig, den erlebnismäßigen und reflexiven Zugang eines Menschen zu sich selbst reduktionistisch durch physikalische Vorgänge zu ersetzen. Nicht weniger als das Überleben der Menschheit steht auf dem Spiel, wenn Besinnung, Innehalten und Nachspüren vernachlässigt werden.
Der Trend zur Verobjektivierung des Subjekts ist nun an seinem Ende angelangt und zeigt erste Erosionserscheinungen. In der Medizin wird das Gespräch wieder aufgewertet, und in der Wirtschaft beginnt man allmählich, in Anbetracht der endlichen Rohstoffressourcen, Synergie und Kooperation einem konkurrierenden Marktradikalismus vorzuziehen. Erst wenn wir lernen, angesichts der zunehmenden Klimaproblematik Konsumgüter nicht mehr als Statussymbol, sondern für die Befriedigung von Grundbedürfnissen zu sehen, werden auch transzendente Werte wieder an Einfluss gewinnen. Es gilt nicht, sich die Welt untertan zu machen, sondern sie als Geschenk der Schöpfung zu sehen. Dies ist ein Hauptanliegen der transpersonalen Psychologie, die in ihrem überkonfessionellen Wachstumskonzept alte Weisheitslehren des Ostens und moderne Bewusstseinsforschung mit Bedacht zusammenführt. Damit wurden fundamentale Seinsfragen wieder der Wissenschaft zugänglich gemacht, und der Dialog zwischen Psychotherapie und Spiritualität wurde in Gang gebracht.
Unbestritten ist die naturwissenschaftliche Betrachtungsweise, auf deren Ergebnisse ich in bestimmten Fragestellungen auch zurückgreifen werde, ein wertvoller Zugang, die Welt und den Menschen besser kennenzulernen. Nur die einseitig materialistische Ausrichtung und der Versuch, dieser Form von Erkenntnisgewinnung in allen Belangen den Vorzug zu geben, sind in Frage zu stellen. Die Innenschau, im Sinne eines erfahrungswissenschaftlichen Zugangs, muss daneben einen gleichberechtigten Platz finden, ohne gleich eine idealistische Position, in der Materie als Epiphänomen des Bewusstseins betrachtet wird, zu unterstellen. Es geht dabei in erster Linie um eine Balance der Erkenntnisperspektiven, um Ausgewogenheit, nicht um eine neue Einseitigkeit.
Am Beispiel des Körpers lassen sich diese beiden Perspektiven klar differenzieren. Von außen betrachtet, können wir unsere eigene Anatomie wahrnehmen und analysieren, und wenn wir uns nach innen wenden, werden wir Empfindungen und Befindlichkeiten erfahren. Für eine erfolgreiche Behandlung von Krankheiten sind beide Weisen des Sehens unabdingbar. Wer subjektive Erlebnisschilderungen, atmosphärische Anmutungen, innere Bilder oder spirituelle Erfahrungen als unwissenschaftlich diskreditiert, klammert wesentliche Aspekte der Psyche aus der Forschung aus. Gerade durch die Sensibilisierung für innere Erkenntnisprozesse werden Wachstum, Gesundheit und die Verwirklichung von kreativen Potenzialen erst möglich. Darin liegt auch der Schlüssel für eine Daseinsverantwortung, die nicht einem neuen Individualismus, in dem es nur um das Glück des Einzelnen geht, das Wort redet.
Je mehr wir uns darauf einlassen, desto mehr sind wir auch in der Lage, Verantwortung für das Große und Ganze, für die Welt und den Kosmos, zu übernehmen.
Was wäre aus dem Menschen geworden, wenn er sich nicht selbst erforscht hätte und so seiner tiefer liegenden Natur gewahr geworden wäre? Mit der Aufschrift »Erkenne dich selbst« am Eingang des Apollotempels in Delphi wird der Suchende von den Göttern aufgefordert, sich nach innen zu wenden, um herauszufinden, wer er wirklich ist. Mit dieser einfachen Unterweisung lassen sich die Traditionen spiritueller Richtungen und Selbsterforschungswege zusammenfassen. Selbsterkenntnis ist die Voraussetzung für menschliche Entwicklung. Erst wenn wir in die Stille gehen und nach innen schauen, können wir erahnen, worauf es im Leben ankommt. Werde dir bewusst, wer du bist! Erkenne, was im Leben wichtig ist! Versöhne dich mit deinem Schicksal! Sei wahrhaftig! Liebe deinen Nächsten wie dich selbst! Gehe nach innen!
In Anbetracht der zunehmenden Beschleunigung der Lebenswelten sind die Botschaften der spirituellen Lehrer wichtiger denn je. Erst wenn man beginnt, sich selbst zu verstehen, wird man auch Antworten auf die Kernfragen des Daseins finden: Weshalb lebe ich? Oder: Woher komme ich und wohin gehe ich? Folgen wir dieser Spur konsequent, führt sie uns ins Innere, dorthin, wo sich das Mysterium des Lebens offenbart und wir unseres essenziellen Ursprungs bewusst werden. Dabei kann man tiefer liegende Wirkkräfte entdecken, die Potenziale des Bewusstseins ergründen und Einsichten in die Funktionsweise der menschlichen Natur gewinnen. Dies ist der Schlüssel zu einem segensreichen Leben, in dem der Mensch, im Einklang mit seiner Wesensnatur und in der Einheit mit allem Lebendigen, Verantwortung für sich und die Welt übernimmt. So können wir tiefer in die Geheimnisse des Lebens eindringen. Wir analysieren unsere Erfahrungen, fragen nach dem Wozu und Warum, erkunden unser Gewordensein und lernen verstehen, weshalb etwas ist, wie es ist. Selbsterkenntnis ist ein vielschichtiger und mannigfaltiger Prozess, der an einer bestimmten Stelle des Lebens bewusst einsetzt und sich auf die Erfahrung des Lebens richtet, im Sinne einer inneren Prozessarbeit. Es sind spezielle Momente des Aufbruchs, die häufig durch Krisen, schicksalhafte Ereignisse oder spontane Seinsfühlungen begünstigt werden. In Selbstverwirklichungsprozessen werden immer zwei Perspektiven in den Vordergrund treten. Anfangs werde ich mit der Frage konfrontiert: Weshalb bin ich, wie ich bin? Um darauf Antworten zu finden, muss ich bereit sein, meine Lebensmuster, Gewohnheiten und Motive zu erforschen. Wenn wir unser seelisch-emotionales Gefüge, aus dem unsere Antriebe entspringen, klarer sehen lernen, erweitert sich unser Horizont. Je mehr wir die unbewussten Reaktionen kennenlernen, desto weniger lassen wir uns fremdbestimmen. Neurotische Ängste werden abgebaut, und innere Reifungsprozesse können besser greifen.
Wenn das gelingt, ergibt sich ein nächster Schritt: Wer bin ich eigentlich darüber hinaus – wer bin ich wirklich, jenseits meiner Prägungen und persönlichen Charaktereigenschaften?
Um dieses Geheimnis lüften zu können, müssen wir über uns selbst hinauswachsen. Nur dann kommen wir dem Wesen des Seins, das von der Totalität des All-Einen durchwirkt wird, näher. Der Mensch ist mehr als nur Rollen, Persönlichkeit und Lebensgeschichte. Er ist getragen von etwas Größerem und verbunden mit allem. Je mehr wir das realisieren und unser Leben darauf beziehen, desto mehr werden wir uns durch die Impulse, die vom Seinsgrund ausgehen, entfalten. Innerliches und Äußerliches befruchten sich dann gegenseitig. Viele Menschen haben dies erkannt und wissen vom kosmischen Zusammenspiel individueller Lebensgestaltung und universeller Kraftfelder. Diese Einsichten werden durch Introspektion zutage gefördert, denn die Quelle der Weisheit liegt im Inneren. Auch Evidenzerlebnisse, Intuitionen oder das sichere Gefühl, genau zu wissen, was zu tun ist, weisen darauf hin, wie wichtig es ist, nachhaltige Lösungen für Lebensentscheidungen im Inneren zu suchen. Meistens fehlt der Bezug dazu, weil heutzutage die Aufmerksamkeit überwiegend nach außen gerichtet ist. Diese Fähigkeit zur Wahrnehmung des Innenraumes ist dem Menschen auch nicht von vornherein gegeben, sondern muss erst schrittweise ausgebildet werden. Auf dem Weg nach innen kann man auch Ängsten vor dem Unergründlichen in sich selbst begegnen. Erst wenn man das Risiko eingeht, sich zu öffnen, in sich hineinzuhören, kann man erkennen, welche Schätze tief in einem verborgen sind. So wird eine Ebene des Wissens aktiviert, die immer dann zur Verfügung steht, wenn man sich zentriert und nach innen wendet. Menschen, die sich selbst erforschen und bewusster leben, können schneller und direkter diese Ressourcen nutzen.
Dem wachsenden Bedürfnis vieler Menschen nach Weisheit stehen die Zweifel der akademischen Welt gegenüber. Das hängt damit zusammen, dass erlebte Wahrheiten als bloß persönlich abgestempelt werden, weil sie nicht durch direkte Beobachtung überprüft werden können. Doch mittlerweile weiß man, wie wertvoll es ist, sich vor wichtigen Entscheidungen zu zentrieren, nach innen zu spüren und wahrzunehmen, wie sich die Alternativen im Herzen oder im Bauch anfühlen. Wenn zum Beispiel eine angebotene Stelle eine körperliche Enge oder Dissonanz hervorruft, obwohl die äußeren Bedingungen eigentlich optimal wären, so sollte man das ernst nehmen. Manchmal stellt sich dann im Nachhinein heraus, dass etwas unterschwellig aufgenommen wurde, ohne dass es direkt benannt werden konnte. Zum Beispiel, dass die betreffende Firma ein halbes Jahr später Insolvenz anmelden musste.
Die innere Resonanz nimmt atmosphärische Schwingungen auf, die latente Botschaften beinhalten. Dies geht oft mit spirituellen Erfahrungen einher, die durch die innere Betrachtung ausgelöst werden. Da sie zumeist in symbolischer Form auftauchen, sind sie für Außenstehende nicht einfach zu entschlüsseln, da die Sprache sie nicht zu fassen vermag. Während einer therapeutischen Sitzung sah ein Klient an einem Regentag plötzlich die Sonne scheinen, als er sich zu einem Schritt der Versöhnung mit seinem Bruder entschloss.
Sätze von Mystikern, wie etwa »Es gibt nur Leere«, »Alles ist gleich«, »Es gibt keine Dualität«, »In der Gegenwart existieren Ich und Du und Wir nicht«, »Der Suchende und der Weg sind eins« oder »Du bist immer schon dort, wo du hinmöchtest« werden verwundert zur Kenntnis genommen, wenn eigene Vorerfahrungen fehlen. Für jemanden, der nie einen ähnlichen Zustand erlebt hat, klingt dies zunächst befremdlich, vielleicht sogar widersprüchlich. Wie soll ich nämlich ein Individuum sein und gleichzeitig nicht mehr als Person existieren? Ähnlich schwierig wäre es, Blindgeborenen die Abendröte am Meeresstrand nahebringen zu wollen. Der Reifegrad, die Aufnahmekapazität und die Flexibilität innerer Schemata entscheiden über Qualität und Tiefe des Wahrgenommenen.
Die Reichweite des inneren Erkennens ist immer von seelischen und spirituellen Wachstumsprozessen abhängig. Nur durch die kontinuierliche Zunahme von Offenheit, Wertschätzung, Liebe und Achtsamkeit, sich selbst und anderen gegenüber, können Bewusstseinsschranken aufgehoben werden und sich die Räume im Inneren öffnen.
Dies sind nicht nur intellektuelle Lernschritte, sondern auch emotionale. Wir wissen, dass etwa nicht integrierte Schattenaspekte wie Neid, Hass oder Eifersucht Blockaden gegen tiefere Selbsterkenntnis errichten können. Auch paranormale Wahrnehmungen können durch die Lockerung von Widerständen durchaus möglich werden. Ein Seminarteilnehmer sah in einem veränderten Bewusstseinszustand seinen Vater in einer CT-Röhre liegen, und später erfuhr er, dass sein Vater zur selben Zeit wegen eines schweren Hirnschlags ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Die traditionelle Wissenschaftstheorie muss erweitert und ergänzt werden, will man solche Erfahrungen nicht als unwirklich oder illusionär abtun. Es ist notwendig, die Innenschau als wichtige und legitime Erkenntnismethode anzuerkennen, gerade angesichts der wachsenden Zahl spirituell Suchender.
Erst wenn man sich selbst wahrnehmen kann, gewinnt man Einsichten über die Grundlagen der Existenz. Dadurch werden die inneren Spielräume weiter, und man beginnt in sich selbst zu ruhen, sich in der Welt zu Hause und mit dem Leben verbundener zu fühlen – also mehr Mensch zu sein. Wenn ich mein Inneres genauer spüren kann, kann ich auch bessere Entscheidungen treffen und im Leben glücklicher werden. Auf allen Ebenen bewirkt dies Wandlung und Reifung, um frei, ruhig und offen zu werden. Erst wenn ich zu mir selbst komme, werde ich herausfinden, wer ich wirklich bin und weshalb ich lebe. Auf diesem Weg lerne ich, verantwortlich mit mir und der Welt umzugehen, Lebensaufgaben besser zu bewältigen und eine liebevolle Einstellung zum Leben zu entwickeln. Selbsterkenntnis ist ohne Bewusstsein nicht vorstellbar. Bewusstsein zu haben ist ein essenzielles Merkmal des menschlichen Seins. Das Wesen des Bewusstseins ist rätselhaft und in seiner Form unbestimmt. Dennoch sollen hier einige Grundlinien aufgezeigt werden.
Erkennen und Bewusstsein
Erkennen ist ein Akt des Bewusstseins, und Erkenntnis ist der Inhalt, den ich im Bewusstsein antreffe. Das Bewusstsein klärt, differenziert, entwirft, vergleicht, lässt los, übt und kann sich sogar von außen betrachten. Das Bewusstsein ist weder über die Materie noch über den Geist alleine zu erklären, denn es berührt, durchzieht und durchdringt unterschiedliche Zustandsformen. Es ist fähig, neue Phänomene und Strukturen spontan herauszubilden.
Auch wenn Bewusstseinsprozesse des Individuums in der Großhirnrinde repräsentiert sind, lassen sich jedoch ihre Inhalte nicht darüber ermitteln. Dass ich denke oder fühle, kann über Hirnströme abgebildet werden, aber nicht, was ich denke oder fühle. So ist es auch nicht verwunderlich, dass durch Beeinträchtigungen der neuronalen Funktionen das Bewusstsein getrübt werden kann.
Wenn das Bewusstsein normal funktioniert, entwirft es fortwährend ein in sich zusammenhängendes Selbst- und Weltbild. Dies befähigt den Menschen, zu sich selbst und zur Welt eine Beziehung aufzubauen, zu erleben und zu handeln. Ferner vermittelt, arrangiert und organisiert das Bewusstsein unseren Lebensalltag. Es kann sich im zeitlichen Verlauf wahrnehmen, darin Vergangenes erkennen und Zukünftiges entwerfen sowie über die Endlichkeit hinaus in Zeitlosigkeit eintauchen. Räumlich ist das Bewusstsein an keinen bestimmten Ort gebunden, da die Grenzen der Ausdehnung willkürlich und beweglich sind. Es besitzt die Fähigkeit zu nichtlokaler Präsenz. Bewusstsein ist somit innerhalb und jenseits der raumzeitlichen Ordnungslinien anzutreffen. Das Bewusstsein kommentiert, begleitet und unterstützt den Menschen auf seinem Lebensweg in den Welten, in denen er sich befindet. Es kann neue Qualitäten und Sinnzusammenhänge kreieren, die nicht durch das vorhandene Datenmaterial erklärbar sind. Aus diesem geheimnisvollen Zusammenspiel von Gehirn und Geist kann eine Art höherer Weisheit entspringen, die der Ursprung kreativer und schöpferischer Akte ist. Wie anders wären Erfindungen und kulturelle Errungenschaften zu erklären. Auch wenn die Emergenzen in den jeweiligen Gehirnen eine materielle Grundlage haben, sind sie dennoch transmateriell.
Das Bewusstsein kann sich auf unterschiedliche Seinszustände richten. Solche, die innerhalb, und solche, die außerhalb des Subjekts oder der Person erscheinen. Die Grenzen sind dabei durchlässig, variabel und zustandsbestimmt. Sie können sogar in gewissen Momenten wegfallen. Das Bewusstsein kann zu sich selbst eine Distanz einnehmen, sich von außen betrachten und sich in sich selbst vertiefen. Es kann sogar Inhalte vergegenwärtigen, die zunächst unzugänglich waren oder nicht identifiziert werden konnten, weil sie noch unbewusst sind. In erster Linie sind es natürlich verdrängte und vergessene Eindrücke der Seele. Es gehören aber auch Inhalte dazu, die außerhalb des momentanen Fokus der Aufmerksamkeit liegen, unterschwellige Wahrnehmungen oder automatisierte Abläufe.
Über das narrative Gedächtnis, das sich erst nach der Geburt entwickelt, wird die Biographie aufgebaut. Perzeptive, kognitive und emotionale Prozesse, die im Säuglingsalter oder in vorgeburtlichen Stadien ablaufen, fließen in die Entwicklung mit ein, sind jedoch erst einmal nicht direkt verfügbar.
Inhalte des emotionalen Gedächtnisses, die entscheidend an der Persönlichkeitsbildung mitwirken und die Fundamente des Charakters bilden, beeinflussen den Lebensstil stärker als kognitive Einsichten. Für die Wirksamkeit von Veränderungsstrategien erscheint es wichtig, diese vorwiegend unbewussten Vorgänge zu beleuchten. Dazu muss die vertraute Reichweite des Bewusstseins ausgedehnt werden, was nur gelingt, wenn die Kontrollmechanismen, die durch ungünstige Prägungen entstanden sind, gelockert werden. Dies hat den Effekt, dass man sich selbst und anderen gegenüber offener und akzeptierender wird. Deshalb muss jeder Psychotherapeut in seiner Ausbildung auch eine Eigentherapie durchlaufen. Erst wenn die Helfer sich und ihre dunklen Seiten kennengelernt haben, können sie die psychodynamischen Prozesse des Klienten erfassen. Wer selbst nie eine Krise bewältigt oder sich in Frage gestellt hat, kann nicht wirklich hilfreich andere begleiten.
Es können aber auch gravierende Lebensumstände, welche die willkürlichen Grenzen aufsprengen, ebenso zu spontanen Aufbrüchen führen, wie bewusstseinsverändernde Methoden und spirituelle Übungen tiefere Selbsterkenntnisse vorbereiten helfen.
Im beharrlichen Blick nach innen lernt der Mensch, seine Mitte zu finden und sich selbst zu verstehen. Dadurch wächst die innere Sicherheit, die es leichter macht, starre Selbst- und Weltbilder loszulassen. So öffnen sich neue Erfahrungs- und Handlungsräume. Wenn wir unserer selbst bewusst werden und bereit sind, Schranken zu öffnen, werden Transzendenzerfahrungen möglich. Durch sie erkennt der Mensch seine Bestimmung, seine Heimat und sein Wesen. Er bricht zu sich selbst durch. Voraussetzung hierfür ist allerdings eine leidenschaftliche Suche nach dem Sinn des Lebens, denn nur eine starke Motivation kann die Schranken der Gewohnheiten überwinden helfen. Der stetige Weg nach innen kultiviert diese Transformationsprozesse, unterstützt tiefe Einsichten in das Wesen des Menschlichen und führt auch zu innerer Ruhe und Klarheit. Auch wenn die Innenschau hier hervorgehoben wird, ist zu beachten, dass sie einer Reihe von Einflüssen ausgesetzt ist, die ihre Ergebnisse beeinträchtigen und ihre Inhalte verzerren können. Nur wenn wir diese stets stillschweigend mitbedenken, können wir vermeiden, dass sich individuelle Lebenseinsichten zu Ideologien verfestigen.
Einflüsse auf die Introspektion
Das Streben nach Glück und Zufriedenheit, von dem wir alle angetrieben werden, kann zu einer Falle werden, insbesondere in Lebenskrisen. Dann ergreift man gerne den nächsten Strohhalm, der Besserung verspricht, ohne vielleicht genau zu prüfen, ob das Angebotene auch wirklich weiterbringt. Die vermeintliche Aussicht auf Heilung und Verbesserung der Lebensqualität vermindert die kritische Wahrnehmung und macht uns verführbar für einfache Erklärungen. Das ist aber in Anbetracht unseres Wissensstandes gefährlich. Zu komplex ist die Natur des Menschen, als dass triviale Rezepte, wie sie von Sekten, politischen Vereinigungen und charismatischen Bewegungen präsentiert werden, auf Dauer hilfreich sind.
Deshalb sollten wir von dem Grundsatz ausgehen, dass jede Erkenntnis unvollständig, vorläufig und selektiv ist. Sie wird durch genetisch-biologische, individuell-subjektive und kulturell-gesellschaftliche Raster vermittelt und gefärbt.
Jeder Mensch muss sich im Leben und in seiner Umgebung zurechtfinden, entsprechend seinem Alter, seiner Zeit und seiner Kultur. Dafür werden innere Schemata ausgebildet, mit deren Hilfe wir wahrnehmen und handeln können. Sie unterliegen einem beständigen Veränderungsprozess, der nach dem berühmten Entwicklungspsychologen Jean Piaget hauptsächlich durch zwei Mechanismen gesteuert wird: die Assimilation, durch die wir das, was auf uns einwirkt, an unsere inneren Erfahrungsstrukturen anpassen, und die Akkommodation, durch die wir, gemäß den neuen Erfahrungen, unsere Erfassungskapazität erweitern. Der Akkommodationsvorgang ergreift alle Schemata, die auf einer bestimmten Entwicklungsstufe das Weltbild des Kindes strukturieren. Immer dann, wenn die Assimilation fehlschlägt, muss akkommodiert werden. Das Zusammenspiel dieser progressiven Differenzierungs- und Integrationsschritte kann durch liebevolle elterliche Beziehungen, also gute Bindungserfahrungen, gefördert werden. Das sind die Fundamente gelingender Entwicklungsprozesse. Bei chronischen Defiziten oder schweren Traumata müssen sich die einst beweglichen Schemata zu starren Mustern verfestigen, um befürchteten weiteren Schaden abzuwenden. Im Erwachsenenalter werden sie als Vorurteile oder eingeschränkte Erlebnis- und Handlungsräume sichtbar. So lassen wir vielleicht einen Anhalter nicht ins Auto steigen, weil wir befürchten, dass er uns bedrohen könnte. Handeln wir nun, entgegen unseren Ängsten, einmal anders und erleben während der gemeinsamen Fahrt eine berührende Begegnung, werden wir in Zukunft vielleicht unser Verhalten verändern.
Über Schemata werden im Bewusstsein pragmatische Selbst- und Weltbilder entworfen, die den Menschen dazu befähigen, ganzheitlich wahrzunehmen und erfolgreich zu handeln. Ohne sie wären wir lebensuntüchtig. Es ist dabei nicht wichtig, wie die Welt wirklich ist, sondern dass wir uns darin bewegen können. Wir stülpen der Wirklichkeit unsere Sinnkonzepte, Gedanken und Einstellungen über. Gemäß unserem unbewussten Erleben inszenieren und konstruieren wir die Wirklichkeit. Das Ausmaß und die Kraft der daraus hervorgehenden Gedanken zeigen sich eindrucksvoll in selbsterfüllenden Prophezeiungen. Je mehr jemand erwartet, sexuell zu versagen, desto wahrscheinlicher wird er es. Gerne nützen gerade Sportler vor wichtigen Wettkämpfen die Wirksamkeit positiver Gedanken und Vorstellungen.
Dass wir die Welt als unabhängig von uns existierend erleben, durch konstante Koordinaten verortet, ist auch einer Vielzahl innerer perspektivischer Konstruktionen zu verdanken. Das ist aber nur möglich, wenn wir auch unserem Ich und Selbst, unserer individuellen personalen Identität, eine lokale Stabilität verleihen. Die Konstruktionen unabhängiger Wirklichkeiten sind demgemäß pragmatische Hilfsvorrichtungen, um besser mit der Welt und anderen Menschen in Beziehung treten zu können. In erweiterten Bewusstseinszuständen entpuppen sich jedoch die vermeintlich unumstößlichen Grenzen und stabilen Bezugspunkte des Individuums als Illusion. Auch die Kognitions- und Hirnforschung sieht mittlerweile das individuelle Selbst nicht als festen Ort oder von Dauer, sondern als eine temporäre Serie mentaler und körperlicher Ereignisse, die eine gewisse kausale Kohärenz und Integrität in der Zeit besitzen. Obwohl wir glauben, eine bleibende Identität zu besitzen, sind wir doch in jeder Sekunde jemand anderer. Diese Veränderungsprozesse werden in dem konstruierten Selbstbild vernachlässigt, so dass wir uns am Morgen, wenn wir aufstehen, als derselbe erleben, der am Abend vorher ins Bett gegangen ist. In herausfordernden Lebensabschnitten wie in der Midlife-Crisis werden uns dann diese Unterschiede bewusst und führen zu einer Identitätskrise.
In den persönlichen Theorien über uns und die Welt verweben sich angetroffene und konstruierte Inhalte zu einem Sinnganzen, um rasch neue Situationen oder andere Menschen einordnen zu können. Wie adäquat nun Bedeutungszuweisungen sind, hängt von den verfügbaren Erfahrungen ab, die als Raster dienen. Ein Schlüsselreiz, wie etwa der Schnurrbart eines großen Mannes, genügt, wenn jemand durch entsprechende Vorerfahrungen geprägt wurde, um ihn als bedrohlich wahrzunehmen. Oder wenn ein Bekannter grußlos vorübergeht, werden wir ihm arrogantes Verhalten unterstellen, obwohl wir nicht wirklich wissen, was gerade in ihm abläuft. Aber auch ein komplexes Ereignis, wie zum Beispiel ein Unfall, kann zu spontanen sinnstiftenden Spekulationen über die Ursachen führen. So teilte mir ein Klient mit, dass er deshalb verunglückt sei, weil er in einem früheren Leben anderen Menschen gegenüber zu überheblich gewesen sei. Wäre er nun ein Katholik, könnte er vielleicht sagen, dass er die letzten Wochen nicht zur Sonntagsmesse gegangen sei und dafür bestraft werde. Ein Atheist würde das als reinen Zufall sehen und sich darüber beklagen, dass er gerade in diesem Moment an der fraglichen Stelle war.
Die genetische Ausstattung, die individuelle Lerngeschichte, die gesellschaftlich-kulturellen Rahmenbedingungen und der eigene Wille entscheiden nun darüber, wie starr oder beweglich die inneren Schemata an neue Situationen angepasst werden können. So können aus frühen Ängsten rigide Lebenseinstellungen entstehen, die Lernerfahrungen vermeiden und zu einem Gefühl des Feststeckens führen. Eine künstlerisch veranlagte Frau traute es sich nicht zu, sich an einer Kunstakademie zu bewerben, weil die Eltern ihre Fähigkeiten abwerteten. Erst wenn die dahinterstehenden schmerzlichen Erlebnisse integriert werden, kann die Psyche durch die neugewonnene Stabilität die inneren Koordinaten erweitern und die Entwicklung wieder in Fluss bringen. Wenn es uns dann gelingt, vorschnelle Bedeutungszuweisungen wieder loszulassen und stattdessen Geduld aufzubringen, um zu spüren, was wirklich von innen kommt, würde das der Reifung dienen. Die automatischen Reaktionen wären unterbrochen, und die inneren Strukturen könnten sich, entsprechend den neuen Informationen, konstruktiv verändern.
Aus dem Pool an Informationen, die zur Verfügung stehen, werden jene ausgewählt, die am besten zum inneren Kontext sowie zu den momentanen Bedürfnissen, Stimmungen, Interessen und Wünschen passen. Ist man hungrig, werden Restaurants und Gaststätten prägnanter wahrgenommen, oder wenn jemand ängstlich ist, wird er in den Nachtstunden eine mäßig beleuchtete Straße meiden. Auch Erfahrungen in der Kindheit, die zu einem mangelnden Selbstwertgefühl geführt haben, können zu fehlgeleiteten Schlüssen führen, wenn sich beispielsweise jemand eine Aufgabe nicht zutraut, obwohl er die Fähigkeiten dazu hätte.
Deshalb ist es hilfreich, in sich zu gehen, um herauszufinden, welcher unbewusste Prozess gerade die ablaufenden Eindrücke lenkt, um Spielräume zu schaffen und festgefahrene Muster zu überwinden.
Auch wenn Objektivität gefordert ist, sind unsere Einsichten immer subjektiv gefärbt, weil man sich selbst im Erkenntnisakt gewöhnlich nicht auszulöschen vermag. Wenn zwei Menschen gleichzeitig einen Autounfall beobachten, werden sie dem Polizisten dennoch unterschiedliche Versionen schildern. Natürlich ist es auch möglich, sich auf einen gemeinsamen Nenner zu einigen, doch nie wird es zu einer vollständigen Übereinstimmung kommen. Sogar ein und dieselbe Person wird zu einem anderen Zeitpunkt zu unterschiedlichen Interpretationen kommen. Persönliche Einsichten sind wandelbar, instabil und vieldeutig.
Auch persönliche Gestimmtheiten wie Ärger, Traurigkeit oder Erregung können die Inhalte des Erkennens genauso entscheidend beeinflussen wie unterschiedliche Bewusstseinszustände; denken wir an Trancereisen oder tiefe Meditation. Gleiches gilt für den Reifegrad eines Menschen. Ein Weiser, der dreißig Jahre die Versenkung geübt hat, wird viel tiefgründigere Einsichten erlangen als jemand, der zeitlebens nur materielle Wünsche befriedigt hat.
Unbewusste psychische Mechanismen beeinflussen in einem hohen Maße introspektive Einsichten, um belastende Situationen zu verarbeiten. Je tiefgreifender die Schädigung, desto stärker wird die Eigenwahrnehmung verzerrt, weil Schutzmechanismen der Psyche die bedrückenden Inhalte entziehen oder sie verändern, um die wichtigsten innerseelischen Funktionskreise aufrechtzuerhalten.
Folgende Abwehrformen, die ich gleich noch kurz erläutere, sind hervorzuheben: Verleugnung, Abspaltung, Projektion, Verkehrung ins Gegenteil, Bagatellisierung, Harmonisierung, Idealisierung und Retroflexion oder Deflexion.