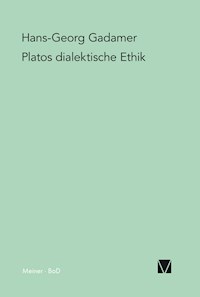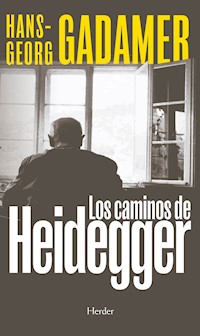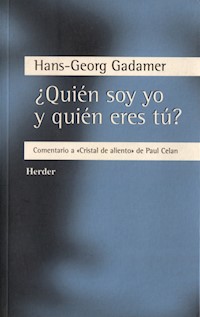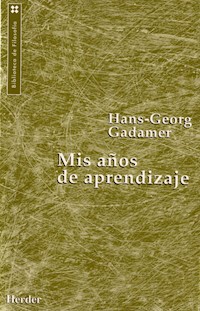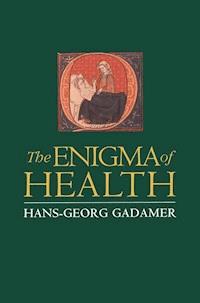6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Great Papers Philosophie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Gadamers kurzer, aber äußerst einflussreicher Text weist in das Zentrum seiner Theorie: Er bildet die wichtigste Vorstufe seines Hauptwerks Wahrheit und Methode (1960): Hier skizziert Gadamer den Ansatz seiner neuen philosophischen Hermeneutik, die versucht, den historischen Objektivismus des Historismus und die romantische Hermeneutik (v. a. Schleiermacher) zu überwinden. Der Band zeichnet Argumentationsgang und Fortleben des Textes nach und bietet eine hilfreiche Einführung in Gadamers Gesamtwerk. Die Reihe »Great Papers Philosophie« bietet bahnbrechende Aufsätze der Philosophie: - Eine zeichengenaue, zitierfähige Wiedergabe des Textes (links das fremdsprachige Original, rechts eine neue Übersetzung). - Eine philosophiegeschichtliche Einordnung: Wie dachte man früher über das Problem? Welche Veränderung bewirkte der Aufsatz? Wie denkt man heute darüber? - Eine Analyse des Textes bzw. eine Rekonstruktion seiner Argumentationsstruktur, gefolgt von einem Abschnitt über den Autor sowie ein kommentiertes Literaturverzeichnis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 193
Ähnliche
Hans-Georg Gadamer
Vom Zirkel des Verstehens
Great Papers Philosophie
Reclam
RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK Nr. 962172
2024 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
© Mohr Siebeck GmbH & Co. KG
Covergestaltung: Cornelia Feyll, Friedrich Forssman
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2024
RECLAM, UNIVERSAL-BIBLIOTHEK und RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK sind eingetragene Marken der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962172-2
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-014226-4
www.reclam.de
Inhalt
Vom Zirkel des Verstehens
Zu dieser Ausgabe
Anmerkungen
Literaturhinweise
Werke von Hans-Georg Gadamer
Sekundärliteratur
Nachwort
1. Hans-Georg Gadamer – eine biographische Skizze
2. Gadamers philosophisches Werk – zwischen griechischer Philosophie und Hermeneutik
3. Zur Entstehungsgeschichte von Wahrheit und Methode
4. Gadamers Aufsatz Vom Zirkel des Verstehens
5. Von der ›traditionellen‹ zur ›philosophischen‹ Hermeneutik – die Grundkonzeptionen von Gadamers hermeneutischer Philosophie
Verzeichnis der wichtigsten Begriffe
Zeittafel
Inhalt
Sachregister
[5]Vom Zirkel des Verstehens
[E24/GW57] Die hermeneutische Regel, daß man das Ganze aus dem Einzelnen und das Einzelne aus dem Ganzen verstehen müsse, stammt aus der antiken Rhetorik und ist durch die neuzeitliche Hermeneutik von der Redekunst auf die Kunst des Verstehens übertragen worden. Es ist ein zirkelhaftes Verhältnis, das hier wie dort vorliegt. Die Antizipation von Sinn, in der das Ganze gemeint ist, kommt dadurch zu explizitem Verständnis, daß die Teile, die sich vom Ganzen her bestimmen, ihrerseits auch dieses Ganze bestimmen.
Wir kennen das aus der Erlernung von fremden Sprachen. Wir lernen da, daß wir einen Satz erst ›konstruieren‹ müssen, bevor wir die einzelnen Teile des Satzes in ihrer sprachlichen Bedeutung zu verstehen suchen. Dieser Vorgang des Konstruierens ist aber selber schon dirigiert von einer Sinnerwartung. die aus dem Zusammenhang des Vorangegangenen stammt. Freilich muß sich diese Erwartung berichtigen lassen, wenn der Text es fordert. Das bedeutet dann, daß die Erwartung umgestimmt wird und daß sich der Text unter einer anderen Sinnerwartung zur Einheit einer Meinung zusammenschließt. So läuft die Bewegung des Verstehens stets vom Ganzen zum Teil und zurück zum Ganzen. Die Aufgabe ist, in konzentrischen Kreisen die Einheit des verstandenen Sinnes zu erweitern. Einstimmung aller Einzelheiten zum Ganzen ist das jeweilige Kriterium für die Richtigkeit des Verstehens. Das Ausbleiben solcher Einstimmung bedeutet Scheitern des Verstehens.
Nun hat Schleiermacher diesen hermeneutischen Zirkel von Teil und Ganzem sowohl nach seiner objektiven wie [6]nach seiner subjektiven Seite hin differenziert. Wie das einzelne Wort in den Zusammenhang des Satzes, so gehört der einzelne Text in den Zusammenhang des Werkes eines Schriftstellers und dieses in das [E25] Ganze der betreffenden literarischen Gattung bzw. der Literatur. Auf der anderen Seite gehört aber der gleiche Text als Manifestation eines schöpferischen Augenblicks in das Ganze des Seelenlebens seines Autors. Jeweils erst in solchem Ganzen objektiver und subjektiver Art kann sich Verstehen vollenden. – Im Anschluß an diese Theorie spricht dann Dilthey von ›Struktur‹ und von der ›Zentrierung in einem Mittelpunkt‹, aus der sich das Verständnis des Ganzen ergibt. Er überträgt damit auf die [GW58] geschichtliche Welt, was von jeher ein Grundsatz aller Interpretation ist: daß man einen Text aus sich selbst verstehen muß.
Es fragt sich aber, ob die Zirkelbewegung des Verstehens so angemessen verstanden ist. Was Schleiermacher als subjektive Interpretation entwickelt hat, darf wohl ganz beiseite gesetzt werden. Wenn wir einen Text zu verstehen suchen, versetzen wir uns nicht in die seelische Verfassung des Autors, sondern wenn man schon von Sichversetzen sprechen will, so versetzen wir uns in seine Meinung. Das heißt aber nichts anderes, als daß wir das sachliche Recht dessen, was der andere sagt, gelten zu lassen suchen. Wir werden sogar, wenn wir verstehen wollen, seine Argumente noch zu verstärken trachten. So geschieht es schon im Gespräch, wieviel mehr noch beim Verstehen von Schriftlichem, daß wir uns in einer Dimension von Sinnhaftem bewegen, das in sich verständlich ist und als solches keinen Rückgang auf die Subjektivität des anderen motiviert. Es ist die Aufgabe der Hermeneutik, dies Wunder des [7]Verstehens aufzuklären, das nicht eine geheimnisvolle Kommunion der Seelen, sondern eine Teilhabe am gemeinsamen Sinn ist.
Aber auch die objektive Seite dieses Zirkels, wie sie Schleiermacher beschreibt, trifft nicht den Kern der Sache. Das Ziel aller Verständigung und alles Verstehens ist das Einverständnis in der Sache. So hat die Hermeneutik von jeher die Aufgabe, ausbleibendes oder gestörtes Einverständnis herzustellen. Die Geschichte der Hermeneutik kann das bestätigen, wenn man z. B. an Augustin denkt, wo das Alte Testament mit der christlichen Botschaft vermittelt werden soll, oder an den frühen Protestantismus, dem [E26] das gleiche Problem gestellt war, oder endlich an das Zeitalter der Aufklärung, wo es freilich einem Verzicht auf Einverständnis nahekommt, wenn der »vollkommene Verstand« eines Textes nur auf dem Wege historischer Interpretation erreicht werden soll. – Es ist nun etwas qualitativ Neues, wenn die Romantik und Schleiermacher, indem sie ein geschichtliches Bewußtsein von universalem Umfang begründen, die verbindliche Gestalt der Tradition, aus der sie kommen und in der sie stehen, nicht mehr als feste Grundlage für alle hermeneutische Bemühung gelten lassen. Noch einer der unmittelbaren Vorläufer Schleiermachers, der Philologe Friedrich Ast, hatte ein ganz entschieden inhaltliches Verständnis der Aufgabe der Hermeneutik, wenn er forderte, sie solle das Einverständnis zwischen Antike und Christentum, zwischen einer neugesehenen wahren Antike und der christlichen Tradition herstellen. Das ist gegenüber der Aufklärung insofern schon etwas Neues, als es sich jetzt nicht mehr um die Vermittlung zwischen der Autorität der Überlieferung einerseits und der [8]natürlichen Vernunft andererseits handelt, sondern um die Vermittlung zweier Traditionselemente, die, beide durch die Aufklärung bewußt geworden, die Aufgabe ihrer Versöhnung stellen.
[GW59]Mir scheint, daß eine solche Lehre von der Einheit von Antike und Christentum ein Wahrheitsmoment am hermeneutischen Phänomen festhält, das Schleiermacher und seine Nachfolger zu Unrecht preisgegeben haben. Ast hat sich hier durch seine spekulative Energie davor bewahrt, in der Geschichte bloße Vergangenheit und nicht vielmehr die Wahrheit der Gegenwart zu suchen. Die von Schleiermacher herkommende Hermeneutik kommt einem vor diesem Hintergrunde als eine Verflachung ins Methodische vor.
Das gilt noch mehr, wenn man sie im Lichte der durch Heidegger entwickelten Fragestellung sieht. Von Heideggers Existenzialanalyse aus gewinnt nämlich die Zirkelstruktur des Verstehens ihre inhaltliche Bedeutung zurück. Heidegger schreibt: »Der Zirkel darf nicht zu einem vitiosum und sei es auch zu einem gedulde-[E27]ten herabgezogen werden. In ihm verbirgt sich eine positive Möglichkeit ursprünglichsten Erkennens, die freilich in echter Weise nur dann ergriffen ist, wenn die Auslegung verstanden hat, daß ihre erste, ständige und letzte Aufgabe bleibt, sich jeweils Vorhabe, Vorsicht und Vorgriff nicht durch Einfälle und Volksbegriffe vorgeben zu lassen, sondern in deren Ausarbeitung aus den Sachen selbst her das wissenschaftliche Thema zu sichern.«1
Was Heidegger hier sagt, ist zunächst nicht eine [9]Forderung an die Praxis des Verstehens, sondern beschreibt die Vollzugsform des verstehenden Auslegens selbst. Heideggers hermeneutische Reflexion hat ihre Spitze nicht so sehr darin, nachzuweisen, daß hier ein Zirkel vorliegt, als vielmehr darin, daß dieser Zirkel einen ontologisch positiven Sinn hat. Die Beschreibung als solche wird jedem Ausleger einleuchten, der weiß, was er tut.2 Alle rechte Auslegung muß sich gegen die Willkür von Einfällen und die Beschränktheit unmerklicher Denkgewohnheiten abschirmen und den Blick ›auf die Sachen selber‹ richten (die beim Philologen sinnvolle Texte sind, die ihrerseits wieder von Sachen handeln).
Sich dergestalt von der Sache bestimmen lassen, ist für den Interpreten offenkundig nicht ein einmaliger ›braver‹ Entschluß, sondern wirklich ›die erste, ständige und letzte Aufgabe‹. Denn es gilt, den Blick auf die Sache durch die ganze Beirrung hindurch festzuhalten, die den Ausleger unterwegs ständig von ihm selbst her anfällt. Wer einen Text verstehen will, vollzieht immer ein Entwerfen. Er wirft sich einen Sinn des Ganzen voraus, sobald sich ein erster Sinn im Text zeigt. Ein solcher zeigt sich wiederum nur, weil man den Text schon mit gewissen Erwartungen auf einen bestimmten Sinn hin liest. Im Ausarbeiten eines solchen Vorentwurfs, der [GW60] freilich beständig von dem her revidiert wird, was sich bei weiterem Eindringen in den Sinn ergibt, besteht das Verstehen dessen, was dasteht.
Diese Beschreibung ist natürlich eine grobe Abbreviatur: [10]daß jede [E28] Revision des Vorentwurfs in der Möglichkeit steht, einen neuen Entwurf von Sinn vorauszuwerfen; daß sich rivalisierende Entwürfe zur Ausarbeitung nebeneinander herbringen können, bis sich die Einheit des Sinnes eindeutiger festlegt; daß die Auslegung mit Vorbegriffen einsetzt, die durch angemessenere Begriffe ersetzt werden: eben dieses ständige Neu-Entwerfen, das die Sinnbewegung des Verstehens und Auslegens ausmacht, ist der Vorgang, den Heidegger beschreibt. Wer zu verstehen sucht, ist der Beirrung durch Vor-Meinungen ausgesetzt, die sich nicht an den Sachen selbst bewähren. So ist die ständige Aufgabe des Verstehens, die rechten, sachangemessenen Entwürfe auszuarbeiten, das heißt Vorwegnahmen, die sich ›an den Sachen‹ erst bestätigen sollen, zu wagen. Es gibt hier keine andere ›Objektivität‹ als die der Ausarbeitung der sich bewährenden Vormeinung. Es hat seinen guten Sinn, daß der Ausleger nicht geradezu, aus der in ihm bereiten Vormeinung lebend, auf den ›Text‹ zugeht, vielmehr die in ihm lebende Vormeinung ausdrücklich auf ihre Legitimation, und das ist: auf Herkunft und Geltung prüft.
Man muß sich diese grundsätzliche Forderung als die Radikalisierung eines Verfahrens denken, das wir in Wahrheit immer anwenden. Weit entfernt davon, daß, wer jemanden anhört oder an eine Lektüre geht, gar keine Vormeinung über den Inhalt mitbringen darf und alle seine eigenen Meinungen vergessen soll, wird vielmehr Offenheit für die Meinung des anderen oder des Textes schon immer einschließen, daß man sie zu dem Ganzen der eigenen Meinungen in ein Verhältnis setzt oder sich zu ihr. Anders gesprochen, Meinungen sind zwar eine bewegliche Vielfalt [11]von Möglichkeiten, aber innerhalb dieser Vielfalt des Meinbaren, d. h. dessen, was ein Leser sinnvoll finden und insofern erwarten kann, ist doch nicht alles möglich, und wer an dem vorbeihört, was der andere wirklich sagt, wird es am Ende auch der eigenen vielfältigen Sinnerwartung nicht einordnen können. So gibt es auch hier einen Maßstab. Die hermeneutische Aufgabe geht von selbst in eine sachliche Fragestellung über und ist von dieser immer schon mitbestimmt. Damit gewinnt das hermeneu-[E29]tische Unternehmen festen Boden unter den Füßen. Wer verstehen will, wird sich der Zufälligkeit der eigenen Vormeinung von vornherein nicht überlassen, um an der Meinung des Textes so konsequent und hartnäckig wie möglich vorbeizuhören – bis etwa diese unüberhörbar wird und das vermeintliche Verständnis umstößt. Wer einen Text verstehen will, ist vielmehr bereit, sich von ihm etwas sagen zu lassen. Daher muß ein hermeneutisch geschultes Bewußtsein für die Andersheit des Textes von vornherein empfänglich sein. Solche Empfänglichkeit setzt aber weder sachliche ›Neutralität‹ noch gar Selbstauslöschung [GW61] voraus, sondern schließt die abhebbare Aneignung der eigenen Vormeinungen und Vorurteile ein. Es gilt, der eigenen Voreingenommenheit inne zu sein, damit sich der Text selbst in seiner Andersheit darstellt und derart in die Möglichkeit kommt, seine sachliche Wahrheit gegen die eigene Vormeinung auszuspielen.
Heidegger hat eine völlig richtige phänomenologische Beschreibung gegeben, wenn er in dem vermeintlichen ›Lesen‹ dessen, was ›dasteht‹, die Vorstruktur des Verstehens aufdeckt. Er hat auch ein Beispiel dafür gegeben, daß daraus eine Aufgabe folgt. Er hat in ›Sein und Zeit‹ die [12]allgemeine Aussage, die er zum hermeneutischen Problem macht, an der Seinsfrage konkretisiert (S. u. Z. 312 ff.). Um die hermeneutische Situation der Seinsfrage nach Vorhabe, Vorsicht und Vorgriff zu explizieren, hat er seine an die Metaphysik gerichtete Frage an wesentlichen Wendepunkten der Geschichte der Metaphysik kritisch erprobt. Er hat damit getan, was das historisch-hermeneutische Bewußtsein in jedem Falle verlangt. Ein mit methodischem Bewußtsein geführtes Verstehen wird bestrebt sein müssen, seine Antizipationen nicht einfach zu vollziehen, sondern sie selber bewußt zu machen, um sie zu kontrollieren und dadurch von den Sachen her das rechte Verständnis zu gewinnen. Das ist es, was Heidegger meint, wenn er fordert, in der Ausarbeitung von Vorhabe, Vorsicht und Vorgriff aus den Sachen selbst her das wissenschaftliche Thema zu ›sichern‹.
In Heideggers Analyse gewinnt damit der hermeneutische Zirkel [E30] eine ganz neue Bedeutung. Die Zirkelstruktur des Verstehens hielt sich in der bisherigen Theorie stets im Rahmen einer formalen Relation von Einzelnem und Ganzem, bzw. von dessen subjektivem Reflex: der ahnenden Vorwegnahme des Ganzen und seiner nachfolgenden Explikation im einzelnen. Nach dieser Theorie lief also die Zirkelbewegung an dem Text hin und her und war in dem vollendeten Verständnis desselben aufgehoben. Die Theorie des Verstehens gipfelte in einem divinatorischen Akt, der sich ganz in den Verfasser versetzt und von da aus alles Fremde und Befremdende des Textes zur Auflösung bringt. Heidegger dagegen erkennt, daß das Verständnis des Textes von der vorgreifenden Bewegung des Vorverständnisses dauerhaft bestimmt bleibt. Was Heidegger so [13]beschreibt, ist nichts anderes als die Aufgabe der Konkretisierung des historischen Bewußtseins. Mit ihr ist verlangt, der eigenen Vormeinungen und Vorurteile inne zu sein und den Vollzug des Verstehens jeweils so mit historischer Bewußtheit zu durchdringen, daß die Erfassung des historisch Anderen und die dabei geübte Anwendung historischer Methoden nicht das bloß herausrechnet, was man hineingesteckt hat.
Der inhaltliche Sinn des Zirkels von Ganzem und Teil, der allem Verstehen zugrunde liegt, muß aber, wie mir scheint, durch eine weitere Bestimmung ergänzt werden, die ich den ›Vorgriff der Vollkommenheit‹ nennen [GW62] möchte. Damit ist eine Voraussetzung formuliert, die alles Verstehen leitet. Sie besagt, daß nur das verständlich ist, was wirklich eine vollkommene Einheit von Sinn darstellt. So machen wir diese Voraussetzung der Vollkommenheit, wenn wir einen Text lesen. Erst wenn diese Voraussetzung sich als uneinlösbar erweist, d. h. der Text nicht verständlich wird, stellen wir sie in Frage, zweifeln etwa an der Überlieferung und suchen sie zu heilen. Die Regeln, die wir bei solchen textkritischen Überlegungen befolgen, können hier beiseite bleiben, denn worauf es ankommt, ist auch hier, daß die Legitimation zu ihrer Anwendung nicht von dem inhaltlichen Verständnis des Textes ablösbar ist.
Der Vorgriff der Vollkommenheit, der all unser Verstehen leitet, [E31] erweist sich so selber als ein jeweils inhaltlich bestimmter. Es wird nicht nur eine immanenteSinneinheit vorausgesetzt, die dem Lesenden die Führung gibt, sondern das Verständnis des Lesers wird auch ständig von transzendenten Sinnerwartungen geleitet, die aus dem Verhältnis zur Wahrheit des Gemeinten entspringen. So [14]wie der Empfänger eines Briefes die Nachrichten versteht, die er enthält, und zunächst die Dinge mit den Augen des Briefschreibers sieht, d. h. für wahr hält, was dieser schreibt – und nicht etwa die Meinung des Briefschreibers als solche zu verstehen sucht, so verstehen wir auch überlieferte Texte auf Grund von Sinnerwartungen, die aus unserem eigenen Sachverhältnis geschöpft sind. Und wie wir Nachrichten eines Korrespondenten glauben, weil er dabei war oder es sonst besser weiß, so sind wir auch einem überlieferten Text gegenüber grundsätzlich der Möglichkeit offen, daß er es besser weiß, als die eigene Vormeinung gelten lassen will. Erst das Scheitern des Versuchs, das Gesagte als wahr gelten zu lassen, führt zu dem Bestreben, den Text als die Meinung eines anderen – psychologisch oder historisch – zu ›verstehen‹3. Das Vorurteil der Vollkommenheit enthält also nicht nur dies, daß ein Text seine Meinung vollkommen aussprechen soll, sondern auch, daß das, was er sagt, die vollkommene Wahrheit ist. Verstehen heißt primär: sich in der Sache verstehen, und erst sekundär: die Meinung des anderen als solche abheben und verstehen. Die erste aller hermeneutischen Bedingungen bleibt somit das Sachverständnis, das Zutun-haben mit der gleichen Sache. Von ihm bestimmt sich, was als einheitlicher Sinn vollziehbar wird und damit die Anwendung des Vorgriffs der Vollkommenheit. So erfüllt sich der Sinn der Zugehörigkeit, d. h. das Moment der Tradition im [15]historisch-hermeneutischen Verhalten, durch die Gemeinsamkeit grundlegender und tragender Vorurteile. Die Hermeneutik muß davon ausgehen, daß wer ver-[E32]stehen will, mit der Sache, die mit der [GW63]Überlieferung zur Sprache kommt, verbunden ist und an die Tradition Anschluß hat oder Anschluß gewinnt, aus der die Überlieferung spricht. Auf der anderen Seite weiß das hermeneutische Bewußtsein, daß es mit dieser Sache nicht in der Weise einer fraglos selbstverständlichen Einigkeit verbunden sein kann wie sie für das ungebrochene Fortleben einer Tradition gilt. Es besteht wirklich eine Polarität von Vertrautheit und Fremdheit, auf die sich die Aufgabe der Hermeneutik gründet, nur daß diese nicht mit Schleiermacher psychologisch als die Spannweite, die das Geheimnis der Individualität birgt, zu verstehen ist, sondern wahrhaft hermeneutisch, d. h. im Hinblick auf ein Gesagtes: die Sprache, mit der die Überlieferung uns anredet, die Sage, die sie uns sagt. Die Stellung zwischen Fremdheit und Vertrautheit, die die Überlieferung für uns hat, ist also das Zwischen zwischen der historisch gemeinten, abständigen Gegenständlichkeit und der Zugehörigkeit zu einer Tradition. In diesem Zwischen ist der wahre Ort der Hermeneutik.
Aus dieser Zwischenstellung, in der sie ihren Stand nimmt, folgt, daß ihr Zentrum bildet, was in der bisherigen Hermeneutik ganz am Rande blieb: der Zeitenabstand und seine Bedeutung für das Verstehen. Die Zeit ist nicht primär ein Abgrund, der überbrückt werden muß, weil er trennt und fernhält, sondern sie ist in Wahrheit der tragende Grund des Geschehens, in dem das gegenwärtige Verstehen wurzelt. Der Zeitenabstand ist daher nicht etwas, was überwunden werden muß. Das war vielmehr die naive [16]Voraussetzung des Historismus, daß man sich in den Geist der Zeit versetzt, daß man in deren Begriffen und Vorstellungen denkt und nicht in seinen eigenen und auf diese Weise zur historischen Objektivität vordringt.
In Wahrheit kommt es darauf an, den Abstand der Zeit als eine positive und produktive Möglichkeit des Verstehens zu erkennen. Er ist ausgefüllt durch die Kontinuität des Herkommens und der Tradition, in deren Lichte uns alle Überlieferung sich zeigt. Hier ist es nicht zu wenig, von einer echten Produktivität des Geschehens zu sprechen. Jedermann kennt die eigentümliche Ohn-[E33]macht unseres Urteils dort, wo uns nicht der Abstand der Zeiten sichere Maßstäbe anvertraut hat. So ist das Urteil über gegenwärtige Kunst für das wissenschaftliche Bewußtsein von verzweifelter Unsicherheit. Offenbar sind es unkontrollierbare Vorurteile, unter denen wir an solche Schöpfungen herangehen und die ihnen eine Überresonanz zu verleihen vermögen, die mit ihrem wahren Gehalt und ihrer wahren Bedeutung nicht konform ist. Erst das Absterben all solcher aktuellen Bezüge läßt ihre eigene Gestalt sichtbar werden und ermöglicht damit ein Verständnis dessen, was in ihnen gesagt ist, das verbindlich Allgemeinheit beanspruchen kann. Die Herausfilterung des wahren Sinnes, der in einem Text oder in einer künstlerischen Schöpfung gelegen ist, ist übrigens selber ein unendlicher Prozeß. Der Zeitenabstand, der diese Filterung leistet, ist in einer ständigen Bewe-[GW64]gung und Ausweitung begriffen, und das ist die produktive Seite, die er für das Verstehen besitzt. Er läßt die Vorurteile absterben, die partikularer Natur sind, und diejenigen hervorkommen, die ein wahrhaftes Verstehen ermöglichen.
[17]Oft vermag der Zeitenabstand4 die eigentlich kritische Aufgabe der Hermeneutik zu lösen, die wahren Vorurteile von den falschen zu scheiden. Das hermeneutisch geschulte Bewußtsein wird daher ein historisches Bewußtsein enthalten. Es wird die das Verstehen leitenden Vorurteile bewußt machen müssen, damit die Überlieferung, als Andersmeinung, sich ihrerseits abhebt und zur Geltung bringt. Ein Vorurteil als solches zur Abhebung zu bringen, verlangt offenbar, es in seiner Geltung zu suspendieren; denn solange uns ein Vorurteil bestimmt, wissen und bedenken wir es nicht als Urteil. Ein Vorurteil so gleichsam vor mich zu bringen, kann nicht gelingen, solange dies Vorurteil beständig und unbemerkt im Spiele ist, sondern nur dann, wenn es sozusagen gereizt wird. Was so zu reizen vermag, ist die Begegnung mit der Überlieferung. Denn was zum Verstehen verlockt, muß sich selber schon zuvor in seinem Anderssein zur Geltung gebracht haben. Das erste, womit das Verstehen beginnt, ist, daß etwas uns anspricht. Das ist die oberste aller hermeneuti-[E34]schen Bedingungen. Wir sehen jetzt, was damit gefordert ist: eine grundsätzliche Suspension der eigenen Vorurteile. Alle Suspension von Urteilen aber, mithin und erst recht die von Vorurteilen, hat, logisch gesehen, die Struktur der Frage.
Das Wesen der Frage ist das Offenlegen und Offenhalten von Möglichkeiten. Wird ein Vorurteil fraglich – angesichts dessen, was uns ein anderer oder ein Text sagt –, so heißt dies mithin nicht, daß es einfach beiseitegesetzt wird und [18]der andere oder das Andere sich an seiner Stelle unmittelbar zur Geltung bringt. Das ist vielmehr die Naivität des historischen Objektivismus, ein solches Absehen von sich selbst anzunehmen. In Wahrheit wird das eigene Vorurteil dadurch recht eigentlich ins Spiel gebracht, daß es selber auf dem Spiele steht. Nur indem es sich ausspielt, spielt es sich mit dem anderen so weit ein, daß auch dieses sich ausspielen kann.
Die Naivität des sogenannten Historismus besteht darin, daß er sich einer solchen Reflexion entzieht und im Vertrauen auf die Methodik seines Verfahrens seine eigene Geschichtlichkeit vergißt. Hier muß von einem schlecht verstandenen historischen Denken an ein besser zu verstehendes appelliert werden. Ein wirklich historisches Denken muß die eigene Geschichtlichkeit mitdenken. Nur dann wird es nicht dem Phantom eines historischen Objektes nachjagen, das Gegenstand fortschreitender Forschung ist, sondern wird in dem Objekt das Andere des Eigenen und damit das Eine wie das Andere erkennen lernen. Der wahre historische Gegenstand ist kein Gegenstand, [GW65] sondern die Einheit dieses Einen und Anderen, ein Verhältnis, in dem die Wirklichkeit der Geschichte ebenso wie die Wirklichkeit des geschichtlichen Verstehens besteht. Eine sachangemessene Hermeneutik hätte diese eigentliche Wirklichkeit der Geschichte im Verstehen selbst aufzuweisen. Ich nenne das damit Geforderte ›Wirkungsgeschichte‹. Verstehen ist ein wirkungsgeschichtlicher Vorgang, und es ließe sich nachweisen, daß es die allem Verstehen zukommende Sprachlichkeit ist, in der das hermeneutische Geschehen seine Bahn zieht.
[19]Zu dieser Ausgabe
Der Abdruck des Textes folgt der Ausgabe:
Hans-Georg Gadamer: Vom Zirkel des Verstehens (1959). In: H.-G. G.: Gesammelte Werke. Bd. 2: Hermeneutik II. Wahrheit und Methode. Ergänzungen. Register. Tübingen 1986. S. 57–65.
Die Originalpaginierung dieser Ausgabe [GW] sowie die Seitenzahlen der Erstausgabe [E] werden in eckigen Klammern wiedergegeben. Rechtschreibung und Zeichensetzung folgen der Vorlage buchstaben- und zeichengenau. Gadamers wenige Korrekturen des ursprünglichen Textes und die beiden Ergänzungen (in eckigen Klammern) wurden übernommen und die Anmerkungsziffern korrigiert.
Der Erstdruck des Aufsatzes erfolgte in
Martin Heidegger zum siebzigsten Geburtstag. Festschrift. Hrsg. von Günther Neske. Pfullingen 1959. S. 24–35. Wiederabdr. in: H.-G. G.: Kleine Schriften IV: Variationen. Tübingen 1977. S. 54–61.
Übersetzungen des Textes liegen auf Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch Koreanisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch und Spanisch vor.
Im Folgenden eine Liste der Unterschiede zwischen beiden Ausgaben. Links vom Lemmazeichen ] steht der Text der Gesammelten Werke, rechts davon der Text der Erstausgabe.
Kommunion ] Kommunikation
Alte Testament ] alte Testament
soll. – ] soll.
Das ist ] Das ist zwar
Mir ] Aber mir
Sein und Zeit, S. 154. ] Sein und Zeit p. 153.
tut.2 ] tut2.
Interpretation«, S. 11 ff. ] Interpretation« p. 11 ff.
ihr ] ihnen
abhebbare ] abhebende
derart ] damit
[Jetzt in D. Henrich, H. R. Jauss (Hrsg.), Theorien der Kunst, Frankfurt a. M. 1982, S. 59–69. ] ]
Oft vermag der Zeitenabstand4 ] Nichts anderes als dieser Zeitenabstand vermag
Frage ] Frage
[Zu dieser Änderung des ursprünglichen Textes vgl. Ges. Werke Bd. 1, S. 304]. ]
[21]Anmerkungen
Rhetorik: Redekunst.
Hermeneutik: (Kunst-)Lehre und Praxis des Verstehens und der Interpretation, vor allem von Texten oder mündlichen Äußerungen.
Antizipation: Vorwegnahme.
Schleiermacher: Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768–1834), deutscher evangelischer Theologe, Philosoph und Platon-Übersetzer. Prediger in Stolp, Halle und Berlin, Professor an den Universitäten Halle (ab 1804) und Berlin (ab 1810). Hauptwerke: seine fünfbändige Platon-Übersetzung sowie