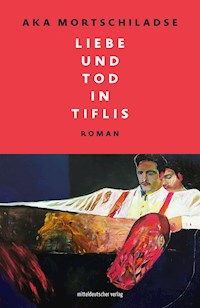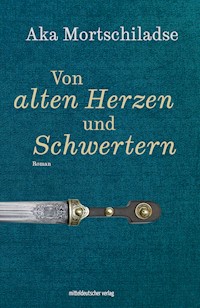
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mdv Mitteldeutscher Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Georgien in den 1820er Jahren. Während Russland sich den Kaukasus zu unterwerfen versucht, kommt der junge georgische Adelige Baduna Pavneli, der in Tiflis einen russischen Offizier getötet hat, nach verbüßter Strafe auf freien Fuß. Unter einer Bedingung: Er darf die nächsten zehn Jahre sein Dorf nicht verlassen. Als er jedoch entdeckt, dass sein taubstummer Bruder Tadia verschwunden ist, um die vor Jahren entführte Mutter zu finden, macht sich Baduna auf die Suche. Vom Militär verfolgt, schlägt er sich durch die Wälder, Täler und Berge Georgiens. Wie ein klassischer tragischer Held riskiert er alles, ohne zu wissen, was ihn am Ende seiner Reise am Schwarzen Meer erwartet. Dort holen ihn die Vergangenheit und seine russischen Verfolger ein … Voller wunderbarer Originalität erzählt Aka Mortschiladse eine dramatische Geschichte über Entführung, Liebe und Krieg im Georgien des 19. Jahrhunderts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 180
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Aka Mortschiladse, geb. 1966 in Tbilissi, erlebte als junger Mann den Zusammenbruch der Sowjetunion und die Unabhängigkeitserklärung Georgiens. Er studierte Geschichte an der Staatlichen Universität Tbilissi. 1992 erschien sein erster Roman, „Reise nach Karabach“, der auch verfilmt wurde. Inzwischen hat er über zwanzig Romane und zwei Erzählungsbände veröffentlicht und ist einer der bekanntesten georgischen Schriftsteller der Gegenwart. Für seine Bücher erhielt er die wichtigsten Literaturpreise seines Landes. Im Mitteldeutschen Verlag erschienen „Santa Esperanza“ (2017), „Schatten auf dem Weg“ (2018) und „Obolé“ (2018). Der Autor lebt und arbeitet in London.
1
Im Frühling des Jahres 1828 wurde in der Stadt Tiflis der Edelmann Baduna Pavneli im Alter von sechsundzwanzig Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Es war Pfingsten.
Noch im Gefängnis bekam der Edelmann seine Waffen zurück: einen mit Silber verzierten Gürtel, einen silbernen Dolch und ein Schwert aus persischem Stahl mit versilberter Scheide – alles geerbt von seiner vor ihm gegangen Familie. Außerdem eine versilberte Pulverflasche, die noch nach Schießpulver roch.
Das Gefängnis war kein Gefängnis im eigentlichen Sinne, sondern eine Kaserne. In den fünfundzwanzig Jahren, seit sie Georgien kontrollierten, hatten die Russen in Tiflis kein Gefängnis gebaut, wahrscheinlich weil es keines bedurfte. Es gab Kerkerzellen in der alten Festung, das war alles.
Da aber der junge Pavneli von adliger Herkunft war, konnte er nicht zu den anderen Insassen in den Kerker geworfen werden. Nein, Edelmänner hielt man in einem kleinen Raum in der Kaserne fest.
Seine Entlassung kam unerwartet. Jemand musste sich beherzt genug gefühlt haben, beim Statthalter – oder sogar an höherer Stelle, beim Vizekönig – für ihn vorzusprechen. Es gab keine andere Möglichkeit für eine so vorzeitige Entlassung. Wenn die Art, wie Russen ihre Gefangenen behandeln, für ihn infrage gekommen wäre, hätte man ihm den Schädel und den Schnauzer halb geschoren und ihn für weiß der Himmel wie lange nach Sibirien verschleppt.
Damals kursierten in Tiflis haufenweise Geschichten über Sibirien, schreckliche Geschichten von dickem Eis und schweren Fußeisen. Ein Priester der Antschischati-Basilika predigte sogar, dass Sibirien tatsächlich die Hölle war.
So erwies es sich als sehr hilfreich, in der Familie einflussreiche Taufpaten zu haben. Der junge Pavneli ahnte nichts von dem Gespräch, das der Grund für seine Entlassung war. Einmal auf freiem Fuß, blieb er nicht allzu lange in der Kaserne. Er wurde, noch unbewaffnet, auf schnellstem Wege in das Dienstzimmer des Obersts geführt, wo er auf einen strengen, in dunkles Blau gekleideten Mann traf, den er zuvor zwar gesehen hatte, an dessen Namen er sich aber nicht erinnerte. Es war der Oberst, der Pavneli mehr als einmal verhört hatte.
Der Oberst klappte seine Schnupftabakdose mit einem Knall zu und wandte sich auf Russisch an Pavneli:
„Wir entlassen Euch auf Befehl Seiner Exzellenz. Ihr könnt Euren Landsleuten dafür danken, Euch aus unseren Fängen befreit zu haben. Ihr hättet eine härtere Strafe verdient … Unterzeichnet diese Urkunde. Ihr versteht doch Russisch, oder?“
Baduna Pavneli lächelte nur – die Worte des Obersts hatte er nämlich kaum verstanden –, setzte sich an den Tisch und beugte sich über die unverständliche Urkunde.
„Unterschreibt!“, forderte ihn der Oberst auf. „Unterschreibt, und Eure Haft hat ein Ende. Doch müsst Ihr die nächsten zehn Jahre in Eurem Dorf bleiben. Ihr dürft es nicht verlassen. Tiflis und auch alle anderen Orte sind Euch verboten.“
Der junge Edelmann verstand auch dies nicht, begriff aber, dass er entlassen werden sollte. Also schrieb er „Ich stimme zu“ in georgischer Schrift an den unteren Rand des Schriftstücks.
Der Oberst nahm an, dass dies seine Unterschrift sei. Entsprechend den örtlichen Gepflogenheiten nahm Pavneli seinen Siegelring vom kleinen Finger und hielt Ausschau nach Kohle, um die Urkunde zu besiegeln. Er erhob sich, ging zum Ofen, öffnete die Ofenklappe und schabte mit dem Ring an der Innenwand.
Der Oberst schaute ihn zornig an.
Pavneli drückte schwungvoll seinen Ring auf die Papiere, steckte ihn wieder an den Finger und erhob sich.
„Verschwindet“, sagte der Oberst und setzte sich an seinen Schreibtisch.
Mit einer Verbeugung nahm Pavneli Abschied, drehte sich um und ging. An der Tür erwartete ihn ein Mann mit einem Gewehr und brachte ihn in den Raum, wo man ihm seine Waffen aushändigte.
„Meine Pistole?“, fragte der ehemalige Häftling. „Wo ist meine Pistole?“
Die Russen schauten einander an und schüttelten die Köpfe.
Die Pistole gaben sie ihm nicht zurück.
Es war am Morgen. Am anderen Ufer des Flusses sah er, jenseits des Kasernentors, Tiflis.
2
Was später als „das Duell“ bezeichnet wurde, um eine einfache Erklärung für das zu finden, was geschehen war, war in keinster Weise ein Duell.
Baduna Pavneli – den Akten nach ein Waisenkind, Nachkomme eines Adelsgeschlechts, das dem Fürstenhaus Eristawi treu ergeben war, und Besitzer mehrerer Weinberge nahe dem Dorf Pawnisi – wurde in einen Schwertkampf mit einem russischen Offizier verwickelt, der erst kürzlich ruhmreich von der russisch-osmanischen Front zurückgekehrt war. Das geschah am helllichten Tag, direkt auf dem Zugang zum Marktplatz, nämlich vor dem Kojori-Tor.
Es war Mittag. Pavneli kam gerade aus der Taverne, wo er einer Partie Backgammon zugesehen hatte.
Der Offizier plünderte einen Marktstand, der orientalische Süßwaren anbot. Er zerstieß und zerschlug die Pyramiden aus Konfekt und Backwaren, die am Straßenrand aufgetürmt waren, und hatte offensichtlich sein Vergnügen daran. Der persische Händler hockte auf der Straße, hielt sich die Augen zu und hoffte, dass das Ganze bald überstanden wäre.
Eine Menschenmenge sammelte sich, aber niemand wagte einzugreifen. Der Offizier war eindeutig ein gut ausgebildeter Schwertkämpfer und schwang die Klinge mit großer Selbstgewissheit, mal in einer geschmeidigen Bewegung aus der Rückhand über den Marktstand hinweg, mal einen Stoß ausführend, mal nach unten schwingend. Einige in der Menge applaudierten, andere spornten ihn durch Zurufe an.
Der Offizier wusste, dass seine Vorgesetzten ihm dafür die Leviten lesen würden, aber das schien ihm die Sache wert zu sein. Nach jedem Hieb schaute er über die Köpfe der Menge hinweg zu einer geschlossenen Kutsche. Dort saß eine Frau, die alles beobachtete, was er tat.
Es ging einzig und allein darum. Darum und sonst nichts. Es war schwer vorstellbar, was der Frau an diesem Gebaren hatte gefallen können, aber wer weiß schon, was im Kopf eines unverkennbar adligen Offiziers vorgeht, der gerade siegreich aus einer Schlacht zurückgekehrt ist.
Als Baduna Pavneli das sah, stellte er sich hinter den Rücken des Offiziers zu dem Dutzend Schaulustiger, das sich um den Offizier versammelt hatte. Da stand er genau vor dem Fenster der Kutsche, nämlich dort, wo der von seinen Schwerthieben aufgekratzte Offizier fortwährend hinsah. Die Ermittlungen ergaben keine Antwort auf die Frage, ob der junge Edelmann absichtlich dort gestanden hatte oder ob es nahe dem Kojori-Tor einfach keinen anderen Platz gegeben hatte.
Im Büro des Statthalters wurde niemand klug aus der Abschrift von Pavnelis Vernehmung, die mithilfe eines Dolmetschers stattgefunden hatte. Pavneli hatte Folgendes erklärt: „Vor über neunhundert Jahren schenkte mein Vorfahr dem Schiomghwimi-Kloster vier Dörfer. In ähnlicher Weise gehört der Boden, auf dem ich stand, der Familie Zizischwili. Wenn also zwischen mir und dem Offizier irgendetwas geschah, dann ist es Aufgabe der Zizischwilis, es zu ermitteln.“
Das Land gehörte in der Tat der Familie Zizischwili. Die Angestellten des Statthalters waren so verunsichert, dass sie verschiedene Fürsten der Zizischwilis befragten und das altgeorgische Strafgesetzbuch zurate zogen, um ein besseres Verständnis davon zu erlangen, wie schwerwiegend das Verbrechen war, das der junge Pavneli begangen hatte.
In jedem Fall hatte sich Baduna Pavneli vor die Kutsche gestellt. Als der Offizier fertig damit war, den Stand zu verwüsten, langte er in seine Hosentasche, zog einige Geldscheine heraus und warf sie dem persischen Händler, der noch immer am Boden kauerte, vor die Füße. Dann spießte er mit seinem Schwert ein großes Stück türkischen Honigs auf, reckte seine Beute in die Luft und wirbelte geschickt damit herum, bevor er erneut zur Kutsche hinübersah und, die Mütze wieder auf dem Kopf, stolz darauf zuging.
Die Menge teilte sich, um ihn durchzulassen, bis auf einen Mann, der zwischen ihm und der Tür der Kutsche stehen blieb. Dieser Mann war Baduna Pavneli.
„Macht Platz, Herr! Macht Platz!“, rief der Offizier, aber Pavneli lächelte nur.
Der Oberst glaubte natürlich, dass der junge Pavneli die Tür der Kutsche absichtlich verstellt hatte, konnte es aber nicht beweisen.
Um die gebotene Diskretion zu wahren, wurden die Namen der Insassen der Kutsche nirgends erwähnt und auch dem Oberst stand es nicht zu, sie preiszugeben.
Eigentlich hatte sich der Offizier nur an den Süßigkeiten bedienen wollen. Aber niemand konnte den Oberst von seiner Überzeugung abbringen, dass hier zwei Rivalen ein Duell um die Zuneigung einer Dame ausgetragen hatten. Zumal Pavnelis Antworten komplett unerwartet waren und die Verdächtigungen des Obersts begannen, sein Urteilsvermögen zu trüben.
„Macht Platz, Herr! Macht Platz!“
3
Leutnant Gekht starb im Spital der Kaserne an der ihm zugefügten Wunde, nur etwa fünfzehn Meter von dem Raum entfernt, in dem die Soldaten Baduna Pavneli nun gefangen hielten. Bevor er starb, schaffte es der Leutnant noch, dem Oberst einen Brief zu schreiben, in dem er das Geschehene als zufällig und als unerwartetes Duell beschrieb und darum bat, seinem Gegner gegenüber, mit dem sich ein simples Missverständnis ergeben habe, Milde walten zu lassen. In seinem kurzen, verworrenen Schreiben erwähnte Leutnant Gekht weder die Kutsche noch die Dame oder Damen darin und erwies sich so als ein Mann von Ehre. Er bat außerdem darum, seinen Gegner zu treffen und zu sprechen, was ihm das Büro des Statthalters aus Gründen untersagte, die sich niemandem so recht erschlossen. Das überzeugte den Oberst nur noch mehr davon, dass der junge Pavneli den Leutnant schon vor dem Duell gekannt und ihm an diesem Tag aufgelauert hatte, um sich dieses Rivalen ein für alle Mal zu entledigen.
Als Pavnelis einflussreiche Paten – von denen einer bereits zum General in der russischen Armee aufgestiegen war – anfingen, sich für diesen einzusetzen, wurde deutlich, dass das Büro des Vizekönigs selbst die ganze Angelegenheit herunterspielen, gleichsam unter den Teppich kehren wollte. Daraus konnte der mit den Ermittlungen betraute Oberst schließen, dass Pavneli ungestraft davonkommen würde.
Der Oberst versuchte dennoch sein Bestes. Leutnant Gekht war im Regiment sehr beliebt gewesen. Er mochte den Süßwarenstand zertrümmert haben, das machte er allerdings mit seinem Einsatz in der Schlacht um Jerewan auf das Vortrefflichste wett, außerdem beglich er seine Schulden beim Kartenspiel immer sofort.
Es war ein kurzer Schwertkampf gewesen.
Der junge Pavneli sagte dem Oberst, er habe den Batzen türkischen Honigs auf dem Schwert des Leutnants überhaupt nicht gesehen, außerdem habe er den Offizier für einen Fremden gehalten, der aus heiterem Himmel zugeschlagen habe.
Er war einen Schritt zurückgetreten, hatte ein Knie gebeugt und sein Schwert gezogen. Nach dem Vernehmungsprotokoll hatte von den Schaulustigen niemand etwas gesehen, nur gehört, wie Stahl auf Stahl schlug. Zweimal. Es war der dritte Hieb, der Leutnant Gekhts tödliche Wunde verursachte. Er erstarrte, versuchte seine Pistole zu ziehen, war aber nicht mehr in der Lage dazu.
Ein Zeuge, der selbst im Umgang mit dem Schwert geschult war, beschrieb es nicht als wütenden Hieb. Pavneli war nach vorn gestürzt und hatte zugestoßen. Der Regimentsarzt bestätigte, dass es sich um eine Stichwunde handelte, eine sehr tiefe, denn das Schwert war in Gekhts Bauch eingedrungen.
Aber man konnte Pavneli nicht einfach für den Ausgang des Duells verantwortlich machen. Der Oberst dachte, dass dieser gar nicht in der Lage wäre, den Vorfall zu beschreiben, sondern nur fähig, sein eigenes Verschulden auszudrücken.
Die Ermittlungen dauerten drei Monate.
4
Aziz-Bey, müde und gelangweilt dreinschauend, saß mit verschränkten Beinen und dem Rücken zum Meer am Wasser und starrte auf das Dorf an der felsigen Küste, das sich Stück für Stück zur Stadt auswuchs. Nicht weit entfernt war am alten hölzernen Kai sein schwarzes Boot festgemacht. An Bord gingen zwei Seemänner ihrer Arbeit nach und doch schien es fast, zumindest für diesen Moment, als würde der Klang des Meeres – so vertraut und bekannt er ihm war – für ihn nicht existieren. Vor kurzem waren Aziz-Bey und seine beiden Männer von Batumi aus zu diesem Dorf gesegelt, das Poti genannt wurde. Sobald sie ihr Boot festgemacht hatten, gab Aziz-Bey einigen Kindern, die am Strand spielten, ein paar Münzen und schickte sie ins Dorf, um seinen alten Freund Ashiq-Bash zu suchen.
Wie das Glück es wollte, hielt sich Ashiq-Bash tatsächlich gerade im Dorf auf. Er hieß eigentlich gar nicht Ashiq-Bash, das war nur ein Spitzname, den Aziz-Bey ihm verpasst hatte, weil er ihn an einen alten Volkshelden gleichen Namens erinnerte. Aziz-Bey wusste, dass er ein rastloser Mann war und selten längere Zeit an einem Ort weilte, aber in diesem Fall hatte er keine andere Wahl, als einfach aufzutauchen und zu hoffen, dass Ashiq-Bash da wäre.
Aziz-Bey plante, in seinen alten Beruf zurückzukehren, der ihn lange ernährt hatte, und genau dazu war er auf Ashiq-Bash angewiesen.
Aziz-Bey war nicht mehr der Jüngste. Er war alt und hatte es satt, in den Diensten eines anderen zu stehen. Er trug einen Dolch und zwei Pistolen bei sich, die unter dem Hemd im Hosenbund steckten. Anders als viele mochte er seine Waffen nicht zur Schau stellen.
Er brauchte keinen Barbier mehr, denn unter seinem mit tausend Edelsteinen besetzten Turban hatte er keine Haare mehr. Aziz-Bey war kahl und diente dem Pascha von Batumi als Fahnenträger.
Aber das Tragen von Fahnen war keine Aufgabe für einen alten Mann und Aziz-Beys Knöchel schmerzten. Seine Handgelenke, seine Ellbogen und sein Nacken schmerzten ebenso. Er war schon oft in diesen Gewässern gesegelt, und er mochte das Meer nicht.
Als er so mit verschränkten Beinen auf der blanken Erde saß, sah Aziz-Bey, wie ein Mann aus dem Dorf auf ihn zugeritten kam.
Auch auf die Entfernung erkannte er Ashiq-Bash, seinen alten Freund und Gefährten, wie er sich im ruhigen Trab näherte.
Das war das Erstaunliche an der Eingebung: Es war nur ein Punkt am Horizont und dennoch war es eindeutig Ashiq-Bash, denn nur wenige Reiter ließen ihr Pferd sich so elegant aufbäumen, ja es fast tanzen.
„Hier bin ich und werde immer älter, während er kein bisschen gealtert zu sein scheint“, dachte Aziz-Bey und erhob sich mühsam. Er schaute auf sein Boot, sein großes, hässliches, dreckiges Boot, und übersah das Meer völlig.
An diesem Tag war die See ruhig. Auch nachts, als sie gesegelt waren, war die See ruhig gewesen.
Aziz-Bey wusste, dass irgendwo an der Küste, in der Nähe des Dorfes, ein russisches Regiment lagerte, und wollte von den Soldaten nicht gesehen werden. Der Pascha – sein Herr – verwandte keinen Gedanken darauf, in welche Gefahren sich sein Diener begab. Jetzt, da der Sultan gegen den russischen Zaren Krieg führte, war es sehr gut möglich, dass Aziz-Bey, der arme, erschöpfte, lang gediente Aziz-Bey, genau hier, an dieser Küste, getötet würde.
5
Aus irgendeinem Grund hing die Luft schwer und nach Heu duftend über Tiflis.
Pavneli sah, wie eine Mutter das Gesicht ihres Kindes mit rotem Wein wusch. In der einen Hand hielt sie eine Tonschale, goss kleine Mengen in die andere Hand und rieb dann kräftig über das Gesicht des Kindes.
Baduna erinnerte sich, wie seine Mutter sein Gesicht einmal auf die gleiche Weise gewaschen hatte.
Er ging den Hügel hinab zum Fluss, um über die Brücke in den anderen Teil der Stadt zu gelangen. Er konnte die Glocken der Metechi-Kirche läuten hören und als Antwort von der anderen Seite des Flusses das Geläut des Sioni-Doms und der Antschischati-Basilika.
In den vergangenen drei Monaten war Baduna Pavneli ein Bart gewachsen, der ihn allerdings nicht älter aussehen ließ. Er wusste ohnehin nicht, wie er aussah. Er war es nicht gewöhnt, in den Spiegel zu schauen, und hätte es, auch wenn er in der Kaserne einen zur Verfügung gehabt hätte, nicht getan. Eines jedoch bereitete ihm Vergnügen: der Gürtel um seine Hüften mit dem eingesteckten Schwert und dem Dolch. Endlich spürte er wieder ihr vertrautes Gewicht und fiel in seinen gewohnten Gang. Als er die Brücke überquerte, hielt er am Rande des Marktplatzes inne, direkt bei der Moschee. In dieser frühen Stunde war noch niemand unterwegs. Er machte kurz halt, als müsste er sich entscheiden, in welche Richtung er weitergehen wollte, dann folgte er den engen Straßen, die nun nicht mehr nach Heu, sondern nach Backwerk dufteten.
Er ging zur Heiliggeistkirche und sah vor sich die Kuppel, wie sie sich stolz erhob. Nach Badunas Berechnungen musste es Pfingsten sein. Einer seiner Verwandten war Priester in der Heiliggeistkirche; das war Pater Nimos, ein Mann in seinem Alter, aber sehr viel gebildeter und gelehrter in Glaubensfragen.
Die Luft um ihn herum war schon schwer vom Duft frischer Brote und wurde umso mehr davon erfüllt, je höher er stieg. Das war kein Stadtteil für einen hungrigen Mann.
Neben der Heiliggeistkirche buken sie heiliges Brot in riesigen Tonöfen. Es gab vier dieser Tonöfen und mit jedem Atemzug sog man den Duft ein.
Eine große Gemeinde hatte sich zur Messe in der Heiliggeistkirche versammelt. Frauen aus der Nachbarschaft, Witwen, Arme und, weil es ein Feiertag war, auch ein paar Herren, selbst wenn sie die Eucharistie viel später feiern würden. Der Priester erblickte Baduna Pavneli und war sichtlich erstaunt, aber Pavneli machte mit einer ruhigen Bewegung das Kreuzzeichen, ging hinaus, setzte sich an die Mauer der Bäckerei und schaute auf Tiflis hinunter. Er konnte den Ort sehen, an dem der russische Offizier sein Schwert zu spüren bekommen hatte, und bemerkte wieder, wie hungrig er war, aber er wollte hier noch kein Brot kaufen.
Dann schlief Baduna Pavneli ein und schlief, bis der Priester ihm seine Hand auf die Schulter legte und ihn herzhaft schüttelte.
„Komm mit, komm mit“, sagte er und ging schnell zur Kirchentür. Sobald sie in der Kirche waren, drehte sich der Priester brüsk um und sagte: „Erwarte bloß keine leichte Absolution. Du hast etwas genommen, das Gott gegeben hat …“
Und plötzlich umarmte er Baduna und drückte ihn an seine Brust.
So standen sie eine Weile, bis der Priester sich löste und Baduna von oben bis unten musterte. Er hob die Finger und berührte Badunas Bart.
Baduna Pavneli war dünn und sah anders aus als sonst. Er sagte nichts.
„Du hast nicht einmal deine Taufpaten besucht und sie sagen, dass sie dich auch nicht sehen wollen. Sie haben Blut geschwitzt bei dem Versuch dich zu befreien“, sagte der Priester. „Jetzt musst du im Dorf bleiben, bleib einfach hier, denk über alles nach, lerne. Arbeite auf deine Absolution hin. Du musst Tiflis bei Anbruch der Nacht verlassen, oder die Russen werden nicht zögern, dich ins Exil zu schicken.“
„Bei Anbruch der Nacht?“ Pavneli schien überrascht.
„Warum bei Anbruch der Nacht?“
Der Priester schaute ihn verwundert an.
„Haben sie es dir nicht gesagt? Du wurdest in dein Dorf verbannt und darfst es nie mehr verlassen.“
„Ja, das sagten sie mir“, sagte Pavneli, „aber ich kann Tadia sicher mitnehmen? Darf ich Tadia nicht sehen?“
„Ich habe Tadia letzte Woche besucht. Ihm geht es gut.“ Der Priester schaute nachdenklich. „Aber daran habe ich nicht gedacht.“
„Ja, Tadia. Ich nahm an, ich könnte ihn mitnehmen.“ Der Priester schüttelte den Kopf und bekreuzigte sich. Dann setzte sich Baduna wieder an die Mauer der Bäckerei. Er hielt ein heißes Lawasch-Brot in der einen Hand und riss mit der anderen kleine Stücke ab, die er langsam und gedankenverloren aß.
Der Priester brachte einen Tonkrug mit Wein. „Ich kann dir die Kommunion nicht erteilen. Noch nicht.“ Er dachte weiter darüber nach, was Pavneli gesagt hatte.
„Wann, liebe Erde, werde ich hierher zurückkehren?“, fragte Baduna Pavneli und sah zu Boden.
Er legte das Fladenbrot auf einen flachen Stein und stand auf. „Ich brauche ein Pferd … zwei Pferde … meins steht noch im Stall meines Taufpaten. Wie soll ich dahin gelangen?“
„Ich werde gehen“, sagte der Priester, „und ich werde dir dein Pferd bringen. Ich leihe dir auch meins. Es ist ein Maultier, denk dran …“
Sie lachten.
„Ich komme später wieder“, sagte Pavneli und ging den Hügel hinab.
Er war lange eingesperrt gewesen, was ohne Zweifel der Grund dafür war, dass der Brotduft so starke Gefühle in ihm weckte.
6
Der Pascha von Batumi hatte sich entschlossen, nach Konstantinopel zu reisen, und war damit beschäftigt, Geschenke für die Reise vorzubereiten. Als Statthalter der am weitesten entfernten, am besten versteckten, am meisten vergessenen und stillsten Provinz des osmanischen Reiches wollte er den Besuch nutzen, um Eindruck zu machen. Er hatte einen Mann vorgeschickt, der für eine angemessene Unterkunft sorgen sollte, und war nun mit seinen eigenen Vorbereitungen beschäftigt.
Der Pascha von Batumi wollte, dass ihn ein Gefolge von fünfzig Mann begleitete, wie es zu einem Mächtigen von hohem Stand passte. Die Reise selbst sollte eine unvorstellbare Summe kosten. Um die Kosten zu decken, handelte er mit etlichen Kaufleuten aus, ihm das Geld zu leihen.
Alle wussten, dass der Pascha diese Reise deshalb so dringend machen wollte, weil er hoffte, ein Heilmittel gegen seine Unfruchtbarkeit zu finden. Das war auch der Grund, keine Kosten zu scheuen. Außerdem hoffte er, den Sultan mit seinen Gaben und Geschenken zu entzücken.
Kinderlos zu sein bewegt jeden Mann, aber das traf in besonderer Weise auf den Pascha von Batumi zu, da er Georgier war und somit den Auftrag hatte, einen Sohn und Erben zu hinterlassen. Im Osmanischen Reich war es eigentlich nicht üblich, dass Ämter vom Vater auf den Sohn übergingen, aber wer sollte an dieser vergessenen Küste die Entscheidung eines Mannes infrage stellen, seinen Titel an sein Kind weiterzugeben.
So war der Vater des jetzigen Paschas schon Pascha gewesen und vor diesem dessen Vater.