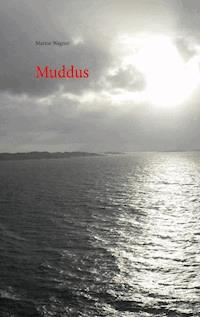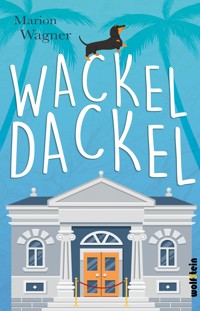
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: WOLFSTEIN
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Charlottes Leben ist in Schieflage geraten. Ihr sonst so langweiliger Ehemann Theodor ist auf der Suche nach spiritueller Erleuchtung nach Bora-Bora ausgewandert und ihr droht in ihren besten Jahren das Klimakterium. Zu allem Überfluss braucht sie auch noch einen neuen Job. Dann ist da noch der attraktive neue Nachbar mit den dunklen Tiramisu-Augen, der Charlottes Gefühlsleben in Aufruhr bringt. Arbeitssuche und Liebesleben gestalten sich turbulent, bis ein Aushilfsjob im Dackelmuseum und die Kittelschürze ihrer verstorbenen Tante Uschi eine unerwartete Wendung bringen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 376
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inahltsverzeichnis
Am Rande des Klimakteriums
Eine tickende Zeitbombe
Einhörner in Echtzeit
Bunte Zeltblusen
Frau Lüttich und das Zölibat
Betty Boobs und ihre Freunde
Schweinkram
Dann lieber Modern Talking
Problemzonen einer Ehe
Männerfreundschaft
Königsjodler
Der Nackedei-Laufsteg
Ein altersschwacher Luftballon
Herabstürzende Bauteile und holländische Muffins
Mental instabil
Manövergrüne Hässlichkeiten
Meine innere Event-Managerin
Glatzköpfe mit Nelkensträußchen
Verfröhlichung
Ein Kindörspiel
Schleimige Horden
Eine Reise zurück in der Zeit
Der Ameisen-Marschbefehl
Französische Schimpfwörter
Arme Josefine
Der Hühnerdieb
Hauptsache, Bambi war glücklich
Kernschmelze
Penelope, der Mond und ich
Sangria für den Frauenbund
Der entlaufene Pudel
Hereingedackelt
Der Höllenschlund ist aufgetan
Alles bestens
Das süßeste Mädchen der Schule
Säbelzahntiger
Die Bedeutung von Tiramisu
Die virale Kittelschürze
Zwei tundrische Schafhirten
Die Gründung der Kittelschürzen-Republik
Satanische Gesänge
Liebevolle Schwingungen
Marion Wagner wurde im niederbayerischen Passau geboren. Sie lebt mit ihrer Familie sowie zwei Katzen und vier Hühnern in einem kleinen Dorf in der Nähe der Dreiflüssestadt. Ihren Beruf als Assistentin der Personalleitung in einem Industriebetrieb übt sie in Teilzeit aus.
Vollständige e-Book-Ausgabe 2023
Copyright © 2023 WOLFSTEIN
ein Imprint der Spielberg Verlagsgruppe, Neumarkt
Lektorat: Kati Auerswald
Umschlaggestaltung: © Ria Raven, www.riaraven.de
Bildmaterial: © shutterstock.com
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
(e-Book) ISBN: 978-3-95452-121-0
www.spielberg-verlag.de
Am Rande des Klimakteriums
Mein Gynäkologe heißt Herr Dr. Steinmeier, wie unser Bundespräsident, und er sieht auch ein bisschen so aus. Er ist ein netter älterer Herr mit weißem Haar und runder Brille, der erfreulich wenige Worte über sein Tun verliert, dieses ohne unnötige Verzögerung erledigt und jederzeit geneigt ist, mit seinem Kopf zwischen meinen Oberschenkeln den Klimawandel zu diskutieren. Ich habe im Laufe der Jahre eine sehr professionelle Routine entwickelt, den Gynäkologen während der Untersuchung in ein anregendes Gespräch über das Tagesgeschehen zu verwickeln, oder notfalls auch über das Wetter. Es gibt reichlich Themen, die sich ganz wunderbar zwischen Abstrich und Brustultraschall besprechen lassen. Wichtig dabei ist, dass er nicht auf die Idee kommt, die Beschaffenheit meiner Eierstöcke mit mir zu diskutieren. Das hat bislang immer prima funktioniert.
Nun, heute ist alles anders. Mein überaus geschätzter Herr Dr. Steinmeier ist durch einen Bandscheibenvorfall außer Gefecht gesetzt (wie ich vermute war hier die berufsbedingt stets leicht vorwärts geneigte Körperhaltung nicht gerade hilfreich, womöglich sogar ursächlich). Seine Vertretung hat ein recht junger und offenbar noch völlig unverbrauchter Arzt mit einem Doppelnamen übernommen. Ich war von der Nachricht, dass heute ein vollkommen Fremder das Spekulum in mein Innerstes führen würde, derart überfahren, dass ich mir den Namen nicht gemerkt habe.
Schon die Vorbesprechung, die sich bei Herrn Dr. Steinmeier normalerweise auf den Dialog: «Passt alles, Frau Kiebitz?» – «Alles bestens» – «Na, dann wollen wir mal» beschränkt, hat einen zweistelligen Minutenwert beansprucht, wobei der Jüngling intensiv mit zusammengekniffenen Augen in der Akte mit meiner gynäkologischen Historie forschte und gelegentlich mit dem Zeigefinger auf offensichtlich interessante Passagen klopfte. Zum Glück hatte ich niemals irgendwelche peinlichen Geschlechtskrankheiten.
Die Untersuchung gestaltet sich nun ebenfalls weniger unterhaltsam als ich es von Herrn Dr. Steinmeier gewohnt bin. Ich habe den Stuhl erklommen. Als der Jüngling die Latexhandschuhe überstreift, starte ich den Versuch einer launigen Konversation.
«Wie wunderbar, dass heute mal wieder die Sonne scheint, nach all dem Regen, nicht wahr?»
Nachdem ich die politische und religiöse Einstellung des jungen Mannes nicht kenne und man bei den jungen Leuten nicht zwingend Kenntnisse über die aktuellen Vorgänge in den europäischen Adelshäusern voraussetzen kann, scheint mir dies ein gelungener, unverfänglicher Einstieg. Der junge Arzt reagiert jedoch nur mit einem zustimmenden Brummen. Meine Unterleibsinspektion erfordert volle Konzentration. Jedes verwendete Instrument, jeder Untersuchungsschritt und jede seiner Feststellungen werden mir nun wortreich erläutert. Es erscheint mir unhöflich, ihn zur Eile anzutreiben und darauf hinzuweisen, dass es mir grundsätzlich vollkommen egal ist, in welchem Zyklusstadium meine Eierstöcke sich gerade befinden, solange sie sich technisch einwandfrei präsentieren. Ich lasse die Beschau mit allerlei grusligem Gerät und vielsilbigen Fachausdrücken über mich ergehen und mache hin und wieder höflich «Hm-hm». Der Junge meint es nur gut. Mit ein paar Jahren Praxiserfahrung werden ihm die ausschweifenden Vorträge aus dem Gynäkologen-Lehrbuch schon noch vergehen.
Ich werde ohne sichtbare Mängel und mit einem energischen Händedruck nach Hause geschickt. Nun beschäftigt mich aber eine Bemerkung, die während des Gesprächs mehrfach fiel. Der junge Mann war zwar medizinisch enorm kompetent, aber im Fach «Das einfühlsame Patientengespräch» hat er während seines Studiums offensichtlich geschwänzt. Oder es hat ihn einfach niemand darauf hingewiesen, dass es nicht ratsam ist, seine Patientinnen auf ihr ALTER anzusprechen. Mehr als einmal wurden seine Erklärungen von der beiläufig hingeworfenen Wort-Granate «in Ihrem Alter» begleitet. Auch der Begriff «Klimakterium» ist gefallen. Wie bitte??
Ich hab´s gegoogelt: es bedeutet Wechseljahre.
Gut, es ist nicht zu leugnen: Ich, Charlotte Elvira Kiebitz, geborene Wullinger, bewege mich altersmäßig in einem Bereich, in dem ich die 50 erschreckend klar am Horizont erblicke. Er rückt mit jedem Tag näher, der Meilenstein auf dem Weg zum Greisentum. Machen wir uns nichts vor: mit 50 ist die Jugend vorbei. Würde ein 50-Jähriger eine Bank überfallen, kein Augenzeuge würde von einem «jungen Mann» als Täter berichten. Mitunter bekommt man in diesem Alter auch mal einen Sitzplatz im überfüllten Linienbus angeboten, vor allem, wenn man beigefarbene Leinenhosen trägt. Trotzdem widerstrebt mir erheblich, was Google an Informationen zum Suchbegriff «Wechseljahre» liefert. Hitzewallungen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Konzentrationsprobleme, ja sogar Zahnausfall … alles hervorgerufen durch die hormonelle Umstellung des Körpers. Verdrossen rühre ich in dem Cappuccino, den ich mir nach dem verstörenden Arztbesuch in meinem Lieblings-Café bestellt habe. Der hübsche junge Kellner hat mir freundlich zugezwinkert, als er die Tasse mit dem lustigen Kakao-Smiley auf dem Milchschaum vor mir auf den Tisch stellte. Vermutlich erinnere ich ihn an seine Oma.
Wechseljahre! Empört schnaubend reiße ich die Plastikverpackung mit dem lächerlich kleinen Keks auf, die neben der Tasse liegt. Nelli regt sich über derartig unsinnigen Plastikmüll immer fürchterlich auf. Nun, ich sehe aufregende Zeiten in unserem Haushalt auf uns zukommen, nachdem auch bei Töchterlein Nelli die Hormon-Kameraden wahrscheinlich schon die Ärmel hochkrempeln und sich startklar machen für die Pubertät. Womöglich hat Theodor gerade noch rechtzeitig seine Koffer gepackt, ehe hier die Hormonhölle losbricht.
Eine tickende Zeitbombe
Nelli ist dreizehn und damit eine tickende Zeitbombe. Jeden Moment kann es passieren, dass sie morgens die Augen aufmacht und lospubertiert. Ich beäuge sie täglich kritisch, aber im Moment scheint noch alles ruhig an der Hormonfront. Sie ist freundlich, lustig und ausgeglichen. Es hat sogar den Anschein, sie kann mich leiden. Also noch keine pubertären Anzeichen - aber es kann jeden Tag losgehen. Ich habe mir daher überlegt, ihr vorsorglich ein Tagebuch zu schenken. Es mag ein wenig altmodisch anmuten, aber vielleicht findet meine Tochter es hilfreich, ebenso wie ich in ihrem Alter, die inneren Gewitterstürme durch das schriftliche Formulieren zu zähmen. Auf Papier gebannt verliert so manches Drama an Dimension.
Ich erinnere mich noch genau an mein allererstes Tagebuch: es war wunderschön, hellblau satiniert, und besaß ein ausgesprochen praktisches Accessoire: ein kleines Vorhängeschloss. Ich war über diese Extravaganz entzückt, kam es doch gerade zu der Zeit, da sich mein minderjähriges Herz erstmals für das andere Geschlecht erwärmte. Ich war zwölf, also ungefähr so alt wie Nelli. Meine Einträge beschäftigen sich in erster Linie mit der Analyse der Worte und Taten meiner großen Liebe Franzi. Er lebte in der Nachbarschaft und war der mit Abstand schönste Vierzehnjährige auf Erden. Mein hellblaues Büchlein erfuhr bis ins kleinste Detail, wie wunderschön seine dunklen Schokoladen-Augen glänzten, und dass ich die blöde Dörthe nicht leiden konnte, weil mein Franzi ihr in meinem Beisein ein Kompliment über ihre neue Frisur gemacht hatte. Ich fand ja, der Wischmopp meiner Mutter war besser frisiert und konnte in diesem Moment nicht umhin, an Franzis Urteilsvermögen zu zweifeln. Nachdem ich meine zahlreichen Liebesleiden und -freuden mit rosaroter Tinte zu Papier gebracht hatte, klappte ich das Büchlein zu, drehte feierlich den winzigen Schlüssel in dem winzigen Schloss um, und verriegelte so meine romantischen Geheimnisse vor der Welt. Das Schlüsselchen ruhte an einer zarten Kette an meiner Brust. Oh ja, ich habe das Büchlein geliebt. Die Exklusiv-Berichterstattung darin wandte sich nach einer gewissen Zeit übrigens mangels befriedigender Ergebnisse von dem dunkelhaarigen Franzi ab und dem blonden, nicht minder schönen Peter zu. Zwölfjährige können so wankelmütig sein!
Wenig später, als die Pubertätshormone in meiner Gefühlswelt für den ein oder anderen emotionalen Tsunami und diverse Kontinentalverschiebungen sorgten, brachte mich die Problembewältigung mittels Tagebuchs durch die wildesten Stürme meiner Jugend und half mir, die Depressionsgräben meiner Pubertät zu überwinden. Der Eintrag anlässlich der Auflösung von Modern Talking zum Beispiel war an ehrlich empfundener Dramatik nicht zu überbieten.
Ich habe für Nelli ein Buch gewählt, das durch seinen abgenutzt wirkenden Ledereinband ein wenig an die Zauberbücher von Harry Potter erinnert. Nelli liebt die Geschichten von dem Zauberschüler, hat alle Bücher gelesen und Filme gesehen, trägt in den Wintermonaten einen gestreiften Hogwarts-Schal in den Farben von Gryffindor und hat zuletzt wiederholt den Wunsch nach einer eigenen Schnee-Eule geäußert. Nachdem sie allerdings im Internet nachgelesen hat, dass Eulen mehrmals täglich Lebendfutter in Form von putzigen, knopfäugigen Mäusen verlangen, begrub sie diesen Wunsch schaudernd.
Nelli beißt gerade in ihr Erdbeermarmeladenbrot, als ich ihr das Buch auf den Tisch lege. «Hier, für dich.»
«Boah, cool! Ein Zauberbuch! Verteidigung gegen die dunklen Künste oder Zaubertränke?», fragt Nelli mampfend.
«Das entscheidest du. Bisher steht noch nichts drin. Aber vielleicht magst du ja mal irgendwas aufschreiben. Es ist ein Tagebuch», bewerbe ich mein Geschenk. «Und sprich bitte nicht mit vollem Mund», füge ich hinzu. Man hat schließlich einen Erziehungsauftrag.
Nelli guckt ein wenig ratlos und blättert in den leeren Seiten.
«Hmpflt», äußert sie schließlich diplomatisch. Mehr ginge gerade auch nicht, denn sie hat immer noch den Mund voller Brotkrümel. Ich nehme an, das heißt «Vielleicht.»
Einhörner in Echtzeit
Theodor ist am Telefon. Noch vor ein paar Jahren hätte ihn der Anruf ein Vermögen gekostet, aber ein Whats-App-Telefonat ist auch aus Französisch-Polynesien kostenlos. Bora-Bora, um genau zu sein.
«Hallo Charlotte, na wie geht es euch?», begrüßt mich mein Noch-Ehemann im Plauderton.
«Alles okay», nuschle ich an den Müsliriegelkrümeln vorbei, die sich in meinem Mund gerade auf die Suche nach einem bequemen Plätzchen zum Überwintern in den Zahnzwischenräumen machen. «Ich backe gerade supergesunde, ballaststoffreiche Müsliriegel für Nellis Klassenfrühstück. Seltsamerweise stehen die Kids da drauf, obwohl keinerlei Schokolade enthalten ist. Und bei dir?»
«Oh, es ist wunderbar. Das Meer hat eine so unglaubliche Kraft und eine … transportierende Wirkung.»
Ich verkneife mir eine launige Bemerkung, denn ich weiß, Theodor meint etwas Spirituelles. Vermutlich schickt er schlechte Schwingungen hinaus aufs Meer und erhält sie frisch gewaschen zurück. Im Hintergrund ist Wellenrauschen zu hören.
«Du, ist Nelli in der Nähe? Ich kann sie nicht erreichen.»
Ich versuche, nicht neidisch zu sein, als ich mein Handy an Nelli weiterreiche, denn auf meiner – meteorologisch weniger begünstigten – Erdhalbkugel ist das einzige Rauschen das des Regens, der schon den ganzen Tag gegen die Fensterscheiben prasselt.
Ich kann das grundsätzlich nur ganz schlecht verkraften: Urlaubsgrüße aus exotischen Ländern mit enthusiastischen Beschreibungen von traumhaften Stränden, luxuriösen Hotelanlagen und permanent schönem Wetter. Sie dienen meiner Meinung nach nur dazu, den Daheimgebliebenen ihr eigenes Elend vor Augen zu führen. Ich muss dem Absender einer solchen Nachricht schon sehr gewogen sein, um ihm die Taktlosigkeit zu vergeben, die eine ausschweifende Huldigung des Hotel-Pools und der unverdrossen vom Himmel lachenden Sonne darstellen, wenn ich zur gleichen Zeit allmorgendlich mit vereisten Windschutzscheiben kämpfe und meinen Schal bis zur Nasenspitze hochziehe, um keine Eiskristallbildung in meinen Mundwinkelfalten zu riskieren. Früher erhielt man Ansichtskarten, die wochenlang in Postsäcken unterwegs gewesen waren. Man konnte sich also damit trösten, dass die Urlaubsbräune des Absenders zwischenzeitlich längst verblasst war, und er/sie mittlerweile ebenfalls mit den Widrigkeiten des deutschen Winters zu kämpfen hatte, statt cocktail-schlürfend an einem Hotelpool zu fläzen. Dank der modernen Technik wie WhatsApp oder Facebook erfolgt der Gruß vom Pool heutzutage aber leider in Echtzeit. Das Selfie von dem Urlaubenden, der gerade unter Palmen auf einem aufblasbaren Einhorn in den Wellen dümpelt, ist nur wenige Sekunden entstanden, ehe die Daheimgebliebene – also ich – durch knietiefe Schneemassen stapft, um die Schneeschaufel aus dem Schuppen zu holen.
Möglicherweise ist es eine Art Defekt, etwa ein fehlender Baustein in meiner DNA, der mir das Gefühl tiefer Freude über den Karibikschnorchelspaß meiner Mitmenschen verwehrt. Meine Akzeptanz gegenüber bunt bebilderten Urlaubsgrüßen steigt jedoch in direkter Relation zur Außentemperatur. Wenn ich Flip-Flops an den Füßen habe, kann ich Bilder von Pool-Einhörnern prima tolerieren. Ich bin im Grunde überhaupt ein sehr duldsamer Mensch und kann über vieles problemlos hinwegsehen. Naive Malerei, Enthaarungscremes, geblümte Bettwäsche, volkstümlichen Schlager … Mich stören noch nicht einmal Mitmenschen, die weiße Socken zu schwarzen Halbschuhen tragen. Das mag daran liegen, dass ich einst in jungen Jahren, nachdem Modern Talking sich getrennt hatten und ich somit orientierungslos und idolberaubt durch die Pubertät irrte, Michael Jackson und seine Glitzersocken ziemlich super fand.
Ich akzeptiere sogar meinen in die Südsee ausgewanderten Ehemann. Was bleibt mir auch anderes übrig.
Es ist noch gar nicht so lange her, da packte Theodor jeden Morgen seine gelbe Brotdose mit dem Hogwarts-Wappen (ein Geschenk von Nelli) in seine abgewetzte Ledertasche, küsste mich zum Abschied flüchtig auf die Wange und machte sich auf den Weg in sein Büro, um dort Bilanzen zu prüfen, oder was man als Bilanzbuchhalter bei einem Steuerprüfungsunternehmen halt so macht. Staubtrockene und hochkomplizierte Materie mit für mich nicht nachzuvollziehender Kalkulationsakrobatik. Mir fehlt jeder Bezug zu Zahlen. Wird beispielsweise in einer Fernsehsendung die Entfernung vom Mars zur Erde genannt, dann wird die genannte Zahl der Kilometer (die ich jetzt natürlich nicht parat habe) in meinem internen Speicher sofort durch den variablen Wert «sehr sehr viel» ersetzt. Alternativ, wenn die Superlative nicht ganz so extrem ist, gibt es noch die Kategorie «sehr viel» oder «relativ viel». Oder im umgekehrten Fall einer geringen Wertangabe «sehr wenig» oder «sehr sehr wenig». Theodor ist anders. Er hört eine Zahl und speichert sie im Langzeitgedächtnis, wo sie zu jeder Tages- und Nachtzeit abrufbar bereitsteht. Würde man ihn nachts um zwei Uhr wecken und nach der Population der Madegassischen Schnabelbrust-Schildkröte befragen, oder der Einwohnerzahl von Norwegen, er hätte die Angaben parat. Wir haben zu beiden Themen Fernsehbeiträge zusammen angeschaut. Ich weiß nur noch, es waren sehr sehr wenige Tiere und relativ wenige Norweger.
Theodor ist Superbrain. Theodor ist zuverlässig. Theodor ist korrekt. Ja, man könnte sagen, Theodor ist ein bisschen langweilig. Und jetzt ist er Klangschalentherapeut auf Bora-Bora.
Bunte Zeltblusen
Den Umstand, in Scheidung von einem spätberufenen Hippie zu leben, der seine Chakren nur unter Palmen befriedigend einschwingen kann, darf man als Betroffene denke ich getrost als Widrigkeit bezeichnen. Wenn sich zu diesem Ärgernis auch noch der unerquickliche Zustand der Arbeitslosigkeit gesellt, ist es unvermeidlich – wenn keine Minderjährigen anwesend sind – hin und wieder mal ein paar Kraftausdrücke zu benutzen.
Die zweite Hälfte des fünften Lebensjahrzehnts ist kein günstiger Zeitpunkt, sich auf dem Arbeitsmarkt zu werfen, wie ich feststellen musste. Insbesondere in meinem Beruf ist enorm viel attraktives Frischfleisch im Angebot. Oh, ich fürchte, das war sexistisch. Also nochmal politisch korrekt: es gibt viele junge Frauen, die sich für den Beruf der Assistentin interessieren und bedauerlicherweise auch noch hervorragende Qualifikationen mitbringen. Ich erkenne vollkommen neidlos an (okay, das ist gelogen), dass einige der jungen Damen, wie mir zu Ohren kam, nicht nur den schwankungsfreien Gang auf High Heels, sondern zudem die Anwendung von Pivot-Tabellen beherrschen. Ich könnte nicht mal genau sagen, was das eigentlich ist. Als ich in dem Beruf anfing, waren die meines Wissens noch gar nicht erfunden.
Während ich damals, mit Mitte 20, noch als «Frischfleisch» durchging, hatte sich meine Vorgängerin, Frau Mömmlinger, im Laufe der Jahre den Status eines Cerberus erworben. Sie wogte in aufdringlich gemusterten Zeltblusen durch die Gänge der Firma und sparte weder an Make-Up noch an Haarspray für ihre beeindruckende Turmfrisur. Ihr Nerzmäntelchen ließ immerhin auf eine gewisse Lukrativität der Anstellung schließen, aus der sie sich nun aus Altersgründen verabschiedete. Mit viel Farbe im streng blickenden Gesicht wachte sie unerbittlich vor der Bürotür des Chefs. Große Loyalität zeichnete sie aus, jedoch gepaart mit einer Neigung zum Eingeschnapptsein, die sich chefseitig durch eine angemessen große Schachtel Pralinen aber mühelos wieder ausbügeln ließ. Das wirkte sich mit den Jahren unweigerlich auf den Taillenumfang aus, daher kamen irgendwann zwangsläufig die bunten Zeltblusen ins Spiel. Frau Mömmlinger war gefürchtet, aber sie hatte für diejenigen, die sie in ihr unter der üppigen Oberweite verborgenes Herz geschlossen hatte, stets Gummibärchen und im Notfall auch Hansaplast oder ein Blutdruckmessgerät in der Schublade.
Und ich? Nun, mein Fürsorgetrieb ist leider arg unterentwickelt, zumindest wenn es um erwachsene Männer geht. (Bei unter Dreijährigen laufe ich dagegen zur Hochform auf. Meine Guguck-Dadaaa-Animation ist, in aller Bescheidenheit, legendär.) Nur einmal, als meinen Chef eine Dienstreise nach Finnland führte, verspürte ich ein wenig Anteilnahme. Ich sorgte mich bei der Vorstellung, wie mein dicklicher Chef dort, sich den Landesgepflogenheiten unterwerfend, in brüllheißen Dampfbädern mit gut gelaunten, weil dampfsauna-erprobten finnischen Geschäftspartnern ausharren musste. Ein weißes Frottee-Badetuch um die rundlichen Hüften geschlungen, über dem das Kugelbäuchlein sich schweißüberströmt wölbte; Sturzbäche salzigen, verzweifelten Schweißes auf dem spärlich behaarten Haupt; nach dem Dampfbad erschöpft auf einem Rentier zu der gemieteten Blockhütte reitend … so stellte ich ihn mir vor und hatte Mitleid.
Außerdem wird jedes Gummibärchen, das in meine Reichweite gelangt, von mir persönlich vertilgt. Aufgrund einer höchst bedauerlichen Inkompatibilität meiner Füße mit schicken High Heels kriege ich noch nicht mal den Teil mit den Pumps richtig hin. Meine Füße sind leider so breit, dass jeder italienischer Edelschuhdesigner kapituliert. Nachdem mir jedoch nie Beschwerden zu Ohren gekommen sind, ging es für meinen Chef wohl in Ordnung, dass er all die Jahre ohne angemessene Gummibärchen-Grundversorgung und Pumps-Pirouetten auskommen musste. Dafür hat er mit mir im Vorzimmer viel Geld für Pralinen gespart, denn durch mein tendenziell eher positives Gemüt (wer über Jahre hinweg Guguck-Dadaaa im Dauerbetrieb aufgeführt hat, den bringt so schnell nichts mehr aus der Ruhe) ergab sich kaum je die Notwendigkeit, Schokolade zur Wahrung des Betriebsfriedens zu liefern. Das ist gut so, denn bunte Zeltblusen stehen mir nicht besonders.
Mein Chef hieß … Ach nein, das klingt ja, als wäre er verstorben. Und das ist er ganz und gar nicht, im Gegenteil. Wie man hört, hält er sich im oberbayerischen Voralpenland auf und genießt sein Rentnerdasein mit ausgedehnten Bergwanderungen, Murmeltierbeobachtung sowie fröhlichem Enziankonsum. Der Schnaps, nicht die Pflanze. Also, der Mann, der mein Chef war, heißt Dr. Ludwig Kraut. Das würde ich nicht besonders betonen, wenn wir in Berlin oder Hamburg wären. Lebt man dagegen im südlichen Teil der Republik, ist der Name ein regelrechter Schenkelklopfer. Der schöne Name Ludwig wird hierzulande nämlich gerne zu «Wiggerl» verniedlicht. Zudem neigt der Bayer dazu, die Reihenfolge der Namen umzukehren. Man sagt also nicht, ich bin die Charlotte Kiebitz, sondern in Bayern muss es heißen: die Kiebitz Charlotte. Ja, und so wird aus dem Herrn Ludwig Kraut der Kraut Wiggerl. Was wiederum zugleich, wenn auch in anderer Schreibweise, der Name eines sehr leckeren bayerischen Traditionsgerichtes ist – nördlich der alt-bayerischen Kulturgrenze als Kohlroulade geläufig. Natürlich sprach die Belegschaft den Chef stets respektvoll mit «Herr Dr. Kraut» an. Diesem war durchaus bekannt, dass er in der Kaffeeküche und nach Feierabend als «Krautwiggerl» bezeichnet wurde. Da es jedoch viel schlimmere Pseudonyme für Vorgesetzte gibt – ich kenne Herren, die sind allgemein als «der blöde Doofkopf» oder «die alte Sackratte» geläufig – war das für ihn aber in Ordnung. Er war ein toller Chef. Nicht besonders groß, mollig und mit einem spitzbübischen Humor, weitgehend haar-, und leider auch kinderlos. Das war das Dilemma. Als er sich dem Rentenalter näherte, begann sich abzuzeichnen, dass sich kein Nachfolger für sein Architekturbüro finden lassen würde. Er legte daher allen Mitarbeitern frühzeitig ans Herz, sich nach einer neuen Arbeitsstelle umzusehen. Und so verwaiste ein Schreibtisch nach dem anderen in den Büroräumen. Ich verspeiste unzählige Abschieds-Muffins, trank flaschenweise Ausstands-Piccolöchen, sang mehrfach angeschickert Jolly Good Fellow – und blieb. Irgendwann kam der Tag, an dem ich nur noch ins Büro ging, um die letzten verstaubten Gummibärchen in meiner Schreibtisch-Schublade aufzuessen. Ich bekam meine Papiere und die erste, etwas ungelenke Umarmung vom Krautwiggerl in unserer Arbeitsbeziehung.
«Liebe Frau Kiebitz, es tut mir in der Seele weh, Sie der Obhut der Agentur für Arbeit zu überantworten. Sie sind eine Spitzenkraft, man wird sicherlich in Bälde eine angemessene Position für Sie finden!» Bekräftigend ließ er seine Hosenträger schnalzen, tätschelte mir den Rücken und setzte seinen Hut auf. Der Gamsbart vibrierte ergriffen.
Man möchte meinen, mit jahrzehntelanger Berufserfahrung wäre man so etwas wie ein Rolls Royce auf dem Arbeitsmarkt. Erfahrung, Zuverlässigkeit und erprobte Technik! Wie sich in den letzten Wochen herausgestellt hat, sind Oldtimer jedoch unabhängig von ihrer Laufleistung nur schwer vermittelbar. Es reißt zum Beispiel heute niemanden mehr vom Stuhl, dass ich Anfang der Neunziger bayerische Meisterin im Stenografieren war. Im Gegenteil, man muss Glück haben, jemanden zu finden, der das Wort noch kennt und es nicht für ein ausgefallenes Hobby wie das Bemalen von Tee-Untertassen hält. Auch Diktate vom Band waren für mich dank souveräner Beherrschung des Zehnfinger-Tippsystems stets eine Leichtigkeit. Zum Glück war mein Krautwiggerl der modernen Technik stets zugetan, und so verschwand die mechanische Schreibmaschine mit dem hängenden «s» und dem klemmenden «p» recht schnell und machte einem todschicken Computer Platz. Ich kann mich noch gut erinnern, wie meine Kollegen und ich uns begeistert vor dem Bildschirm versammelten, um verschiedene Schriftarten, -farben, -formatierungen und -größen unter begeistertem Jubel auszuprobieren. Was man mit der modernen Textverarbeitung alles anstellen konnte! Jeder Brief wurde zum Kunstwerk, und auch wenn mich der Krautwiggerl oft für meine Kreativität lobte, so bat er doch darum, ich möge mich innerhalb eines Textabschnitts auf nur eine Schriftart beschränken und von der Verwendung wild gemusterter Hintergrund-Designvorlagen absehen. Corporate Design war zwar damals noch nicht erfunden, trotzdem machte eine Schriftart mit lustigen Schneemützchen auf den Buchstaben in Geschäftsbriefen keinen professionellen Eindruck, das sah ich ein.
Auch mein Diplom über den erfolgreichen Besuch eines Abendkurses in Textverarbeitung aus dem Jahr 1996 stieß bei der für mich zuständigen Sachbearbeiterin von der Arbeitsagentur, Frau Lüttich, auf eher geringes Interesse. Sie lächelte nachsichtig und legte es zur Seite. Ebenso das Zertifikat für den Kursbesuch «Internet für Einsteiger».
Unser Chef hatte für unseren schicken PC irgendwann auch ein Modem angeschafft. Ein unscheinbares Kästchen, das unter beängstigendem Knattern, Pfeifen und Jaulen die Verbindung ins World Wide Web herstellen konnte. Ich wusste nicht so recht, was ich damit anfangen sollte, und so nahm mich unsere Auszubildende, die Jessica, zur Seite, um mir das Wesen und die Funktionsweise einer E-Mail zu erklären. Da stand ein Mädel vor mir, das noch mit karottenbreiverschmiertem Mund in ihrer Alete-Schüssel herumgekleckst hatte, als ich schon alle Texte von Modern Talking auswendig hersingen konnte – und erklärte mir, dass es eine Möglichkeit geben sollte, einen Brief in Sekundenschnelle per Mausklick ins Empfängerpostfach zu befördern. Unfassbar! Versonnen dachte ich an meine Kindheit zurück, in der ich rege Brieffreundschaften gepflegt hatte. Sobald die Tinte auf dem Papier mit dem Blümchen-Motiv getrocknet war, wurde der Brief sorgfältig in ein ebenfalls blümchengemustertes Kuvert gesteckt. Dann trug die kleine Charlotte diesen stolz zum Postamt, wo der freundliche Schalterbeamte das Design mit einer hübschen Marke abrundete, ehe er das Schreiben auf den Weg schickte. Sollten die Kinder fürderhin auf diese Freuden verzichten? Schlimm genug, dass sie ohne Modern Talking aufwachsen mussten – aber auch ohne Blümchen-Briefpapier und den wöchentlichen Gang zur Post? Mir schien das ein herber Verlust an Lebensqualität. Aber im dienstlichen Kontext durchaus sinnvoll, keine Frage. Ich packte meine Disketten in die Schublade und schaltete das Modem ein.
Digitale Outlook-Kalender haben die Terminplanung in Papierbüchlein verdrängt. Von den Wählscheibentelefonen bis zur Skype-Telefonie war es ein langer Weg. Und wenn ich Nelli erzähle, dass es einst eine Zeit gab, in der niemand ein Smartphone besaß, dann starrt sie mich an, als wäre mir mit einem Plopp eine zweite Nase gewachsen.
Ich habe jeden technischen Fortschritt interessiert aufgenommen, erlernt und angewandt. Nur die Erfindung der Tabellenkalkulation ist mir wohl entgangen.
Kurz nach dem wenig ermutigenden Erstgespräch mit Frau Lüttich dachte ich, eine ebenso simple wie einträgliche Einnahmequelle entdeckt zu haben, die meine naturgegebene Mitteilungsfreude in gewinnbringende Bahnen lenken würde: Bloggen. Das habe ich eher zufällig entdeckt, als ich in einem Wartezimmer in einer Zeitschrift blätterte. Wenn um mich herum alles röchelt und schnieft oder lädierte Gliedmaßen beklagt, sitze ich auf meinem Stühlchen und blättere – ebenfalls schniefend oder siechend, aber konzentriert – in all den Illustrierten, die ich mir selbst niemals kaufen würde, und versuche, mich im Zeitraffer über alles, was sich in der Welt der Reichen, Schönen und Adligen ereignet hat, auf den neuesten Stand zu bringen. Nachdem ich recht selten krank bin, ist mein Nachholbedarf meist enorm. Glücklicherweise kann ich zwischen die Arzt- immer noch ein paar Friseurbesuche streuen, sonst wären meine Wissenslücken nicht zu schließen. Es kam schon vor, dass royale Schwangerschaften beinahe komplett ausgetragen waren, ehe ich davon erfuhr!
In einem dieser Schickimicki-Hochglanz-Heftchen fiel mir ein großformatiges Bild von einer dunkelhaarigen, gar nicht mal so hübschen, aber sehr dünnen und zweifellos hippen jungen Frau auf, deren Namen ich schnurstracks wieder vergessen habe. In Erinnerung dagegen blieb mir ihre Berufsbezeichnung, die neben dem Namen stand: Sie war Bloggerin. Was mochte dieses magere Menschlein wohl Weltbewegendes verfasst haben, dass sie für den Celebrity-Teil dieser Zeitung abgelichtet wurde? Das Bild war von einem mordswichtigen Promi-Event, woraus ich folgerte: Bloggerin ist ein Beruf mit allerlei interessanten Perspektiven.
Als ich meiner Mama von dem Gedanken erzählte, tippte sie sich an die Stirn und brummte ungnädig: «Was soll denn das sein?» Sie ist ein Mensch, der auf Bewährtes pocht und sich beharrlich der Machtübernahme ihres Refugiums durch «neumodisches Glump» verweigert. In ihrer Wohnung findet man weder Computer noch Smartphone noch DVD-Player noch einen elektrischen Eierkocher. Mehr als fünf Fernsehprogramme werden von ihr bis heute nicht in Anspruch genommen, zumal Florian Silbereisen auf dem ersten Programm gesendet wird. Von irgendeiner Form der Digitalisierung in ihrem Haushalt will ich gar nicht reden. Sie würde vermutlich Schnappatmung bekommen, sollte ihr Kühlschrank eines Tages selbständig das Fehlen von aufgeschnittenem Leberkäse, Camembert oder Schokopudding beanstanden und Neubeschaffung vorschlagen. Das kann ich ihr aber nicht verübeln – ich bin selbst jemand, der sich nicht gerne mit Haushaltsgeräten unterhält. Ich erklärte also meiner Mama, der erklärten Freundin der Handkurbel, was ich selbst erst unlängst erfahren hatte: Ein Blogger ist jemand, der sein Tagebuch im Internet führt, mit regelmäßigen Beiträgen zu völlig frei wählbaren Themen. Man kann über das Liebesleben seiner Aquarienfische referieren, über den liebsten Brotaufstrich sowie dessen Zubereitung oder das Abriebverhalten von Polyesterstrümpfen auf verschiedenen Bodenbelägen. Man muss keineswegs den Kilimandscharo bestiegen haben oder der Friseur von Jogi Löw sein, um eine interessierte Leserschaft zu gewinnen. Oder wenn es sehr gut läuft, eine Einladung zu einem Promi-Event mit Gratis-Häppchen und nachgelagerter Berichterstattung in Hochglanz-Zeitschriften.
Vor meinem geistigen Auge erschienen ein roter Teppich, Blitzlichtgewitter, Champagner, Häppchen und George Clooney. Leider habe ich jedoch nie derart aufregende Dinge erlebt, die Menschen zu der Annahme verleiten, ihre Erlebnisse und Ansichten sollten der Nation nicht vorenthalten bleiben. Ich habe weder jemals die Geschicke eines Landes gelenkt noch die Hitparaden mit schmissigem Liedgut angeführt. Ich war weder mit Lothar Matthäus verheiratet noch mit Boris Becker in der Besenkammer. Ich hatte noch nicht einmal eine übermäßig schwere Kindheit, wenn man davon absieht, dass es in meiner Jugend weder Handys noch Spielkonsolen gab und nur fünf Fernsehprogramme, dafür Modern Talking und die Schwarzwaldklinik. Und Aquarienfische besitze ich auch nicht. Außerdem mag ich keinen Champagner, und George Clooney ist verheiratet. Überdies wäre es der pure Stress, wenn Fotografen meine Mundwinkelfalten ständig gnadenlos mit Blitzlicht ausleuchten würden oder ich Angst haben müsste, mir in High Heels den Halux zu versauen. So beschloss ich, auf Ruhm und Reichtum durch eine Internet-Präsenz zu verzichten und mir meine Häppchen weiterhin selbst zu schmieren. Leider wird es damit aber auch sehr unwahrscheinlich, dass ich mich jemals gemeinsam mit George Clooney auf einem roten Teppich wiederfinden werde.
Frau Lüttich wird schon etwas für mich finden. Ich bin schließlich eine Spitzenkraft.
Frau Lüttich und das Zölibat
Frau Lüttich dürfte etwa im gleichen Alter sein wie ich. Ich habe sie nicht gefragt, aber bei unserem Gespräch kann ich ihre Mundwinkelfalten näher betrachten, die meinen eigenen in Verlauf und Ausprägung sehr ähneln. Ich habe im Selbstversuch vor dem Spiegel festgestellt, dass es hilft, wenn man lächelt. Wenn die Mundwinkel nach oben gehen, verschwinden die unschönen Merkel-Furchen und verwandeln sich in sympathische Lachfalten. Leider weiß Frau Lüttich offenbar nichts davon. Aber vermutlich hat man in ihrem Job nicht viel Grund zum Lächeln. Sie ist in der Agentur für Arbeit zuständig für Arbeitssuchende in Nichtakademischen Berufen, Buchstabenkreis H bis L, und damit für mich und meine nicht von der Hand zu weisenden Defizite. Bei unserem heutigen Gespräch zieht sie meine einst so ruhmreichen und nunmehr leider wertlosen Steno-Diplome aus der Mappe und schüttelt zum wiederholten Male bedauernd den Kopf.
«Nuu, damit is´ heudzudage wirglisch keen Blumendopf mehr zu gewinn´.»
Frau Lüttich entstammt sehr offensichtlich nicht dem bayerischen Sprachraum. Ich tippe auf sächsisch oder hessisch oder irgendwas Rheinfränkisches. Aber sie gibt sich Mühe. Nun, dass die Lorbeeren meiner Jugend heutzutage nicht viel mehr als welkes Laub darstellen, das hatten wir ja schon besprochen. Wie vergänglich sind Können und Wissen! Gestern war ich noch die gefeierte Steno-Queen, heute eine schwer vermittelbare Arbeitslose.
Ich muss an die ersten beiden Lebensjahre von Nelli denken: die Zeit, in der ich im Hauptberuf Mama in Vollzeit war. Auch damals musste ich feststellen, dass nahezu jede der erlernten Fertigkeiten in dem „Job“ von zeitlich sehr begrenztem Nutzen war. So war beispielsweise die Fähigkeit, mitten in der Nacht mit einem laut brüllenden Kind auf dem Arm einhändig in Rekordzeit ein Fläschchen zuzubereiten – nachdem ich, einem Zombie gleich, mit hängenden Armen, zerwühltem Haar und blutunterlaufenen Augen an das Bettchen des plärrenden Säuglings geschlurft war – nach kurzer Zeit überhaupt nicht mehr gefragt. Ich habe damals außerdem gelernt, dass man ein von Blähungen gepeinigtes Babybäuchlein stets im Uhrzeigersinn massieren muss. Und dass man unweigerlich in jubelnden Beifall ausbricht, wenn die Uhrzeigerbauchmassage endlich zum befreienden Knattern im Höschen führt. Zu einer fundierten Grundausbildung gehörten selbstverständlich ein paar lustige Reime und Liedchen sowie die Bereitschaft, sich ausdauernd mit dem Guckuck-Dadaaaa-Spiel zum Kasper zu machen, um dem Kind ein vergnügtes Glucksen zu entlocken. Nun, so erfüllend all dieses Fachwissen auch sein mochte – es war aufgrund des unaufhaltsamen und auch durchaus angestrebten Heranwachsens des Kindes nicht dauerhaft nachgefragt. Genau wie Stenografieren.
Seit dem Zeitpunkt, als Nelli in den Kindergarten kam - ich die Guckguck-Dadaaa-Sache also in professionelle Hände legte - habe ich mein administratives Geschick, meine Gewissenhaftigkeit und mein tadelloses Benehmen – so steht es in meinem Arbeitszeugnis – zum Wohle des Architekturbüros Dr. Ludwig Kraut eingesetzt. Die freundliche Bescheinigung meiner Leistungen durch meinen früheren Arbeitgeber ist aber eher nebensächlich, wie mir Frau Lüttich mitteilt, im Hinblick auf meine fehlenden Tabellenkalkulationskenntnisse. Zudem wäre es ungemein hilfreich, wenn ich über Projektmanagementerfahrung verfügen würde.
«Und wie steht es denn eigendlisch mit Ihren Englisch-Kenntnissen? Isch kann in Ihren Underlaachn leider keene Information dazu finden.»
Was wohl daran liegt, dass es keine Informationen dazu gibt. Ich hatte während meiner Schulzeit einigermaßen passable Noten in dem Fach, aber danach keine Veranlassung mehr, die Sprache aktiv anzuwenden. Für die Frage nach dem Weg zum Klo hat es noch in allen Urlaubsländern gereicht (wobei ich meistens die Antwort ohnehin nicht verstand, weil die türkischen/ägyptischen /französischen Hotelangestellten meistens noch schlechter Englisch sprachen als ich). Krautwiggerls Architekturbüro war nicht international tätig, wenn man von der Finnland-Eskapade mal absieht, so dass ich ohne jegliche Fremdsprache in all den Jahren hervorragend zurechtgekommen bin.
Meine launige Antwort: «Ich kann alle Songtexte von Modern Talking auswendig!», findet Frau Lüttich gar nicht witzig. Zumindest ist keine Regung im zerfurchten Mundwinkelareal ersichtlich.
«Nuu, Frau Kiebitz, mit diesem lüggenhaften Ferdiggeidengerüst … und in Ihrem Alder …»
Sie lässt den Satz mit unheilvoll bebenden Backenfalten in der Luft hängen. Na prima. Nun ist mein Alter also nicht nur in der Gynäkologie-Praxis, sondern auch bei der Arbeitsvermittlung offiziell zum Problem deklariert. Ich würde meine Schallplattensammlung verwetten, dass Frau Lüttich auch keine Pivot-Tabellen beherrscht und auf Englisch allerhöchstens eine Wurstsemmel bestellen kann. Aber Frau Lüttich ist ja auch nicht arbeitssuchend, sondern komfortabel im deutschen Staatsdienst verbeamtet. Ich senke schuldbewusst ein wenig den Kopf, ob meiner Unzulänglichkeiten.
«Nuu, auf so viele Kurse wie isch Sie schigge müsst´, um Sie für eenen Einsatz in Ihrem Zielberuf zu erdüschdigen, das lässt sisch kaum reschdferdchien. Isch muss Sie daher darauf vorbereiten, dass isch Ihnen Dädischgeiden vorschlaachn werde, die nischd Ihrem bisherigen Berufsbild entschpreschn. Das Anforderungsbrofil ist in diesem Beräisch läider enorm anschpruchsvoll geworden, das ham Sie ja mitgekriescht.»
Ja, das habe ich. Voller Wehmut denke ich an meinen Krautwiggerl. Er war stets zufrieden gewesen mit meinem minderwertigen Leistungsprofil. Nie hat er von mir verlangt, ein Projekt zu managen oder längs- und quer-verlinkte S-Verweis-Tabellen in bunte Querschnitts-Torten-Säulendiagramme umzuwandeln. Wenn er einen gut strukturierten Terminkalender vorfand, stets das richtige Zugticket in die Hand gedrückt bekam und ich ihm sagen konnte, wo er seinen Büroschlips für Kundenbesuche hingelegt hatte, dann war er vollauf zufrieden gewesen. Was er wohl gerade macht, der Gute? Bestimmt hatte er schon sein Jodeldiplom. Fortbildung war ihm immer sehr wichtig.
Frau Lüttich tippt ein wenig in ihrem Computer herum, dann erwacht der Drucker neben ihr zum Leben und spuckt ein Blatt Papier aus, das sie mir in die Hand drückt.
«Nuu, wir können es mal hiermid probiern.»
Ich werfe einen Blick darauf. «Thekenkraft im Wellness-Hotel?»
«Nuu, isch weiß, dass dieses Angebot im Vergleisch zu Ihrer bisherigen Tädischgeid eher anschpruchslos erschäint, aber nachdem Sie allem Anscheen nach eene überdurchschniddlische Kommunikationsfreude besitzen, wäre eene Anschtellung mit reechn Publikumsverkehr doch sischerlisch eene Möglischgeid für Sie, die man in Erwächung ziehen sollte.»
Ja, da hat sie sicher recht. Aber wie ist sie nur auf den Schluss mit der Kommunikationsfreude gekommen? Wir haben uns bei unserem letzten Treffen ausgesprochen nett unterhalten. Nun, möglicherweise habe ich etwas weit ausgeholt, als sie mich bat, meine Stärken und Schwächen zu skizzieren.
Ich habe mich, und das entspricht den Tatsachen, als ungemein moralischen, von Lauterkeit und Tugenden durchdrungenen Menschen charakterisiert. Von den gesellschaftlich im allgemeinen tolerierten Sünden wie dem vorehelichen Beischlaf oder dem freitäglichen Verzehr von Fleischgerichten mal abgesehen, habe ich eine mustergültige Kartei im himmlischen Sündenregister vorzuweisen. Wobei das mit dem Fleisch eigentlich nicht wirklich zählt. Ich esse so wenig davon, dass ich, wenn mir dann doch mal ein Wiener Würstl auf den Teller hüpft, nun wirklich nicht noch auf den Kalender gucken kann, ob zufällig gerade Freitag ist, um die sündige Wurst gegebenenfalls mit gekreuzten Fingern abzuwehren und stattdessen Fischstäbchen aus dem Gefrierschlaf zu zerren. Außerdem bin ich zuversichtlich, dem Jüngsten Gericht notfalls auch den unlizenzierten vorehelichen Beischlaf plausibel machen zu können. Zum einen ist das sicherlich bereits verjährt. Zudem habe ich die Vermutung, dass in einer geheimen Schublade des Vatikans längst eine himmlische Weisung herumliegt, nach der besagte Sünde im Zuge der Neuordnung einiger Paragraphen aus dem Katalog genommen wurde, diese Anordnung jedoch vom Klerus unter Verschluss gehalten wird. Über die Gründe dafür kann ich nur spekulieren. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das Dokument möglicherweise gleichzeitig, weil thematisch verwandt, die Aufhebung des Zölibats verkündet, und das muss der auf unzählige Jahre der Entbehrung und Selbstpeitschung zurückblickenden Priesterschaft ja stinken. Ich würde genauso handeln, erführe ich heute beispielsweise, dass Tiramisu in Wahrheit die Krone der vitaminhaltigen Lebensmittel ist – und nicht der böse, verführerische, unwiderstehliche Millionen-Kalorien-Genuss, der sich ohne Zwischenstation unverzüglich auf den Hüften niederlässt. Ich würde voll Bitterkeit auf die Kämpfe zurückblicken, die ich vor unzähligen Kuchentresen ausgefochten habe. Ich würde für jedes Stück, auf das ich in meiner Unwissenheit verzichtet habe, zornige Tränen vergießen. Ich würde aus meinen Sportschuhen, den Nährwertanalyse-Tabellen, dem Weight-Watchers-Punkte-Plan und Kohlrabi ein Lagerfeuer entfachen, dessen flackernder Schein mein grimmiges Gesicht erleuchtet … Und vor allem: ich würde es für mich behalten. Ich habe jahrelang gegen diese Obsession angekämpft. Manchen Kampf habe ich gewonnen, viele verloren, und nur selten ohne Reue auf die verzehrten Mascarpone-Löffelbiskuit-Kakao-Schnitten zurückgeblickt. Soll es den nachfolgenden Generationen nicht anders gehen.
Während mein Sündenregister also eine wenig aufregende Lektüre für die himmlischen Bediensteten darstellt, müssen dem heiligen Petrus beim Studium meiner Gute-Taten-Kartei regelmäßig die Freudentränen kommen. Ich bin ein Mensch, der stets die Wahrheit spricht, zu viel herausgegebenes Wechselgeld artig zurückgibt, dem Violinenspieler in der Fußgängerzone trotz seines jämmerlichen Gefiedels ein paar Münzen in den verbeulten Hut wirft und bei Fußballspielen prinzipiell der schwächeren Mannschaft zujubelt. In aller Bescheidenheit stelle ich mir vor, wie bei meinem Ableben Petrus mich an der Himmelspforte erwartet, um mir die Ehren-Engels-Schärpe für ein besonders verdienstvolles irdisches Wirken umzuhängen.
«Aber ehe ich mich zum Jubilieren auf eine Wolke setze», beendete ich meine Ausführungen, «hätte ich gerne noch geklärt, ob es Engelskonfektion gegebenenfalls auch in Übergrößen gibt, haha.»
Dieses Späßchen sollte für ein wenig weibliche Verbundenheit sorgen. Schließlich war offensichtlich, dass auch Frau Lüttich schon der einen oder anderen Verführung am Kuchenbuffet nachgegeben haben musste. Aber Frau Lüttich war im Dienst und nicht zu Scherzen über ihre oder meine Konfektionsgröße aufgelegt.
All dies habe ich Frau Lüttich erzählt, und sie hat geduldig zugehört und sich gelegentlich Notizen gemacht. Wenn ich mich recht erinnere, hat sie gelegentlich einen Blick auf ihre Armbanduhr geworfen. Möglicherweise bin ich tatsächlich ein wenig zu sehr ins Detail gegangen.
«Okay, dann werde ich mich da mal melden», antworte ich brav und stecke den Zettel mit dem Stellenangebot in meine Handtasche. Wenn Frau Lüttich der Meinung ist, das wäre was für mich, dann werde ich nicht widersprechen. Frau Lüttich ist schließlich ein Profi.
Betty Boobs und ihre Freunde
Immerhin: ich bin nicht völlig mittellos und damit vorerst noch weit davon entfernt, mich bei einem Privatfernsehsender als Talkshowgast zu bewerben. Gibt es diese Shows überhaupt noch? Da ich bis vor kurzem noch berufstätig war, bin ich mit dem aktuellen Hausfrauenfernsehen leider nicht vertraut. Ich erinnere mich aber, dass man in den Neunzigern keine Chance hatte, am Nachmittag durch die Programme zu schalten, ohne die pikanten Lebensbeichten diverser Randgruppen serviert zu bekommen. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir dabei eine Sendung, die ein Musterbeispiel war für seriösen und investigativen Journalismus. Ein Grippevirus hatte mich auf die Couch gestreckt, und ich siechte mit der Fernbedienung in der Hand wehleidig vor mich hin. Mir stand der Sinn nach einer Wiederholung von Unsere kleine Farm oder ähnlich trostspendenden Heile-Welt-Geschichten. Auf meiner Suche blieb ich bei jener Talkshow hängen, gefesselt von einer amerikanischen Einblendung über eine ausnehmend gut bestückte Hausfrau mit dem originellen Künstlernamen «Betty Boobs». Ihr Hobby war es, sich am Straßenrand zu postieren und vor durchreisenden Truckerfahrern ihre Brüste zu entblößen. Vor diesen und dem Rest der Vereinigten Staaten, denn die Fernsehkamera an ihrer Seite dürfte ihr kaum entgangen sein. Dies war peinlich, aber immer noch leichter zu ertragen, als der Bursche, der seiner, wie wir vernehmen konnten, sexuell sehr spielfreudigen Freundin seinen Wunsch nach einem flotten Dreier mit einem maskierten und in lecker Leder verpackten Bodybuilder gestand. Das Publikum johlte, als der potenzielle Dritte im Bunde in ekstatischer Vorfreude die knackige Hüfte kreisen ließ. Bedauerlicherweise war die Frau nicht begeistert und rannte empört aus dem Studio. Dies ließ man ihr aber nicht durchgehen, schließlich wurde sie dafür bezahlt, das gesamte Drama vor Publikum auszufechten. Die Kamera samt Moderatorin folgten ihr, da gab´s nix. Ich verzichtete darauf mir anzuschauen, wie die Moderatorin die Flüchtige zurück ins Studio schleifte und schaltete weiter. Mein Bedürfnis nach einer schönen Sendung mit komplett angezogenen Leuten und moralisch integren Kindern, die sich dauernd sagen, wie lieb sie sich haben, war noch größer geworden. Unsere kleine Farm konnte ich leider nicht finden, dafür aber Dieter Thomas Heck. Das Idol meiner Kindertage in einer Sendung aus meinen Kindertagen! Fette Koteletten, giftgrüner, hautenger Anzug, dicke Brille … Herrlich! Als Rex Gildo die Bühne erklomm und temperamentvoll die Ellbogen schwingend Fiesta Mexicana zum Besten gab, kuschelte ich mich selig seufzend in die Kissen. Das war so viel schöner als der nackte Busen von der Trucker-Betty! Eine Oma aus dem Publikum kraxelte zu dem Sänger auf das Podest, um ihm verschämt ein Nelken-Arrangement in die Hand zu drücken. Und sie blieb nicht allein. Heerscharen von Damen mit Faltenröcken und Rüschenblusen stürmten mit Blumengebinden die Bühne. Es war wunderschön anzusehen, wirklich.
Nun, zum Glück bin ich vorerst nicht darauf angewiesen, meine Geheimnisse und moralischen Verfehlungen der Fernsehnation gegen eine mickrige Gage zum Fraß vorzuwerfen. Zum einen wirken sich mangelnde Tabellenkalkulationskenntnisse nicht mindernd auf das Arbeitslosengeld aus. Zudem hat Theodor, als der das Land verließ, um seine Mitte zu finden, nahezu nichts mitgenommen. So betrachtet ist es geradezu ein Glücksfall, wie sich unsere Wege getrennt haben. Wäre er mit einer langbeinigen, zweiundzwanzigjährigen (und womöglich der Pivot-Tabellen kundigen) Blondine auf High Heels durchgebrannt, dann wäre das für mich sicherlich in jeder Hinsicht schwierig geworden. Zum einen, weil es das Ego einer alternden, verlassenen Ehefrau am Rande des Klimakteriums nur schwer verkraftet, durch attraktives Frischfleisch ersetzt zu werden. Insbesondere wenn man Zeitlebens nie auch nur annähernd blond und langhaarig war, sondern stets einen praktischen feldmausbraunen Allerweltshaarschnitt vom Typ Afghanischer Windhund gepflegt hat. Die Trennung wäre im Falle einer Machtübernahme durch die erwähnte langbeinige Blondine weiterhin schwieriger geworden, da es meines Wissens eher selten vorkommt, dass gut situierte Männer dem schicken neuen Püppchen an ihrer Seite den dringenden Wunsch nach Geschmeide, einem schicken Cabrio und italienischen High Heels abschlagen. Ich will niemandem etwas unterstellen, es gibt sicherlich junge Frauen, die ältere Männer mit wabbligem Bauchansatz und Hüftgelenksverschleiß extrem anziehend finden. Ich halte es aber für wahrscheinlich, dass ein gut gefülltes Bankkonto es deutlich erleichtert, fehlendes Haupthaar (womöglich mit quergekämmtem Restbestand) und die Zahnprothese am Nachtkästchen zu tolerieren. Der Freude über den Jagderfolg im fortgeschrittenen Lebensalter wird von den im zweiten Frühling und der eigenen Potenz schwelgenden Kerlen häufig in barer Münze Ausdruck verliehen, was den Zugewinnausgleich für die kurzbeinige Ex-Ehefrau mit der praktischen Windhundfrisur zusehends mindert. Aber zum Glück ist das nicht passiert. Unsere Ehe hat keine geldlüsterne Zweitfrau zu Fall gebracht - sondern eine goldene Schüssel mit einem Schlägel.
Theodors Selbstfindung wären weltliche Güter, wie unser 85-Zoll-Flachbildfernseher oder das Familienfahrzeug eines deutschen Premium-Automobilherstellers völlig im Wege gestanden. Soweit ich ihn verstanden habe, ist jedweder Eigentum, der über vier Unterhosen und eine Zahnbürste hinausgeht, als sinnloser und belastender Kommerz einzustufen. Theodor wollte nur das Geld für das Flugticket nach Bora-Bora. Mit nichts als zwei Koffern (in denen sich rechnerisch je zwei Unterhosen befunden haben mussten) stieg er ins Taxi. Ich bin also eine demnächst geschiedene Frau mit einem dicken Auto und einem großen Fernseher. Zum Glück belief sich unser Sparguthaben auf etwas mehr als den Gegenwert eines Flugtickets in die Südsee. Ich bin daher derzeit unbesorgt, mein Kind, die drei verfressenen Katzen und mich durch den nächsten Winter bringen zu können. Für den übernächsten wäre aber ein geregeltes Einkommen hilfreich. Ich möchte nicht in die zuvor erwähnte Verlegenheit kommen, doch irgendwann bei einem privaten Fernsehsender als Talkshowgast vorstellig werden zu müssen. Fürs erste habe ich die Fixkosten gesenkt: Ich habe den Spenden-Dauerauftrag für die Rettung rumänischer Tanzbären gekündigt, das Fernsehzeitschriften-Abo und meine Mitgliedschaft im Fitnessstudio, bei dem seit meinem letzten Besuch mehrere Jahre ins Land gegangen sind. Als nächstes werde ich unsere Katzen mit der Umstellung von schweinsteurem Premium-Katzenfutter auf Discount-Ware überraschen. Und ich werde mit Kind, Katzen und Kegel in eine kostengünstigere Bleibe umziehen: In das alte Gockelhaus.
Schweinkram
Mein kleines Häuschen ist alt, ungünstig geschnitten und besitzt ein moosgrün gekacheltes Bad. Aber es war bereits vor der Eheschließung meins und ist damit vor der Zerfleischung durch die Zugewinnberechnung sicher. Während unserer Ehejahre haben Theodor und ich natürlich schicker gewohnt. Das grüne Bad mit den güldenen Armaturen hätte bei meinem Gatten vermutlich auf Dauer zu Erblindungserscheinungen geführt. Sein Einzug in mein kleines Häuschen in romantischer Flusslage direkt am Regen wurde in der Diskussion über unseren gemeinsamen Wohnsitz nur kurz gestreift. Theodor war klug genug, das grüne Bad nicht negativ zu erwähnen, und auch nicht die mit Prilblumen beklebten orangefarbenen Küchenkacheln oder den Keramikgockel auf dem Dachgiebel. Letzteres war ein Alleinstellungsmerkmal in der Nachbarschaft, sodass das Haus mit der Zeit nur noch das «Gockelhaus» genannt wurde. Theodor sprach lediglich von dem «kostenmäßig schwer zu kalkulierenden Sanierungsbedarf» und wies darauf hin, dass das Häuschen keine Garage aufweisen könne.
«Schau mal Schätzelein, im Sommer heizt sich das Auto so auf, dass du mit deinen hübschen Beinen am Ledersitz festpappst», – damals ließ meine Oberschenkelbeschaffenheit noch das Tragen von Miniröcken zu – «und im Winter musst du eine halbe Stunde früher raus, um das Auto freizuschaufeln.»