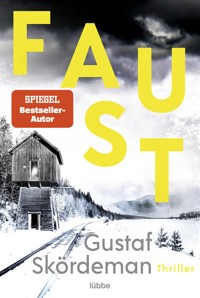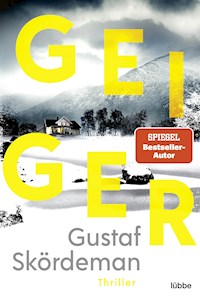14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Geiger-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Trotz höchster Sicherheitsvorkehrungen gelingt es Doppelagentin Agneta Boman, einen russischen Oligarchen in London zu ermorden. Zur gleichen Zeit wird in Stockholm der frühere Außenminister von einem bekannten Firmenchef enthauptet. Dieser unfassbar brutale Mord wird gefilmt - und das Video der Polizei zugespielt. Kommissarin Sara Nowak übernimmt die Ermittlungen und ahnt zu dem Zeitpunkt noch nichts von dessen internationaler Dimension. Als weitere hochrangige Personen sich gegenseitig umbringen, taucht eine erste Spur auf. Sie führt zu einer Ölförderfirma und einem russischen Oligarchen. Bald erkennt Sara, dass sie sich mit ihren Ermittlungen jemanden zum tödlichen Feind macht ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 590
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Über das Buch
Über den Autor
Weitere Titel
Titel
Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
Feedbackseite
Über das Buch
Trotz höchster Sicherheitsvorkehrungen gelingt es Doppelagentin Agneta Boman, einen russischen Oligarchen in London zu ermorden. Zur gleichen Zeit wird in Stockholm der frühere Außenminister von einem bekannten Firmenchef enthauptet. Dieser unfassbar brutale Mord wird gefilmt – und das Video der Polizei zugespielt. Kommissarin Sara Nowak übernimmt die Ermittlungen und ahnt zu dem Zeitpunkt noch nichts von dessen internationaler Dimension. Als weitere hochrangige Personen sich gegenseitig umbringen, taucht eine erste Spur auf. Sie führt zu einer Ölförderfirma und einem russischen Oligarchen. Bald erkennt Sara, dass sie sich mit ihren Ermittlungen jemanden zum tödlichen Feind macht …
Über den Autor
Gustaf Skördeman ist 1965 in Nordschweden geboren. Heute lebt er mit Frau und zwei Kindern in Stockholm. Er ist Drehbuchschreiber, Regisseur und Filmproduzent. GEIGER ist sein schriftstellerisches Debüt. Die Idee für diesen Thriller kam ihm bereits vor zehn Jahren. Seitdem hat er an der Handlung für diesen Auftakt einer Trilogie gefeilt. Das Buch wurde gleich ein internationaler Erfolg und erscheint in 20 Ländern.
Weitere Titel des Autors:
Geiger
Faust
Gustaf Skördeman
Wagner
Thriller
Übersetzung aus dem Schwedischen von Thorsten Alms
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Titel der schwedischen Originalausgabe: »Wagner«
Für die Originalausgabe: Copyright © 2022 by Gustaf Skördeman and Bokförlaget Polaris in agreement with Politiken Literary Agency
Für die deutschsprachige Ausgabe: Copyright © 2023 by Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln Textredaktion: Britta Schiller, Eitorf Covergestaltung: FAVORITBUERO, München Covermotiv: © STILLFX / shutterstock; Roman Mikhailiuk / shutterstock E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN978-3-7517-4195-8
Sie finden uns im Internet unter luebbe.de Bitte beachten Sie auch: lesejury.de
1
Schon aus weiter Entfernung sah man, zu welcher Sorte sie gehörten, die beiden groß gewachsenen Männer mit ihren Fernsteuerungen. Sie strahlten nicht nur aus, dass sie töten konnten, sondern auch, dass sie töten wollten.
Ihr Auftrag bestand darin, Drohungen zu identifizieren und sie mit maximaler Effektivität zu beseitigen. Das hatten sie schon viele Male zuvor getan. Leben auszulöschen war ihr Job. Und ihr größtes Vergnügen.
Die Savile Row in London ist eine kleine enge Straße mit einigen der exklusivsten Schneider im Vereinigten Königreich. Die Häuser sind aus Stein gebaut, geschmückt mit großen Flaggen, aber nicht höher als drei, vier Stockwerke. Wenn man nicht weiß, worum es geht, ist es schwierig zu verstehen, was diese kleine Gasse für die Reichen der Welt bedeutet.
Auf den Bürgersteigen der Savile Row sieht man nicht viele Touristen, meistens nur Leute aus der City, also Bank- und Finanztypen. Alle in ihren britisch geschnittenen Anzügen, die sie genau in dieser Straße gekauft haben oder es sich zumindest wünschten.
Jetzt standen die beiden Hünen mit ihren toten Augen an jeweils einem Ende der Straße und steuerten ihre jeweilige Mavic 3, während sie auf den Displays der Controller sorgfältig alles überprüften, was die Drohnen aufnahmen. Sie flogen an den Fassaden entlang, sahen in alle Fenster, stiegen auf und starrten über die Dächer. Fokussierten und konzentrierten sich auf jedes abweichende Detail.
Währenddessen gingen die anderen beiden anzugtragenden Grizzlybären herum und kontrollierten die geparkten Autos auf beiden Seiten der Einbahnstraße, sahen durch die Fenster hinein, kontrollierten ihre Unterseiten mit Spiegeln und lasen ihre Geigerzähler ab, um mögliche Radioaktivität zu entdecken.
Als sie sich sicher fühlten, dass keine Bedrohung vorlag, gaben sie ihrem Anführer Nesti ein Zeichen. Zwei schnelle Signale auf dem Kommunikationsknopf des Funkgeräts, die zu einem doppelten Brummen in Nestis Empfänger wurden. Und als alle vier bereit waren, gab der Anführer das Klarzeichen für den Konvoi.
Zuerst das Knattern eines Hubschraubers, das sich über die Straße senkte und dort verharrte, bedeutend niedriger, als es zulässig war. Dann rollten zwei schwarze BMW X7 M50i in die Straße, gefolgt von einem feuerroten Rolls-Royce Cullinan und zwei weiteren schwarzen BMW X7. Alle gepanzert und garantiert gegen jede Art von Automatikfeuer und eine Sprengkraft von bis zu dreißig Kilogramm TNT gesichert.
Falls Autos tatsächlich etwas ausstrahlen können, dann strahlte diese Karawane aus Autos mit schwarz getönten Scheiben eine Drohung aus, in Übereinstimmung mit der kriminellen Logik, die besagte, dass du umso mächtiger bist, je mehr du dich beschützen musst. Sogar die blasierten City-Angestellten, die über die Bürgersteige hetzten, ahnten, dass sich etwas ganz Besonderes hier abspielte, und betrachteten den Konvoi. Nur um schnell wieder wegzusehen. An einem solchen Oktobermontag voller Nieselregen wollte man einfach nur bis Weihnachten überleben und nichts sehen, was einem das Leben zerstören könnte.
Die gepanzerten Autos blieben vor dem rot geklinkerten vierstöckigen Gebäude stehen, in dem der königliche Hoflieferant Willis & Corrigan residierte, der die Prinzen des Imperiums mit allem, von Jacketts bis zu maßgeschneiderten Unterhosen, versorgte. Hollywoodstars und Ölscheichs standen Schlange, um dort Kunden zu werden, und es blühte eine ganze Gerüchteküche, worin die Auswahlkriterien eigentlich bestanden. Aber niemand wusste es.
Aus den schwarzen SUVs stiegen muskulöse Männer in schwarzen Anzügen und mit Sonnenbrillen. Männer, die schnell die Bürgersteige in beide Richtungen hundert Meter von Willis & Corrigan entfernt absperrten. Zwei stellten sich hinter den letzten SUV und starrten drohend auf die Autos, die jetzt ganz unvermittelt an ihrer Weiterfahrt gehindert wurden. Ob es die Blicke durch die Sonnenbrillen waren oder die Heckler & Koch MP5, die sie trugen, die am meisten abschreckten, blieb unklar, aber niemand in den vordersten Autos der hastig wachsenden Schlange kam auf den Gedanken, gegen die plötzliche Sperrung zu protestieren. Von weiter hinten waren bald einige Hupen zu hören, aber das schien die bewaffneten Fleischberge nicht im Geringsten zu irritieren.
Als die Straße gesichert war, gab Nosorog, der Chef der Leibwache, das Klarzeichen für Romanowitschs Chauffeur, der den Knopf des Mikrofons drückte, über das er mit der Rückbank des Rolls-Royce kommunizieren konnte.
»All clear.«
Aleksandr Aleksandrowitsch Romanowitschs fette Faust griff nach dem blondierten Haar von Anora, dem mageren Mädchen aus Usbekistan, das er in einem der Bordelle gekauft hatte, die er regelmäßig besuchte. Eine Siebzehnjährige, die er höhnisch ›Pretty Woman‹ nannte, während er sich ihr sexuell aufzwang.
»Du darfst nachher weitermachen«, sagte er, zog Anoras Kopf von seinem Schoß hoch und schubste sie grob in eine Ecke der Rückbank. Dann knöpfte er seinen Hosenstall zu und stellte irritiert fest, dass sie immer länger brauchte, um ihn zum Kommen zu bringen. Vielleicht war es an der Zeit, eine Neue zu besorgen. Er konnte ja schlecht einen Schneidertermin verpassen, nur weil Anora nicht mehr genauso gut blies wie früher.
Als er ihren leeren Blick sah, öffnete er die Louis-Vuitton-Tasche aus Leder, die auf dem Boden stand, und griff nach ein paar dicken Bündeln aus Fünfzig-Pfund-Noten, die er ihr zusammen mit dem Versprechen gab, dass sie nachher damit einkaufen gehen konnte. So fühlte es sich vielleicht besser an.
Als Aleksandr Romanowitsch aus dem Wagen stieg, wurde er sofort von vier Männern der Leibwache umringt, während sie an den Hausfassaden entlangstarrten, obwohl die Drohnen immer noch über ihnen kreisten und alle Fenster und Dächer kontrollierten. Romanowitsch richtete seinen Mantel mit dem Kragen aus Wolfspelz.
Die Fußgänger betrachteten die Männer, die die Straße absperrten, bevor sie sich umdrehten und einen anderen Weg wählten. Hier in der City wusste man, dass man besser bedient war, wenn man sich nicht mit bewaffneten Gorillas anlegte. Man wohnte nicht mehr im England der Königin, sondern im London der Gorillas.
Während Romanowitsch mit seinem Gefolge auf Willis & Corrigan zuschritt, tauchte ein Rollstuhl in der Türöffnung auf. Im Rollstuhl saß ein sehr alter Mann mit abwesendem Blick, dem ein Faden Sabber aus dem Mund hing. Auf seinem Schoß lag eine Tüte der Schneiderei, und der Rollstuhl wurde von einer gebeugten, alten Frau geschoben, die offensichtlich der Ansicht war, dass ihr Mann seine Modegewohnheiten nicht aufgeben sollte, nur weil er ein bisschen senil geworden war. Die Frau trug ebenfalls maßgeschneiderte Kleidung, die allerdings schon etwas fadenscheinig aussah. Es war offensichtlich, dass das Kleid und der Mantel einst von erlesenster Qualität gewesen waren, auch wenn sie heute einen Duft nach Mottenkugeln und Schimmel verströmten. Die Frau kämpfte, um den Rollstuhl die beiden Treppenstufen hinunterzubekommen, die zum Bürgersteig führten, er wirkte allzu schwer für ihre gekrümmte Gestalt. Als es ihr schließlich gelang, den Stuhl über die Kante zu heben, kam er plötzlich in Fahrt und rollte ihr beinahe weg. Aber sie klammerte sich fest an den Griff.
Der unerwartete Vorstoß ließ die Leibwächter vor ihren Auftraggeber springen, aber sobald sie erkannt hatten, was passiert war, entspannten sie sich wieder.
Der jüngste der Leibwächter, Schtschenok, ging zu dem älteren Paar und hielt seinen Gesichtsscanner nacheinander vor beide Gesichter. Kein Ausschlag. Sie waren in keinem Register aufgeführt.
»Was machst du? Glaubst du, die beiden sind Terroristen?«, fragte Sobaka und konnte ein Lachen nicht unterdrücken. Die anderen froren ihre Mienen ein, bis sie hörten, dass auch Romanowitsch in Lachen ausbrach, worauf sie alle begannen, ihren übereifrigen jungen Kollegen mit Hohn zu übergießen.
»Dieser Terrorist hat sich sogar in die Hose gemacht!«, sagte Sobaka und zeigte auf einen kleinen, feuchten Fleck im Schritt des alten Mannes.
»Vielleicht ist es eine geheime Waffe?«, sagte Ios und grinste.
Schtschenok ging zurück zu den anderen, die zehn Schritte vor dem Eingang zur Schneiderei stehen geblieben waren, um das alte Paar vorbeizulassen.
»Was soll ich denn tun?«, schmollte er und verfluchte im Stillen die anderen, die ständig auf ihm herumtrampelten. Entweder war er zu nachlässig und bekam deswegen Schimpfe, oder er war zu genau und wurde deswegen als lächerlich dargestellt. Idioten.
Die alte Frau kämpfte, um den Rollstuhl wieder in Fahrt zu bringen, als sie auf dem Bürgersteig waren, und näherte sich sehr langsam der Gruppe von grimmigen Männern.
»Stehen bleiben!«, brüllte Sobaka und stoppte sie mit einer Handbewegung, bevor er eine Geste in die andere Richtung machte. »Weg! Geht da lang!«
Aber die Frau sah ihn nicht an und schien ihn auch nicht zu hören. Sie kämpfte weiter mit dem Rollstuhl. Eine Hand in der Handtasche vergraben, versuchte sie, ihren mental abwesenden Gatten vor sich her zu bugsieren.
»Stopp, habe ich gesagt!«, schrie Sobaka erneut, und jetzt richtete er seine Automatikwaffe auf sie.
»Nein! Hilfe!«, schrie die Frau und blieb endlich stehen.
Dann warf sie ihre Handtasche vor die Füße der fünf Männer und hob die Hände in die Luft.
Sobaka sah erst sie und dann seine Kollegen verblüfft an.
»Sie glaubt, dass wir sie ausrauben wollen.«
Alle fünf brachen erneut in Gelächter aus.
Die alte Frau ging hinter dem Rollstuhl in Deckung und schien nicht zu hören, was er sagte. Sie rief nach Hilfe. In voller Panik.
»Die dumme Kuh!« Sobaka lachte und schüttelte den Kopf.
In dem Augenblick waren vier Sekunden vergangen. Die Zeit, die die russische F-1 Handgranate brauchte, die in der Handtasche lag und deren Sicherung gezogen war, bis sie explodierte. Eine F-1 verteilt Splitter in bis zu zweihundert Meter Entfernung, aber die Panzerplatte, die an die Rückseite des Rollstuhls montiert war, schützte die alte Frau vor den scharfen Projektilen, während der senile ehemalige Spion im Rollstuhl den Körper von den Metallteilen zerrissen bekam.
Die ganze Gruppe wurde von der Druckwelle mehrere Meter zurückgeworfen, aber die Frau hatte die Füße auf ein kleines Querband gestellt und fuhr ganz einfach mit, bis der Rollstuhl gegen das Gatter vor einem der anderen exklusiven Schneidereien schlug, mit der Frau als Stoßdämpfer.
Sie schrie vor Schmerz auf, kam aber schnell wieder auf die Füße. Mit einem übergezogenen Gummihandschuh fischte sie eine weißhaarige Perücke aus der Tasche und ließ sie neben dem Rollstuhl auf den Boden fallen. Gleichzeitig warf sie einen schnellen Blick in das Chaos, das jetzt zwanzig Meter vor ihr lag.
Ein vollständiger Erfolg.
Die schockierten Leibwächter, die jetzt zu den gefallenen Kameraden und ihrem ermordeten Chef liefen, nahmen keine Notiz von ihr. Sie brachten die Explosion nicht mit der verwirrten alten Dame in Verbindung.
Im gepanzerten Rolls-Royce konnte Anora ihren Augen kaum glauben. Nachdem sie etwa zehn Sekunden auf Romanowitschs toten Körper gestarrt hatte, faltete sie die Hände und dankte Gott.
Dann nahm sie die Ledertasche von Louis Vuitton, stieg aus dem Wagen und ging davon.
Auf der anderen Seite der Straße eilte eine alte, weißhaarige Dame davon. Ihr Herz schlug beunruhigend schnell, und die Arthrose begann sie zu warnen, dass sie später ihre Strafe dafür bekommen würde.
Aber im Augenblick war es ihr egal.
Agneta Broman war zurück.
2
Das Seil schnitt in die Handgelenke.
Die Haube erschwerte das Atmen.
Die intensive Hitze ließ den Schweiß den Rücken hinunterlaufen.
Solange sie nichts sah, schärften sich die anderen Sinne.
Alles wurde so deutlich.
Sie registrierte die schwachen Geräusche des menschlichen Atems, bildete sich ein, dass sie ihren Herzschlag hörte.
Die Haube, die sie ihr über den Kopf gezogen hatten, duftete leicht nach Kräutern, Schweiß und Rauch. Und nach etwas unvorstellbar Altem.
Sie hatten sich angestrengt, damit sie nicht erraten konnte, in welches Land sie sie geführt hatten, aber wenn die Berichte, die sie gelesen hatte, stimmten, dann ahnte sie, wo sie gelandet war. Es spielte ohnehin keine Rolle.
Sie war vollkommen präsent.
Sie hatte sich niemals so lebendig gefühlt.
Motivierter als jetzt war sie nie gewesen.
Ihre Lunge bettelte um mehr Sauerstoff, aber sie musste warten.
Alle mussten warten. Alle Sinne und alle Gefühle mussten sich unterwerfen.
Wann hatte sie das letzte Mal gegessen? Daran konnte sie sich nicht erinnern. Ein bisschen Fatut, als sie ankam, wann auch immer das gewesen war.
Ihr Körper hatte aufgehört, Ansprüche an sie zu stellen, Dinge wie Essen, Flüssigkeit und Schlaf zu fordern. Zu pinkeln. Der Körper war abgeschaltet.
Ihr Fokus lag auf etwas anderem.
Sie hatte sich vom Boden erhoben. Ihr altes Leben hinter sich gelassen. Jetzt war sie unüberwindlich.
Das Knistern eines Streichholzes auf einer rauen Oberfläche, dann ein Paffen, als würde man sich eine Zigarette anzünden.
Dann das Geräusch zweier Scheinwerfer, die eingeschaltet und auf sie gerichtet wurden. So stark, dass sie sie durch den dicken Stoff blendeten.
Jemand kam von hinten an sie heran, knotete das Seil auf und hob die Haube ab.
Sie hielt die Hand als Schutz gegen das starke Licht hoch, machte aber nicht den Fehler, unter dem Schatten der Hand denjenigen anzublicken, der ihr gegenübersaß.
»Spiel«, sagte eine Stimme, erst auf Arabisch, dann auf gebrochenem Englisch.
Sie sah sich um und entdeckte eine Geige, die auf einem kleinen Tisch direkt neben ihr lag.
Sie stand auf, wund und steif nach den vielen Stunden, die sie an den Stuhl gefesselt gewesen war. Danach nahm sie die Geige, legte das Instrument an die Schulter und setzte den Bogen auf die Saiten.
Aus der einfachen und schlecht gestimmten Geige strömte ein »Erbarme dich« von Johann Sebastian Bach. Das Stück, das sie in dem Video gespielte hatte, von dem sie wusste, dass er es gesehen hatte. Vom Abschlussabend der neunten Klasse. Seltsam, dass er dieses Video hier im Nahen Osten gesehen hatte, Tausende von Kilometern entfernt.
Sie wusste nicht, wie gut er sich mit Bach auskannte, sah aber zu, dass sie das Stück genau so spielte wie damals, als sie eine Teenagerin gewesen war. Mit einem jugendlichen Eifer, der glaubte, dass er mehr wisse, als tatsächlich der Fall war, mit einer eingebildeten Lebenserfahrung und einer gewissen pubertären Dramatik.
»Stopp!«
Sie hielt inne.
»Muttermal!«
Sie fummelte an dem Umhang herum, mit dem sie sie bekleidet hatten, konnte aber schließlich ein Stück Haut unter der linken Brust entblößen und das große, dunkle Muttermal zeigen, das sich dort befand.
»Okay.«
Er musste irgendeine Form von Zeichen gegeben haben, denn jetzt wurden die Scheinwerfer wieder ausgeschaltet.
Danach die Schritte, mit denen er sich entfernte, umgeben von seinem engsten Gefolge.
Aber sie lebte.
Also hatte sie den Test bestanden.
War akzeptiert.
Jetzt war es nur noch eine Frage der Zeit.
Dieses Mal sollte es ihr gelingen.
Und dieses Mal würde Sara ihre Strafe bekommen.
Lotta Broman würde Sara Nowak mit ihren bloßen Händen töten.
3
Obwohl die Videoaufnahme keinen Ton hatte, war es offensichtlich, dass der ehemalige Außenminister Jan Schildt um Gnade bat.
Mit Panik im Blick.
Er schrie und weinte und versuchte sich von den Seilen loszureißen, die ihn an der Bank aus Stahl festhielten. Er bettelte und flehte.
Aber August Sandin ließ sich nicht erweichen.
Er hob eine Motorsäge, eine ganz gewöhnliche Husqvarna 130, zog das Startkabel mit einer entschlossenen Bewegung und legte die Kette an den Hals von Schildt.
Blut spritzte über die Anzüge der beiden Männer, und Schildt schrie. Man sah es an seinem Mund. Ein furchtbarer Schrei voll Todesangst und unerträglichen Schmerzen.
Die Motorsäge blieb stecken, sodass Sandin sie herausziehen und von vorne anfangen musste.
Schildt lag im Sterben. Die Pupillen verschwanden unter den Augenlidern, und das Blut rann aus dem Mund und über das Kinn nach unten. Der Körper zuckte in Konvulsionen.
Sandin sah sich um, seufzte tief und machte weiter.
Jetzt drückte er die Motorsäge mit aller Kraft an den Hals seines Opfers, und schließlich gelang es ihm, den Kopf vom Körper zu trennen.
Da kamen die Tränen.
Er weinte, bis er zu zittern begann. Von oben bis unten mit Blut bespritzt, ließ er die Motorsäge zu Boden fallen und drehte sich um.
Er griff nach einer CZ 75 Compact, während er gebrochen schluchzte. Mit einer instinktiven Bewegung wischte er sich die Tränen aus den Augen, wischte das Blut dabei in roten Streifen über das halbe Gesicht.
Dann setzte er die Pistole an seine rechte Schläfe und schoss.
Er fiel aus dem Bild, dann endete das Video.
Sara Nowak und Anna Torhall wandten sich an Harald Moberg, den Vorstandsvorsitzenden des Forstbetriebs Norskog, der jetzt in Saras Büro in der Polizeiwache von Solna saß. In seinem Brionianzug mit gefalzten Nähten, seinen handgenähten Schuhen von Church’s und dem kreideweißen Hemd von Bauer mit glänzenden Manschettenknöpfen von Bulgari fiel er vor der unauffällig bürokratischen Einrichtung deutlich auf. Und seine missmutige Miene zeigte mit aller gewünschten Deutlichkeit, dass es ihn irritierte, in ausgerechnet diesem Raum empfangen zu werden. Obwohl er selbst sich an die Polizei gewandt hatte.
Diese Irritation wurde noch dadurch verstärkt, dass Moberg an die nächstgelegene Polizeiwache und zwei gewöhnliche Kriminalinspektorinnen verwiesen worden war. Er hatte Sara und Anna deutlich zu verstehen gegeben, dass er am liebsten vom Polizeipräsidenten empfangen worden wäre. Immerhin war er ein Mann in einer außerordentlich exponierten Position.
Konnte er sich überhaupt auf die Schweigepflicht dieser beiden Polizistinnen verlassen? Alles, was einen Mann wie Moberg betraf, musste mit äußerster Diskretion behandelt werden, das musste ihnen doch klar sein? Sara hatte erwidert, dass sie damit vollkommen einverstanden wären, hätte ihn aber am liebsten, tja, zurück in den Wald geschickt.
Bis sie das Video gesehen hatte.
Da wachte die Polizistin in ihr auf und übertönte die Teenagerrebellin.
»Woher haben Sie dieses Video?«, fragte Sara und beugte sich über den Schreibtisch, der sie vom Vorstandsvorsitzenden trennte.
»Keine Ahnung. Von Schildt oder Sandin kann es jedenfalls nicht kommen.«
»Kannten Sie die beiden? Schildt und Sandin?«
»Nicht persönlich. Aber ich habe beide natürlich zu verschiedenen Anlässen getroffen. Wir bewegten uns ja in denselben Kreisen.«
Kreise, denen Moberg mit deutlich vernehmbarer Zufriedenheit angehören durfte.
»Und welches Verhältnis hatten sie untereinander?«, warf Anna ein. »Ein ehemaliger Außenminister und der Vorstandsvorsitzende einer Aktiengesellschaft?«
»Verhältnis? Gar keines, soweit ich weiß«, sagte Moberg und fegte sich ein unsichtbares Staubkorn von einer Schulter. »Aber sie kannten einander vielleicht. Es ist ja trotz allem ein kleines Land.«
»Und Sie haben diese Videoaufnahme in Ihrem Briefkasten gefunden? Auf diesem USB-Speicher?«
»Ja, im Briefkasten zu Hause in Nockeby.«
»In einem Umschlag?«, fragte Sara.
»Mit der Beschriftung ›You’re next‹.«
4
Verdammter Idiot. Wie eine Parodie auf den lästigen Nachbarn. Eine nervtötende, ermüdende Scheißparodie.
Hans-Gunnar Schermann.
Ein Rentner mit allzu viel Zeit.
Und irgendeinem Kurzschluss im Kopf.
Immer nur klagen und motzen und über alles und jeden festgefahrene Ansichten haben. Herumstehen und mit dem krummen, blassgelben Finger zeigen. Und dann noch seine ekligen feuchten Lippen. Hellbraune Chinos mit viel zu hoch gezogenem Bund, zusammengehalten von einem Gürtel.
Dieses Grundstück gehörte verdammt noch mal nicht ihm.
Schließlich hatten sie genug davon gehabt, seinem Gemecker zuzuhören. Aber als Malin und Christian nicht mehr öffneten, wenn Schermann klingelte, begann er stattdessen Zettel im Briefkasten zu hinterlassen.
»Die Kinder machen Lärm!«
»Nicht nach neun grillen!«
»Ein Apfelbaum wächst in mein Grundstück hinein!«
Ja, das ist doch klar, dass Kinder Lärm machen, dass man in seinem eigenen Garten grillen kann, wann man will, und dass ein Apfelbaum wächst. Was zum Teufel glaubte dieser Wirrkopf eigentlich?
Und jetzt war er noch einen Schritt weiter gegangen und hatte einen Zettel an die Windschutzscheibe geklebt.
»Hecke zurückschneiden!«
Malin war kurz davor, mit dem Zettel zu ihm hinüberzugehen und ihm zu sagen, wo er sich das Teil hinstecken sollte, aber sie wollte sich nicht streiten. Es war ihr Geburtstag. Da sollte man sich nicht mit seinem widerwärtigen Nachbarn zanken.
Aber wenn er auch noch über das ganze Laub zu meckern begann, das ihm aufs Grundstück fiel, dann würde er eine gewaschene Antwort bekommen. Schließlich war es nicht Malins Schuld, dass der Herbst kam.
Sie setzte ihren smaragdgrünen Porsche Macan Turbo vor der großen blassgelben Villa im Stjärnvägen 18 zurück, hielt das Tempo niedrig, solange sie sich in der engen Straße befand, und gab ordentlich Gas, als sie über die Lidingöbrücke fuhr. Nach wenigen Minuten hatte sie die Schwedische Fernsehgesellschaft SVT im Gärdet erreicht, gemeinhin ›das Studiohaus‹ genannt, wo sie ihren Arbeitsplatz hatte. Im Augenblick moderierte sie das Programm »Jalla! Hör zu!«, das auf unterhaltsame Weise und mit humoristischer Ansprache junge Männer aus den Vorstädten dazu bewegen sollte, miteinander zu sprechen, statt zur Waffe zu greifen.
Nachdem sie in der Tiefgarage geparkt hatte, ging sie durch den Haupteingang hinein, marschierte an dem kleinen Café vorbei und blickte zu Micke am Empfang. Besucher mussten durch die Schwingtüren gehen, aber die Angestellten konnten die Passage daneben benutzen, wenn man seine Karte zog.
»Hallo, Micke.«
Malin achtete sorgfältig darauf, dass sie den älteren Mann am Empfang immer grüßte. Für sie war jeder bei SVT gleich wichtig. Und sie wusste, dass Micke hier schon gesessen und Besucher und Angestellte willkommen geheißen hatte, als sich die Fernsehfilmabteilung noch hinten bei A1 befunden hatte, der alten Kaserne, wo sowohl Lennart Hyland als auch Ingmar Bergman und »Die Reederei« so viele Stunden klassische Fernsehunterhaltung geliefert hatten.
»Hast du heute Geburtstag?«, fragte Micke, nachdem er die Hand zum Gruß erhoben hatte.
»Ja, woher weißt du das?«
Dass Leute sich ihren Geburtstag merkten. Malin war ein bisschen gerührt.
»Du hast eine Lieferung bekommen«, sagte Micke und lächelte. »Da gibt es anscheinend jemanden, der dich mag.«
»Okay?«
»Oben in der Redaktion.«
»Danke. Schönen Tag noch. Tschüs.«
Malin drehte sich um, und während sie ihre Passierkarte herauszog, warf sie einen Blick auf die große Sammlung von Preisstatuen der Kristallen-Verleihung, die SVT zur allgemeinen Bewunderung in einem riesigen Glasschrank an der hinteren Wand aufgestellt hatte. Micke sagte immer, was für ein Glück es war, dass die Fernsehkanäle einen Preis wie Kristallen erfunden hatten, damit sie sich selbst daran erinnern konnten, wie leistungsfähig sie waren. Es hörte sich immer so an, als würde er scherzen, wenn er es sagte, aber Malin fand, dass dieser Preis seine Funktion erfüllte. Es war doch klar, dass man für seine Arbeit wertgeschätzt werden wollte.
Sie zog ihre Passierkarte durch und ging durch die Schwingtüren zu den Treppen. Ging einen Stock hinauf und bog in die Fußgängerbrücke ab, die über den riesigen blauen Korridor führte, an dem die Fernsehstudios in einer Reihe lagen, mit Requisiten und Technik und ganz hinten dem Bolibompa-Drachen aus dem Kinderprogramm. Wie viele Programme hier im Laufe der Jahre wohl eingespielt wurden? Dass sie ein Teil dieser Fernsehgeschichte war, war trotzdem ziemlich krass.
Die Höhe des Studiogangs sorgte dafür, dass er fast wie ein Kirchenschiff wirkte. Mächtig und ehrerbietig. Hier musste man eine ganze Weile laufen, bevor man seinen Arbeitsplatz erreichte. Der tägliche Canossagang, hatte ihr Vater zu seiner Zeit gesagt, und Malin war nicht ganz klar, worauf er sich dabei bezog, hatte den Ausdruck aber trotzdem übernommen, als sie hier begonnen hatte. Wie der Vater, so die Tochter.
Als sie die offene Bürolandschaft betrat, die die Redaktion von »Jalla! Hör zu!« beherbergte, traf sie G-Punkt, den Projektleiter und letzten Repräsentanten der alten Generation. Ein Mann, der sogar mit ihrem legendären Vater Stellan zusammengearbeitet und sich noch bis weit über seinen ersten Pensionstag festgeklammert hatte. Dass er es überhaupt tun durfte, lag wahrscheinlich daran, dass er irgendwann die meisten Mitglieder der Chefetage eingestellt hatte, als sie als junge Welpen den ersten Job in der Fernsehbranche ergattert hatten. Jeder wusste, wer G-Punkt war. Immer gut gelaunt, mit einem Scherz auf den Lippen bei allen, denen er begegnete. Ein breites Lächeln, eine kleine Brille aus Stahldraht und ein riesiger grauer Haarschwall, den er nach hinten kämmte, der ihm aber trotzdem immer wieder in die Stirn fiel. Posaunist in einer Showband, obwohl Malin sich kaum vorstellen konnte, wie er es fertigbrachte, während des Spielens nicht zu reden.
»Glaub ja nicht, dass es von uns ist«, sagte G-Punkt und nickte in den Raum hinein.
Da sah Malin es.
Die ganze Redaktion war voller Blumen.
Rote Rosen in Vasen, Seideln, Kaffeekannen, Krügen, leeren Pappkartons und herausgezogenen Schreibtischschubladen.
»Tausend Stück«, sagte G-Punkt. »Ich habe sie gezählt.«
»Von wem sind die?«, fragte Malin mit aufgerissenen Augen.
»Das steht vielleicht in der Karte«, sagte G-Punkt und reichte ihr ein kleines Kuvert in Visitenkartengröße. Malin öffnete es und zog ein goldumrandetes Kärtchen heraus.
»Ich liebe dich«, stand darauf.
Aha, dachte Malin und lächelte. Christian. Großer Gott, er war wirklich verrückt. Aber romantisch.
Sie rief ihren Mann an, der das Gespräch immer annahm, wenn sie es war, selbst wenn er in einer Besprechung saß. Zum Ausgleich versuchte Malin nur von sich hören zu lassen, wenn es wirklich etwas Wichtiges gab.
»Danke, Liebling«, sagte sie, als er sich gemeldet hatte. »Sie sind wunderbar, aber du bist doch verrückt. Tausend Stück!«
»Wer ist wunderbar? Wer ruft Ponsbach an?«
Das Letzte war offenbar nicht an Malin gerichtet.
»Die Rosen. Du hast tausend Rosen zu mir ins Büro geschickt.«
»Äh, nein. Hast du welche bekommen?«
»Ja. Sind sie nicht von dir?« Malin runzelte die Stirn, während sie die Karte in der Hand hin und her drehte.
»Nein. Tut mir leid. Aber nächstes Jahr schicke ich dir zweitausend. Åsa, schreib auf, dass ich nächstes Jahr zweitausend Rosen an Malin schicken werde, wenn sie Geburtstag hat. Super. Hättest du jetzt auch lieber so was gehabt?«
»Nein. Die Diorstiefel waren superhübsch.«
»Okay, gut, wir hören dann voneinander, jetzt beginnt die Ziehung. Küsschen«, sagte Christian.
»Küsschen.«
Malin drückte das Gespräch weg.
»Sie kommen also nicht von deinem Mann?«
Malin begegnete G-Punkts neugierigem Blick und schüttelte geistesabwesend den Kopf.
»Dann hat hier wohl der ehrgeizigste Stalker zugeschlagen, von dem ich in meinem Leben gehört habe, seit ich konfirmiert bin.«
Stalker.
Tja, das wäre ja auch eine Möglichkeit.
Malin ließ ihren Blick über das Blumenmeer wandern. Tausend rote Rosen. Sie sollte überglücklich sein. Aber vor allem machte sie sich Sorgen.
Sie hatte auch vorher schon Blumen ins Büro geschickt bekommen. Und Briefe und Ansichtskarten. Und Bilder von Geschlechtsorganen. Hunderte männliche und ein weibliches. Vor allem, als sie Moderatorin für »Sommersprudel« gewesen war, aber auch danach hatten die Leute von sich hören lassen. Es gab viele, die sie nicht vergessen konnten, auch deswegen, weil sie die Tochter des berühmten Stellan Broman war. Aber was wollten sie eigentlich? Ihre Freunde sein? Sie heiraten? Mit ihr schlafen? Sie in einen Käfig sperren und gelegentlich ansehen?
Und was wollte jetzt diese Person?
»Ich liebe dich.«
Nein, das tust du nicht, dachte Malin.
Denn wenn du es tätest, würdest du mich nicht auf diese Weise erschrecken.
5
Sara hielt den Blick auf den Computerbildschirm gerichtet, auf dem gerade noch das Video mit Schildt und Sandin den Kollegen gezeigt wurde. Sie sollte etwas sagen, aber das konnte noch warten.
Im Augenblick musste sie sich zusammenreißen.
Der erste Tag zurück auf der Arbeit, und dann begegnete ihr das hier. Noch mehr brutale Gewalt. Männer, die töteten.
Sie wusste wirklich nicht, ob sie das aushalten würde.
Abgesehen von dem Trauma, das es mit sich gebracht hatte, ein weiteres Mal um das eigene Leben kämpfen zu müssen, hatte sie auch Schuldgefühle, weil sie getötet hatte. Vielleicht auch Angst davor, dass es ein weiteres Mal passieren könnte. Dass dieses Töten ein Brandmal auf ihr hinterlassen hatte, sie zerstört hatte. Dass sie nie wieder zu ihrem alten Selbst zurückkehren könnte.
Das Leben hatte sich verändert, alle Träume waren zerstört. Es kam ihr so vor, als würde sie direkt in einen Abgrund starren. Nach dem Verrat ihres Schwiegervaters fiel es ihr schwer, sich auf Menschen zu verlassen, und sie hatte in den letzten Monaten kaum mit jemandem außerhalb der Familie gesprochen. Die Therapeutin, die sie getroffen hatte, sagte, dass Sara daran arbeiten solle, aber mitunter fragte sie sich, ob es das tatsächlich wert war. Konnte die Nähe zu anderen Menschen wirklich das kompensieren, was sie durchgemacht hatte? Manchmal hatte sie Angst, dass sie nie wieder jemanden so nahe an sich herankommen lassen würde. Dass sie nie wieder das Risiko eingehen würde, von jemandem dermaßen bloßgestellt zu werden. Manchmal dachte sie, es sei alles egal.
Formell war Sara vom Dienst befreit, aber in Wirklichkeit war sie krank gewesen. Posttraumatische Belastungsstörung. Gleichzeitig wurde sie immer und immer wieder vom schwedischen Verfassungsschutz, der Säpo, sowie dem deutschen Bundesnachrichtendienst BND verhört. Der Tod ihres Schwiegervaters Eric war eine Frage von äußerstem Gewicht für die europäische Sicherheit, so hatten sie es erklärt. Und damit angedeutet, dass Saras und Martins Leben nicht vom geringsten Gewicht für das vereinigte Europa war.
Sie hatte gespürt, dass sie mit diesen ganzen Fragen nicht umgehen konnte, dass sie nicht alles analysieren konnte, was passiert war.
Sie hätte komplett krankgeschrieben sein sollen. Damit sie ihre Ruhe hätte.
Und nicht ein Verhör nach dem anderen.
Sie hätte nicht nach wenigen Monaten schon zur Arbeit zurückkommen sollen.
Wäre vielleicht am besten gar nicht zurückgekommen.
Aber sie war zu schwach gewesen, um sich zu wehren, also war sie jedes Mal gekommen, wenn sie gerufen hatten, hatte ihre Fragen beantwortet und alle Schweigeverpflichtungen unterschrieben, die sie ihr vorgelegt hatten.
Und jetzt war sie wieder in ihrem Büro in der Polizeiwache von Solna. Zurück als Ermittlerin in der Kriminalabteilung.
Wo sie alles tat, um die Fassade aufrechtzuerhalten.
Die Umgebung legte ein gewisses Mitleid an den Tag, weil ihr Schwiegervater umgekommen war, aber ein Schwiegervater war wiederum kein so enger Verwandter, dass es nicht nach der ersten Kaffeepause wieder vergessen war.
Offiziell war Eric zu Hause an einem Herzinfarkt gestorben, und sein Sohn Martin hatte sich den Tod des Vaters sehr zu Herzen genommen. So sehr, dass er sich krankschreiben lassen musste. In Wirklichkeit litt er an dieser tiefen Depression, weil sein Vater kurz davorgestanden hatte, ihn hinzurichten und außerdem auch Saras Leben zu opfern, die daraufhin gezwungen gewesen war, den Schwiegervater zu erschießen. Er war den Verletzungen erlegen. Aber Erics Zusammenarbeit mit dem deutschen Geheimdienst und der verdeckten Widerstandsbewegung der NATO, Stay behind, war zu wichtig und zu geheim, um etwas Negatives über ihn in die Öffentlichkeit kommen zu lassen.
Und zu allem Überfluss jetzt auch noch das hier. Ein bestialischer Mord, gefolgt von einem Selbstmord.
»Abartig«, war das Einzige, was der sonst so schlagfertige Peter über die Lippen bekam. Seine ständige Gefährtin Carro sah mitgenommen und schockiert aus.
»Das war doch Schildt. Der Außenminister.«
Alle hatten Schwierigkeiten, das Gesehene zu verarbeiten. Könnte es vielleicht eine Fälschung gewesen sein?, versuchte man sich zu beruhigen. Aber auch wenn niemand von ihnen Expertise auf diesem Gebiet besaß, war ihnen dennoch klar, dass das Video echt war.
»Wer war der andere?«, fragte Leo. Der groß gewachsene Mann war so ruhig wie immer, sah in diesem Fall aber auch ein wenig erschüttert aus.
»August Sandin«, sagt Sara. »Irgend so ein Vorstandsvorsitzender.«
»Der Schildt hasst.«
»Der ihn hasste.« Näher kam Peter nicht an einen Scherz heran.
»Warum seid ihr damit nicht direkt zu mir gekommen?«
Die kleinen gemeinen Augen der leitenden Ermittlerin Heidi Dybäck starrten auf Sara.
»Weil wir nicht wussten, was sich darauf befand.«
»Das war kein guter Anfang, Sara. Ein klares Minus.«
Sowohl Anna als auch Carro warfen Sara unterstützende Blicke zu. Jede von ihnen wusste, wie Heidi Hitler war.
Eine negative Überraschung, als Sara in ihren Beruf zurückgekehrt war, war die Vertreterin ihres Chefs Axel Bielke gewesen, der an einer Schussverletzung laborierte. Heidi Dybäck wurde im Prinzip im ganzen Polizeiapparat nur Heidi Hitler genannt, aufgrund ihrer Aggressivität und ihres vollständigen Unwillens, ihren Mitarbeitern zuzuhören. Eine giftige kleine Satansbraut, so lautete das weit verbreitete Urteil. Das Gesicht war rot unterlaufen und auf eine Weise in Falten gelegt, dass Sara mutmaßte, dass Heidi eine Alkoholikerin war, die ihren Job einwandfrei erledigte, sich dafür aber jeden Abend besinnungslos trank. Von der Sorte, die in der Morgendämmerung aufstand und auf der Arbeit deswegen so penibel war, weil sie hoffte, damit die schmerzhafte Sehnsucht dämpfen zu können, am Abend wieder im Vollrausch zu versinken. Und alles, was andere Leute zu ihr sagten, war nichts als ein Hindernis auf dem Weg in die abendliche Auslöschung. Daher der Zorn auf die Kollegen genauso wie auf den Rest der Welt. Ihrer Kleiderwahl fehlte ein strukturierender Gedanke, heute trug sie eine dunkelgrüne Fjällrävenhose mit Seitentaschen, braune Schneestiefel und einen beigen Babydoll-Umhang mit Peter-Pan-Kragen. Es blieb unklar, was sie damit sagen wollte.
Andere Veränderungen unter den Kollegen betrafen eher das Äußere. Carro hatte sich das Haar auf Streichholzlänge gekürzt, während Sara krankgeschrieben gewesen war und sich einen Ring in die Nase gesetzt hat. Der muskulöse Leo hatte sich einen Vollbart wachsen lassen und begonnen, einen Hut zu tragen. Einen kleinen Porkpie, der auf dem großen Kopf etwas verloren aussah. Nur Peter sah aus, wie er immer ausgesehen hatte, mit seinem struppigen Haar, seinem Hoodie und der Ladung Snus Kautabak unter der Oberlippe.
»Aber wer hat es gefilmt?«, fragte Carro in einem Versuch, das Gespräch wieder in die richtige Richtung zu lenken. »Im Prinzip kann es der Vorstandsvorsitzende getan haben. Aber wer hat es dann ausgeschaltet und das Video verschickt?«
Der Besprechungsraum in der Wache in Solna war kühl. Eine milde Oktobersonne wärmte durch die Fenster, und einer der Fensterflügel stand auf Kipp und ließ frische Luft herein.
Während die Stille sich im Raum ausbreitete, dachte Sara darüber nach, wie die anderen sie wohl betrachteten. Als Kollegin, die ständig in der Krise war? Anna wusste ein wenig von dem, was passiert war. Dass Saras Leben bedroht gewesen war, aber mehr auch nicht. Niemand hier wusste etwas von dem Terroristen Abu Rasil oder über Faust.
Oder über Geiger. Saras Kindheitsidol Lotta Broman war ganz nahe daran gewesen, den größten Terroranschlag in der Geschichte Europas zu verüben.
Alles war vorbei, aber Sara fragte sich, wie lange diese Ereignisse sie noch verfolgen würden. Der Tod, die Gewalt und vor allem die vielen Leute, die sie im Stich gelassen hatten. Vermutlich für immer. Und sie dachte, dass sie damit leben könnte, wenn sie sich nur nicht für den Rest des Lebens so schlecht fühlen würde wie jetzt.
Sie hatte ihr natürlich rotes Haar herauswachsen lassen, und es war jetzt halb aschblond, halb feuerrot. Es erinnerte ein wenig an ein Thermometer. Je mehr Drama es in ihrem Leben gab, desto röter wurde es.
Die Narben im Gesicht saßen eben, wo sie saßen, aber man konnte sie überschminken. Sie wusste nicht, ob sie noch mehr Operationen über sich ergehen lassen wollte. Vielleicht würde sie die Narben auch lieber behalten, die Welt sehen lassen, was sie durchgemacht hatte. Viel zu viele Frauen versteckten ihre Narben. Sowohl die physischen als auch die emotionalen.
»Wo ist derjenige, der das Video abgegeben hat? Wartet er hier irgendwo?«
Heidis schmale Pfefferkorn-Augen starrten Sara mit einer Glut an, als würde sie versuchen, ein Loch in sie hineinzubrennen.
»Auf keinen Fall«, sagte Anna und imitierte daraufhin Harald Mobergs aufgeblasene Stimme: »Ich habe einen Konzern zu führen. Vierzigtausend Menschen unterliegen meiner Verantwortung.«
»Er ist also gegangen?«, fragte Carro verwundert.
»Wir haben die Nummer seiner Assistentin bekommen«, sagte Sara und hielt eine Visitenkarte hoch.
»Aber vielleicht war es auch die Sekretärin der Assistentin.«
»Ja, ja, das spielt ja auch keine Rolle«, sagte Heidi und breitete die Arme aus. »Ein Mord und ein Selbstmord, danach kann ja nicht mehr viel passieren. Sorgt aber bloß dafür, dass die Zeitungen nichts erfahren. Wir wollen keinen Skandal. Habt ihr mich gehört? Das hier ist Top Level Security!«
Alle nickten. Niemand hatte Lust, Heidis Vorliebe für reißerische englische Filmausdrücke zu kommentieren.
»Die Frage ist jetzt«, sagte Sara, damit sie nicht mehr an ihren derzeitigen Führer denken musste, »wer das hier gefilmt und wer das Video geschickt hat, wobei es sich vermutlich um ein und dieselbe Person handelt.«
»Und warum ausgerechnet Moberg das Video bekommen hat«, fügte Anna hinzu.
»Wir müssen nach Verbindungen zwischen den Toten suchen.«
»Fantastische Idee«, sagte Anna ironisch. »Dass noch niemand daran gedacht hat.«
»Eifersucht? Geschäfte?«, fuhr Sara fort, ohne sich um die Stichelei zu kümmern.
»Hatte Sandin psychische Probleme? Ist unlängst etwas passiert, was dazu geführt haben könnte? Was macht Schildt eigentlich heute, oder machte, besser gesagt? Es ist ja eine Weile her, dass er Minister war.«
»Ihr dürft niemandem etwas von dem Video erzählen«, sagte Heidi. »Oder dass sie tot sind. Da kommt der Deckel drauf.«
»Aber wie sollen wir dann ermitteln?«, fragte Sara und runzelte die Stirn. »Wenn der Deckel draufbleiben soll?«
»Schafft ihr es etwa nicht, die Klappe zu halten? Meinst du vielleicht das? Ihr seid doch nicht zurückgeblieben!«
Für ein paar Sekunden war es mucksmäuschenstill, bis Peter sich räusperte. »Das heißt nicht zurückgeblieben, sondern kognitiv beeinträchtigt«, merkte er an.
»Idiot!«
»Es heißt nicht Idiot, sondern Audibesitzer.«
Carro lächelte, aber vor allem, um nett zu Peter zu sein.
»Okay«, sagte Sara und übernahm erneut das Kommando. »Keiner der beiden Männer im Video ist im Kriminalregister zu finden, also gibt es dort keine Anhaltspunkte.«
»Sollen wir Moberg Polizeischutz geben?«, fragte Anna und richtete ihren Blick auf Heidi.
»Warum denn?« Heidi sah beinahe beleidigt aus.
»Er hat schließlich das Video bekommen. Und den Zettel mit ›You’re next‹. Ist das nicht eine Art Drohung?«
»Von wem? Der Mörder ist doch tot.«
»Aber wer hat die Videoaufnahme bei ihm abgegeben?«
»Jetzt mach einen Fall, der gelöst ist, nicht unnötig kompliziert«, lautete das abschließende Urteil ihrer Chefin. »Fahrt besser los und informiert die Familien über die Todesfälle.«
Carro und Peter übernahmen die Familie Schildt, Anna und Sara fuhren zu Sandins. Als Heidi außer Hörweite war, erinnerte Sara die anderen daran, dass der Auftrag nicht nur darin bestand, die Angehörigen zu informieren, sondern auch darin, dort mehr über die Opfer zu erfahren. Gab es Angehörige, die etwas wussten, was das Ganze erklären konnte? Gab es private Verbindungen zwischen Schildt und Sandin?
Anna saß am Steuer. Sie pflegten stets darüber zu streiten, wer fahren sollte, weil beide es langweilig fanden, daneben zu sitzen, aber dieses Mal dachte Sara nicht einmal darüber nach. Und wie immer, wenn Anna fuhr, legte sie Michelle Shockeds »Captain Swing« auf.
Durch die Windschutzscheibe sah Sara das orange Laub am Sundbybergsvägen liegen und ließ ihre Gedanken wandern. Vielleicht bedeutete ihr herauswachsendes rotes Haar nicht nur die Rückkehr ihrer jugendlichen Energie, sondern war ganz im Gegenteil auch das rote Herbstlaub des Körpers? Vielleicht schloss sich bald ihr Lebenskreis? So oft man auch als Teenager an den Tod dachte, verstand man niemals, was er bedeutete. Mittlerweile spürte sie die baldige Auslöschung im ganzen Körper, der von unzähligen Gebrechen geplagt wurde nach all dem, was Sara hatte durchmachen müssen. Sie hatte das Gefühl in mehreren Fingern verloren und war mittlerweile gezwungen, auf der Seite zu schlafen, weil sich ansonsten der Rücken versteifte. Ständige Gedanken an den Tod weckten die Gedanken daran, wie ihre Tochter Ebba und ihr Sohn Olle mit ihrer Trauer und ihrer Verzweiflung umgehen würden. Sie hatten es in letzter Zeit sehr schwer gehabt mit ihrem deprimierten Vater, einer krankgeschriebenen Mutter und einem Großvater, der plötzlich aus dem Leben geschieden war. Obwohl Ebba bereits von zu Hause ausgezogen war, fiel sie in Saras Verantwortung und würde es auch in Zukunft tun.
Sara warf einen Blick zum Fahrersitz. Sie war auf jeden Fall froh, dass sie ihrer Freundin vergeben hatte, nachdem sie ihr im Auftrag ihres Chefs Bielke hinterherspioniert hatte. Sie hatte verstanden, dass Anna es vor allem getan hatte, weil sie sich Sorgen um sie machte. Und hätte sie nicht mitgemacht, dann hätte Bielke Sara auch nicht in Solna aufgenommen. Wo wäre sie dann gelandet? Mit ihrer Befehlsverweigerung im Zusammenhang mit dem Mord am Sexualverbrecher Stellan Broman hatte sich Sara bei keinem der Personalverantwortlichen im Polizeiwesen beliebt gemacht.
Dass sich nachher herausgestellt hatte, dass Bielke gewisse Hintergedanken hatte, als er Anna bat, Sara unter Aufsicht zu halten, war eine andere Geschichte. Gedanken, aus denen Wirklichkeit geworden war. Eine einzige gemeinsame Nacht. Er hatte sich zur richtigen Zeit am richtigen Ort befunden. Sara bereute es nicht, aber sie würde es auch nicht wiederholen wollen.
Obwohl das Video, das sie sich gerade angesehen hatten, zu den widerwärtigsten Dingen gehörte, die Sara in ihrem ganzen Leben erlebt hatte, wurde ihr klar, dass sie sich für diesen Fall nur schwer engagieren könnte. Weder die Brutalität noch das Rätselhafte, was das Ganze umgab, brachten sie in Fahrt. Das Einzige, woran sie dachte, war das, was im Keller von Martins Eltern passiert war. Wie ihr Schwiegervater die Erhängung seines Sohns vorbereitet hatte, um Sara in eine Falle zu locken, die einen sehr lang gezogenen und qualvollen Tod mit sich gebracht hätte.
Ihr Schwiegervater. Das Monster Eric Titus. Wie war es möglich, so wenig über einen Menschen zu wissen, den man seit dreißig Jahren kannte? War sie eine so schlechte Menschenkennerin? Wie viele von denen, die sie täglich traf, trugen ähnliche Geheimnisse in sich? Eric musste einzigartig gewesen sein. Die Alternative wäre grauenvoll. Dass es mehr von seiner Art gäbe, denen nicht nur sie, sondern auch Ebba und Olle ausgesetzt sein könnten.
Annas Handy klingelte, und sie nahm das Gespräch an. Normalerweise hätte Sara ihr jetzt eine Grimasse gezeigt, weil man sich nicht mit dem Handy beschäftigen durfte, während man fuhr, aber in diesem Moment war es ihr gleichgültig.
»Hallo, Schatz«, sprach Anna in das Handy. »Auf der Arbeit … Mit Sara. Im Auto.«
Anna hörte zu, nickte vor sich hin und schaltete das Autoradio ein, damit das Gespräch über die Lautsprecher übertragen wurde.
»Sag Hallo«, forderte sie Sara auf.
»Hallo, Lina.«
Lina war Annas große Liebe, aber für Sara war Lina nur eine zusätzliche Erinnerung an alles, was passiert war, weil Anna und Lina sich auf dem Fest zum zwanzigjährigen Jubiläum von Martins Firma kennengelernt hatten. Martin, der stillschweigend zugesehen hatte, als eine Frau auf Befehl des Rappers Uncle Scam in einer bestialischen Peepshow umgebracht worden war. Martin, mit dem sie immer noch verheiratet war, mit dem sie aber nicht mehr das Bett teilte und den sie auch nicht mehr liebte. Er war nur noch ein Schatten seiner selbst, eine Pappfigur als Papa. Waren sie noch verheiratet wegen der Kinder oder weil Sara nach wie vor eine klitzekleine Hoffnung auf eine Wiedervereinigung nährte, trotz allem, was passiert war?
»Hallo, alles gut?«, fragte Lina und unterbrach ihren Gedankengang.
»Ja, bestens.« Es war trotz allem eine leere Phrase.
»Wo seid ihr?«
»Auf dem Weg nach Östermalm. Warum?«, fragte Anna.
»Also, ich dachte, wenn ihr auf Södermalm gewesen wärt, dann hätten wir zusammen zu Mittag essen können.«
»Das wäre schön gewesen. Ein andermal vielleicht.«
Anna und Lina verabschiedeten sich mit Kussgeräuschen und beendeten das Gespräch. Sara nahm den bekannten Faden auf, dass Anna einen festeren Bund mit Lina eingehen sollte, und die Freundin argumentierte gegen diesen Vorschlag. Sara wies darauf hin, dass Anna sehr verliebt wirke, doch Anna meinte, dass dies genau das Problem sei. Lina sei »zu hübsch, zu gut« für sie.
»Sie hat es sogar selbst gesagt«, meinte Anna und lachte. »Wenn sie mein Profil auf Tinder gesehen hätte, hätte sie niemals nach rechts gewischt.«
»Wie gemein.«
»Nein, ganz im Gegenteil. Denn es bedeutet, dass die richtige Anna besser ist, denn mit mir ist sie ja schließlich zusammen. Also, diese Profile sind total geisteskrank. Alle lügen und schneiden auf und suchen sich Bilder aus, auf denen sie wesentlich reizvoller aussehen als in Wirklichkeit.«
»Aber warum hast du Tinder, wenn du mit ihr zusammen bist?«
»Das habe ich gar nicht. Mein Profil habe ich gelöscht. Aber sie wollte es sich erst noch ansehen.«
»Sie kontrolliert dich?«, sagte Sara und lächelte. »Wer ist denn die Polizistin von euch? Sieht sie sich auch deine SMS an?«
In dem Moment fiel Sara ein, dass sie auch mal wieder auf ihr eigenes Handy sehen sollte. Sie hatte nach den Ereignissen mit Abu Rasil einen starken Widerwillen dagegen entwickelt, wusste aber, dass die Tatsache, nicht auf die Mail von Pastor Jürgen Stiller geantwortet zu haben, ihn und seine Frau im letzten Sommer vermutlich das Leben gekostet hatte. Deshalb erinnerte sich Sara ständig daran, das Mobiltelefon im Auge zu behalten, obwohl es ihr nicht behagte. Es fühlte sich an, als kämen nur schlechte Nachrichten und Todesmeldungen über den Bildschirm.
Nicht in diesem Fall allerdings. Nur ein verpasster Anruf von Malin Broman. Was wollte sie? Keine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, also war es wohl nicht wichtig.
Anna und Sara waren zu der riesigen Wohnung in Lärkstan gefahren, in der August Sandin gewohnt hatte, und waren von seiner schlanken, gut geschminkten Frau Valeria empfangen worden, die im Augenblick etwas abwesend wirkte. Sie trug hochhackige Schuhe bei sich zu Hause und hatte einen schwer zu identifizierenden ausländischen Akzent.
Sie hatten die Todesnachricht überbracht, und wenn sie eine Reaktion erwartet hatten, dann ganz bestimmt nicht diese: dass die Ehefrau des Toten einen großen, orangefarbenen Kalender von Hermès mit einem Einband, der vermutlich aus Krokodilleder gefertigt war, herausholte, in den sie mit einem Montblancstift aus der Marcel-Proust-Produktlinie »August tot« in die Zeile des heutigen Datums eintrug.
Dass August sich das Leben genommen haben sollte, konnte sie nur schwer glauben, aber wenn die Polizei es sagte, dann musste es wohl so gewesen sein. Ein Grund für diese Tat fiel ihr allerdings nicht ein.
»Kannte Ihr Mann Jan Schildt?«, fragte Anna. »Den ehemaligen Außenminister?«
»Das weiß ich nicht.«
»Hatte er einen Grund, schlecht über ihn zu denken?«
»Das weiß ich nicht.«
Valeria Sandins Gesichtsausdruck war vollkommen neutral. Die Stirn blank vom Botox.
»Wann haben Sie Ihren Mann das letzte Mal gesehen?«
»Vor ein paar Tagen vielleicht.«
Frau Sandin blätterte in ihrem Krokodilkalender und legte einen langen, leuchtend roten Nagel unter eine Notiz.
»Hier. Am Freitag. Als er zur Arbeit fuhr.«
»Sie haben sich am gesamten Wochenende nicht gesehen?«, hakte Sara nach.
»Nein. Warten Sie.«
Der perfekte Zeigefinger blätterte im Kalender, der in die Haut eines einst lebendigen Wesens gehüllt war.
»Er sollte auf eine Konferenz.«
»Was für eine Konferenz?«
»Für die Arbeit. Aber das sagte er immer, wenn er zu Gustav wollte.«
»Wer ist das denn?«, fragte Sara und musste aus irgendeinem absurden Grund an Gustav Gans bei Donald Duck denken. Manchmal wunderte sie sich über ihre eigenen Assoziationen.
»Sein Freund. Wenn Sie verstehen, was ich meine.«
»Ein Sexualpartner? Liebhaber?«
Valeria Sandin ließ ihre Hand hin und her wackeln, während sie nachdachte, als wollte sie andeuten, dass es schwer zu definieren war.
»Lustknabe«, sagte sie schließlich.
Anna holte tief Luft und ließ sie langsam wieder heraus, bevor sie antwortete.
»Wir verstehen, dass das Ganze traumatisch ist. Wenn Sie mit jemandem reden müssen, dann gibt es PsychologInnen, deren Nummern wir Ihnen geben können. Aber leider müssen wir Sie bitten, noch niemandem von Augusts Tod zu erzählen. Aus ermittlungstechnischen Gründen brauchen wir noch etwas mehr Zeit, um die Vorgeschichte zu untersuchen, bevor alles an die Presse geht.«
Valeria zuckte als bestätigende Geste mit den schlanken Schultern.
»Okay. Wenn Sie mir auch mit einer Sache helfen.«
»Soweit es geht«, sagte Anna abwartend.
»Kommen Sie.«
Sie folgten ihr durch einen langen Küchenflur in die inneren Bezirke der Wohnung. Valeria öffnete die Tür zu einem Zimmer, in dem zwei Handwerker standen und mit Wasserwaage, Hammer und Nägeln warteten. Der eine hielt ein Bild in grellen Pastellfarben in den Händen. Es zeigte ein unklares Motiv, das aus Federn und Augen und Wolken in einem wilden Durcheinander bestand.
»Wo sollen sie das Bild aufhängen? Ich kann mich nicht entscheiden, und sie sprechen kein Schwedisch.«
Bevor Sara die bizarre Szene kommentieren konnte, klingelte ihr Handy. In der Hoffnung, aus dieser Gemäldesituation herauszukommen, antwortete sie sofort und hatte direkt die aufgeregte Stimme ihrer Schwiegermutter im Ohr.
»Sie sind wieder hier gewesen! Das Salz steht falsch!«
Und dann hörte sie das Geräusch einer weinenden Marie Titus, am Boden zerstört wie ein Kind, dessen Teddy verschwunden war.
»Sie geben mir den Rest«, schluchzte sie. »Sara, du musst sie aufhalten.«
6
Sara blieb einen Moment vor der Außentür stehen, bevor sie hineinging.
»Titus«, verkündete das blanke Namensschild.
So hätte sie auch heißen können.
Sara Titus.
Wenn sie den Nachnamen ihres Mannes angenommen hätte.
Wie hätte sie das beeinflusst? Wäre sie eine andere gewesen? Oder war der Nachname nur Ornament?
Wofür stand eigentlich »Titus«? Die Familie eines bösen Mannes. Ein Erbe aus Opfern und Tätern. Sara weigerte sich, ein Teil davon zu sein. Sie weigerte sich, sich von dem Ungeheuerlichen, das sie erlebt hatte, und dem Schrecklichen, das sie hatte tun müssen, verhärten zu lassen. Sie hatte Narben fürs Leben bekommen, sowohl körperlich als auch seelisch, und sie würde niemals mehr so sein wie vorher. Aber sie trug eine Verantwortung gegenüber ihren Kindern. Sie musste es nicht nur überleben, sondern die Kinder auch vor ihren eigenen Traumata schützen. Dafür sorgen, dass sie ihre Wut nicht an die nächste Generation weitergab, wie Eric es getan hatte.
Sie sah erneut auf das Namensschild.
Blankes Messing mit altmodischem Schriftbild. Sorgfältig ausgewählt. Die Hausfassade und das Namensschild stellten die Abgrenzung zur Außenwelt dar, die Oberfläche, die man anderen entgegenhielt. Sie sagten, wer man sein wollte. Natürlich abhängig von den Ressourcen, die man hatte. Nicht alle konnten sich die Fassade leisten, die sie gerne hätten.
Was Eric Titus betraf, hätte genauso gut Faust oder Otto Rau auf dem Namensschild stehen können, denn er war genauso sehr auch sie. Vielleicht lagen diese Identitäten sogar näher an Erics wirklichem Ich. Hier, wie in allen anderen Familien in gut situierten Gegenden auch, galt es, den Dreck unter den handgeknüpften Teppich zu kehren, aber Eric hatte bedeutend schlimmere Sachen zu verbergen gehabt als irgendeiner seiner Nachbarn. Seine Boshaftigkeit übertraf sogar die von Stellan Broman.
Es verwunderte Sara, dass Martin denselben Nachnamen behalten hatte wie der Vater, obwohl dieser ihn in seiner Jugend so sehr gequält hatte. Vielleicht hatte er den Schritt nicht gewagt. Eric zumindest hätte ihn bestimmt nicht zugelassen. Möglicherweise brauchte Martin auch den soliden Eindruck, den der Name Titus vermittelte, gerade weil sein Inneres das reinste Chaos war.
Und jetzt war sogar Maries Fassade eingebrochen.
In den fünfundzwanzig Jahren, die Sara ihre Schwiegermutter mittlerweile kannte, hatte diese nie etwas anderes gezeigt als ein breites Lächeln. Höchstens eine bekümmerte Furche zwischen den Augenbrauen, falls ein Rock von Schuterman nicht die Qualität hielt, die sie erwartet hatte. Sara musste zugeben, dass sie froh darüber war, dass Marie jetzt ihre Deckung fallen gelassen hatte, auch wenn sie natürlich hoffte, dass nichts Schlimmes passiert war.
Hätte Sara nicht Erics Thronerben Tom Burén versprochen, eine Vollmacht von Marie und Martin zu besorgen, dann wäre sie nie davon ausgegangen, das Haus von Eric in ihrem Leben noch einmal zu besuchen. Tom wartete bereits mehrere Wochen und klang ausgesprochen angespannt, wenn er hin und wieder bei Sara anrief und sie mit höflicher Stimme daran erinnerte, dass er diese Vollmacht nun aber wirklich brauche, um den Konzern zu leiten. Jetzt konnte sie in der Frage endlich etwas unternehmen. Aber am liebsten hätte sie das Haus nie wieder gesehen.
Bevor sie eintrat, schaute Sara sich um. Vielleicht um zu sehen, ob es Hilfe in der Nähe gab oder ob von irgendwo her eine Gefahr im Anmarsch war.
Die grauen Wolken, die den Himmel bedeckten, wirkten plötzlich eher bedrohlich als langweilig. Nicht einmal hier blieb man von der Tyrannei der Jahreszeiten verschont.
Nicht einmal auf dem Grönviksvägen 189 in Bromma. Eine Adresse, die so nobel war, wie man es sich nur vorstellen konnte.
In derselben Straße wie die Bromans und damit auch in derselben, in der Sara einst gewohnt hatte. Was eine große Sache war, als Sara ein frischgebackener Teenager war. Der hübscheste Junge der Schule wohnte ebenfalls in dieser Straße. Wie oft war sie mit dem Fahrrad dort vorbeigefahren und hatte versucht, einen kurzen Blick auf Martin zu erhaschen.
Aber das war damals gewesen. Als sie dieses Haus zum letzten Mal betreten hatte, war es für sie um Leben und Tod gegangen.
Jetzt war es an der Zeit, das Kommando über das eigene Leben zurückzugewinnen. Wenn der Teufel weg ist, ist die Hölle nichts anderes mehr als ein warmer Ort.
An den Keller wollte sie allerdings nicht denken. Es war immer noch zu viel, um es zu verarbeiten. Wie Martin hier wohnen konnte, verstand sie nicht. Vielleicht war es für ihn eine Methode, Sara zu zeigen, wozu sie ihn zwang, wenn sie ihn nicht zu Hause wohnen ließ. Dann wurde er nämlich genötigt, sich in seine Kindheit zurückzuziehen, in die Erniedrigung. Alles nur wegen Sara.
Aber sie konnte nicht mit ihm zusammenleben, nicht nach dem, was mit Uncle Scam passiert war.
Die Ereignisse, die sich im Keller abgespielt hatten, tauchten wieder in ihrer Erinnerung auf, obwohl sie alles versuchte, um sie auszusperren. Die Kopfschmerzen, die sich herangeschlichen hatten, pochten jetzt gegen die Schläfen, ließen sie Übelkeit verspüren. Sie musste fest schlucken, während der verzweifelte Kampf von Neuem in ihr hochkochte. Ihre Angreifbarkeit, ihr gebrochener Ehemann, die Panik, nicht nur für das eigene Leben, sondern auch für Martins kämpfen zu müssen. Damit Olle und Ebba nicht elternlos wurden. Damit sie ihre Kinder wiedersehen konnte. Und dann der Schock darüber, dass ihr Schwiegervater das Böse war, das sie die ganze Zeit gejagt hatte. Dass jemand aus ihrem Umkreis, aus ihrer eigenen Familie, sie töten wollte. Und es ihm fast geglückt wäre. Dass er all seine destruktive Energie gegen sie gewendet hatte. Dass sie am Ende gezwungen war, ihn umzubringen.
Und wie sie anschließend, ohne darüber nachzudenken, Thörnell anrief, statt ihre Kollegen bei der Polizei. Aus purem Instinkt. Sie hatte trotz ihres verwirrten Zustands das Gefühl gehabt, dass es Menschen gab, die ein starkes Interesse daran hatten, die Informationen über Eric Titus’ Todesfall zu kontrollieren. Irgendwo tief in ihrem Inneren war ihr vielleicht auch klar gewesen, dass der Anruf bei Thörnell die beste Chance für sie war, aus dem Ganzen herauszukommen, ohne dass ihre eigenen Kinder erfahren mussten, wer ihren Großvater getötet hatte.
Und tatsächlich war alles vertuscht worden. Offiziell bestand die Todesursache darin, dass er einen Herzinfarkt erlitten hatte. Marie kümmerte sich um die Enkelkinder, während Martin zum Krankenhaus gefahren wurde, um anschließend direkt an die psychiatrische Notaufnahme weitergereicht zu werden, bis er schließlich in einem Behandlungsheim für Patienten mit posttraumatischer Belastungsstörung landete. Sara wurde wochenlang nach dem ausgefragt, was sie wusste und was geschehen war. Sie beschlich das Gefühl, dass man vor allem wissen wollte, ob man sich auf sie verlassen konnte.
»Warum machen sie das?!«
Marie war abgemagert. Und sie war blass geworden. Sie hatte offensichtlich keine Zeit oder auch keine Lust, für die früher stets perfekte Sonnenbräune zu sorgen. Und sie hatte vergessen, sich zu schminken. Ob dieser Verfall eine Folge des Todes ihres Mannes war oder auf dem jetzt erlebten Angriff beruhte, war schwer zu sagen.
»Was machen sie denn?«, fragte Sara. »Und wer überhaupt?«
Die Augen der Schwiegermutter waren aufgerissen und ängstlich.
In dem Titusschen Heim hatte alles seinen exakten Platz, darüber wusste Sara Bescheid. Es war ihr immer ein bisschen unangenehm gewesen, sich dort zu bewegen. Sie hatte Angst, gegen irgendetwas zu stoßen, einen Teppich zu zerknittern, die Ordnung zu zerstören. Wenn es irgendetwas gab, was Pedanten in den Wahnsinn trieb, dann waren es kleine Abweichungen in ihrem häuslichen Stillleben, und wenn Sara etwas nicht vermeiden konnte, dann war es ihre Eigenschaft, überall, wo sie unterwegs war, die Ordnung zu zerstören. Also waren die Besuche bei den Schwiegereltern stets mit einer gewissen Anspannung behaftet gewesen.
Sie sah sich um. Alles sah genauso aus wie immer. Die Möbel von der Nordiska Galleriet, die echten Teppiche, die Kronleuchter. Der einzige Unterschied bestand darin, dass ein riesiges Porträt von Eric an die Wand in der Halle gelehnt war, oberhalb von Josef Franks Schrank 881 aus Vavona Maser. Sara fiel auf, dass sie nie zuvor ein Foto von Eric gesehen hatte. Auf dem Foto war der Schwiegervater auffallend jung. Vielleicht gab es keine Aufnahmen von ihm aus späteren Jahren, weil es wichtig für ihn gewesen war, nicht gesehen zu werden, nicht identifiziert zu werden. Oder Marie sehnte sich zurück in die Zeit, als sie ihren Mann kennengelernt hatte, danach, wie er ihr damals erschienen war.
»Was haben sie denn deiner Meinung nach bewegt?«, fragte Sara und sah sich um.
»Alles! Die Fernbedienungen liegen in der falschen Reihenfolge. Das Küchenhandtuch hängt mit dem Waschzettel zur Wand. Die große Schere liegt rechts von den Pfannenwendern. Wer ist denn ständig hier und sorgt für diese Unordnung?«
Gespenster, dachte Sara. Das hätte jedenfalls Anna gesagt. Dein eigenes Gehirn, wollte Sara am liebsten sagen. Aber die Schwiegermutter brauchte jemanden, der ihr glaubte. Ganz unabhängig davon, wie unwahrscheinlich ihre Geschichten waren. Und Sara wusste, dass der ostdeutsche Geheimdienst manchmal so gearbeitet hatte, um Andersdenkende gerade mit solchen minimalen Veränderungen in ihrem Haushalt, die sie zum Nachdenken brachten und an ihrem Verstand zweifeln ließen, zu zerbrechen. Am Ende gaben sie auf und erhängten sich.
Aber die Stasi gab es nicht mehr.
»Hat vielleicht Martin die Sachen verschoben?«
Obwohl Martin die exakte Ordnung der Dinge in diesem Haus von Kindesbeinen an eingeimpft bekommen hatte, könnte er ja ein paar Details im Laufe der Jahre vergessen haben, besonders nach den traumatischen Erlebnissen der letzten Zeit.
»Er hat sein Zimmer den ganzen Tag nicht verlassen. So war es an allen Tagen, an denen sie hier waren, er liegt einfach dort und schläft.«
»Schläft?«
»Ja, er hat ja all die Jahre so hart gearbeitet. Da ist es doch verständlich, wenn er jetzt total erschöpft ist.«
Wollte Marie nicht einsehen, dass ihr Sohn sich schlecht fühlte, oder konnte sie es nicht? War ihr klar, dass sie selbst sich ebenfalls in einem Auflösungszustand befand?
Sara folgte Marie in das Untergeschoss, wo die Witwe mit gellender Stimme auf all die Dinge zeigte, die eine Winzigkeit verkehrt lagen. Sara beruhigte die verwirrte Frau, so gut sie konnte, und versicherte ihr, dass sie so etwas ebenfalls erlebte. Sie war überzeugt davon, dass sie etwas an einen bestimmten Ort gelegt hatte, um es später ganz woanders zu finden. Und sie erklärte in einem mitleidigen Tonfall, dass die Polizei keinen Fall übernehmen konnte, bei dem es um verschobene Fernbedienungen ging. Dann holte sie eine blaue Plastikmappe mit einem Zettel darin heraus.
»Eine Vollmacht«, sagte Sara. »Tom hat von sich hören lassen und gesagt, dass weder du noch Martin nach Eric übernehmen wollen. Aber irgendjemand muss alle Papiere unterschreiben. Es ist ja jetzt euer Konzern.«
Marie betrachtete das Papier, dann Sara.
»Eine Vollmacht? Damit wir nichts machen müssen?«
»Damit ich für euch unterschreiben kann. Bis ihr wisst, was ihr machen wollt. Aber ich lasse natürlich bis auf Weiteres Tom bestimmen, der alles weiß und den Betrieb kennt.«
»Wie schön.«
Marie nahm den Stift, den Sara ihr hinhielt, und setzte ihre Unterschrift auf das Dokument.
»Willst du Martin nicht Hallo sagen?«, fragte die Schwiegermutter unvermittelt, und Sara bekam das Gefühl, dass es eigentlich nur um genau diesen Punkt gegangen war. Sorge um den Sohn, die Marie nicht einmal sich selbst gegenüber eingestehen konnte, sondern dadurch verbarg, dass sie sich auf die Position des Salzstreuers auf dem Esstisch konzentrierte.
»Doch. Er muss ja auch unterschreiben.«