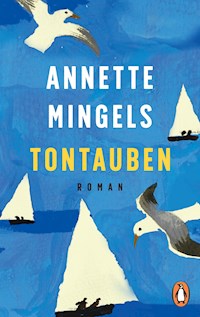9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Albrecht Knaus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Dass sie adoptiert wurde, weiß Susa seit ihrer Kindheit. Es hat sie nie gestört – sie liebt ihre Eltern und wird von ihnen geliebt; daran ändert sich auch nichts, als sie ihre leibliche Mutter Viola kennenlernt, mit der sie nichts zu verbinden scheint. Aber dann erfährt Susa von Brüdern und verspürt eine irritierende Sehnsucht nach ihnen. Und ist der Wunsch, den biologischen Vater kennenzulernen, ein Verrat an ihrem im Sterben liegenden Adoptivvater? Als Susa sich in Henryk verliebt, der zwei Töchter mit in die Ehe bringt, wird die Sache noch komplizierter. Was ist das überhaupt, eine Familie? Was begründet sie? Die Gene? Oder doch die Liebe?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 358
Ähnliche
Über das Buch:
Dass sie adoptiert wurde, weiß Susa seit ihrer Kindheit. Es hat sie nie gestört – sie liebt ihre Eltern und wird von ihnen geliebt. Daran ändert sich auch nichts, als sie ihre leibliche Mutter kennenlernt, mit der sie nichts zu verbinden scheint. Und doch … Susa erfährt von Brüdern und verspürt eine irritierende Sehnsucht nach ihnen. Und ist der Wunsch, den biologischen Vater kennenzulernen, ein Verrat an ihrem im Sterben liegenden Adoptivvater? Als Susa sich in Henryk verliebt, der zwei Töchter mit in die Ehe bringt, wird die Sache noch komplizierter. Was ist das überhaupt, eine Familie? Was begründet sie? Die Gene? Die Liebe?
In ihrem neuen Roman erzählt Annette Mingels von den vielen Spielarten der Familie. Ob biologisch oder sozial gewachsen, intakt oder dysfunktional, herbeigesehnt oder abgelehnt – immer geht es der Autorin um das, was Familie in unserer Zeit ausmacht: die Nähe zueinander, die Distanz, die Unmöglichkeit einander ganz zu verstehen, die Brüchigkeit des Ganzen und seine Belastbarkeit.
Über die Autorin:
Annette Mingels wurde 1971 in Köln geboren und dort im Alter von zwei Wochen adoptiert. Sie studierte Germanistik und promovierte über Dürrenmatt und Kierkegaard. Danach arbeitete sie als Dozentin und Journalistin. 2003 veröffentlichte sie ihren ersten Roman, dem drei weitere und ein Erzählband folgten. Nach Aufenthalten in Zürich und New York lebt Annette Mingels seit 2011 mit ihrer Familie in Hamburg.
Annette Mingels
WAS ALLES WAR
Roman
Knaus
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2017 beim Albrecht Knaus Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Der Abdruck aus Margaret Atwood, Alias Grace, erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Berlin Verlags in der Piper Verlag GmbH, Berlin
Covergestaltung: bürosüd nach einem Entwurf von Sabine Kwauka
Covermotiv: Bridgeman/Humboldt-Universität zu Berlin
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-20224-8V004
www.penguin.de
Wenn man sich mitten in einer Geschichte befindet, ist es keine Geschichte, sondern nur eine große Verwirrung; ein dunkles Brüllen, eine Blindheit, ein Durcheinander aus zerbrochenem Glas und zersplittertem Holz, wie ein Haus in einem Wirbelsturm oder wie ein Schiff, das von Eisbergen zerdrückt oder von Stromschnellen mitgerissen wird, und alle an Bord sind machtlos, etwas dagegen zu tun. Erst hinterher wird daraus so etwas wie eine Geschichte. Wenn man sie erzählt – sich selbst oder jemand anderem.
Margaret Atwood: Alias Grace
Anfangen
Der Brief traf an einem Montagmorgen ein, ich sah kurz auf den Absender und steckte den Umschlag in meine Tasche. Es war warm, die letzten schönen Tage vor dem Winter, wirklich goldenes Licht. Peter, der Hund, hechelte neben mir. Ich öffnete den Brief auf dem Weg zur Arbeit, ich las: Ihre Mutter würde Sie gerne kennenlernen, sie ist Schauspielerin und lebt in Indien. Ich las: Melden Sie sich bei ihr, falls Sie Interesse haben.
Der kurze Weg über die Promenade zum Maritimen Museum, Ilka am Telefon hinter dem Infoschalter, ich ging an Maltes Büro vorbei, die Tür stand weit offen, er sah mich und rief, lass uns heute endlich das Paper für die Biological Reviews schreiben!, er rief es mit einer Dringlichkeit, als ob ich ihn die letzten Wochen und Monate daran gehindert hätte. Ich ging in mein Büro, die Tür schloss ich sehr leise hinter mir.
Wenn ich Henryk damals schon gekannt hätte, hätte ich ihn jetzt angerufen. Ich hätte gefragt, was mach ich denn bloß?, und er hätte gesagt: Na, was wohl, du schreibst ihr eine Mail. Aber so saß ich nur vor meinem Schreibtisch, Peter darunter, und dachte nach, dann ging ich zu Malte, der an seinem Laptop saß, aufblickte und sagte: Den Titel hab ich bereits – Geschlechterkampf der Würmer!
Wenn ich Henryk schon gekannt hätte, hätten wir am Abend darüber gesprochen, über den Brief und die Aussichten, Viola kennenzulernen, über die Frage, wie das für meine Eltern sein würde, ob sie Angst hätten oder im Gegenteil plötzlich keine mehr, weil es, da war ich sicher, so sein würde, wie ich es immer geahnt hatte (kein Aufschrei, keine Heimkehr oder Einkehr), einfach eine Begegnung, das Schließen einer Klammer, die bei meiner Geburt geöffnet worden war. Vielleicht hätten wir auch über die Würmer gesprochen, wie sie einander zu überlisten versuchten, oder er hätte von seinem Tag erzählt, den er wahrscheinlich in der Bibliothek verbracht hätte, in den letzten Zügen seiner Habilitation zum Erlebnisgehalt des Minnesangs oder etwas ähnlich Abseitigem, es muss damals, vor fünf Jahren, ungefähr das gewesen sein, was er machte, aber da es weder ihn für mich gab noch Paula und Rena, somit also niemanden, mit dem ich sprechen oder dem ich vorlesen, dem ich Haare flechten oder Geschichten erzählen konnte, saß ich schließlich vor meinem Computer und schrieb an Viola. Ich habe den Brief vom Jugendamt bekommen, schrieb ich, und ja: Ich würde dich auch gerne einmal treffen. Dann drückte ich auf Senden, und die kurze Nachricht sauste davon, unaufhaltbar, uneinholbar, ich schaltete den Computer aus und ging ins Bett. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich hätte von Henryk geträumt und von den Mädchen, darum wären sie mir schon eigentümlich vertraut gewesen, als ich ihnen dann ein paar Wochen später begegnete, aber so war es nicht.
Liebe Susanna,
nun hätte ich beinahe Alina geschrieben. Denn so nannte ich dich immer, wenn ich von dir erzählte. Ja, ich habe von dir erzählt. Immer wieder. Alina, die kleine Alina, mit dem Schopf nasser Haare, die ich nur kurz gesehen habe, bevor sie mir von der übereifrigen Krankenschwester weggenommen wurde, einer norddeutschen Kratzbürste sondergleichen, die wahrscheinlich ohne jede Freude durchs Leben kam. Nun ja, weggenommen … Let’s be honest: Ich hatte dich freigegeben, schon Wochen vor der Geburt. Damals wurde man da noch nicht so verständig behandelt, wie es heute wahrscheinlich der Fall ist. Rein ging’s wohl leichter als raus, höhnte eine der Schwestern, als ich in den Wehen lag. Stell dir das vor! Und die Muttermilch, die ich während der ersten Woche jeden Tag ins Krankenhaus brachte, haben sie wahrscheinlich weggeschüttet, kaum dass ich ihnen den Rücken zuwandte.
Um fünf nach acht an einem Dienstagmorgen im Februar wurdest du geboren. Meine wunderbare Freundin Alina, nach der ich dich benannt hatte, erstellte mir später dein Horoskop: Wassermann mit Aszendent Waage. Also kreativ, mutig, freiheitsliebend, dabei charmant und um Ausgleich bemüht, jemand, der im Leben zurechtkommen würde. Ein chinesischer Drache, im Baumhoroskop eine Zeder: eigenwillige Persönlichkeiten, die gerne führen, voller Energie und Lebensliebe. Aber vielleicht ist das alles Quatsch für dich. Vielleicht ist dir die Stellung der Gestirne gleichgültig. Was soll es schon ausmachen, wo die Venus stand und was der Mond trieb, als du das Licht der Erde erblicktest! Mich jedoch hat es beruhigt.
Deine Eltern, so sagte man mir, seien künstlerisch veranlagt. Auch das beruhigte mich. Ohne Kunst verdorrt das Leben, ich hoffe, das haben sie dir beigebracht. Ich selbst bin zeitlebens der Kunst gefolgt. Sie ist mein Ziel, mein »leuchtender Pfad«. Und als du dich entschlossen hast, zu mir zu kommen, musste ich dich darum freigeben.
Aber nun endlich eine Begegnung. Wie sehr mich das freut! Werde ich dich erkennen? Wirst du mich erkennen? Lass uns keine Seelenverschwandtschaft erwarten, aber vielleicht ein Quäntchen Vertrautheit? We’ll see. Im März kann ich kommen. Schreib mir, ob dir das passt. Ich habe keinen eigenen Internetzugang, aber alle paar Tage kann ich hier, im Büro meines Freundes Goyal, an den Computer.
Vor mir steht ein kleines Bild der Göttin Durga, sie hat acht Arme und reitet auf einem Tiger, so vollkommen in ihrer Weisheit. Let’s take it as a sign.
Viola
Eine Fahrt über Land, vorbei an Dörfern und kleinen Städten, manchmal kilometerlang nichts als Wiesen, Gruppen von Windrädern darauf verteilt, wie kleine Kolonien, das Meer nah, aber fast nie zu sehen. Der Winter hat schließlich nachgegeben, die Sonne scheint, noch blass. Ich höre Radio, singe den Refrain der Lieder mit. Da, wo einmal die Grenze war, steht ein blaues Schild: Danmark, inmitten der gelben Sterne. Um halb vier parke ich das Auto vor dem Flughafengebäude, eine Stunde früher als nötig. An einem Kiosk blättere ich eine Zeitlang in einer dänischen Architekturzeitschrift und kaufe schließlich eine deutsche Zeitung, die ich im einzigen Café des Flughafens lese, dann gehe ich zum Terminal, der auf dem Monitor angegeben ist, und blicke wie die anderen Wartenden auf die breite Schiebetür, die sich immer wieder lautlos öffnet, um jeden Fluggast wie auf eine Bühne zu entlassen.
Da bist du also, sagt Viola, aber vielleicht sagt sie auch: Das bist du also, und ich nicke und nenne meinen Namen, was so formell klingt, dass ich es mit einem Lächeln zurückzunehmen versuche. Mein Auto steht nahe des Ausgangs, hier lang müssen wir, ist die Tasche schwer, soll ich sie nehmen? Sicher nicht? Wir haben uns fast sofort erkannt, nicht, weil wir uns ähnlich sehen, sondern weil wir uns angesehen und nicht wieder weggeschaut haben. Wir haben uns nicht umarmt, sondern einander die Hand gereicht, aber Viola hat ihre zweite Hand daraufgelegt, wodurch die Begrüßung etwas Feierliches bekam: die Begegnung zweier Staatsoberhäupter.
Hattest du einen guten Flug?
Ja. Doch, doch. Eigentlich waren es ja drei. Drei Flüge, meine ich. Neu Delhi – London. London – Frankfurt. Frankfurt – Sonderburg.
Über der Schulter trägt Viola eine lederne Reisetasche, in der rechten Hand einen Beutel aus bunter Seide. Graue Haare, die das Gesicht fransig umrahmen. Sie ist etwa einen Kopf kleiner als ich, nicht eigentlich zierlich, aber durch das schmale Gesicht wirkt sie schlanker, als sie ist. Dazu ihre Art zu gehen: der Gang einer Tänzerin, eher ein Schreiten als ein Gehen, aber sich seiner selbst zu bewusst, um wirklich anmutig zu sein. Auf ihrer Stirn sehe ich jetzt einen kleinen glitzernden Stein.
Auf dem zweiten Flug, sagt Viola, saß ein Geschäftsmann neben mir, der die ganze Zeit Zahlenkolonnen in seinem Laptop anschaute, unablässig. Wirklich. Sie sieht mich mit hochgezogenen Brauen an.
Gab’s keinen Direktflug?
Nein.
Wir haben inzwischen das Auto erreicht, und ich öffne den Kofferraum, um die Reisetasche zu verstauen, die Tür ist offen!, Viola setzt sich auf den Beifahrersitz, den Seidenbeutel auf ihrem Schoß wie eine zutrauliche Katze. Sie hält sich sehr gerade, schaut aus dem Fenster, wenn ich ihr erkläre, woran wir vorbeifahren, sieht mich manchmal von der Seite an, als ob sie etwas überprüfen wolle, und ich schaue dann angestrengt geradeaus. Nur einmal erwidere ich ihren Blick, und Viola sagt, du siehst aus wie er, die gleichen Augen, das blonde Haar. Meins war braun. Schnurgerade und braun, bevor es irgendwann grau wurde. Sie fährt sich mit einer Hand in die Stirnfransen, ordnet sie ein wenig, klappt die Sonnenblende herab und wirft einen prüfenden Blick in den Spiegel. Und du tust gut daran, die Brauen nicht zu zupfen, sagt sie, ohne mich anzusehen. Ich habe es übertrieben und jetzt wachsen sie nicht mehr nach.
Auf Höhe der Grenze säumen Lastwagen den Seitenstreifen. Käfige auf einer Ladefläche, je vier übereinander wie Kojen, hinter den Stäben undeutliche Bewegungen. Auf einem Kleinlaster ein Schriftzug, Aloha-Transport, zwischen den Lastwagen Zöllner in grellgrünen Westen.
Hast du Hunger?
Appetit, sagt Viola. Das schon.
Was ich bereits vor dem Hauptgang weiß: Sie fing ein Studium an und brach es ab, heiratete einen Medizinstudenten, sie lebten in der norddeutschen Provinz, das Schrecklichste vom Schrecklichen, sagt sie, dabei habe sie immer rausgewollt, raus aus der Provinz, raus aus Deutschland.
Mit dreiundzwanzig war sie geschieden und auf dem Weg nach München, wo sie zwei Jahre blieb, bevor sie nach San Francisco zog, dann Rio de Janeiro, Melbourne, Gomera und Ko Samui, dazwischen zwei Jahre Italien, einem römischen Schriftsteller verfallen, der große Ambitionen hatte, es aber zeitlebens nur zu einem – immerhin anerkannten – Buch über italienische Sommerweine brachte. Wovon sie lebt? Sie hebt beide Hände wie zu einer Willkommensgeste. Mal von diesem, mal von jenem. Meistens übersetze sie Bücher. In Indien, wo sie seit einigen Jahren lebe, brauche sie nicht viel Geld.
Es reicht, ich bin nicht gierig. Und du? Sie wischt den letzten Soßenrest mit einem Stück Brot auf. Du bist Biologin?
Ja. Meeresbiologin.
Keine Kinder?
Viola hat den Teller inzwischen von sich geschoben und presst nun den Zeigefinger mehrfach gegen den Stein auf ihrer Stirn, der abzufallen droht. Sie sitzt auf der gepolsterten Bank an der Wand, sodass sie fast das gesamte Restaurant überblickt, während ich meinen Blick einzig auf sie und das hinter ihr hängende Bild richten kann. Irgendwo habe ich einmal gelesen, dass der Platz an der Wand der der Frauen sei – jeder Mann mit Manieren müsse ihn seiner Begleiterin überlassen –, aber wie sieht die Sache aus, wenn zwei Frauen zusammen essen gehen? Wer muss sich dann mit dem Blick auf die Wand begnügen? Die Jüngere?
Nein, sage ich.
Ich erwähne Henryk nicht. Weder Henryk noch Paula und Rena. Ich kenne sie erst seit ein paar Wochen. Sie sind noch nicht meine Kinder und er ist noch nicht mein Mann.
Viola betrachtet den Kellner, der am Nebentisch eine Bestellung aufnimmt, ein Lächeln lauert in ihrem Blick, und als der Kellner in Richtung Küche davongeht, ohne sie angeschaut zu haben, gibt sie es mir, das Lächeln.
Ich habe vier Kinder, sagt sie. Alica – das war die Erste, dann kamst du, dann Cosmo und schließlich Samuel. Alles wunderbare, kluge Kinder, finde ich. Sie greift über den Tisch, legt ihre Hand auf meine und zieht sie gleich wieder fort, um ihr Kinn aufzustützen.
Erzähl mir von ihnen, sage ich.
Ihr seid alle Halbgeschwister. Ich liebte das Leben – und die Männer. Tu ich übrigens immer noch. Sie lacht und sieht sich im Restaurant um, in dem außer unserem nur noch zwei Tische besetzt sind. Als niemand ihren Blick erwidert, wendet sie sich wieder mir zu, präsentiert sich wie eine Kostbarkeit, als wäre sie, wenn sie wählen könnte, sich selbst die liebste Gesellschaft. Alica wuchs bei ihrem Vater auf, fährt sie fort. Wir haben ein sehr enges Verhältnis. Sie ist Pilotin – wegen ihr kann ich mir überhaupt all diese Reisen leisten. Eine kleine, zierliche, schöne Person, die diese Riesenmaschinen steuert. Ich find’s immer noch schwer vorstellbar. Und Cosmo. Ja, der. Wuchs bei seinen Großeltern auf, väterlicherseits, der Großvater ein alter Nazi. Ich durfte Cosmo nie kontaktieren, stell dir das vor! Als er achtzehn war, rief ich bei ihm an. Hier spricht deine Mutter, sagte ich. Er hat sich unheimlich gefreut. Er macht irgendwas mit Werbung, hat eine eigene Agentur. Ein unglaublich kreativer Mensch, eigentlich ein Künstler, weißt du. Dazwischen du. Und am Ende Samuel. Der Einzige, der bei mir lebte. Sehr talentiert, aber nicht immer einfach. Mal hasst er mich, mal liebt er mich. Aber das ist wohl das Los der Mütter.
Sie hat den letzten Satz mit gespieltem Ernst gesagt. Jetzt ändert sie ihren Tonfall, klingt auf einmal wirklich ernst: Ich bin wohl nicht so sehr der Muttertyp. Oder zumindest nicht vorrangig. Ich bin in einem kleinen Städtchen in Bayern aufgewachsen, meine Mutter, an der ich sehr hing, starb, als ich acht war, mein Vater war entsetzlich, einfach furchtbar – selten da, und wenn, cholerisch. Ich ging von zu Hause fort, so früh ich konnte. Ich wollte immer frei sein, ungebunden, wollte reisen. Und mit einem Kind – oder mehreren – ging das nicht.
Ich sage: Ich mach dir keinen Vorwurf, weil du mich weggegeben hast. Ich fand das immer eine gute Entscheidung von dir.
Das stimmt. Ich wusste immer, dass nicht ich als Person das Problem gewesen war, sondern die Umstände. Ich hatte mir vorgenommen, Viola das zu sagen. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Erleichterung? Dankbarkeit?
Das sehe ich genauso. Viola lächelt zerstreut, bevor sie den Blick wieder durch das Restaurant wandern lässt, wo er sich für einige Sekunden in irgendetwas oder irgendwem verhakt. Ganz genauso sehe ich das auch, wiederholt sie.
Viola hatte am Telefon gefragt, ob sie bei mir übernachten könne.
Ich kann dir sicher ein günstiges Hotelzimmer besorgen, hatte ich gesagt.
Die Sache ist die, hatte Viola geantwortet: Ich habe kein Geld.
Das Hotel, in dem ich ein Zimmer für sie gebucht habe, liegt zwei Querstraßen von meiner Wohnung entfernt. An der Front des vierstöckigen Hauses leuchten gelb der Name des Hotels und daneben drei Sterne, von denen einer unruhig flackert. Das Haus scheint dunkelgrau zu sein, und ich versuche mich zu erinnern, ob das seine richtige Farbe ist oder ob es nur im spärlichen Licht des Eingangs so dunkel wirkt. An der Rezeption steht eine müde aussehende Frau mit streichholzkurzen Haaren, im Fernseher läuft lautlos eine Nachrichtensendung, es riecht nach frittiertem Essen und einem Raumerfrischer, Kiwi oder Waldmeister.
Das Hotelzimmer ist schmal und niedrig. In einer Ecke ist knapp unter der Decke ein Fernseher angebracht, die Bettwäsche zieren grellgelbe Monde und Sterne auf blauem Grund. Die Dusche im Bad ist ein in den Kachelboden eingelassenes Kunststoffviereck, das nicht tief genug scheint, um eine Überschwemmung zu verhindern. In der Seifenschale zwei braune Seifenstücke, dünn wie Schokoladentäfelchen.
Es ist ziemlich einfach.
Es ist wunderbar, sagt Viola, wirklich. Ich bin anderes gewöhnt. Schöneres, aber auch viel Schlechteres. Je nachdem, wo ich auf meinen Reisen unterkomme. Mal bei Freunden, die verreist sind, mal in einer Jugendherberge, mal in einem Schlosshotel oder in einer Strandhütte. Das Einzige, was ich immer brauche, ist das hier. Sie nimmt den Seidenbeutel und holt ein kleines weißes Kopfkissen daraus hervor. Das ist der einzige Punkt, in dem ich heikel bin. Sie geht zum Bett, schiebt das bunte Kopfkissen zur Seite, legt stattdessen ihr weißes hin, singt leise: Wherever I lay my hat that’s my home, na ja, in meinem Fall ist es eben ein Kissen – Marvin Gaye, kennst du den?
Schon mal gehört.
Unser Spiegelbild im Fenster. Zwei Frauen, unscharfe Konturen, zwischen ihnen das gemusterte Bett, im Fenster nun nicht mehr blau, sondern braun, sepiafarben die ganze Szenerie wie auf einer alten Fotografie. Von der Straße dringt das gedämpfte Geräusch einer zuschlagenden Autotür herauf, irgendwo auf dieser Etage läuft ein Fernseher oder Radio und durchbricht – beruhigend und enervierend – die Einsamkeit, die das Hotel einhüllt wie ein Leichentuch.
Was ich dich fragen wollte, beginne ich, und Viola sagt sofort, ja?, als habe sie den ganzen Nachmittag auf diese eine Frage gewartet.
Was ich dich fragen wollte: Wer war der Vater?
Ach so. Es ist Viola anzumerken, dass sie sich eine andere Frage erhofft hat, aber welche, welche bloß?
Ja, der Vater… Ein Musiker. Ein schöner Mann. Groß, lockig. Muskulös, wenn ich mich recht erinnere. Benjamin war sein Name, Benjamin Rochlitz. Sie hat den Namen englisch ausgesprochen. Nun lächelt sie mit geschlossenem Mund und legt den Kopf schief.
Morgen, okay? Ich erzähl dir morgen von ihm. Geht das? Kannst du es noch so lange aushalten?
Ja, sage ich, natürlich. Ich hebe meine Handtasche vom Boden auf und hänge sie mir über die Schulter. Benjamin Rochlitz. Ich habe nun einen Namen. Werde ihn in dieser Nacht so lange im Kopf wiederholen, bis er sich von jedem Sinn gelöst hat und zu etwas Figürlichem geworden ist, Buchstaben, die auf einer endlosen Schlaufe hin- und hersausen wie Perlen auf einer Kette.
Morgen früh muss ich arbeiten, sage ich. Aber wir können uns zum Mittagessen treffen, wenn du willst.
Sicher will ich das! Rufst du mich hier im Hotel an?
Ich gehe zur Tür und Viola folgt mir wie eine beflissene Gastgeberin. Sie hat die Schuhe ausgezogen.
Schlaf gut.
Sie macht einen Schritt auf mich zu, und bevor ich zurückweichen kann, nimmt sie mich in den Arm. Du auch.
Die zwei Würmer haben sich ineinander verhakt. Sie sehen aus wie ein einziges, zitterndes Wesen, bevor sie sich wieder voneinander lösen. Die Besamung ist vollbracht: Beide Würmer, jeder von ihnen ein Zwitter, haben besamt und sind besamt worden, sie treiben auseinander. Ich beobachte, wie sich die Würmer zu ihren weiblichen Geschlechtsorganen hinbeugen. Erst vor Kurzem haben Malte und ich herausgefunden, was sie da tun: dass sie versuchen, den fremden Samen rauszusaugen. Offenbar wollen sie einzig die männliche, nicht die weibliche Rolle übernehmen. Wollen ihre Spermien verbreiten, nicht aber wertvolle Ressourcen damit vergeuden, die Eier auszubrüten. Aber die Spermien dieses Wurms haben sich auf die ungastliche Behandlung eingestellt. Sie trotzen ihr mit Borsten und Widerhaken, klammern sich im weiblichen Genital förmlich fest; sie sind winzige harpunenartige Geschosse, äußerst kampftauglich, die sich gegen den Willen ihres Wirtes einen Weg bahnen und sich dann einnisten.
Malte sitzt am Laptop und sieht mich abwartend an. Ich schaue wieder ins Mikroskop, das Wimmeln hat nicht nachgelassen, neue Wurmpaare haben sich gebildet und getrennt, also, sage ich, fangen wir mal an, schreibst du? The Macrostomum lignano, a small, transparent, non-parasitic marine flatworm, is part of the intertidal sand meiofauna of the Adriatic Sea.
Mit Viola habe ich am Telefon verabredet, dass sie zu mir ins Museum kommt. Es ist ihr Wunsch gewesen zu sehen, wo ich arbeite.
Bist du sicher? Interessierst du dich denn für Fische?
Nicht wirklich. Aber für dich.
Was sollte ich dazu sagen, zu einem Kompliment, das so einfach zu geben und zu haben war, ein Kompliment, das so wenig bedeutete, dass es fast wie Ironie wirkte.
Na schön. Dann kannst du dir die Ausstellung anschauen und wir essen im Museumscafé etwas zu Mittag.
Wir hatten vereinbart, uns um eins vor dem Haupteingang zu treffen, aber bereits um zehn vor klopft es an meiner Tür, und Viola tritt ein.
Ich habe mich einfach durchgefragt, sagt sie. Nette Leute hier.
Sie trägt heute einen pink leuchtenden Seidenmantel, groß wie ein Kaftan, über der ihr Kopf seltsam klein aussieht. In der Hand hält sie ihren Stoffbeutel. Sie blickt sich im Büro um, bleibt vor der Bildtafel stehen, in Frakturschrift als Buntfarbige Fische überschrieben, darunter die hundertjährigen Abbildungen der Goldmaid, des Geringelten Meerjunkers, des Zauberfisches und der verschiedenen Barscharten, leuchtend rot der Lippfisch, urzeitlich der Knurrhahn, sie sieht sich alles ganz genau an. Als sie sich wieder zu mir umwendet, presst sie die Lippen zu einem hilflosen Lächeln zusammen.
Willst du dir das Museum anschauen?, frage ich, und Viola sagt: Klar. Wenn ich schon mal hier bin.
Auf dem Weg zur Ausstellung begegnet uns Wolfgang. Er hält einen Brief in der Hand, den er aus seinem Postfach am anderen Ende des Flurs geholt haben muss, aber sein Gesichtsausdruck – gespielte Überraschung, hinter der Neugier lauert – zeigt mir, dass er mit der Absicht sein Büro verlassen hat, uns zu begegnen.
Darf ich dir, sage ich zu Viola, meinen Chef vorstellen?
Ich nenne Wolfgangs Namen und den von Viola, und Wolfgang deutet eine Verbeugung an und lächelt maliziös.
Sie sind eine Freundin?
Die Mutter, sagt Viola erfreut, während ich sage: eine Bekannte, und Wolfgang lässt seinen Blick mit leichter Belustigung zwischen uns hin- und hergehen, bevor er uns mit einer priesterlichen Handbewegung und einem Segensspruch verabschiedet.
Was war denn das? Viola kichert leise, als wir weitergehen.
Eine Masche von ihm, sage ich, macht sich lustig über die Kirche, fühlt sich aber eigentlich angezogen von allem Okkulten und dem ganzen plüschigen Katholizismus.
Inzwischen sind wir im Ausstellungsraum angelangt.
Willst du eine Führung oder dich lieber alleine umschauen?
Machst du die Führung?
Ja.
Dann bitte eine Führung.
Das Zusammentreffen mit Wolfgang hat Viola belebt. Sie scheint bester Stimmung, bereit, mit allem zu flirten, was ihr begegnet: mit mir, den anderen Besuchern, dem Meeresgetier in den Terrarien, auf das sie mit einer Mischung aus Ekel und Mitleid hinabblickt, mit Ilka schließlich, an deren Tresen wir vorbeimüssen, um ins Café zu kommen, und der Viola ein Kompliment macht für ihre Samtbluse im Ochsenblutrot schwedischer Holzhäuser. Diesmal verzichtet sie darauf, sich als meine Mutter vorzustellen, ich bin Viola, sagt sie, und, mir einen Blick zuwerfend, fügt sie hinzu: eine Bekannte.
Du hast es nicht gern, wenn ich als deine Mutter auftrete, sagt sie, nachdem sie ihre Bestellung aufgegeben und einen ersten Schluck Wein genommen hat.
Du bist es halt einfach nicht.
Das, meine Liebe, ist nun allerdings falsch. Wenn sich die Behörde nicht getäuscht und uns irrtümlich zusammengeführt hat – was ja durchaus vorkommen kann, aber dafür siehst du deinem Vater zu ähnlich –, bin ich deine Mutter. Keine gute vielleicht und keine, der du töchterliche Gefühle entgegenbringst. Aber biologisch gesehen: deine Mutter.
Der Kellner bringt das Essen und Viola lehnt sich in ihrem Stuhl zurück.
Biologisch ja, sage ich, als der Kellner wieder fort ist. Aber es fühlt sich für mich wie Verrat an, wenn ich dich als meine Mutter bezeichne. Weil dieser Begriff an jemand anders gebunden ist. Und weil es ein exklusiver Begriff ist. Keiner, der auf mehr als eine Person passt.
Ach je, sagt Viola. Sie hat, während ich sprach, von ihrem Essen gekostet, nun lässt sie die Gabel sinken und sieht mich ungläubig an. Das ist so eng gedacht. So – sie sucht nach einem passenden Wort – so unnötig kompetitiv. Es ist doch so … Sie nimmt noch einen Bissen von ihrem Essen und beugt sich kauend über den Tisch, mit einer Hand eine Pause andeutend, die ich abwarten, nicht mit eigenem Sprechen füllen soll. Du und ich und deine Eltern, wir sind doch miteinander verbunden, unsere Schicksale haben uns in einen Zusammenhang gesetzt, unser Karma hat uns miteinander in Berührung gebracht – und dies auf die schönste Weise, oder? Haben mir deine Eltern nicht geholfen, indem sie dich annahmen, und habe ich ihnen nicht das wunderbarste Geschenk bereitet, das einer dem anderen bereiten kann: ein Kind? Wir müssen nicht miteinander konkurrieren, wir sind eine Einheit.
Es geht nicht um Konkurrenz, sage ich. Ich will bloß nicht jedem gleich erklären müssen, wie unser Verhältnis ist. Ich blicke auf meinen Teller, der Appetit ist mir vergangen. Was will sie eigentlich? Zuneigung? Bewunderung? Vielleicht sogar so etwas wie Liebe? Ich schüttele unwillkürlich den Kopf, und Viola fragt, alles klar?
Ja. Ich nicke, ich lächle, dann sage ich: Ist dir eigentlich aufgefallen, dass das gesamte Museum einem Schiff nachempfunden ist? In groben Zügen zumindest. Hier befinden wir uns also in der Messe am Oberdeck. Unsere Büros sind die Kojen, das Labor ist der Bunker, die Terrasse die Brücke und so weiter. Musst mal drauf achten: steht auf den kleinen Schildern, die vor den Zimmern angebracht sind. Und wenn man vom Strand kommt, kann man auch erkennen, dass das ganze Gebäude einem Schiff ähnelt.
Ich könnte noch lange so weiterreden, über das Museum und das Institut, über unsere Forschungen und die Plattwürmer mit ihrer ständigen Kopulationsbereitschaft, vierzehn Mal in einer Stunde, stell dir das vor, vielleicht würden wir beide darüber lachen. Über Wolfgang, Malte und Ilka, über die Stadt, in der ich jetzt seit acht Jahren lebe und die ich an einem der ersten Tage vom Dach eines roten Trolleybusses aus erkundet habe, über das Gefühl, das Meer so nah zu wissen, die grauen Tage, in denen das Wasser wie flüssiger Beton aussieht, die Sonnentage, das metallische Blitzen auf der Oberfläche wie kleine hingeworfene Speere.
Also, sagt Viola unbeeindruckt. Was möchtest du nun über deinen Vater wissen?
Ich nehme einen letzten Bissen von meinem Essen, das inzwischen kalt geworden ist, dann hebe ich das Glas, proste Viola kurz und unerwidert zu und trinke es leer.
Alles. Einfach alles, was du weißt.
Sie waren sich in einer Bar in München begegnet. The Piperman. Ein englischer Pub mit dunkel gebeizten Tischen, grün bezogenen Bänken und einer Jukebox, die nur etwa dreißig Lieder zur Auswahl hatte, von denen Viola jedes – aber wirklich jedes – auswendig kannte. Sie arbeitete drei Abende die Woche hier, während sie eigentlich anderes vorhatte. Größeres. Schauspielerin wollte sie werden.
Ich war begabt, ehrlich. Sie sieht mich so eindringlich an, als hätte ich gerade das Gegenteil behauptet. Ich hatte schon Erfahrung gesammelt, erzählt sie. Nicht viel, nichts Repräsentatives, aber immerhin. Auf der Schulbühne, im freien Theater. Brecht, Piscator, Kleist. Nun denn, so grüß ich dich mit diesem Kuss, Unbändigster der Menschen, mein! Sie hat plötzlich die Stimme angehoben und feierlich gesprochen, und ich schaue kurz auf meinen Teller hinab, bevor ich wieder aufblicke und ein paarmal zustimmend nicke.
Penthesilea, sagt Viola knapp. Kurz bevor sie und Achilles sich zerfleischen.
Er hatte an diesem Abend einen Auftritt in einem Club nahe des Bahnhofs gehabt und war danach mit seiner Band, drei Jungs und ein Mädchen, mit denen er seit der Highschool zusammen spielte, weitergezogen: erst in einen Biergarten, wo sie jeder einen Maßkrug leerten, und als der schloss, in den Pub. Sie hatte ihn erst bemerkt, als er am Tresen stand und sie anschaute. Ein hübscher, langhaariger Junge, auf den sie mit ihren fünfundzwanzig Jahren ein wenig herabsah. Er war erst einundzwanzig, und er wirkte keinen Tag älter. Sie wusste nicht, wie lange er schon dastand und sie fixierte, und wann aus seiner Absicht, eine Bestellung aufzugeben, eine andere geworden war. Eine, die sie betraf. Aber nachdem er seinen Freunden das Bier gebracht hatte, kam er zurück an den Tresen, sah sie einfach an, trank sein Glas langsam leer und versuchte sich den Anschein zu geben, als wisse er genau, was er tue. Als seine Freunde aufbrachen, blieb er. Es gab einen Streit, eine kurze heftige Auseinandersetzung zwischen ihm und einem seiner Freunde, die die Sängerin der Band zu betreffen schien. Das Mädchen stand neben der Tür und beobachtete den Disput, dann verließ sie mit den anderen den Pub, ohne sich noch einmal umzuschauen.
Um kurz nach zwei verscheuchte Viola die letzten Gäste, dann begann sie die Stühle hochzustellen und den Zapfhahn zu reinigen. Wenn du schon da bist, kannst du mir auch helfen, sagte sie zu Benjamin, der immer noch am Tresen saß. Was soll ich machen? Sie hielt ihm einen Besen hin und eine Kehrschaufel, und er begann, den Boden zu fegen.
Fünfundzwanzig?, sage ich. In den Unterlagen steht neunundzwanzig.
Gott bewahre. Mach mich bloß nicht älter, als ich bin! Sechzig reicht mir schon. Sie hält einen Moment inne, doch als ich nichts darauf sage, spricht sie weiter. Er kam mit zu mir. Und blieb eine Woche. Am nächsten Morgen telefonierte er mit seinen Bandkollegen, und einer von ihnen brachte ihm bald darauf seinen Rucksack. Ich weiß nicht, was die Band in der Zeit machte. Ob sie einen Auftritt hatte ohne ihn, ob sie zurück nach Amerika flog oder weiter durch Europa reiste. Ihm war’s egal und mir, ehrlich gesagt, auch.
Und das Mädchen, frage ich, die Sängerin der Band – war das seine Freundin?
Viola deutet ein Schulterzucken an, und in ihrem Gesicht spiegelt sich nichts als Gleichgültigkeit. Keine Ahnung. War auch nicht wichtig.
Sie scheint zu überlegen, dann atmet sie tief ein, als müsse sie sich mit Geduld wappnen, um mir das Folgende zu erläutern. Sein, mein, dein – das waren einfach nicht die Kategorien, in denen wir damals dachten. Ich – wir – haben ganz im Moment gelebt, ohne Bankkonto, dauerhafte Adresse, regelmäßige Jobs. Auch wenn man natürlich immer was getan hat. Alles schien möglich. Aber diese Angst, die ich jetzt überall sehe … davor, den Job zu verlieren, den Status oder was weiß ich – die kannten wir nicht. Die normalen Menschen vielleicht damals auch schon, aber nicht wir.
Wer war wir? Du und Benjamin? Oder du und deine Generation?
Viola schüttelt energisch den Kopf. Nicht die ganze Generation, Gott bewahre! Da gab’s auch schon den einen oder anderen Spießer. Nein, wir … kleine Gruppierungen, überall auf der Welt, die sich mit anderen Dingen beschäftigten als dem, was die Gesellschaft als unbedingt erstrebenswert erachtete. Man begegnete einander, ob im Vorbeigehen auf der Straße oder wo auch immer, schaute sich in die Augen, blickte in die Seele des anderen – und verbrachte eine Lebenszeit mit ihm oder ihr, auch wenn sie in Normalzeit nur ein paar Tage dauern mochte.
Sie hat schwärmerisch gesprochen, jetzt macht sie eine kleine Pause, dann blickt sie auf, findet zurück in die Gegenwart, an diesen Tisch, schaut mich herausfordernd an. Sorry to say, aber es war eine wunderbare Zeit, in gewisser Weise ohne Verantwortung und Sorgen, wenn wir uns auch vielleicht um ehrlichere Antworten bemühten, als es heute der Fall ist. Eine Zeit der Liebe, so habe ich es immer empfunden.
Es ist offensichtlich, dass Viola meint, was sie sagt, und dass sie es nicht zum ersten Mal sagt. Ein auswendig gelerntes Manifest, ein Ein-Personen-Stück. Dies war mein Leben. In dem, natürlich, früher alles besser war (war es das nicht immer in diesen Stücken?), nur nicht die Hauptperson selbst, die ist heute nämlich noch besser als damals, ist gereift wie kostbarer Wein, selten geworden wie ein wertvolles Fossil. Dabei liegt doch genau hier der springende Punkt: Was sich wirklich verschlechtert hat, ist das eigene Leben.
Tja, sage ich.
Und was Benjamin angeht, sagt Viola, diese paar Tage mit dem schönen Amerikaner, der dein Vater werden sollte, waren ebenso eine Zeit der Liebe, und als er gehen musste – zurück nach New York, wie er sagte –, fiel es mir nicht im Traum ein, um eine Adresse oder Telefonnummer zu bitten. Und das beileibe nicht nur, weil ich zu diesem Zeitpunkt bereits eine Beziehung hatte. Sie zieht ein spöttisches Gesicht. Mit einem überaus langweiligen Physikstudenten, dem ich kurz nach Benjamins Abreise endgültig den Laufpass gab. Nein. Das war nicht der Grund. Sie schüttelt bekräftigend den Kopf, dann sagt sie: We lived a whole life of love – so kitschig oder unglaubwürdig sich das für dich vielleicht auch anhören mag. Doch Wahrheit ist subjektiv, und ich habe es immer so empfunden, bis heute.
Also weißt du nichts Näheres über ihn.
Ich merke selbst, wie kühl das klingt, wie wenig es mir gelingt, auf Violas hohen Ton einzusteigen. A whole life of love.
Viola lächelt nachdenklich und sieht sich nach dem Kellner um. Ich würde töten für einen Kaffee, murmelt sie. Sie winkt dem Kellner, der sofort kommt und die Bestellung aufnimmt.
Also, sagt sie, nachdem sie ihren Kaffee Schluck für Schluck, mit kleinen übertriebenen Lauten des Wohlbehagens und ohne die Tasse einmal abzusetzen geleert hat. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe doch einige Infos. Zum Beispiel eine Adresse. Sie lacht, als sie mein überraschtes Gesicht sieht. Nun guck nicht so, meine Schuld ist das nicht.
Es war Benjamin gewesen, der sich wieder bei ihr meldete. Drei Wochen, nachdem er abgereist war, kam ein Brief von ihm, und erst da, sagt Viola, habe sie auch seinen Nachnamen erfahren. Rochlitz. Sie spricht es »Roklits« aus. Er musste sich ihren Nachnamen am Klingelschild angesehen, ihre Adresse notiert haben. Anscheinend hatte er die Sache doch etwas ernster genommen, hatte vielleicht sogar gedacht, dass sie sich fortsetzen ließe. Dass mehr aus dieser einen Woche der Liebe werden könnte.
Viola nimmt ein Buch aus ihrem Stoffbeutel. Darin, zwischen der letzten Seite und dem Buchrücken, der Brief. Ein länglicher, schmaler Umschlag, auf den mit schwarzem Kugelschreiber ihr Name und ihre Adresse geschrieben sind, die Schrift ausladend, barock wie alte Schönschrift, und doch klar als die eines Jungen oder Mannes erkennbar. Viola muss den Umschlag mit den Fingern aufgerissen haben, er ist ausgefranst und die in die linke obere Ecke gequetschte Adresse ein wenig eingerissen. From Benjamin Rochlitz steht da, darunter 45 Myrtle Avenue und der Name einer Stadt, von der ich noch nie gehört habe: Manhasset, NY.
Was steht drin? Ich halte den Brief in der Hand, unsicher, was Viola von mir erwartet. Soll ich ihn gleich hier lesen? Soll ich nur die Adresse auf dem Umschlag lesen und den Brief selbst zurückgeben? Was werde ich mit intimen Details anfangen, falls Benjamin die erwähnt? Will ich die wissen?
Och, sagt Viola gedehnt, so dies und das. Etwas über sein Leben, seine Familie. Erinnerungen an die Woche, die wir gemeinsam verbracht haben. Überlegungen, was noch möglich wäre. Du solltest es lesen. Ich schenke dir den Brief.
Für einen Moment bin ich verwirrt von Violas Großzügigkeit. Dann kommt mir der Gedanke, dass es vielleicht gar kein Opfer für sie ist, den Brief wegzugeben. Ganz einfach, weil er ihr nichts bedeutet – so wenig wie Benjamin ihr etwas bedeutet hatte. Oder das, was aus ihrer Begegnung mit ihm gefolgt ist. Andererseits hat sie diesen Brief mehr als dreißig Jahre lang aufgehoben. Hat ihn, wohin sie auch ging, mitgenommen, zwischen den letzten Seiten eines Buches oder in den Tiefen ihrer Reisetasche.
Vielen Dank, sage ich, und Viola sagt beiläufig: kein Problem. Und jetzt würde ich gerne etwas von der Stadt sehen, wenn das ginge.
Ich bezahle, und gemeinsam verlassen wir das Museum, das jetzt, am frühen Nachmittag, gut besucht ist. Mehrere Gruppen haben sich im Eingangsbereich versammelt, zwischen ihnen zwei Studentinnen der Meeresbiologischen Fakultät, die hier mehrmals wöchentlich Führungen geben. Vor der Tür schlägt uns der Wind entgegen, und ich stelle den Kragen meines Mantels auf, während Viola in ihrem fuchsiafarbenen Seidenmantel dem Wind trotzt wie eine zu früh erblühte Azalee.
Meine liebe Viola,
das hast du nicht erwartet. Dass ich mich melde. Oder doch? Hast du vielleicht – im hintersten Winkel deines hübschen Kopfes – gewusst, dass ich dir schreiben würde? Und war es etwas, das dich ängstigte/nervte/freute? Kreuz an. Ich könnte viele Worte machen, mach ich auch noch, aber das Wichtigste zuerst: Ich denke oft an dich, ich vermisse dich. Jetzt ist es raus, jetzt kann das andere kommen.
Das andere bin ich: Benjamin Thomas Rochlitz, Abkomme jüdischer Einwanderer, die es, im Gegensatz zu ihren Großeltern, Tanten, Onkel, Cousins, Cousinen, Freunden und Nachbarn, noch rechtzeitig hergeschafft haben und sich seitdem mit Schuldgefühlen herumschlagen – warum dürfen wir leben und sie nicht? –, was eine ganze Reihe unschöner Phobien nach sich zieht und dringend einer Analyse bedarf, aber so weit sind sie noch nicht und, lass uns ehrlich sein, werden es wohl auch nie sein. Ihre Namen stehen auf der endlos langen Gedenktafel im Museum auf Ellis Island, damals trug meine Mutter noch ihren Mädchennamen, Berezky, weit entfernt vom Namen meines Vaters, rein räumlich gesehen: B und R, beide aber, wie du vielleicht schon erraten hast, polnischer Abstammung, aus Krakau, um genau zu sein. Wo ich noch nie war, wo ich hätte hingehen sollen/wollen/müssen, hätte ich nicht ein Mädchen in München kennengelernt, wo ich darum hängen blieb, ich korrigiere mich: liegen blieb, für eine ganze Woche, nein sechseinhalb Tage. Auch daran denke ich oft, an deine Küsse, deine Umarmungen, die Nähe zu dir, die nicht nur eine körperliche war. Wie schön du bist! Wie klug und warmherzig und gastfreundlich! Ich vermisse dich – habe ich das schon gesagt?
Ich hoffe, du lachst, aber nicht zu sehr. Ich hoffe, du lachst so, wie du gelacht hast, als ich dir unsere gemeinsame Zukunft entwarf, nach der zweiten, vor der dritten Nacht, lachst ungläubig, verächtlich, aber mit einer Spur von Neugier: du und ich in New York, wo du am Broadway spielst, während ich ein Rockstar bin, natürlich oft auf Tournee, aber scheiß auf die Groupies!, ich habe ja dich!
Im Moment, welch Kontrast, sitze ich in meinem Kinderzimmer, yeahhh… Meine Mutter wird gleich rufen, weil es mein Lieblingsessen gibt, Latkes mit Apfelmus, nach dem dritten wird sie mich nötigen, noch drei zu essen – so sind jüdische Mütter, glaub mir –, und wenn sie wüsste, dass ich einer Schickse schreibe, einer deutschen noch dazu, und wenn sie auch nur ahnte, was ich mit dieser Schickse alles gemacht habe, würde sie auf der Stelle und ohne weitere Umstände ohnmächtig werden und erst wieder zu Bewusstsein kommen, wenn ich ihr verspräche, dich zu vergessen und noch drei weitere Latkes zu essen. Aber beides wäre mir unmöglich.
Darum: schreib mir, bitte, oder besser: komm her! Befreie mich aus der Enge von Manhasset: zwei Restaurants, eine Bäckerei, ein Seven-Eleven und – der Höhepunkt – ein Pub namens Blue Dog; befreie mich aus den Klauen meiner liebenden Mutter, aus den Schmerzen meines gebrochenen Herzens. Lach ruhig, aber komm!
In Liebe,
dein
Benjamin
Und darauf hat sie wirklich nichts geantwortet?, fragt Henryk ungläubig.
Ich habe ihn angerufen und ihm den Brief vorgelesen.
Er klingt sympathisch, sagt er.
Die Mädchen sind bereits im Bett, aber Henryk spricht leise, weil er nicht sicher sein kann, ob sie wirklich schon schlafen oder nach ihm rufen, wenn sie bemerken, dass er am Telefon ist. Mit wem sprichst du?, würden sie rufen und miteinander beraten, wer es sein könnte, der da angerufen hat, Rena würde sich über den Rand des oberen Bettes lehnen, um Paula im unteren zu sehen und sie, falls nötig, zu wecken.
Willst du ihn suchen?
Oh Gott, sage ich, das würde schwer werden. In Wahrheit habe ich auch schon darüber nachgedacht. Habe sogar seinen Namen im Internet eingegeben und zwei Benjamin Thomas Rochlitz gefunden, einer ist Tauchlehrer in Key West, der andere Versicherungsmakler in Chicago, beide grauhaarig; der erste drahtig und braun gebrannt, wie es sich für einen Tauchlehrer gehört, der andere dagegen ein wenig dicklich mit weichen Gesichtszügen, die ihn wie einen folgsamen, Süßigkeiten liebenden Jungen aussehen lassen. Ähnlich sehe ich weder dem einen noch dem anderen.
Und wie war dein Tag mit Viola?
Anstrengend. Erst als ich es ausspreche, merke ich, wie sehr es stimmt. Ich bin müde und auf ungute Weise aufgekratzt. Die Vorstellung, morgen wieder mit Viola zusammen zu sein, erst zum Frühstück und danach, um sie zum Flughafen zu bringen, beginnt auf einmal, mich zu ängstigen: Noch einmal würde ich ihr zuhören müssen, noch einmal würde ich erfahren, wie sie ist und was sie denkt, und sehr klar empfinde ich, dass ich darüber bereits genug weiß, dass es reicht. Viel lieber würde ich dich sehen, sage ich.
Komm morgen Abend zu uns, wir bekochen dich und du musst nichts tun.
Auch nichts erzählen?
Sein Lachen klingt wie das leise Schnauben eines freundlichen Ponys. Du darfst so still und bewegungslos verharren wie ein Stachelrochen.
Sechs Wochen zuvor, am neunundzwanzigsten Februar, war er mir begegnet. Der See im Park war plötzlich zugefroren, fast über Nacht und mit so einer dicken Eisschicht, dass Schlittschuhfahren erlaubt war. Das verlernt man nicht, hatte ich zu meiner Schwester Maike gesagt, unsere Schlittschuhe in einer Ecke ihres Kellerabteils, aneinandergelehnt, als seien sie müde vom Warten.
Passen die noch?
Klar, sagte ich, an den Füßen wird man ja nicht dicker. Ein bisschen eng waren sie dann aber doch. Und du, kommst du mit?
Maike wollte schon den Kopf schütteln, doch dann nickte sie, warum eigentlich nicht?, und wir hängten uns beide unsere Schlittschuhe über die Schulter, wie wir es als Teenager getan hatten, um in die Eislaufhalle direkt neben dem Friedhof zu gehen.
Das Kratzen im Eis, die vielen Beulen und Hubbel, der Schnee, der wie Puderzucker auf dem Eis lag und den Schwung hemmte, von Dahingleiten keine Spur, nur dann und wann eine kurze Bahn bis zur nächsten Unebenheit. Anfangs hielten wir uns an der Hand, aber dann sagte Maike, so geht’s noch schlechter, und machte sich los. Ich sah ihr, auf den Kufen wackelnd wie auf Stelzen, hinterher; schon immer war sie die bessere Eisläuferin gewesen, nur ein Jahr älter, aber versierter in fast allem. Sie hob die Hand und winkte mir, ich winkte zurück und richtete mich auf, um den See zu überblicken aus meiner neuen Höhe: die Eltern, die Schlitten hinter sich herzogen, bepackt mit Kindern und Anoraks, weil die Sonne herausgekommen war, die Jungs mit ihren Eishockeyschlittschuhen, die scharf vor den Mädchen abbremsten, aufwirbelnder Eisstaub, die Gruppen von Mädchen, die sich kichernd zueinander hinbeugten wie Cheerleader vor ihrem Auftritt, ein alter Mann, der kerzengerade dahinglitt, die Hände in den Taschen seines braunen Trenchcoats.