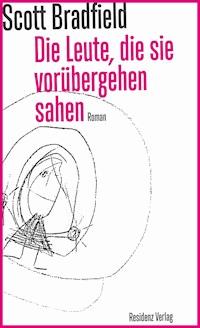11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Mit diesem Bravourstück schwärzesten Humors, das den Charme von Hal Ashbys ›Harold and Maude‹ hat, setzt Scott Bradfield seine Erforschung kalifornischer Zu- und Umstände fort. Dabei läßt er die Zwillingsdämonen der amerikanischen Seele – freier Waffenbesitz und befreie deinen Geist – gegeneinander antreten. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 276
Ähnliche
Scott Bradfield
Was läuft schief mit Amerika
Roman
Aus dem Amerikanischen von Manfred Allié und Gabriele Kempf-Allié
FISCHER E-Books
Inhalt
Für E.H.
Der Autor dankt dem National Endowment for the Arts für die Unterstützung
Oktober
1
Liebe Kinder, Enkel, Angeheiratete, Cousins und Cousinen und was da sonst noch an Sippschaft kreucht,
tja, ich bin’s, eure verrückte alte Oma, und was meint ihr? Ich habe beschlossen, ein Tagebuch zu führen, mein Leben, meine Erfahrungen niederzuschreiben; und zwar hat es zweierlei Gründe, daß ich mich plötzlich dazu berufen fühle. Zunächst mal habe ich mich ja zu Lebzeiten ziemlich rar gemacht unter den diversen Früchten meines Leibes, aber das soll nicht heißen, daß es so unpersönlich weitergehen muß, wenn ich erstmal tot bin. Und zum zweiten, ihr könnt, wenn es soweit ist, wahrscheinlich ganz schön Ärger kriegen, bis ihr an mein Erbe kommt (mehr davon später), deshalb fand ich es vernünftig, die Verwandtschaft über meine finanzielle Lage aufzuklären.
Laßt mich also zu Anfang ganz offiziell zu Protokoll geben: Ich, Emma Delaney O’Hallahan, bei voller geistiger Gesundheit und in noch ganz passabler körperlicher Verfassung, vermache am heutigen 12. Oktober die Erfahrungen meines Lebens der Welt in Gestalt dieses Tagebuches. Meine weltlichen Besitztümer hingegen vermache ich ausschließlich und exklusiv euch Kindern und Enkeln, aber erst wenn ich tot bin. Und daß ich tot bin, ist übrigens die Hauptvoraussetzung, die erfüllt sein muß, bevor jemand dieses Tagebuch zu lesen bekommt.
Das Haus ist ganz abbezahlt, und die Papiere laufen auf meinen Namen, so daß die Tatsache, daß ich euren Opa umgebracht habe, keinerlei negative Auswirkungen auf die »Vermögensverfügung« haben sollte. Ich habe das gemeinsame Sparkonto geplündert und das Geld in kleinen Scheinen unter dem Rhododendron im Garten hinter dem Haus vergraben, das heißt womöglich nur ein paar Fuß von der Stelle entfernt, wo ich euren erbärmlichen Opa begraben habe.
So, nun wißt ihr, zumindest in finanzieller Hinsicht, eigentlich genausoviel wie ich.
Mit dem Schreiben ist das fast wie mit dem Sport – man sollte sich am ersten Tag nicht übernehmen, weil einem sonst alle möglichen Muskeln im Handgelenk weh tun.
Hier herrscht eine solche Ruhe, ich kann es kaum fassen! Letzte Nacht habe ich in dem großen Doppelbett geschlafen wie ein Murmeltier, ohne alle paar Minuten von eurem schnarchenden und stinkenden alten Opa herumgeschubst zu werden. Ich weiß, ich treibe die Sache wahrscheinlich auf die Spitze, wenn ich nun auch noch so viel Schlechtes über ihn erzähle, wo ich ihn schon von der Bildfläche habe verschwinden lassen, aber in meinem Herzen haben sich fast fünfundvierzig Jahre hochkonzentrierten Hasses auf diesen Dreckskerl angestaut, und es wäre meinem spirituellen Wohlbefinden natürlich ganz und gar nicht zuträglich, wenn ich diesem Haß nicht irgendwie Luft machte. Wenn ich also bisweilen übertrieben gehässig klinge, dann denkt bitte daran, daß ich nur versuche, seelisch zu bewältigen, was ich Böses getan habe, und nicht die Absicht habe, noch mehr negatives Karma auf die Welt loszulassen, denn die hat wahrlich genug spirituelles Gift in sich.
Das ist jetzt schon der zweite Tag, an dem ich erst nach neun Uhr aufgewacht bin und nicht aufstehen mußte, um Mr. Miesepeter seine Frühstückseier zu kochen! Ich schwöre, die Frühstückseier für Mr. Miesepeter zu kochen war eine Art chronischer Selbstkasteiung, denn in den fünfundvierzig Jahren unterwürfiger, freiwilliger Erniedrigung, die manche Leute als »Ehe« bezeichnen, war er nicht ein einziges Mal zufrieden mit dem Frühstück, das ich ihm bereitete. Die Eier waren ihm entweder zu weich oder zu hart, der Toast zu trocken oder zu dick gebuttert und so weiter und so fort. Und mittlerweile mußte ich mir nicht nur den ganzen Morgen seine Nörgelei anhören, sondern auch noch mein eigenes blödsinniges Gejammer dazu.
»Ach, das tut mir leid, Schatz«, habe ich immer gesagt, ohne daß ich es wirklich gemeint hätte. »Soll ich dir das ein wenig warm machen, Liebling?« oder »Möchtest du etwas frischen Saft dazu, Süßer?«
Diese Frühstückseier waren ein solcher Akt der Selbstverleugnung, ich kann kaum glauben, daß ich sie ihm fünfundvierzig Jahre lang Morgen für Morgen gekocht habe!
Es war seltsam, ganz allein in der Küche zu sein, wie Ferien auf einem anderen Planeten oder als ob man gestorben und geradewegs in den Himmel gekommen wäre. Zum ersten Mal in meinem Leben konnte ich am Morgen die Vögel in den Bäumen singen und die Frösche am Bach hinter unserem Gartenzaun quaken hören.
Natürlich singen die Vögel nicht in unseren Bäumen, aber ich hoffe, der grundlegende Wandel in der Atmosphäre dieses Ortes bringt sie bald zurück. Das war auch eine wirklich häßliche Eigenart, die euer Opa da im Laufe der Jahre entwickelte, nämlich daß er allmorgendlich seine Zwölferflinte mit Vogelschrot lud und geradewegs in die Blätter der hohen Eiche und der Wacholderbüsche in unserem Garten feuerte, sobald die Vögel zu laut wurden. (Diese Zwölferflinte ist natürlich dieselbe, die ich vor zwei Tagen morgens mit zwanzig Schrotkügelchen, Größe 3, geladen habe!)
»Da, ihr dämlichen Schitköppe!« rief euer erbärmlicher Opa dann immer den Vögeln zu.
Haha. Wenn euer dämlicher Opa reden könnte.
Von jetzt an, bis meine Hand sich besser an die langen Einträge gewöhnt hat, werde ich einen Teil am Morgen und einen am Nachmittag schreiben, mit einer Pause dazwischen mit Mittagessen und Nickerchen. Und schließlich bleiben eine Menge Besorgungen, die ich muy pronto erledigen muß, damit die guten alten Haushaltsgelder weiter fließen, und so bin ich viel zu beschäftigt, um den ganzen Tag einfach nur dazusitzen und zu schreiben.
Und jetzt, um das heutige Thema noch zu Ende zu bringen, die vielen anderen nützlichen Vorteile, die ich davon habe, daß euer erbärmlicher Opa nicht mehr hier herumsitzt:
1. Jetzt, wo All-Talk-Radio nicht mehr durchs Haus dröhnt, kann ich mich hinsetzen und in meinen Büchern lesen, wann immer ich will, und das kommt mir als ein solcher Luxus vor, daß ich es kaum glauben kann!
2. Nun, wo ich mein Tagebuch schreiben kann, ohne daß ich mir anhören muß, wie euer Großvater über alle Dreckskerle dieser Welt lamentiert, die ihm sein Geld wegnehmen und unser großartiges Land kaputtmachen wollen, lerne ich tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben zu hören, wie ich denke. Fünfundvierzig Jahre meines Lebens lang bestand die einzige Möglichkeit für mich, in dieser Hölle hier zu existieren, darin, daß ich lernte, mich nicht denken zu hören, wenn man das so sagen kann.
3. Ich kann den Vögeln zuhören und weiß, daß euer Opa nie wieder mit seiner Zwölferflinte auf sie schießen wird.
4. Ich muß nie wieder Tag für Tag um Punkt sieben Uhr das Glücksrad ansehen, was sogar geschah, wenn wir mitten bei einem schönen Essen saßen, für das ich den ganzen Tag über gekocht hatte, oder einer von euch Kindern oder Enkeln anrief (nicht daß das allzuoft vorgekommen wäre!, wenn überhaupt jemals!).
Also, mehr Gründe fallen mir im Augenblick gar nicht ein, warum ich glücklich darüber bin, daß Marvin ein für allemal aus der Abteilung »Leben« verschwunden ist. Komisch.
Na dann bis morgen.
2
Zuerst einmal ist es wichtig, sich klarzumachen, daß ich für euch Enkelkinder nicht gerade ein positives Vorbild bin, und das weiß ich. Wenn ich euch ein positives Vorbild sein wollte, dann müßte ich viel zerknirschter sein wegen all der schlimmen Dinge, die ich angestellt habe, aber ich muß gestehen, ich fühle mich kein bißchen zerknirscht, und da wäre es ja nun wirklich unaufrichtig, wenn ich so täte als ob. Eine ganz schöne Zwickmühle. Aber ich finde, ehrlich zu sein ist viel wichtiger, als zerknirscht zu sein, und so hoffe ich denn, wenn ich euch schon kein Beispiel dafür gebe, wie sich ein langjähriges Eheweib zu benehmen hat (nämlich daß ein solches Eheweib nicht seinen Gatten ermordet und ihn dann im Garten verbuddelt, selbst wenn er wirklich ein erbärmlicher Dreckskerl ist), ich euch doch wenigstens einen gewissen Begriff von menschlicher Anständigkeit vermitteln kann, und ihr sollt lernen, mit eurer persönlichen, inneren Natur im Einklang zu leben, statt daß ihr immer nur versucht, sie zu unterdrücken.
Sich selbst gegenüber aufrecht zu sein ist eine sehr schwierige Sache, und ich muß es wissen, denn ich bin praktisch nicht ein einziges Mal in meinem ganzen Leben aufrecht zu mir gewesen. Stattdessen habe ich immer meinen feigen Mund gehalten und die Dinge laufen lassen, und ich glaube, das ist ein viel schlimmeres Vorbild, das ich euch Enkelkindern geben könnte, als ein kaltblütiger Mord.
Was ebenfalls bei meinen Unternehmungen wahrscheinlich kein positives Vorbild abgibt, ist die Tatsache, daß ich mir denke, ich komme – für den Augenblick jedenfalls – damit durch. Weil nämlich euer Opa immer schon bei der kleinsten Bewegung wild in die Gegend geballert hat, hat keiner von den Nachbarn Notiz genommen, als ich es tat. Gerade heute vormittag noch kam Mrs. Stansfield von gegenüber hier vorbei, als ob sich nicht das geringste Außergewöhnliche getan hätte, und ich habe sie zu einer Tasse Kaffee hereingebeten.
»Überall hier in der Gegend nimmt das Verbrechen überhand, Emma, und trotzdem tut die Regierung nicht das geringste dagegen.«
Mrs. Stansfield, wie alle anderen hier in der Stadt, redet mit mir, als sei ich ein Vollidiot. Sie lehnt sich in ihrem Sessel vor und spricht jedes Wort ganz prononciert, als ob sie einen kleinen Gummiball im Mund hätte.
»Das bedeutet, wenn Bürger wie wir, denen ihr Zuhause lieb ist, uns schützen wollen, dann sind wir auf uns selbst angewiesen. Wären Sie bereit mitzuhelfen, daß etwas gegen die erschreckende Kriminalitätsrate in unserer Gemeinde getan wird, Emma? Und würde vielleicht auch Ihr Mann, Mister O’Hallahan, sich uns anschließen wollen?«
Mrs. Stansfield hat mir eben die hübschen Aufkleber und Straßenschilder ihres Bürgervereins für Verbrechensverhütung gezeigt, die sie überall in der Gegend verteilt. Alle paar Sekunden sage ich irgendwas Dummes wie zum Beispiel »Ach, wie nett« oder »Da haben Sie recht, meine Liebe«, nur damit Mrs. Stansfield nicht vergißt, daß ich auch noch da bin. Immer wenn ich das Gefühl habe, Mrs. Stansfield wartet darauf, daß ich etwas Interessantes sage, werde ich furchtbar nervös und biete ihr noch eine Tasse Tee an. Ich biete ihr Brötchen mit Frischkäse an, Kräcker mit Pasteten.
Möchte sie vielleicht zum Mittagessen bleiben? Ich könnte ja noch rasch einen Braten in die Röhre schieben.
Mrs. Stansfield seufzt. Ich glaube, Mrs. Stansfield hat sogar noch mehr als ich die Nase voll davon, daß ich ihr Sandwiches anbiete!
»Ein andermal gern, Emma. Aber im Augenblick wüßte ich nur gern, ob Sie bei unserem neuen Bürgerverein dabeisein wollen. Am Dienstag abend findet das erste Gemeindetreffen bei mir im Haus statt. Da sorge dann ich für die Erfrischungen.«
Es läuft mit kalt den Rücken herunter, wenn ich mir das nur ausmale. Ich atme tief durch und werfe einen Blick über die Schulter in Richtung Garten. Alles ist grün und frisch im Garten, ich habe ja auch erst heute morgen alles gegossen.
»Also, Mrs. Stansfield«, sage ich, »mein Mann ist oben und ruht sich aus, aber ich glaube, ich weiß, was er sagen würde. Er würde sagen, wir brauchen keinen Bürgerverein, weil wir ja schon seine hervorragende Waffensammlung haben.«
Als ich heute nachmittag mein Nickerchen machte, erschien mir das Bild eures Opas im Traum. Bemerkenswert, daß es eigentlich kein Alptraum war, obwohl euer Opa darin vorkam.
»Findest du das eigentlich wirklich fair?« hat euer Opa mich gefragt. »Wenn du jedem immer und immer wieder erzählst, was für ein erbärmlicher Dreckskerl ich war, findest du nicht, daß du da übertreibst? Ich meine, ich habe dafür gesorgt, daß du ein Dach über dem Kopf und etwas zu essen auf dem Tisch hattest. Willst du mir nicht wenigstens das zugutehalten?«
Euer Opa saß in dem knarrenden Korbsessel, den ich vor Jahren bei Cost Plus gekauft habe. Er hatte immer noch dieselben schrecklichen Sachen an, die er jeden Tag seines Lebens seit seiner Pensionierung getragen hat. Rot-grün kariertes Flanellhemd mit hochgerollten Ärmeln, ausgewaschene graue Baumwollhose und Slipper von Hush Puppies ohne Socken.
Ich lag auf dem Bett. Ich hatte mir das Heizkissen mit Heftpflaster an meine Beine geklebt. Ich weigerte mich, mich aufzusetzen oder sonderlich von eurem Opa Notiz zu nehmen, hauptsächlich da ich ja wußte, daß er nur ein Gespinst meiner hyperaktiven Phantasie war.
»Du warst schon ziemlich schlimm, Marvin«, sage ich zu ihm. »Ich weiß, von Toten soll man nur Gutes sagen, aber ich vermisse dich nicht ein klitzekleines Bißchen.«
»Na gut«, sagt er, »ich habe vielleicht meine Launen gehabt. Aber eins steht fest – ich habe weder dich noch die Kinder je geschlagen, nicht ein einziges Mal. Vielleicht neige ich zu Wutausbrüchen, aber das heißt nicht, daß ich nicht auch liebevoll sein und Anteil nehmen kann.«
»Du hast immer gesagt, ich sei dumm.« Ich tue so, als schlösse ich die Augen wieder, aber in Wirklichkeit halte ich sie einen winzigen Spalt weit offen, gerade so, daß ich ihn noch sehen kann. »Du hast dich über meine Kochkünste lustig gemacht. Jedesmal wenn ich eine Aufnahme mit dem Videorecorder verdorben habe, hast du mich als hirnlosen Trottel beschimpft. Du hast niemals ein Wort zu mir gesagt, es sei denn, es war etwas Kritisches oder Negatives. Es ist nicht leicht, Selbstachtung zu entwickeln, wenn man einen Mann hat, der einem ununterbrochen vorhält, wie dumm man ist und wie schlecht man aussieht, und das auch noch vor den Kindern.«
Euer Opa sieht sich die Kommode an, wo noch all seine alten Stinksachen herumstehen. Haarspray, Noxzema, Vitamine und Valium. Vor zehn Jahren meinte Dr. Marsden, Valium könne Marvin vielleicht helfen, sich zu entspannen, aber Marvin hat nie welche genommen, denn wenn er sich auch nur um ein Jota entspannt hätte, hätte er vielleicht aufgehört, den ganzen Haushalt in den Wahnsinn zu treiben.
(Ich habe übrigens eines Tages aus reiner Neugier tatsächlich angefangen, das Valium zu nehmen, das Marvin verschrieben bekommen hatte, und ich bin zu dem Schluß gekommen, daß es ziemlich gut ist.)
Er kratzt sich an seiner kahlen Stelle. Dann nimmt er seinen schwarzen Plastikkamm von der Kommode und fährt sich damit durch das schütter werdende Stirnhaar, als suche er Gold. »Du benimmst dich ziemlich dumm, Emma. Es geht ja nicht darum, daß du dumm bist. Du bist nur ein bißchen plemplem, das ist alles.«
Da muß ich mich nun doch aufsetzen, damit ich das besser mitbekomme. Mit einem kleinen reißenden Geräusch rupfe ich das Pflaster von meinen Beinen ab. Ich bin so wütend. Eigentlich bin ich hauptsächlich wütend darüber, daß er mich wütend gemacht hat.
»Wenn du mich nicht immer behandelt hättest, als ob ich ein Dummkopf wäre, Marvin, dann hätte ich vielleicht mehr Selbstvertrauen. Du warst ja nun auch nicht gerade ein großes Genie oder sowas.«
Marvin inspiziert den schwarzen Kamm. Er zupft die grauen Haare heraus und spannt sie zwischen den Fingern, so als schlüge er ein halbverschimmeltes Buch vom Flohmarkt auf.
»Ich wünschte nur, du wärst in deinem Tagebuch weniger einseitig«, sagt er. »Versuche einmal, mich als dreidimensionalen Menschen mit komplexen emotionalen Bedürfnissen darzustellen. Ich war vielleicht nicht perfekt – aber wer ist das schon?«
Als ich aufwache, sitze ich tatsächlich so da, das Heizkissen in der Hand, und blicke den leeren Korbstuhl an, wo euer Opa gesessen hatte. Die diversen Toilettenartikel eures Opas liegen noch auf der Kommode verstreut.
Mir tut jeder Muskel im Körper weh. Sogar meine Zehen sind wund.
Nach einigen Augenblicken stehe ich auf und werfe sämtliche Toilettengegenstände eures Opas in eine große grüne Mülltüte und bringe sie hinunter in die Garage.
Dann kehre ich wieder ins Schlafzimmer zurück und nehme noch ein paar Valium.
3
Den ganzen gestrigen Nachmittag nach der Erscheinung eures Opas war mir sehr unwohl zumute, denn ich begriff nun, daß ich mit diesem Tagebuch für die Nachwelt eine ungeheure Verantwortung übernehme. Ein Tagebuch führen, das bedeutet, daß man seine Spuren in der Geschichte hinterläßt und alle, die nach einem kommen, es sich ansehen und darüber urteilen, ob man wirklich wußte, wovon man schrieb, oder ob man nur einer von den vielen großen Schwätzern war. Von diesem Verantwortungsgefühl wird mir manchmal im Magen ein wenig übel, und ich habe schon überlegt, ob ich nicht mein Tagebuch in den Müll werfen soll, zu dem Haarspray eures Opas. Dann habe ich überlegt, ob ich das Versprechen, das ich mir selbst gegeben habe, brechen und das, was ich schon habe, noch einmal durchlesen und die Grammatik und Zeichensetzung ausbessern soll (irgendwie ist das, als ob man das Haus putzt, bevor Gäste kommen). Aber dann habe ich es doch nicht getan und bin stattdessen ins Wohnzimmer gegangen, habe mir einen Brandy genehmigt und ein klein wenig ferngesehen.
(Es ist mein fester Vorsatz, daß ich euch einfach nur jeden Tag erzähle, was mir durch den Kopf geht, und niemals auch nur das geringste davon umschreibe oder es noch einmal lese. Auf diese Weise erfahrt ihr von Tag zu Tag, was ich wirklich fühle, denn ich will mich hier nicht in so einer Art besonderem Licht darstellen oder eine Geschichte erzählen, das habe ich ja irgendwie schon mein ganzes Leben lang getan. Daß ich ein Bild von mir vorgestellt habe, statt wirklich ich selbst zu sein. Klingt das halbwegs vernünftig?)
Diese merkwürdige Stille, die neuerdings in meinem Haus herrscht und die mir vor zwei Tagen noch so gutgetan hat, macht mich jetzt wirklich nervös. Ich trinke zwei Glas Brandy und versuche in meinem Buch zu lesen, nämlich David Copperfield von Charles Dickens. David Copperfield basiert teilweise auf den eigenen Erfahrungen des Autors, der als kleiner Junge in einer Fabrik für schwarze Wichse arbeiten mußte und ins Schuldgefängnis kam – das habe ich aus der wirklich schönen Einleitung zu diesem Buch erfahren, von einem Professor an der Harvard University. Ich weiß zwar nicht, was schwarze Wichse oder ein Schuldgefängnis sind (und ich kann keines von beiden in meinem Lexikon finden, das den Titel Erbe Amerikas trägt), doch das Buch scheint mir trotzdem zu gefallen. Besonders mag ich David Copperfields verrückte Tante Betsey Trotwood, die David aus den Klauen der grausigen Murdstones befreit und die keine Esel auf ihrem Rasen haben will.
In einem Buch zu lesen und dabei Brandy zu trinken war mein einziger Quell der Befriedigung, als ich noch mit eurem entsetzlichen Opa zusammen war. Während er dasaß, mit dem Fernseher auf voller Lautstärke, und über die lausige Regierung herzog, trank ich meinen Brandy und tauchte in mein Buch ein, als führe ich in einem blauen Boot sanft einen grünen, moosgesäumten Fluß hinunter. Euer Opa und alles, wofür er mittlerweile stand (Männer hauptsächlich und Leute, die einen herumkommandieren, und daß man niemals sagen darf, was man denkt usw.), glitt weiter und immer weiter fort von mir; er verschwand nicht ganz, aber alles in allem wirkte er doch recht unbedeutend in der Gesamtheit dessen, was auf Erden geschah. Besonders glücklich war ich, wenn das Buch, das ich las, sehr lang war und ich dann besonders weit reiste. Dann war ich in meiner eigenen Welt, einer Welt klarer schwarzer Wörter auf weißem Holzpapier. Solange euer blöder Opa mich nicht anbrüllte oder mich herumkommandierte, konnte ich mir einbilden, ich sei an einem Ort, an dem ich vollkommen frei sei und an dem niemand mir sagen könne, was ich tun müsse, oder mir meine zahlreichen persönlichen Fehler und Charakterschwächen unter die Nase reiben.
Daß ich mir kistenweise billigen Brandy kaufen durfte, war übrigens eins der wenigen Dinge, bei denen euer Opa zuließ, daß ich Geld einfach nur für mich ausgab, denn er behauptete, es helfe mir gegen mein »PMS«, obwohl ich natürlich nie nennenswerte menstruale Beschwerden gehabt habe (es sei denn, er hätte damit ein Prä- und Post-Marvin-Syndrom gemeint!).
Im wesentlichen ist meine Sorge folgende. Was, wenn Marvin am Ende gar kein so schlechter Mensch war? Was, wenn ich tatsächlich seine Schwächen aufgebauscht habe, so daß sie seine im Grunde guten Seiten überdecken, und ich so selbstsüchtig und dumm war, diese Seiten als solche stets zu verkennen? Zum Beispiel hat er recht, wenn er sagt, daß er mich und euch Kinder nicht ein einziges Mal geschlagen hat. Und wahrscheinlich habe ich es meistens wirklich verdient gehabt, wenn er mich als Spatzenhirn beschimpfte, denn ich sage manchmal ziemlich dumme Sachen. Ihr Kinder mußtet nie für ihn in der Fabrik für schwarze Wichse arbeiten wie der arme David Copperfield (alias Charles Dickens), und wir mußten nie ins Schuldgefängnis. Das sind wohl die positiven Seiten eures Opas, und die Welt sollte das wissen. Ich meine, man muß ja fair sein und darf nichts verzerren.
Am Ende nehme ich dann meinen Brandy mit hinauf ins Arbeitszimmer eures Opas, mit den Regalen voller Bücher und den Stapeln alter Zeitungen und Zeitschriften. Ich habe mir kürzlich geschworen, kein Buch ernst zu nehmen und keine Zeitschrift zu abonnieren, auf die euer Opa etwas hielt, denn selbst wenn er vielleicht alle Jubeljahre mal etwas wirklich Zutreffendes daraus erfuhr, haben sie ihn alles in allem bestimmt nicht glücklich gemacht – und das gilt für mich erst recht. Die Bücher und/oder Zeitschriften, die ihn (und mich) alles andere als glücklich machten, sind im folgenden aufgeführt:
Die New York Times !!!!!!!!!! (Ich werde das Maß an Aufruhr, das diese Publikationen schaffen, mit Ausrufezeichen benennen, und die New York Times verdient mit Sicherheit auf meiner Zehnerskala eine große dicke ZEHN! Marvin hat immer darin gelesen und sich immer beschwert!)
Das National Review, bei dem der Held eures Opas, William F. Buckley jr., der große Mann ist!! (Zwei Ausrufezeichen.) (Mir persönlich geht Mr. Buckley nur milde auf die Nerven, hauptsächlich weil ich nicht die geringste Ahnung habe, wovon er überhaupt redet – vielleicht das einzige, was für Mr. Buckley spricht.)
Der Science of Mental Empowerment Newsletter, der bei nahe täglich im Briefkasten steckt, aber vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Der Science of Mental Empowerment Newsletter ist das Hausorgan von Colonel Robert Robertson, einem ehemaligen CIA-Agenten, der es sich jetzt zur Aufgabe gemacht hat, die Richtlinien für die geistigen Aktivitäten der Menschheit über die nächsten ungefähr hundert Jahre zu bestimmen. Die Theorien des Colonels kann man in seinen eigenen Worten in einer Serie von monatlichen Tonbandvorträgen hören, die für jeweils hundert Scheinchen an seine Anhänger gehen, und euer Opa hat sie immer brav abonniert. (Und das, wo er eurer armen Oma gerade mal zähneknirschend dreißig Dollar pro Monat für Brandy bewilligte!) Auf diesen Bändern erklärt der Colonel, wie weltweit Menschen durch eine im Untergrund tätige Gruppe subversiver Elemente, die es darauf anlegt, freiheitsliebende Menschen in aller Welt zu eliminieren, daran gehindert werden, ihr volles geistiges Potential zu entwickeln. Der Colonel hat unter dem Titel Der nach den Sternen greift auch seine eigene Autobiographie geschrieben und darin erklärt, wie er in seiner Dienstzeit als CIA-Agent beinahe die drei Großmeister der Zerstörung, nämlich Josef Stalin, Mao Tse-tung und Fidel Castro, zur Strecke gebracht hätte, aber jedesmal wurden ihm seine Pläne von einer Bande liberaler Agenten und korrupter Kongreßabgeordneter durchkreuzt.
Wie dem auch sei, ich stufe diesen ganzen Kram mit Colonel Robert Robertsons Büchern und Rundbriefen und alles, was mit seiner raffgierigen Kirche der Vernunft in Anaheim zu tun hat, nur als! (ein Ausrufezeichen) ein. Das ist zwar wahrscheinlich das Hinrissigste in der ganzen Sammlung von Schwachköpfen, die euer Opa hatte, aber wenigstens kann man dann und wann mal ordentlich darüber lachen.
Außerdem gibt es natürlich noch Time und Newsweek, aber da eigentlich niemand diese Zeitschriften ernst nimmt (und euer Opa schon gar nicht), gebe ich dafür überhaupt keine Note.
An der Pinnwand eures Opas hängen alle möglichen Mitteilungsblätter von diesem Verein des Colonels, der Kirche der unbefleckten Vernunft, über lokale Versammlungen und Vorträge, die euer Opa manchmal besucht hat. Da hängen auch ein paar einzelne Zettel aus den Memoiren eures Opas, die in blauen Ringordnern auf seinem Schreibtisch liegen und an denen euer Opa gearbeitet hat, seit er sich zur Ruhe gesetzt hat. Diese autobiographischen Fragmente haben große hochfliegende Titel wie zum Beispiel Die größten Lügen des Jahrhunderts oder Die größten Errungenschaften des Kapitalismus. Euer Opa nannte das »meditative Denkübungen«, auf die der Leser bei der Lektüre seines Buches wie auf, wie er es ausdrückte, »Goldnuggets in einem Minenschacht« stoßen würde. Diese Denkübungen (oder »Goldnuggets«) würden die Menschen dazu bringen, sich den politischen Lügen zu stellen, indem sie sie zwängen, selbst darüber nachzudenken, wodurch ihr Verstand von den »Handfesseln repressiver Gedanken« befreit würde, die weltweit die Großmeister der Zerstörung schmiedeten. Eine dieser »Denkübungen« lautet wie folgt:
Die Russen sind’s.
Die Russen sind’s.
Die Russen sind’s.
Die Russen sind’s.
Die Russen sind’s.
Die Russen sind’s.
Die Russen sind’s.
Die Russen sind’s.
Die Russen sind’s.
Die Farbigen und die Juden sind’s.
Also, ich muß schon sagen, wenn ich diese »Denkübungen« an der Pinnwand eures Opas lese, dann muntert mich das doch ganz entschieden auf, und ich fühle mich längst nicht mehr so voller Selbstzweifel und Sorgen wie zuvor. Schöne »Goldnuggets« sind das! Mich haben diese »Denkübungen« auf den Gedanken gebracht, daß euer Opa offenbar ein vollkommener Idiot war, womöglich sogar noch schlimmer, als ich mir jemals habe träumen lassen (sofern das überhaupt möglich ist). Also fühle ich mich schon längst nicht mehr so schuldig und mache mir eine heiße Ovomaltine mit einem Spritzer Brandy, aus medizinischen Gründen.
Dann lege ich mich ins Bett und schlafe schnell ein.
4
In meinem Traum sagt euer Opa: »Sicher, wenn du es aus dem Kontext reißt, kannst du jedes Zitat so hindrehen, daß es rassistisch klingt. Aber ich bin kein Rassist und bin auch nie einer gewesen. Und ich glaube, Emma, in deinem Innersten weißt du das auch.«
Euer Opa sitzt wieder in dem Korbsessel. Das Schlafzimmer ist von einem grünen Schimmer erfüllt, obwohl keine Lampe brennt und die Vorhänge zugezogen sind.
Heute abend geht mir euer Opa auf die Nerven, und ich lasse es ihn auch gleich spüren: »Du hast unseren Gärtner immer Mr. Ching-Chong genannt, obwohl er in Wirklichkeit Mr. Li hieß. Und jedesmal, wenn er an die Hintertür kam, um sich seinen Scheck abzuholen, hast du deine Hände aneinandergelegt und dich verbeugt und gesagt: ›Sehl, sehl gut, Mistel Ching-Chong, sehl, sehl gut!‹«
»Das war nur ein Witz, Emma«, sagt euer Opa ohne eine Spur von Selbstzweifel in der Stimme. »Und Mr. Li hat meine Witze immer genau so verstanden, wie sie gemeint waren. Freundschaftlich und gutmütig.«
»Du hast Rußland immer als das böse Imperium der slawischen Horden beschimpft, selbst als es überhaupt kein Rußland mehr gab und nur noch ein Haufen armer Leute wild durcheinanderlief und Gemüse und Toilettenpapier kaufen wollte.«
»Die Russen sind keine Nation freiheitsliebender Individuen, Emma, ganz gleich was Medien-Dreckschleudern wie Dan Rather dir erzählen wollen. Sie sind ein potentiell negatives Szenario, das nur darauf wartet, Realität zu werden. Das ist nicht ihre Schuld, sondern das Ergebnis ungeheurer universaler Kräfte, die seit Millionen von Äonen tätig sind. Du mußt begreifen, daß ich nichts gegen die Russen persönlich habe, Emma. Alles, worum es mir geht, ist universelle Wahrheit und Gerechtigkeit für die gesamte Menschheit.«
»Und ich nehme an, deine Bemerkung über die Farbigen und die Juden war ebenso durch und durch unschuldig, Marvin. Als ob ich das nicht besser wüßte.«
»Aus dem Kontext gerissen, Emma – das versuche ich dir ja zu erklären. Du hast vergessen, deiner sogenannten Nachwelt zu verraten, daß meine Memoiren keine Autobiographie sind, sondern eher eine Gesellschaftssatire über Probleme der westlichen Kultur und ihrer Moral. Ich würde niemals die Farbigen und die Juden in die gleiche Untergruppe der Menschheit stecken – genauer gesagt denke ich, daß es zwischen den Juden und den Farbigen nicht die geringste Gemeinsamkeit gibt. Schau dir die Farbigen an – in ihren eigenen Vierteln, an ihre eigenen Kinder und Babys verkaufen sie Drogen und schicken die Prostituierten auf die Straße. Und wenn du die Juden dagegenhältst – die verkaufen Drogen und Prostituierte nur in den farbigen Vierteln. Die würden niemals ihr eigenes Haus und ihr eigenes Geschäft niederbrennen, so wie die Farbigen das tun. Mit Juden kann ich arbeiten, Emma. Als Vizepräsident der Consolidated Mutual habe ich oft mit ihnen gearbeitet. Ich könnte sogar sagen, das sind die richtigen Leute für mich.«
»Geh weg, Marvin. Ich will schlafen.«
»Du mußt mir zuhören«, sagt er. Plötzlich liegt da ein neuer, ungewohnter Ton in der Stimme eures Opas. »Mit wem kann ich denn sonst schon reden?«
»Das ist mir egal, Marvin. Du kannst mich nicht mehr herumschubsen. Du kannst mich zu nichts mehr zwingen, was ich nicht selbst tun will.«
»Ich will doch nur ein bißchen Gesellschaft, Emma, mehr nicht. Es ist kalt da draußen im Garten.«
Als ich die Augen ein wenig öffne, sehe ich, wie Marvin sehnsüchtig mein warmes Bett betrachtet. Er sieht viel schmutziger aus als letztes Mal, und Erdklumpen und Unkraut kleben ihm im Haar und an den Kleidern. Er hat dunkle Ringe um die Augen, als ob er nicht gut geschlafen hätte. Ich glaube, ich rieche auch etwas. Mulch oder ein starkes Düngemittel.
Das liegt wohl daran, daß wir den Garten neu hatten einsäen lassen, eine Woche bevor ich Marvin hinter den Rosenbüschen vergraben habe.
Als ich aufwache, fühle ich mich recht gut, auch wenn euer Opa wieder versucht hat, mir den Schlaf zu rauben. Jetzt wo ich ein Machtwort gesprochen und eurem Opa gezeigt habe, wie die Dinge stehen, hat er vielleicht nicht mehr so viel Lust, mich beim Schlafen zu stören.
Ich trinke meinen Kaffee und esse meine Haferkleie. Dann ziehe ich mich an, lege ein wenig Make-up auf, gehe die Garagentür öffnen und lasse den Oldsmobile warmlaufen. Es ist ein sonniger Tag mit blauem Himmel, und die Vögel sitzen friedlich auf dem Gartenzaun. Keine Frage, sie warten, daß euer Opa wieder mit der Schrotflinte kommt.
Ich streue ein paar Brotkrümel auf den Rasen, und die Vögel sehen mich von der Seite her an, als hätte ich eine Schraube locker oder sowas. Dann stürzt sich ein wagemutiger Spatz herunter und holt sich einen Brotkrümel, da können sich natürlich die eifersüchtigen Rotkehlchen, Meisen und Amseln nicht zurückhalten, fliegen hinab und tun sich an dem Brot gütlich und machen den armen Spatzen das Leben schwer.
Vögel im Garten! Was für eine Freude.
Nachdem der Wagen warmgelaufen ist, fahre ich in die Stadt. Wie immer ist Mr. Sullivan von der Bank hocherfreut mich zu sehen, obwohl ich diesmal nicht frisch frisiert bin, wie sonst, wenn ich ihn besuchen komme.
»Einen wunderschönen guten Morgen, Mrs. O’Hallahan«, sagt er in dem schwachsinnigen irischen Akzent, den er immer aufsetzt, wenn er mit mir spricht, obwohl ja nicht ich die Irin in unserer Familie bin sondern Mr. O’Hallahan. (Genauer gesagt stammen die Familien meiner Eltern aus Dänemark und Wales, obwohl ich niemals meinen Stammbaum gesehen habe oder mir mein Wappen habe kommen lassen, um mich zu vergewissern.) »Und was kann ich an diesem wunderschönen Morgen für Sie tun?«
Mr. Sullivan ist ungefähr so alt wie ich, er lächelt unentwegt, und früher war er mit einer Frau namens Doris verheiratet, die beinahe ebenso gemein und widerlich war wie euer abscheulicher Opa. Jedesmal, wenn ich die beiden zusammen sah, schnauzte Doris Mr. Sullivan gerade in aller Öffentlichkeit an. Sie saß in ihrem großen chromglänzenden Rollstuhl wie so eine Art Königin, und Mr. Sullivan schob sie durch die Gänge im Supermarkt oder half ihr irgendwelche Großdruckbücher in der Bibliothek auszusuchen.
»Du fährst zu schnell!« brüllte Doris dann, so daß alle, die in der Nähe waren, es hören konnten, oder: »Nun mach schon, Donald! Das ist doch kein Leichenzug hier!« Dann schlug sie mit einem schweren Holzstock gegen die Seiten ihres Rollstuhls, und alle in Hörweite warfen sich vielsagende Blicke zu und hoben die Augen zum Himmel.
Was für ein ungeheures L, U, D, E, R, sagten wir uns dann alle mit unseren Blicken. In solchen Augenblicken war ich immer vergleichsweise glücklich, denn die meiste Zeit behandelten mich die Leute hier, als sei ich der vierte apokalyptische Reiter, hauptsächlich wohl, weil ich mit eurem unsympathischen Opa verheiratet war. Doch wann immer Mr. Sullivans Gattin Doris in der Nähe war, gingen die anderen mit mir um, als ob ich zu den Normalen gehörte – auch wenn sie es nur taten, damit wir uns in unserem Haß auf Doris zusammenrotten konnten.
Doch ganz egal, wie gemein Doris vor ihrem plötzlichen Herztod war oder wie trübe das Wetter sein mag, Mr. Sullivan ist seither stets allerbester Laune. Und jetzt, seit er seine Teilzeitstellung in der Spar- und Darlehenskasse angenommen hat, flirtet er jedesmal mit mir, wenn ich hereinkomme, und das gibt der positiven Lebenseinstellung der Unterzeichneten ganz schön Auftrieb.
Ich sage zu ihm: »Ich möchte Mr. O’Hallahans Schecks auf sein Konto einzahlen, Mr. Sullivan, wie üblich. Außerdem hat er mich gebeten, vom selben Konto das Haushaltsgeld für die Woche abzuheben.« Ich reiche Mr. Sullivan die Renten- und Sozialversicherungsschecks und die Dividendenschecks, die ich auf der Rückseite mit der gefälschten Unterschrift eures Opas versehen habe. Dann lege ich Mr. O’Hallahans schriftliche Verfügung hinzu, die mich zum Abheben von fünfhundert Dollar von seinem Konto ermächtigt, natürlich ebenfalls gefälscht.
»Scheint ja, als ob Mr. O’Hallahan auf seine alten Tage noch großzügig wird«, sagt Mr. Sullivan und zwinkert mir zu.