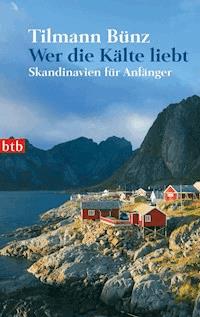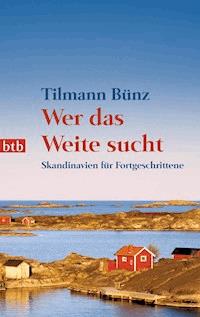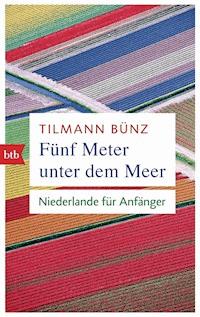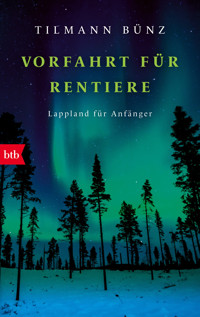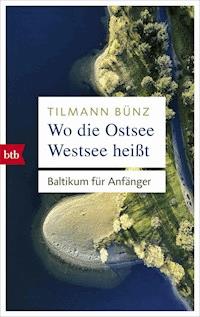Buch
Vom Leben im Norden: Fünf Jahre lang wohnte Tilmann Bünz mit seiner Familie in Stockholm und berichtete als ARD-Korrespondent über eine Region, in der alles ein wenig anders ist als anderswo. Wo sonst begegnet man schon Killerwalen in ihrem Winterlager und Eisbären beim Haareschneiden? Andere Korrespondenten sitzen in den Hauptstädten fest und werden von der Politik aufgerieben. Hier findet die große Politik vor Ort statt, etwa bei den Fischern von Qaanaaq, die den Klimawandel ausbaden müssen, oder im Bücherbus von Lappland, der die Bildung zu jedem Gehöft bringt und Finnland zum PISA-Sieger macht …
»Amüsant zu lesen, wie Tilmann Bünz bewusst die Bullerbü-Brille abgenommen und sich Schweden ganz genau angeschaut hat. Dass er dieses Land nach wie vor liebt, macht seine spürbar warme Zuneigung noch wertvoller.« Gerhard Fischer, Süddeutsche Zeitung
Autor
Tilmann Bünz berichtete für die ARD fünf Jahre lang aus Skandinavien und dem Baltikum. Bünz ist Hamburger, Jahrgang 1957, und träumte schon als Junge davon, einmal nach Schweden zu ziehen. Ein langer Weg mit vielen Stationen: Deutsche Journalistenschule in München, Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in Amsterdam, Evangelische Akademie Tutzing, Redakteur bei »Tagesschau« und »Tagesthemen«, Auslandseinsätze in Tokio, Washington und – immer wieder – in Stockholm. Tilmann Bünz ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Tillmann Bünz
Wer die Kälte liebt
Skandinavien für Anfänger
btb
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe August 2008
Copyright © 2008 by btb Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlagfoto: Wolf Huber
UB · Herstellung: BB
ISBN : 978-3-641-01650-0V002
www.btb-verlag.de
Für Jutta, Philipp und Carlotta
Vorwort
Für mein Büro schaffte ich mir eine wandfüllende Landkarte des Nordens von Island bis Karelien an, auf der jahrelang ein kleiner, gelber Zettel klebte: »Grönland hängt in der Küche«.
Das Reich der Kälte ist groß.
Wir waren nicht zum ersten Mal in Schweden. Ich hatte schon als Junge davon geträumt, einmal hier zu leben. Nun – sechsundzwanzig Jahre nach meinem ersten Besuch – ging mein Traum endlich in Erfüllung.
Meine Frau wollte eigentlich lieber nach Rom. Unsere Kinder Philipp und Carlotta, damals acht und zwölf Jahre alt, hatten keinerlei Neigung, das vertraute Hamburg zu verlassen. Wenn schon Schweden, dann bitte ein Haus auf einer eigenen Insel mit Segelboot, Skilift und Rodelbahn. Schließlich bestimmte die Jüngste den Kurs: Wenn Papi nach Schweden will, dann gehen wir für ein Jahr mit. Das schien vernünftig. Aus einem Jahr wurden zwei, und am Ende wollten die Kinder gar nicht mehr nach Deutschland zurück.
Wir ahnten, dass der Winter die wirkliche Bewährungsprobe sein würde. Spötter sagen, die echten Freunde kommen im Winter auf Besuch. Ein erster Hinweis auf die nahende Kälte war der Winterfahrplan in Stockholm: Es muss wohl seinen Grund haben, dachten wir, dass er bereits am zwanzigsten August beginnt, ganz so, als ob es keinen Herbst gäbe.
Wir waren in der Region der beheizten Bürgersteige gelandet. Wir freuten uns an richtigen Wintern, Schnee statt Matsch, dem unendlichen skandinavischen Himmel, an den Farbnuancen des Eises – von klar bis dunkelblau – und dessen Kontrast zum ausgeblichenen Schilf. Licht und Dunkel bilden hier ein Nullsummenspiel. Was im Winter fehlt, gibt es im Sommer überreichlich. Wie langweilig muss es dagegen am Äquator sein.
Das Land der Kälte kennt Feinheiten, die Menschen aus gemäßigten Klimazonen auf ewig verborgen bleiben. Wie den Unterschied zwischen minus dreißig Grad (da kribbeln die kleinen Haare in der Nase) und minus zehn Grad (es geht eigentlich auch ohne Schal). Es gibt Vergnügungen, die Südländer nie erleben, etwa Wintertage mit wunderbar weißem Schnee, der das Restlicht reflektiert und die helle Zeit dehnt.
Wir freuten uns über die Gesellschaft der vier Rehe in unserem Garten, die uns oft unverwandt anstarrten, als ob wir die Gäste wären und sie die Stammbewohner. Wir genossen die langen Sommer, in denen sich ganz Schweden kollektiv in den Urlaub verabschiedet.
Wir lernten, mit dem Kalender zu leben. Schweden ist nach den Jahreszeiten getaktet. Vom prasselnden Lagerfeuer in der Walpurgisnacht bis zum (leider häufig verregneten) Mittsommerfest mit Tanz, vom Krebsessen in den schon dunkler werdenden Nächten des Augusts bis hin zum Lichterfest Lucia – mit der Neugier der Neuankömmlinge nahmen wir alle Feste mit. Die Kinder liebten Lucia am meisten, diesen Lichtblick im Dezember, wenn man Glanz besonders nötig hat. Das Schönste daran war allerdings nicht der Zug in die Kirche mit dem Lichterkranz auf dem Kopf, fanden Philipp und Lotta, sondern der traditionelle frühmorgendliche Besuch bei den Klassenlehrern. Vorher übernachtete man irgendwo gemeinsam.
Eine schwedische Spezialität lernten wir zwar kennen, ernannten sie nach der ersten Kostprobe aber nicht zu unserer Leibspeise. Im August hat der Surströmming Saison, jene unbekömmliche Delikatesse aus gegorenem Hering. Besser schmeckte uns die Zimtschnecke, die alljährlich am vierten Oktober ihren eigenen »Tag der Zimtschnecke« hat. Trotzdem feierten wir diesen Tag nicht: Man kann, das lernten wir schnell, nicht allen Sitten folgen.
Natürlich gab es auch einiges zu meckern in unserem ersten Winter auf dem sechzigsten Breitengrad: über die Schweden und ihre gesenkten Blicke im Bus, die kurzen Tage von neun bis um drei, das dünne Bier und das lange Warten in der Poliklinik. Wir entdeckten zwei völlig konträre Seiten ein und derselben Mitmenschen und waren ziemlich verwirrt. Bis wir uns das widersprüchliche Verhalten saisonal erklärten. Danach fühlten wir uns etwas wohler. Wir unterschieden zwischen den »Sommerschweden« und den »Winterschweden«. Den Sommerschweden erkennt man unserer Theorie nach daran, dass er zurückgrüßt, wenn man ihm auf einem einsamen Waldweg begegnet. Der Winterschwede hingegen vermeidet jeglichen Blickkontakt, aus Angst, lästig zu fallen.
Es ist auch unter Schweden üblich, gelegentlich über die eigenen wortkargen Landsleute zu seufzen. Geändert hat sich dadurch wenig. Wahrscheinlich, weil diese Zurückhaltung auch ihre sehr positiven Seiten hat: Schweden dämpfen ihre Stimmen am Strand und meiden im Allgemeinen Buchten, in denen schon mehr als vier Personen lagern. Nach fünf Jahren in Schweden erscheint uns das als ein durchaus vernünftiges Verhalten. Schade, dass der Platz in Mitteleuropa für so viel sinnvollen Abstand nicht reicht.
Fünf Jahre haben wir in Schweden verbracht und erfahren, wie es ist, im Ausland Wurzeln zu schlagen. Die Kinder fühlen sich als halbe Schweden. Sie wechseln mühelos zwischen den Sprachen und benutzen Schwedisch, wenn sie sich in Deutschland über Deutsche(s) lustig machen.
Auslandsjahre zählen doppelt. Als Gast auf Zeit hat man keine Zukunft und keine Vergangenheit. Das ist bedauerlich, hat aber einen großen Vorteil: Es gibt keinen Grund, etwas aufzuschieben.
Für Korrespondenten gilt dieses Prinzip der unbeschränkten Neugier ohnehin. Unser Auftrag ist es, in die Kultur des Gastlandes einzutauchen und darüber Bericht zu erstatten. Die meisten Auslandskorrespondenten sitzen in den Hauptstädten fest und werden von der großen Politik aufgerieben. Im Norden ist das anders. Hier findet die große Politik vor Ort statt, etwa bei den Fischern von Qaanaaq, die den Klimawandel ausbaden müssen, weil das Eis brüchig ist und die Robben sich zurückziehen, oder im Bücherbus von Lappland, der die Bildung zu jedem Gehöft bringt und Finnland zum PISA-Sieger macht. In dieser Region darf man, hier muss man reisen. Am Ende sind es bei mir 200 000 Kilometer in fünf Jahren geworden, von der nördlichsten Gemeinde der Welt in Grönland bis zum östlichsten Landhandel mitten im Meer.
Doch die eigentlichen Abenteuer erlebten wir als Familie vor der eigenen Haustür.
Erstes Kapitel
Schweden: Leben von Sommer zu Sommer
Konzert in Wollhosen – Sommerland in Hospitantenhand -Bitte kein Gedränge – Deutsch-schwedischeMissverständnisse – Transparenz total – Die Hassliebezum Schnaps – Open Party – Fähren mit Anhänger -Kleine Fluchten – Menschen sind keine Rentiere -Die Kunst, auf dem Eis zu überleben – Das Gesetz vonJante – Eine unerwiderte Liebe – nordische Familie
Konzert in Wollhosen
Der Mai beginnt damit, dass überall in Schweden tapfere Menschen singend den Winter verabschieden. Sie stehen in wollenen Unterhosen um große Scheiterhaufen und trällern aufmunternde Lieder, in denen von der Macht des Sommers die Rede ist. In diesen Liedern lacht die Maisonne. Sie sollen darüber hinweghelfen, dass es tatsächlich nur sieben Grad warm ist. Jahr um Jahr lauschen die Schweden den schönen Liedern und treten dabei von einem Bein auf das andere, um die Blutzirkulation in Gang zu halten.
Es ist der Abend vor dem ersten Mai, die Walpurgisnacht ist nah. Auch der Motettenchor unserer Insel hat heute seinen festen Auftritt unter freiem Himmel, diesmal mit einer neuen Sängerin, die fröstelnd rechts am Rand bei den dunkleren Stimmen steht. Jutta verstärkt den Alt und freut sich, einen angemessenen Platz für ihre schöne Stimme gefunden zu haben. Ein bisschen Neid ist bei ihr auch dabei, auf die Schweden und die Selbstverständlichkeit, mit der sie ihre Bräuche pflegen. Das halbe Land singt, und die andere Hälfte hört zu. Schweden ist das Land der Chöre und der ungebrochenen Sangestradition, wie das Wetter auch sein mag.
Hinter uns stürmt die Ostsee, vor uns singt der Chor gegen die Kälte an, und seitlich wartet ein Holzhaufen von zwanzig Meter Durchmesser darauf, in Brand gesteckt zu werden. Die Festrednerin im Wollmantel und in dicken Strümpfen beschwört den nahenden Sommer und erinnert sich an ihre eigene Jugend, als sie an Walpurgis ausgelassen feiern wollte und sich schrecklich darüber ärgerte, dass die Mutter sie in wollenen Unterhosen auf das Fest schickte.
Kleine Jungs stehen am Strand und schnipsen Steine ins Wasser. Das Ufer liegt voll Treibholz. Der Winter war lang, wie gut, dass er vorbei ist.
Das letzte Lied ist verklungen. Mit brennenden Stöcken nähern sich ein paar Auserwählte dem Scheiterhaufen, und dreihundert Menschen raunen gleichzeitig »Oooh«, als die ersten Flammen züngeln.
Sommerland in Hospitantenhand
Nach Walpurgis dauert es noch sieben Wochen, bis der richtige schwedische Sommer beginnt. Den merkt man daran, dass alle weg sind. Verschwunden, untergetaucht, niemand ist zu sprechen. Bei der Schulabschlussfeier Mitte Juni verabschieden sich die Familien mit den Worten »bis nach dem Sommer«. Das kann man durchaus wörtlich nehmen.
Weil es Jahr für Jahr nur einen Sommer gibt, machen während dieser Zeit alle Ferien. Wenn man behauptet, »alle« seien im Urlaub, so stimmt das nicht ganz. Es trifft aber immerhin auf achtundachtzig Prozent der Beschäftigten zu. Schweden ist zweifellos eines der Länder, die den Sommer erfunden haben – und die passende Philosophie dazu. Urlaub ist hier wichtiger als Umsatz. Die Praktikanten übernehmen die Macht. Wer dennoch arbeiten muss, tut es murrend. Es ist besser, Geburtstermine außerhalb der Sommerferien zu legen – wenn es sich denn einrichten lässt. Die Sommerferien sind so heilig, dass an Ostern 2006 die SAS-Stewardessen in Norwegen für ihren fairen Anteil an Sommerzeit streikten. Das alles muss man wissen, wenn man in den Norden zieht. Es gibt Schlimmeres. Wie schön, dass ein Land kollektiv die Seele baumeln lässt und Kraft schöpft nach dem langen, harten Winter.
Unangenehm kann es allerdings werden, wenn die allgemeinen Zeitläufe dem Sommer in die Quere kommen. So wie im Juli 2004: Es herrscht die übliche Funkstille. Unsere schwedische Büroleiterin Lisa versucht vergeblich, auf den Ämtern Leute zu erreichen, selbst der zuständige Pflichtverteidiger ist auf seiner Schäreninsel verschwunden. Es geht immerhin um das Urteil in letzter Instanz gegen den Mörder der Außenministerin Anna Lindh. Zurechnungsfähig oder psychisch gestört, lebenslänglich Gefängnis oder Einweisung in die Heilanstalt – das sind die spannenden Fragen.
Wir warten in der Halle des Reichsgerichts auf den Urteilsspruch, zusammen mit ein paar Kollegen. Gleich wird sich eine Holztür öffnen, der Gerichtsdiener wird einen Stoß Kopien auf den Tisch legen, und wir werden uns alle darauf stürzen.
Es ist ein wichtiger Termin: Als Erste wird die junge Kollegin vom schwedischen Rundfunk berichten, Sekunden nach der Urteilsverkündung. Sie kann jederzeit in das laufende Programm schalten, sobald sie das Papier in Händen hält. Den Sender mit den langen Antennenstäben hat sie wie einen Rucksack auf den Rücken geschnallt.
Ich werfe einen Blick in die Runde und stelle wie selbstverständlich die Frage, ob wir uns diesmal wieder an den Druckkosten für die Urteilsbegründung beteiligen müssen wie bei den beiden Vorinstanzen. Zur Antwort ernte ich erstaunte Blicke. Um mich herum erkenne ich nur neue Gesichter. Da wird mir schlagartig klar: Alle anderen sind in Urlaub – hier steht die zweite Garnitur, die Ersatzreserve. Alle anderen sind ausgeflogen.
Der Mörder von Anna Lindh wurde übrigens für schuldfähig erklärt und musste lebenslänglich hinter Gitter.
Bei vielen Berufsgruppen mag es angehen, wenn die Hospitanten im Sommer die Macht übernehmen, meinetwegen auch bei Journalisten. Was aber ist mit wirklich zentralen Figuren des öffentlichen Lebens wie Polizisten und Krankenschwestern? Was ist, wenn etwas passiert? Ein Thema, das uns in geradezu schwejksche Abgründe führt: Zehn Monate lang funktioniert Schweden wie ein hoch effektives Industrieland, den Rest der Zeit leistet es sich eine Sommerpause wie in einer Dorfschule. Ist dieses Urteil übertrieben?
Im kleinen Landstädtchen Kisa machen wir die Probe aufs Exempel. Es liegt in Mittelschweden und verfügt über 493 Badeseen. Kisa gehört nicht zu den sechzig unglücklichen Gemeinden, in denen es im Sommer gar keine Polizeiwache gibt. In Kisa wird immerhin eine Art Notdienst gefahren. Die beiden Streifenpolizisten Arne und Mans reagieren am Telefon zunächst etwas zögerlich auf unsere Anfrage: Wir würden gerne am Beispiel einer ländlichen Polizeistation erfahren, wie man die Verbrecher in Schach halten kann, ohne auf seinen Urlaub als Polizist zu verzichten. Die beiden Polizisten sehen dann aber doch ein, dass dies eine berechtigte Frage ist.
Arne und Mans stecken in der klassischen blauen Uniform. Beide haben breite Schultern, sprechen das gedehnte Idiom des südlichen Schwedens und strahlen Freundlichkeit und Ruhe aus. Arne ist der Ältere und seit fünfundzwanzig Jahren Polizist. Mans arbeitet seit einigen Jahren mit ihm zusammen.
Die Polizeiwache ist ein schmuckloser Flachbau im Zentrum der Kreisstadt, mit Platz für sechs Polizisten und ein Empfangszimmer. Dort sitzt die Sekretärin Barbro, die aber nächste Woche für vier Wochen in Urlaub gehen wird. Sie wird während dieser Zeit nicht ersetzt, die Polizei muss sparen. Die beiden Herren müssen in den kommenden Wochen allein zurechtkommen.
Der Ventilator dreht sich, es ist warm im Büro. Arne und Mans hören den Anrufbeantworter ab und beschließen, den Tag mit einer Streife durch die Landgemeinde zu beginnen. Die beiden Polizisten halten in Kisa die Stellung, aber nur an ausgewählten Tagen. Es ist schwer, den Dienst aufrechtzuerhalten, wenn zwei Drittel des Personals Urlaub machen. Die Kernzeiten der Wache von Kisa kann jeder in der Zeitung nachlesen:
Montag7.00 – 15.00 UhrDienstag7.00 – 15.00 UhrFreitag14.00 – 23.00 UhrSamstag14.00 – 23.00 UhrSonntag14.00 – 23.00 Uhr
Für den Rest der Woche hat die Wache geschlossen. Heute ist einer der aktiven Tage, und Arne und Mans nehmen uns mit durch ihr ländliches Revier. Wir kurven über sanfte Hügel, grüne Weiden, vorbei an kleinen Holzhäusern in Rot oder Gelb, und landen an einem der größeren Badeseen mit Bootsanleger. Fünfzig Motorboote schaukeln in der Mittagsbrise, neunundvierzig davon haben einen Motor am Heck hängen. Einer fehlt.
Letzte Nacht haben sich Diebe auf dem Steg herumgetrieben. Arne und Mans hatten da gerade Feierabend – doch die Wache verfügt zum Glück über einen Anrufbeantworter. Sie erfuhren von dem Diebstahl, als sie gleich am Morgen alle Nachrichten abhörten. Nun sehen sie nach, ob sich die Lage am Tatort wieder beruhigt hat. Sie machen ein Foto und notieren den Bootstyp. Jährlich verschwinden in Schweden viele Tausende von Außenbordmotoren. Die Aufklärungsquote bei diesen Verbrechen ist minimal.
Ganz verstanden haben wir die innere Logik des sommerlichen Dienstplans noch nicht. Im Winter zählt der Landkreis etwa zwanzigtausend Einwohner, im Sommer kommen noch einmal genauso viele Sommergäste dazu. Diebe machen im Allgemeinen keinen Urlaub, sie arbeiten im Gegenteil am liebsten im Sommer.
»Aber warum haben Sie dann ausgerechnet im Sommer geschlossen, wenn doch zu dieser Zeit mehr los ist?«, fragen wir arglos.
Für die Antwort muss Arne nicht lange nachdenken. »Damit auch wir Polizisten im Sommer Urlaub machen können.«
Wenn man den Dienstplan aufmerksam liest, können Diebe in Kisa an drei Wochentagen weitgehend unbeobachtet ans Werk gehen. Denn man kann den Dienstplan auch so verstehen:
Dienstag 15.00 Uhr bis Freitag 14.00 Uhr: Wache geschlossen.
Pünktlich um drei Uhr werden wir Zeugen einer blitzschnellen Verwandlung: Arne schlüpft in Tennisschuhe, Freizeithemd und Bermudashorts, verstaut die Dienstwaffe im Tresor, schließt die Akten und ist nur noch Mensch. Möglich, dass er jetzt mit seinem Kollegen Mans angeln geht – ganz privat, versteht sich.
Nach dem Modell Kisa funktioniert das gesamte Land, wenn auch örtlich abgewandelt. Selbst die Krankenhäuser machen im Sommer dicht. In Stockholm wandern wir mit Chefarzt Stefan Engqvist durch seine leere Klinik im Vorort Huddinge, und er erklärt uns, dass die Leere durchaus politisch gewollt sei. Krankenhäuser in Schweden stellen im Großen und Ganzen während der Sommermonate alle Operationen und Behandlungen ein, die nicht als dringend medizinisch notwendig erachtet werden.
»Bedenken Sie unsere geografische Lage auf dem Erdball«, sagt Stefan Engqvist und lacht. »In Schweden ist es den Rest des Jahres dunkel, kalt, nass, verregnet und windig. Und wenn der Sommer endlich kommt, sehnen sich alle nach ein paar Wochen Urlaub.«
Der Chefarzt führt uns in einen Operationssaal, der während der nächsten zwei Monate nicht benutzt werden wird, und in einige Krankenzimmer, deren Betten leer bleiben werden. Schweden verzeichnete lange Zeit nur halb so viele Arztbesuche pro Einwohner und Jahr wie Deutschland (drei statt sechs). Man kann daraus ablesen, was man will. Vielleicht lösen sich manche Probleme von selbst, wenn die Warteschlange nur lang genug ist. Die Schweden sind zäh, sie werden es schon über den Sommer schaffen. Die warme Zeit ist wie ein Test: Mal sehen, wie es ohne all die Technik funktioniert.
Der schwedische Unternehmerverband betrachtet diese ausgesprochene Urlaubsmentalität mit einer Mischung aus Fatalismus und Missvergnügen, zumal er selbst nicht vom Sommerbazillus verschont bleibt. Auf den Gängen der Zentrale in der Stockholmer Innenstadt geht es recht beschaulich zu. Der Chefökonom steht bei unserem Besuch gerade in der Teeküche und braut Kaffee. Stefan Fölster ist ein schlanker, blonder Mann mit einem freundlichen Lächeln und einem der klügsten Köpfe des Landes. Seine Großeltern sind legendäre Figuren der schwedischen Geschichte, die geistigen Erschaffer der modernen Familienpolitik. Seiner Großmutter Alva Myrdal wurde 1982 der Friedensnobelpreis verliehen.
Stefan Fölster setzt ein leicht ironisches Lächeln auf, bevor er ausholt: »Früher fand das Ausland unsere kollektiven Ferien im Sommer merkwürdig. Heute hat man sich dran gewöhnt. Man arbeitet ja auch mit Chinesen, die in der zweiten Januarhälfte vierzehn Tage Urlaub machen. Ich wundere mich vielmehr darüber, warum sich die Schweden gestresst fühlen, obwohl sie doch, insgesamt gesehen, wenig arbeiten.«
Es ist eine der Lieblingsthesen von Stefan Fölster, dass die Schweden wenig arbeiten und viel krankfeiern. Er steht mit dieser Meinung nicht allein. Das Problem sei nicht die Sommerpause, sagt Stefan Fölster, bevor er sich selbst in den Urlaub verabschiedet, sondern die allgemeine Arbeitsmoral.
Zurück auf dem Land, in Kisa. Wir wollen nicht unterschlagen, dass in wirklich wichtigen Fällen die Polizei aus dem Hauptort der Region anrückt. Kisa ist also nicht ganz schutzlos. Die Zentrale liegt allerdings einhundert Kilometer entfernt.
Unsere beiden Polizisten Arne und Mans haben eine Strategie entwickelt, um ihre Präsenz zu steigern – zumindest in der Wahrnehmung der Einwohner. Regelmäßige Alkoholkontrollen gehören dazu, das spricht sich herum. Noch wirksamer, so wissen sie aus jahrzehntelanger Erfahrung, ist ein einfacher Verdopplungstrick.
»In so einem kleinen Ort kennt jeder jeden«, sagt Arne ernst. »Die Leute erkennen auch unsere Autos, deshalb parken wir mal hier, mal da, immer woanders. Damit verhindern wir, dass die Leute an der Polizeiwache vorbeifahren und gleich wissen: Heute sind Arne und Mans im Dienst. Wir wollen es ihnen nicht so leicht machen.«
Mit derart einfachen Tricks ist es ihnen in all den Jahren gelungen, ihre Sommerferien zu retten.
Bitte kein Gedränge
»Der Schwede wimmelt nicht«, soll Gerhard Polt einmal gesagt haben.
Wimmelbücher, das sind diese großformatigen, detailverliebten Bilderbücher aus Pappe, mit denen man Kleinkindern die Vielfalt des Lebens erklären kann. Polt gehört seit seiner Studienzeit in Göteborg Anfang der sechziger Jahre zu den stillen Liebhabern des Nordens. Seine Beschreibung ist so kurz wie richtig. Schweden meiden tatsächlich eine Bucht, wenn dort schon andere liegen. Sie können es sich erlauben, in einem Land mit 96 000 Seen und einer 3218 Kilometer langen Küstenlinie von Svinesund bis Haparanda.
Jeder Schwede besitzt ein Boot. Und auch wir wollen eines kaufen. Ohne es recht zu wissen, entscheiden wir uns für einen Klassiker, den Archetyp des schwedischen Bootsbaus. Das Kajütsegelboot vom Typ »Folkeboot« erweist sich als Kontaktmagnet. Die einen gucken, weil das Folkeboot (Konstruktionsjahr 1942) im Hafen so winzig aussieht neben den Neubauten aus Vollplastik. Es hat keinen Kühlschrank und keine Dusche, und wer aufrecht stehen will, muss an Deck gehen. Die anderen gucken, weil das Boot sie an ihre Kindheit erinnert.
An Pfingsten unternehmen wir unsere erste große Reise in den Schärengarten vor Stockholms Haustür und landen in einem riesigen Naturhafen an der Insel Ladna. Dort werfen wir Anker und vertäuen unser Boot mit einer langen Leine an einer Kiefer an Land. Das kann uns niemand verwehren: In Schweden gilt das Jedermannsrecht zu Wasser und zu Lande, wonach jeder Mensch überall kampieren darf, vorausgesetzt er hält Abstand zu bebautem Gelände und bleibt nicht länger als eine Nacht. Der Insulaner, der wenig später vom gegenüberliegenden Bauernhof zu uns herüberrudert, kommt in freundlicher Absicht. Er darf mit uns einen Schnaps an Bord trinken.
»Im Sommer ist hier die Hölle los«, sagt der Bauer und zeigt auf den achthundert Meter langen und zweihundert Meter breiten Naturhafen. Nun gibt es tatsächlich Häfen im südlichen Dänemark, in denen der alte biblische Traum wahr werden kann, dass man trockenen Fußes über das Wasser kommt – so dicht liegen die Boote nebeneinander. Als ich vorsichtig nachfrage, ob denn im Hochsommer um die einhundert Boote hier anlegen, ernte ich ein mildes Lächeln. Nein, man solle es nicht übertreiben, aber fünfzehn wären es mindestens, und das wäre wahrlich genug.
Schweden haben gerne ihre Ruhe und respektieren diese auch bei anderen. Laut sind sie nur im Ausland oder beim Krebsessen, am Mitsommerabend und wenn sich einer in der Schlange vordrängelt. Bei ihrem Streben nach einem ruhigen und überraschungsfreien Leben ist ihnen einiges gelungen: Die Welt verdankt dem praktisch orientierten schwedischen Erfindergeist den Reißverschluss und auch den Anschnallgurt, ganz zu schweigen vom Elchtest.
Doch die technischen Errungenschaften greifen nicht im Zwischenmenschlichen. Die Angst vor allzu großer Nähe, so stellt man als Mitteleuropäer fest, führt zu einer gewissen Armut an Kontakten außerhalb des gewohnten Kreises, einem Mangel an Offenheit gegenüber anderen.
Die Ausnahme bilden Schweden, die selbst eine Weile im Ausland gelebt haben wie unsere überaus netten und großzügigen Nachbarn Gustav und Inger. Sie haben fünf Jahre als Diplomaten in London gelebt und wissen, wie sich die Fremde anfühlt.
Vor allem in der Großstadt Stockholm können sich Neuzugänge ziemlich einsam fühlen. Schweden lernen ihre Freunde fürs Leben in aller Regel bereits in der Schule kennen. Wenn dann auch noch, wie in Schweden üblich, die erweiterten Familienbeziehungen intensiv gepflegt werden, bleibt für neue Freundschaften wenig Zeit.
Eine ganze Seite widmete die führende schwedische Morgenzeitung einer deutschen Familie, die darüber klagte, dass sie in vielen, vielen Jahren im Land noch nie zu einer schwedischen Familie nach Hause eingeladen worden sei. Auf diesen Artikel kamen als Reaktion einige hundert Leserbriefe und E-mails, wie die Redaktion erstaunt – und vielleicht auch ein bisschen erschrocken – in ihrer nächsten Ausgabe berichtete.
»Was ist los mit uns Schweden?«, fragten sie.
Sie sind sich selbst ein Rätsel, ganz offenbar. Es ist vielleicht besser, als Fremder die landestypische Zurückhaltung nicht allzu persönlich zu nehmen. Die Schweden klagen, wenn sie unter sich sind, selbst über Kontaktmangel, vor allem im Winter.
Am lautesten artikulieren jedoch Südeuropäer ihr Leiden am schwedischen Hang zur Grübelei und zum Rückzug in die eigenen vier Wände. Mein italienischer Frisör klagte besonders heftig. Er war vor zehn Jahren seiner schwedischen Urlaubsliebe nach Stockholm gefolgt. Bald kam ein Kind, doch dann ging die Beziehung in die Brüche. Der Frisör blieb im kalten Norden, des Kindes wegen. Er schüttete mir häufig sein Herz aus. Bei den Schweden falle nach dem Sommer die Klappe. Sie würden allen Ernstes einfach zu Hause bleiben und Bücher lesen. In seiner Heimat in Süditalien gebe es nur zwei vernünftige Gründe, eine Verabredung auszuschlagen: entweder eine schwere Krankheit – doch dann könne man Besuche am Krankenbett empfangen. Oder man habe sich schon anderweitig verabredet – aber auch das sei kein Grund für eine Absage. Schließlich könne man beide Verabredungen zusammenlegen. Mit Italienern, so sein Fazit, könne man sich jederzeit verabreden. Mit Winterschweden praktisch nie.
Wenn man Schweden mit solchen Aussagen konfrontiert, reagieren sie verhalten. Unsere schwedische Freundin Karin, die selbst mit einem Ausländer, dem Iren Noel, verheiratet ist, verzieht das Gesicht, wenn sie solche Stereotypen hört. »Leute, die so reden, bleiben eben unter sich«, sagt sie. »Das ist die Klagemelodie der Ausländer, und kein Schwede hört sie sich gerne ständig an.«
Deutsch-schwedische Missverständnisse
Wie ist es nun wirklich? Darüber denken die Leute nach, die hier Geschäfte machen müssen. Alle Manager, die ins Ausland gehen, müssen heutzutage ein interkulturelles Training durchlaufen. Sonst leiden die Geschäfte unter Missverständnissen. Tatsächlich sind die Unterschiede selbst zu Nachbarländern so gewaltig, dass sie sogar Eingang in Schulbücher gefunden haben. Die folgenden Tipps stammen aus einem schwedisch-deutschen Lehrbuch:
Bau dein Zelt auf dem Grundstück eines Schweden mit Blick auf das Meer und murmle etwas von »Allemansrätten«, vom Jedermannsrecht.
Unterbrich den Schweden im Gespräch zwei- oder dreimal – er wird dann garantiert nichts mehr sagen. Frag den Schweden nach seiner Meinung und red trotzdem selbst weiter.
Im Wald und am Strand signalisiere durch lautes Sprechen und Rufen deinen Freunden und Bekannten, dass du noch da bist. »Hallo, Paul« über 100 Meter zeigt auch den Schweden, dass die Deutschen gekommen sind.
Grüß fremde Leute im Treppenhaus oder im Hotel mit einem freundlichen »Guten Morgen« oder »Guten Tag«.
Steh vom Essenstisch auf, ohne »tack för maten« zu sagen.
Betritt die Wohnung eines Schweden, ohne dir die schmutzigen Straßenschuhe auszuziehen.
Zeig dem Schweden stolz das Warnungsschild für Elche, das du in Norrland abmontiert hast.
Tatsächlich kann man im mitmenschlichen Umgang viele Fehler machen, wenn man zu direkt auftritt. Auf einem Fest beim Regierungspräsidenten von Stockholm begegnen wir unter lauter weißen Häuptern, unter Fracks und Roben einem Paar, das die Abendgarderobe mit einer sympathischen Distanz trägt. Ylva ist Malerin, Anders Fotograf. Ylvas Großmutter stammt aus der samischen Minderheit und hat ihrer Enkelin etwas Kostbares weitergegeben, nämlich einen ironischen Blick auf die eigenen Landsleute. Ylva und Anders haben ihre Stadtwohnung verkauft und sind nach dreißig Jahren in Stockholm in den nördlichen Schärengarten gezogen.
Als sie fragen, wie es uns in Schweden gefällt, antworten wir brav, dass wir die Natur und das Land lieben, um dann vorsichtig nachzulegen: »Die Menschen sind uns im Sommer näher als im Winter, und manchmal kommen sie uns etwas unverbindlich vor – fast wie Amerikaner. Auf eine angekündigte Einladung kann man mitunter lange warten.«
Als drei Wochen später ein Brief mit einer Einladung nach Yxlan kommt, feixt unser Sohn Philipp: »Das habt ihr euch erschlichen.« Tatsächlich entwickelt sich daraus im Laufe der Jahre eine freundliche Bekanntschaft.
Ylva und Anders wohnen in einem uralten Dorf am Wasser, mit Häusern aus dem siebzehnten Jahrhundert. Die Bucht ist versteckt und war während der Prohibition einer der Rückzugshäfen der Schmugglerkönige. Es sind Ylva und Anders, die uns das Landleben schmackhaft machen. Eines Tages sehen wir uns eine kleine Hütte an, die der örtliche Großbauer an Sommergäste vermietet. Auf dem Weg zum Bootssteg passieren wir ein ausgedehntes Himbeerfeld, das erst zu einem Viertel abgeerntet ist. Nun hat jeder eine Obstsorte, der er nicht widerstehen kann. Bei mir sind es Himbeeren.
Das Feld gehört Ake, dem Großbauern. Es wäre ein Leichtes, zu ihm hinzugehen und ihm für einige Scheine ein paar Stunden Pflückerlaubnis abzukaufen. Allen wäre gedient. Man müsste sich nur ein Herz fassen und den ersten Schritt machen.
»Aber so funktioniert Schweden nicht«, erklärt uns Ylva. »Es ist unschwedisch, angesichts eines halbgepflückten Himbeerfelds zum Besitzer zu gehen und zu fragen: ›Darf ich?‹ Man wartet, bis Bauer Ake kommt und seufzt: ›Ach, ich werde mit der Arbeit gar nicht fertig. Wollt ihr nicht auch mal Beeren pflücken?‹«
Transparenz total
Wenn der schwedische Sommer nach zehn langen Wochen zu Ende geht, kehren die Menschen an ihre Arbeitsplätze zurück, und Schweden wird wieder ein modernes Land. Wie modern und durchrationalisiert es ist, merken wir, als wir beginnen, alle Formalitäten zu erledigen. Das Auto muss ein schwedisches Kennzeichen bekommen, und wir brauchen eine Hausratversicherung. Ich rufe die Versicherung an, stelle mich vor und erläutere unser Anliegen. Dann ist es an mir, erstaunt zu sein. Für den Sachbearbeiter sind wir ein offenes Buch. Das Gespräch läuft folgendermaßen ab:
»Hej, mein Name ist Lasse. Gib mir deine Personennummer.« (Kurze Pause: Der Computer wird mit der Nummer gefüttert) »Ich sehe hier, dass deine Frau Jutta heißt und eure Kinder Philipp und Carlotta. Stimmt das? Ihr wohnt auf Lidingö in einem Mietshaus. Wie hoch, sagtest du, ist der Wert eures Hausrats?« Schon sind wir bei der Sache.
Die Personennummer, eine schwedische Besonderheit, spart auf Ämtern viel Zeit. Von Geburt an hat jeder Bewohner eine persönliche Nummer, die ihn bis zu seinem Ableben begleitet. Der gläserne Bürger ist in Schweden Realität. Die Personennummer wirkt aber auch wie eine Eintrittskarte. Man kann es sogar noch drastischer fassen: Ohne Personennummer ist man ein Niemand.
Die Dame am Schalter meiner neuen Hausbank wirft einen kurzen Blick auf meine Kreditkarte. Die reicht ihr aber nicht. Sie verlangt nach meinem neuen schwedischen Identitätsausweis. Sie tippt die zehnstellige Nummer in den Computer, der Computer bestätigt meine Existenz, sie hebt den Blick vom Schirm und lächelt. Erst ab diesem Moment bin ich geschäftsfähig.
Ein Kollege bei einer großen konservativen Zeitung wollte vor vielen Jahren mit seiner Katze nach Schweden ziehen. Das Tier, so geht die Legende, musste erst einmal einige Zeit an der Grenze in Quarantäne verbringen. Das Herrchen richtete sich derweil schon mal in der verlagseigenen Wohnung in Stockholm ein. In den ersten Tagen geriet er zufällig in eine Verkehrskontrolle, der Beamte überprüfte seine Personennummer und sagte zu ihm: »So, so – du hast also eine Katze in Malmö in Quarantäne.« Fortan stand für den Berichterstatter fest, dass er in einem Polizeistaat gelandet war.
Schweden sehen das gelassener. Sie leben ohnehin in dem Bewusstsein, dass der Staat viel über sie weiß, aber auch in dem Vertrauen, dass die Behörden die persönlichen Daten nicht missbrauchen. So ein Vertrauen entsteht über Jahrhunderte. Die Schweden gehören zu den beneidenswerten Völkern, die seit zweihundert Jahren keine wirklich schlechten Erfahrungen mit ihrer Obrigkeit gemacht haben.
Wenn ein Kind auf die Welt kommt, wird es von seiner Personennummer bereits erwartet. Denn mit der Anmeldung zur Geburtsvorbereitung reserviert das Einwohnermeldeamt eine zehnstellige Nummer mit einigen Lehrstellen. Die Lücken sind unvermeidlich. Selbst der Staat kann nicht bestimmen, wann genau ein Kind geboren und ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Nach der Geburt werden die ersten sechs Ziffern für das Geburtsdatum und die neunte Ziffer für das Geschlecht ergänzt. Bei Mädchen ist die neunte Ziffer gerade, bei Jungen ungerade.
Jeden Tag kann das schwedische Einwohnermeldeamt eintausend unterschiedliche Nummern vergeben. Bisher sind noch nie mehr als fünfhundert Männer und fünfhundert Frauen am gleichen Tag geboren worden, bisher reichten die zur Verfügung stehenden Nummern aus. Zwischen dem Geburtsdatum und dem persönlichen Code steht ein Strich. Hundertjährige müssen anstelle des Strichs ein Sternchen schreiben, damit keine Verwechslungen mit den Neugeborenen des neuen Jahrhunderts passieren. Die Statistiker haben wirklich an alles gedacht.
Das Transparenzgebot gilt auch für Nummernschilder. Wer sich über den Halter eines vor ihm fahrenden Autos informieren möchte, schickt die Autonummer per SMS an die Straßenverkehrsbehörde und erhält innerhalb von Sekunden Antwort. Mitgeteilt werden Wagentyp und genaue Angaben zum Halter mit Vor- und Nachname, Straße und Wohnort.
Selbst die finanziellen Verhältnisse eines jeden Steuerbürgers sind im Finanzamt am Computer einsehbar. Wer möchte, kann die Einkommenssteuererklärung des Außenministers Carl Bildt ebenso anschauen wie die des früheren ABBA-Sängers Benny Andersson oder des eigenen Nachbarn. Nach jeder Reichstagswahl veröffentlichen die Zeitungen lange Listen über die Einkommensverhältnisse der Abgeordneten – und über die Zahl ihrer Strafmandate.
Als die Schweden 2006 nach langer Pause wieder eine bürgerliche Regierung wählten, mussten die ersten Minister bereits nach einer Woche ihren Hut nehmen. Die Handelsministerin hatte den Gewinn aus einem Aktiengeschäft nicht angegeben. Die Kultusministerin, von Amts wegen zuständig für die Kontrolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, hatte sechzehn Jahre lang ihre Rundfunkgebühren nicht bezahlt (und sich damit vor ihren Parteifreunden auch noch gebrüstet). Der Außenminister hatte Anteile an einer russischen Ölfirma, die undurchsichtige Geschäfte mit dem Sudan betrieb. All das kam schnell ans Licht, die zwei Ministerinnen mussten gehen, der Außenminister trennte sich von seinen Papieren. So weit, so richtig.
Mit etwas List kann man sich im Internet auch zu jeder Person ein (Pass-)Foto besorgen. Neonazis nutzten diese Möglichkeit Ende der neunziger Jahre, um Jagd auf unbequeme Gewerkschafter wie etwa Björn Söderberg zu machen. Söderberg hatte einen Arbeitskollegen als führenden Neonazi geoutet. Die Rechtsextremen stellten eine Art Mordliste im Internet zusammen, mit Bildern und allen Details, die sie sich in öffentlichen Bibliotheken besorgt hatten. Der gläserne Bürger wurde zur Zielscheibe. Björn Söderberg wurde vor seiner Wohnungstür von drei Rechtsradikalen erschossen.
Schweden könnte dank seiner Informationsfreiheit ein ideales Arbeitsumfeld für den investigativen Journalismus sein. Vor allem die Boulevardzeitungen nutzen die öffentlichen und halböffentlichen Quellen extensiv. Manchmal geht der Schuss nach hinten los. Nach dem Mord an Schwedens Außenministerin Anna Lindh breiteten die Zeitungen auf Dutzenden von Seiten die Vorgeschichte des Verdächtigen aus: seine Vorstrafen, seine missglückte Schullaufbahn bis hin zum Besuchsverbot, das sein Vater gegen ihn erwirkt hatte. Es fehlte auch nicht der Hinweis, dass der groß gewachsene Mann mit dem Kapuzenshirt und den halblangen Haaren einem in der Stockholmer Szene weit verbreiteten Typ entspreche und zudem eine gewisse Ähnlichkeit mit dem langjährigen Freund der Kronprinzessin Victoria habe. Seite um Seite berichteten die Boulevardblätter über den jungen Mann – bis die Polizei ihn nach ein paar Wochen aus der Verdächtigenliste strich und freiließ.
Dem gläsernen Bürger stehen im Idealfall Medien gegenüber, die nicht hemmungslos im Privatleben der Bevölkerung herumwühlen. Schweden ist, was das angeht, kein Paradies. Die Abendzeitungen mussten zwar Schadenersatz an den zu Unrecht Verdächtigten zahlen, machten aber munter weiter mit der nächsten Indiskretion. Die Presse wird laufend mit neuen Informationen versorgt: Polizisten werden in Schweden nicht üppig bezahlt, und nicht wenige stehen auf den Gehaltslisten der Boulevardblätter.
Für eine gewisse Balance bedarf es eines Staats, der sich in die Karten blicken lässt. Der schwedische Staat benimmt sich wie ein Patriarch, der bestimmt, was die Bürger wissen dürfen und was nicht. Einerseits gibt es das Recht jedes einzelnen Bürgers, sogar die offizielle Post von Staatsminister Reinfeldt einzusehen. Die wirklich wichtigen Dinge wird Reinfeldt – wie alle anderen – aber vermutlich unter vier Augen besprechen.
So birgt Schweden – trotz aller Transparenz – einige Rätsel, wie etwa den nie vollkommen aufgeklärten Mord an Olof Palme oder den Untergang der Estonia. Da endet in beiden Fällen die Auskunftsfreude, der Staat mauert – und alle, die Rätsel lieben, freuen sich, vor allem die schwedischen Kriminalschriftsteller.
Die Hassliebe zum Schnaps
Die Schweden haben ein sehr spezielles Verhältnis zum Alkohol. Es schwankt zwischen kategorischer Ablehnung und magnetischer Anziehung. Vielleicht liegt es in den Genen begründet. Kurz vor dem vierzehnten Geburtstag unseres Sohnes bekommen wir eine Broschüre ins Haus geschickt. Wir werden darüber aufgeklärt, dass unser Kind ein Teenager ist. Es gelte, ihn vor den Gefahren des Alkohols zu bewahren, bis er zwanzig sei, und wenn möglich weit darüber hinaus. Wir Eltern möchten bitte in Sachen Alkohol gegenüber unserem Kind die Haltung der Null-Toleranz praktizieren. Die Regeln seien eindeutig. Kein Verkauf von Alkohol an Jugendliche bis zum zwanzigsten Lebensjahr. Konsum erst ab achtzehn Jahren. Unter achtzehn dürfe ein Jugendlicher gar nichts Alkoholisches trinken, noch nicht einmal ein alkoholfreies Bier.
Bei dieser Gesetzeslage haben wir Mühe, unseren Erziehungsauftrag zu erfüllen. Wir kommen aus einer anderen Tradition. In Deutschland wird bei der Konfirmation mit Wein oder Sekt angestoßen, also im Alter von etwa fünfzehn Jahren.
Schweden dürfen mit achtzehn eine Firma gründen, zur Armee gehen und heiraten. Normales Bier dürfen sie sich aber erst mit zwanzig kaufen. Wie soll das funktionieren?, fragt man sich als Deutscher.
Wir lernen schnell: In Sachen Alkohol sind Nordländer vorbelastet. Der Staat muss schwere Geschütze auffahren, um überhaupt zu ihnen durchzudringen. Alkohol ist in Schweden keine Frage der Pädagogik, sondern der Moral, und damit besonders geeignet als Konfliktfeld für ansonsten eher brave pubertierende Schweden. In der öffentlichen Diskussion über den Alkoholkonsum Jugendlicher sind die Eltern fast nie erschrocken oder böse, sondern immer gleich »enttäuscht«.
Als Philipp dann fünfzehn wird, kommt es auf einem Elternabend der gemischt schwedisch-deutschen Schule zu einer erstaunlichen Szene. Die Lehrer der neunten Klasse sollen während der mehrtägigen Fahrt in ein Ferienheim nicht nur streng darauf achten, dass die Kinder keinen Alkohol anrühren. Ein (schwedisches) Elternpaar regt sogar an, auch die Lehrer sollten, selbst in ihren Zimmern, auf ihr Bier verzichten. Der (deutsche) Klassenlehrer lehnt das Ansinnen als Eingriff in seine Privatsphäre ab.
Wo bleibt hier die schwedische Gelassenheit? Eine Mehrheit der jungen Schweden argwöhnt sogar, dass der Staat als Alkoholmonopolist absichtlich Brechmittel in den Alkohol schütte. Der Staat betreibt den Verkauf in eigener Regie in sogenannten System-Läden. Diese Läden ähneln normalen Supermärkten, bloß dass es nie Rabatte oder Sonderangebote gibt. Sie haben feste Öffnungszeiten und sind immer dann geschlossen, wenn der spontane Bedarf am größten ist, etwa am Samstagabend. Den Verkäufern merkt man die Last ihrer paradoxen Rolle an. Sie sollen einerseits beraten, welcher Wein am besten zu Elch und welcher zu Lachs passt. Auf der anderen Seite dürfen sie nicht zu viel Umsatz machen. Also gucken sie gern ein bisschen streng und kontrollieren alle Kunden, die jünger aussehen als fünfundzwanzig. Vor Feiertagen bilden sich manchmal lange Schlangen vor den Kassen.
Unsere Kinder haben offiziell erst mit zwanzig Zugang zum Systembolaget. In den Supermärkten gibt es für Kunden ab achtzehn Jahren Dünnbier mit einem Alkoholgehalt von maximal 3,5 Prozent zu kaufen, aber auch nur gegen Vorlage des Ausweises.
Das ist die eine Seite. Die andere erlebten wir eines Tages, als wir dem Drängen unseres Sohnes nachgaben und ihm gestatteten, ein Sommerfest bei uns daheim auszurichten.
Open Party