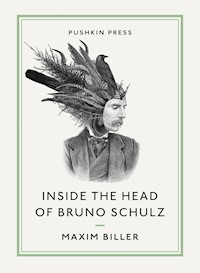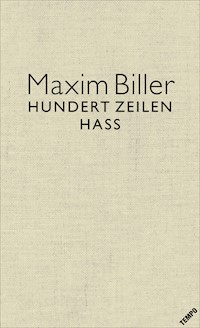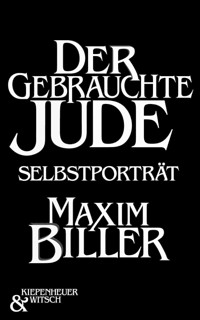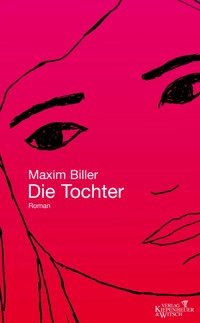8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Maxim Billers schriftstellerisches Werk ist eine großangelegte Suche nach Wahrheit. Seine Literatur ist der umfassende Versuch, das Unvereinbare zu vereinbaren, Schmerz in Erkenntnis zu verwandeln sowie bequeme Konventionen aufzuspüren und zu sprengen. Dabei übernehmen Billers Essays weit mehr als eine Nebenrolle. Sie führen nicht nur vor, dass die Gattung im Kern eine zutiefst literarische ist, sondern auch, wie die Literatur in Sachen Wahrheitsfindung der Wissenschaft oder dem Journalismus voraus sein kann. Dieses E-Book versammelt eine repräsentative Auswahl an Texten aus den letzten drei Jahrzehnten, in denen sich Biller insbesondere mit der deutschen, jüdischen und amerikanischen Literatur sowie mit deutscher Gesellschaft, Politik und Geschichte auseinandersetzt. In ihrer zeitlosen Gültigkeit, stilistischen Brillanz und argumentativen Wucht prägten und prägen sie die Gattung in der deutschsprachigen Literatur maßgeblich. E-Book mit Seitenzählung der gedruckten Ausgabe: Buch und E-Book können parallel verwendet werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 376
Ähnliche
Maxim Biller
Wer nichts glaubt, schreibt
Essays über Deutschland und die Literatur
Reclam
2020 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Cornelia Feyll, Friedrich Forssman
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2020
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN 978-3-15-961681-0
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-019672-4
www.reclam.de
Inhalt
[6]»Es ist nicht so einfach.«
Paul Celan
[7]Deutscher wider Willen
Ein Deutscher wollte ich nie werden. Warum? Vielleicht, weil die ersten Deutschen, die ich sah, Wehrmachtsuniformen trugen. Sie sagten ständig »Scheiße« und »Hände hoch!«, preschten bei Tag und bei Nacht auf ihren Panzern durch die Ukraine und schossen immer nur auf Zivilisten. Das war, damit wir uns nicht missverstehen, im Frühling 1970, ich war damals zehn Jahre alt, ich lag mit meinem armenischen GroßvaterGrigorewitsch, Schmil in Moskau in seinem Bett, wir aßen riesige Brote mit einer zentimeterdicken Schicht Schokoladenbutter und tranken dazu den heißen Kakao, den GroßvaterGrigorewitsch, Schmil jedes Mal eine halbe Ewigkeit lang anrührte, damit er so märchenhaft süß und mild schmeckte, wie ich ihn heute zumindest in der Erinnerung habe. Und während ich also in der Linken den Becher hielt, in der Rechten das Butterbrot, starrte ich auf den Fernsehschirm, und der sowjetische Kriegsfilm, den GroßvaterGrigorewitsch, Schmil und ich uns an diesem Vormittag ansahen, war spannender als jede Eishockey-Übertragung. Ich weiß noch genau, wie erleichtert ich war, dass die Schlacht zwischen der Roten Armee und den Nazis, die wegen ihrer Niedertracht so unbezwingbar schienen, schließlich doch noch mit der Niederlage der Deutschen endete, denn damit hatte ich wirklich nicht mehr gerechnet.
So waren die ersten Deutschen, die ich sah, gar keine echten Deutschen. Sie wurden von russischen Schauspielern dargestellt, und die waren möglicherweise in der einen oder anderen Szene zu gut drauf, gaben den kriegerischen Teutonen vielleicht zu holzschnittartig, zu brutal und zu zähnefletschend, zu xenophob und allzu kühl-narzisstisch. Aber so falsch lagen sie auch wieder nicht: Europa verfiel einst schließlich nicht deshalb in Agonie, weil es an allen Fronten mit zu vielen schlechten deutschen Witzen traktiert worden wäre. Mit den Zähnen zu fletschen, eisig kalt und furchteinflößend zu sein, Scheiße [8]zu sagen und beiläufig Menschen zu erschießen, gehört, finde ich, zu einem nazistischen Welteroberungskrieg irgendwie dazu. Die Deutschen müssen sich eben daran gewöhnen, dass das Bild, das die Welt sich von ihnen macht, niemand anders als sie selbst geschaffen haben.
Deutscher wollte ich also niemals werden, und es vergingen nach jenem Moskauer Vormittag im Frühling 1970 noch viele Jahre, bis ich wirklich begriff, warum – bis ich kapierte, dass meine Abneigung gegen Bayern, Schwaben und Niedersachsen, gegen Hessen und Mecklenburger und Hamburger nicht allein damit zusammenhängt, dass sie in Kriegsfilmen und Comicstrips, in Musicals und oft sogar selbst in der Weltliteratur regelmäßig so mies abschneiden. Meine Abneigung hat mit Dingen und Geschehnissen zu tun, die nur mittelbar und zugleich doch ganz konkret mein eigenes, mein ganz persönliches kleines, sinnloses, unwichtiges und trotzdem alles Leid und alles Glück dieser Erde enthaltendes Leben berühren. Oder, um endlich auf den Punkt zu kommen: Willkommen im Holocaust-Land!
Nehmen wir etwa meinen armenischen GroßvaterGrigorewitsch, Schmil. Er war der einzige Goj in unserer Familie – aber auch so hatte es für ihn gereicht, um wegen der Deutschen eine Menge Scherereien zu haben. Als säbelschwingender Kavallerist kämpfte er, der Mann einer Jüdin, der Vater einer Jüdin, drei endlose Jahre lang gegen HitlersHitler, Adolf Generäle, Offiziere und Landser, er ritt auf seinem Pferd beinah donquichottisch anmutende Attacken gegen die nationalsozialistischen Tötungs-Androiden und war so gesehen von dem Vernichtungs- und Eroberungs- und Weltredigierungs-Wahnsinn der Deutschen genauso betroffen wie jeder Jude in der Familie. Die Juden in meiner Familie aber hatten von Haus aus eine Menge Spaß mit den Deutschen gehabt, die offensichtlich nur deshalb imstande waren, die halbe Welt in Brand zu setzen, weil ein Haufen asozialer, frustrierter [9]Erster-Weltkriegs-Soldaten ein paar clevere, chauvinistische, savonarolahaft-mystische Ideen entwickelt hatte und dafür auch noch, im Jahr 1933 gleich zweimal, gewählt wurde.
Man muss sich das vorstellen: Bloß weil Leute wie HitlerHitler, Adolf oder GoebbelsGoebbels, Joseph im bürgerlichen Leben ebenso wenig Halt fanden wie bei der Boheme Anerkennung, landeten Verwandte von mir nackt im Massengrab von Babi Jar. Andere, vor allem die Jüngeren, wurden mit dem Kopf gegen Wände geworfen und wie Frösche zerdrückt. Einige brannten auch, sie brannten und brannten und brannten, und dann gab es welche, die Glück hatten, sie wurden, so wie die engste Familie meines VatersBiller, Jevsej »Semjon« und meiner MutterBiller, Rada, von den Sowjets in den Ural evakuiert, und natürlich haben auch ein paar als Partisanen oder Soldaten ihr Leben gelassen, ganz ehrenhaft und ganz sinnlos beschissen. Das alles geschah also nur, weil ein paar zukurzgekommene Deutsche eines Tages begriffen hatten, dass die Deutschen insgesamt, als ein kulturell-historischer Komplex sozusagen, einen vollkommen manischen Hang zum Selbstmitleid haben – dem Selbstmitleid angeblich immer und ewig Zukurzkommender, das sich im Aufbegehren gegen den Versailler Vertrag genauso manifestieren kann wie im materialistischen Ossi-Querulantentum, ein Selbstmitleid, das hysterisch und aufgesetzt-existenziell genug ist, um sich jederzeit von Neuem in einen prächtigen, blutigen, Geschichte werdenden Amoklauf verwandeln zu können.
Es ist, um es noch präziser zu sagen, das Selbstmitleid von Leuten, die zu einem Volk gehören, das sich immer als ein Großvolk verstanden hat, als eine Großmacht, die angeblich jedoch niemals ihre vermeintlich legitimen Hegemonialansprüche in Politik, Geostrategie und Kultur ausleben durfte – also das komplette Gegenteil einer gehetzten Minderheit, wie es etwa die Armenier oder Kurden sind, oder einer zurückgesetzten Volksgruppe innerhalb eines riesigen Gebildes, wie [10]es beispielsweise die Tschechen oder Slowaken in der k. u. k. Monarchie waren.
Und so was prägt: Die Doktrin des Staates genauso wie das Denken jedes einzelnen Individuums, das in ihm lebt, arbeitet, gehorcht. So was prägt, es macht arrogant und stumpf, gedankenlos und dadurch immer wieder sehr, sehr böse. Der feine, großmächtige Pinkel nämlich wird von Haus aus mieser und fieser und egotistischer sein als der arme, geschundene Kerl, der froh ist, dass er einmal richtig etwas zum Essen und Anziehen bekommt. Der feine Pinkel könnte für das, was er in seiner Großmannssucht begehrt, betrügen und töten und sich dennoch unumschränkt im Recht fühlen. Der arme Kerl dagegen würde dafür sterben – und wenn er jemals gegen jemanden andern die Hand erhebt, dann zunächst nur aus Verzweiflung, nie aus Anmaßung.
Das große, miese, fiese, egotistische FriedrichFriedrich II. (Preußen)-und-BismarckBismarck, Otto von-Reich hat den deutschen Zukurzgekommenen-Wahn erst richtig hochgezüchtet, die Legende von der angeblich ständig von Zerfall und Zerstörung bedrohten Mittelmacht verfestigte sich gerade in jener Zeit, und wenn heute bei einer Fußball-WM die deutsche Mannschaft gegen Marokko, Mauretanien oder Monaco zurückliegt, dann hat das deshalb auf die deutsche Nation denselben deprimierenden Effekt wie NapoleonsNapoleon Bonaparte Feldzüge oder die Niederlage in der Normandie.
Man sieht sich als Deutscher eben von vornherein im Nachteil, und das verleiht diesem Volk zum einen eine Menge wirtschaftlicher und militärischer Energie. Zugleich erwachsen daraus jene Unsicherheit und mangelnde Souveränität im Umgang mit Menschen, die irgendwie anders und dadurch zunächst nicht durchschaubar sind. Der welsche Feuilletonist, der destruktive Saujude, der schmutzige Zigeuner heißen nur deshalb so und werden diesem sprachlichen Duktus entsprechend angesehen und behandelt, weil der unsichere, [11]selbstbezogene, neidische Deutsche ständig in der Angst lebt, von diesen Leuten aufs Kreuz gelegt und um seinen eigenen Vorteil gebracht zu werden. Dieser Deutsche, der vom Leben nur das absolute Maximum erwartet, fühlt sich deshalb auch wie ein verwöhntes Kind immer und immer wieder zurückgesetzt, er kann einfach nicht verzichten, er kann nicht verlieren, er kann nicht geduldig und bescheiden sein: als Rüstungsmillionär ebenso wenig wie als Chemie-Facharbeiter, als Filmemacher oder General ebenso wenig wie als ostdeutscher Arbeitsloser, als PeymannPeymann, Claus ebenso wenig wie als HandkeHandke, Peter, als SchönhuberSchönhuber, Franz, als NolteNolte, Ernst, als HitlerHitler, Adolf.
Ach ja, HitlerHitler, Adolf: Das, was er Nationalsozialismus nannte, war in Wahrheit nichts anderes als Reklame für sich selbst und somit eine astreine Karrieristen-Ideologie. Um es endlich zu etwas zu bringen, verband er ganz einfach sein Schicksal mit dem Schicksal des genauso wie er wehleidig empfindenden deutschen Volkes, er versprach – ich sage es hier prosaischer und unmystischer als er – den im Weltkrieg, in den frühen 20ern und frühen 30ern gebeutelten Deutschen Wohlstand, Besitztum und Macht. So ist die bei tiefgefrorenen FAZ-Wunderkindern und gewendeten 68er-Greisen beliebte Selbstentlastungsthese, Kommunismus sei dasselbe Böse wie Faschismus, deshalb natürlich auch falsch. Denn im Kommunismus nimmt sich der Mensch vor, sich die Welt, das Leben, das Schicksal, untertan zu machen – im Faschismus aber allein der deutsche Neidbürger.
Faschismus als spießiger, konsumistischer Egotrip also? Ganz genau. Faschismus war – und ist – einfach nur die modernistischere, archaischere und vor allem blutigere Form des 50er-Jahre-Wirtschaftswunders, vermischt mit dem durch die Aufklärung aufgebrachten ideengeschichtlichen Running Gag, der Mensch könne alles, was er nur will. So ist denn auch der Rechtsradikalismus von heute nichts anderes, und wenn man [12]sich die aktuelle Nazi-Personnage ansieht, erblickt man das gleiche Panoptikum. Es ist schon wieder diese Melange aus Arbeitslosen und Analphabeten, aus frustrierten höheren Söhnen, aus sich selbst verleugnenden Homosexuellen und aufgeregten alten Männern, und es gibt nur einen einzigen Weg, mit ihnen aufzuräumen: Statt sie in Talkshows einzuladen, statt nach jedem neuen Pogrom, das sie veranstalten, für ihre soziale Randlage Verständnis zu zeigen und immer weiter in ihrem Sinn das Grundgesetz ändern zu wollen, statt ihnen also ständig nachzugeben, muss man sie jagen, verhaften und gesellschaftlich ächten, muss man noch gnadenloser mit ihnen umspringen als in den 70er Jahren mit der RAF. Denn im Gegensatz zu echten – egal ob sozialistischen oder rein pragmatischen antidiktatorischen – Befreiungsideologien ist Faschismus verbietbar. Ihm geht jede Art von Brüder-zur-Sonne-zur-Freiheit-Eigendynamik ab, das Verbot stärkt ihn deshalb auch nicht, sondern schwächt ihn. Der Faschist-Karrierist, der merkt, dass er als Fähnleinführer nicht reüssieren kann, macht am Ende doch noch den vom Arbeitsamt finanzierten Computer-Lehrgang oder wandert, wenn er es nicht anders begreift, lebenslang ins Kittchen; und wenn irgendjemand – egal ob als wachsweicher Sozi, als tumber Christdemokrat, als naiver Grüner – mal wieder behauptet, man müsse mit den Rechten, statt sie zu stigmatisieren, zusammenarbeiten, um sie so systemimmanent und damit harmlos zu machen, dann muss er wissen, dass dieser Vorschlag genauso bourgeois-feige ist wie das Münchener Abkommen.
Die Demokratien haben schon einmal gedacht – weil ihnen alles andere zu mühsam war und zu unelegant-undemokratisch –, sie könnten mit den Rechtsradikalen verhandeln. Sie haben so lange verhandelt, bis alles anders war und dann zu spät. Aber vielleicht haben sie auch einfach nicht begriffen, was ich längst weiß: eben weil der Faschismus eine rein [13]machiavellistischeMachiavelli, Niccolò und an Macht und sozialem Aufstieg orientierte Karriere-Rezeptur ist, ist das Raffinierteste an ihm, dass er sich nach dem Dominoprinzip einzelne gesellschaftliche Gruppen zur Ausschaltung und Vernichtung aussucht, so dass man immer – aus nachvollziehbarer Feigheit heraus – sagen kann, mich selbst trifft es ja nicht, ich muss bloß die schlechte Zeit überwintern. Und eines Tages ist der demokratische Staat ein SS-Staat geworden, und unsere Schnapsnasen und Hausmeister von einst laufen in Marschalls-Uniformen und Gala-Fracks herum, sie geben Befehle, erschießen Menschen und regieren die Welt. Glaubt denn irgendjemand tatsächlich, die konservativen, weltkriegserprobten deutschen Juden haben in den 30ern allen Ernstes gedacht, sie würden eines Tages über den Feldern von Polen kleine, zarte Rauchpirouetten drehen, um sich dann in nichts aufzulösen? Womit ich, natürlich, wieder im Holocaust-Land angelangt wäre.
Bloß kein Mitleid, ja keine Betroffenheits-Duselei! Ich musste keine Pirouetten drehen und war auch sonst nicht in Gefahr. Als Zehnjähriger bin ich aus Prag nach Deutschland gekommen, zwölf Jahre später tauschte ich meinen sowjetischen Reisepass gegen einen deutschen. Ich habe in diesem Land Abitur gemacht, ich habe hier Haschisch geraucht und Sex gehabt, ich habe tausendzweihundert NDR-Talkshows gesehen und seit 1970 jede Tatort-Folge, ich war Gladbach-Fan und Bayern-Hasser. Ich kenne jedes Lokal von Hamburg, München, Berlin und Frankfurt, das in den letzten zwanzig Jahren halbwegs Avantgarde war, ich habe an einer deutschen Universität studiert und über niemanden anderen als Thomas MannMann, Thomas meine Magisterarbeit geschrieben, und manchmal, wenn ich gerade obenauf bin oder besonders verzweifelt, fällt mir ein, dass ich besser Deutsch spreche als die meisten Deutschen. Kein Majdanek und kein Auschwitz haben mich also daran gehindert, in [14]diesem Land immer alles mitzumachen, was man mitmachen konnte, ich habe dasselbe trostlose 70er-Hippie-Leben geführt wie alle andern, ich war in den 80ern genauso high wie meine Freunde von der Alles-ist-möglich-Fakultät, ich bin durch die 90er durchgerauscht wie durch einen schlechten Martin-WalserWalser, Martin-Traum. Ich bin aus jedem Urlaub nach Deutschland zurückgekehrt und nicht nach Tel Aviv, Paris oder in die Lower East Side, und als ich vor ein paar Jahren eine kleine Tour durch die in Polen gelegenen deutschen KZs mitmachte, sehnte ich mich schon bald nach meinen geliebten Frankfurter Hochhäusern und Fressgassen-Cafés zurück.
Aber Deutscher wollte ich trotzdem nie werden, und mit Holocaust hatte das in Wahrheit nur indirekt etwas zu tun. Ein Satz, der alles bisher Gesagte annulliert und jeden meiner deutschen Leser postwendend erlöst? Natürlich nicht. Denn es muss, was diesen Punkt betrifft, unbedingt gesagt werden, dass es für mich eine eher abstrakte Angelegenheit ist, mit dem Holocaust im Herzen zu leben. Nie würde ich mir anmaßen, mich mit den Stigmata derer, die durch die Hölle kamen, schmücken zu wollen. Den Holocaust zu denken, ihn nicht zu vergessen, ist für mich vielmehr ein archaischer Dienst, es ist Atavismus, es ist das Gefühl, zu einem Volk zu gehören, das es so lange auf dieser Welt gibt wie kaum ein anderes und das es trotzdem immer wieder versteht, Ideen für die Zukunft zu liefern. Und manchmal denke ich deshalb auch, dass, wenn die letzten Juden sterben, auch die Menschheit aufhören wird zu existieren, und so metaphysisch sich das Ganze anhört, so metaphysisch ist es wohl. Aber wie es halt mit den letzten Dingen immer so ist: Das Sinnmachende, Sinngebende, Sinnentleerende an ihnen wird einem selbst nur in sehr wenigen, kostbaren und deshalb umso ergreifenderen Momenten bewusst. Doch in der Regel führt man ein ganz gewöhnliches tragikomisches Menschenlemmingleben, das zu neunundneunzig [15]Prozent aus Routine besteht und zu einem einzigen – höchstens! – aus Metaphysik.
Das Menschenlemmingleben als Emigrantenkind also und nicht als Holocaust-Überlebender: In Deutschland wurde ich als eine Art Staatsgast empfangen, ich war ein Held im Kampf gegen den Weltkommunismus gewesen, ich – der Zehnjährige – war ein Märtyrer des Prager Frühlings, die Galionsfigur einer westlich-kapitalistischen Gegenrevolution. So jedenfalls sah man es offenbar auf dem Hamburger Gymnasium, wo man mich, den Edelausländer, den Nichttürken, den Nichttamilen, in den ersten beiden Jahren, ohne dass ich ein Wort Deutsch gesprochen hätte, mit den allerbesten Noten durchschleuste. Das Mitgefühl ließ aber bald nach, es wich dem Misstrauen einem Jugendlichen gegenüber, der offenbar anders war und das auch gar nicht ändern konnte.
Aber was heißt denn hier, bitte, schon anders: Ich war laut, frech und umtriebig, ich hörte im Unterricht nie zu und wusste trotzdem meistens die beinahe richtige Antwort. Sind Juden so? Ausländer? Marsmännchen? Ich war in keiner Clique, ich war eher der Klassenidiot als der Klassenclown, meine Freunde waren immer auch meine Feinde und nutzten jede Gelegenheit, um sich auf die Gegenseite zu schlagen. Und wenn ich dann wieder einmal zum Direktor musste, sagte der, ich trüge eine gewisse Verantwortung und solle mich schleunigst bessern, denn mein schlechtes Verhalten werfe ein falsches Licht auf all die andern. Auf welche andern? Auf die Juden? Die Marsmännchen?
Das alles sind, sosehr ich mich richtig zu erinnern bemühe, natürlich nur Projektionen von heute aus, und wenn ich schon beim Projizieren bin, dann will ich auch noch schnell meinen Klassenlehrer von damals erwähnen. Er gab bei uns Latein, Deutsch, Geschichte und Sozialkunde, er hatte immer eine stark gerötete Gesichtshaut, eine feste Stimme und weiße [16]Alterskrümel in den Mundwinkeln. Er war ein waschechter Kriegsveteran, jawohl, irgendeiner hatte ihm seinerzeit den rechten Arm abgeschossen, und ab und zu holte Doktor Schöne im Unterricht den Stummel aus dem Hemd heraus, drehte dieses nackte, sinnlose Stück Knochen und Haut ein paar Mal hin und her und sagte, dies sei seine persönliche Art, die Kampfkraft der Roten Horde zu kommentieren. Das hatte natürlich Klasse und war zugleich, soweit ich mich erinnern kann, meine einzige konkrete Begegnung mit einem echten, bekennenden Kriegsdeutschen. Aber die Friedensdeutschen – und darauf will ich die ganze Zeit hinaus – reichten mir auch schon.
Natürlich hatte ich in meinem Leben das eine oder andere antisemitische Erlebnis, es gab schon mal Leute, die mir sagten, im Ofen sei ich am besten aufgehoben, oder mir erklärten, es sei bei mir absolut was dran an der typisch jüdischen Hast und Verschlagenheit. So was legte ich – je älter ich wurde – immer lässiger im Fach der Realsatire ab und beendete trotzdem mit jedem der Sonntags-Stürmer sofort jeglichen Kontakt. Gelebten Antisemitismus, wenn ich so sagen darf, habe ich nie wirklich als Drama, als Erdbeben empfunden, und natürlich würde ich anders reden, wenn es hier nicht um das seichte, feige westdeutsche Judenbenörgeln des alleruntersten, allerverbotensten kollektiven Nachkriegsunterbewusstseins ginge, mal als Antizionismus kaschiert, mal als Ernst-JüngerJünger, Ernst-Bewunderung oder als das schüchterne Kritisieren der angeblich so mächtigen jüdischen Lobby in Amerika. Ich würde anders reden respektive längst über alle Berge sein, hätte ich persönlich es mit VespasianVespasian und TitusTitus zu tun gekriegt, mit Bogdan ChmelnizkijChmelnizkij, Bogdan oder den Teenagern von Rostock. Der meistens außerordentlich zurückhaltend und verschämt vorgetragene Konversations-BRD-Antisemitismus aber, der mir – seit ich erwachsen bin – ab und zu unterkam, machte mir niemals [17]Angst und erfüllte immer nur eine Aufgabe: Er erinnerte mich daran, dass ich offenbar anders bin, denn wenn ich nicht anders wäre, würde man mich wohl kaum der Andersartigkeit zeihen und mir vermeintlich typisch jüdische Eigenschaften anhängen.
Und sie melden sich immer wieder, die seinerzeit von mir kaum registrierten Gespenster meiner Schulzeit. Sie umflattern mich während eines Streits über Israels Politik in einer traumhaft schönen Berlin-Mitte-Bar ebenso still und allgegenwärtig wie in den Tagen der FassbinderFassbinder, Rainer Werner-Debatte, sie wehen mir aus einem hilflos-missgünstigen Zeit-Verriss meines ersten Erzählbandes entgegen, ich sehe sie in den Blicken derer, denen ich in Gesprächen und Diskussionen überlegen bin, und unvergesslich-literarisch ist für mich dieser One-Night-Stand-Moment, als das wildfremde Mädchen, das ich schon halb ausgezogen hatte, plötzlich zu mir sagte: »Stimmt es eigentlich, dass die galizischen Juden die schlimmsten sind?«
Warum, Adonai, bin ich anders? Weil ich nicht Deutscher sein will?
Ich, der andere, schaue in den Spiegel, aber ich sehe nur mich selbst, und so schaue ich die Deutschen an, um etwas zu begreifen, und natürlich betrachte ich nicht irgendwelche abstrakten, längst historisierten Wesen der Nazizeit, sondern Menschen von heute, Menschen, mit denen ich lebe und arbeite. Ich speichere also meinen inneren Computer mit allen Erlebnissen, Gesprächen, Erfahrungen, Beobachtungen, die ich bisher in diesem Land hatte, ich mache mir meinen Modell-Deutschen, ich leiste mir den Luxus der wahrheitsspendenden Generalisierung und – kriege das Kotzen.
Ich kotze vor allem aus einem Grund: Immer wieder stellt sich mir nämlich die angeblich so gemütvolle, die angeblich so romantische und passionsfähige deutsche Seele aus der [18]systembildenden Produktion von NovalisNovalis, Richard WagnerWagner, Richard und Botho StraußStrauß, Botho als ein totes, flaches, abstraktes Gebilde dar, als ewig waberndes Ich-Ding, das – larmoyant, wehleidig eben – einen Sinn für sich selbst hat, aber nie für die Außenwelt, für die Welt der anderen Menschen. Situationen, in denen sich mir diese Art von Kaltschnäuzigkeit eröffnet, erlebe ich oft, und es ist eine Kaltschnäuzigkeit, die manchmal furchtbar intellektualisierend daherkommt, manchmal aber fast unschuldig instinktiv.
Einmal etwa, nachts, sehr spät nachts, saß ich allein in München im Tabacco, die Bedienungen wirkten längst genauso betrunken wie ihre Gäste, Leute liefen ungehindert hinaus, ohne zu zahlen, auf dem Boden lagen Scherben herum, und auf den Tischen glänzten die Barlichter in Lachen von verschüttetem Wein und Bier. Es war so eine richtig anarchische, wüste Sperrstundenstimmung, und der junge Mann, den ich kurz vorher kennengelernt hatte, sah mit seinen 1,90, mit den kurzen blonden Haaren und den ebenen, fast zu ebenen Gesichtszügen genauso aus wie ein SS-Mann. Er war natürlich keiner, er war alles andere als das, ich ordnete ihn sofort – seiner Geisteshaltung und Aussprache entsprechend – dem westdeutschen Kleinstadt-Universitäten-Posthippietum zu, und als er von der längeren Asienreise zu sprechen begann, von der er gerade zurückgekehrt war, wusste ich sofort, dass ich recht hatte. Also gut, dachte ich, reden wir.
Dass er vor einem Jahr plötzlich beschlossen hatte, seinen armseligen Studentenbesitz zu verkaufen, um ostwärts zu ziehen, erschien mir zwar banal, aber trotzdem – zumindest um diese Uhrzeit – nicht uninteressant. Dass ihm dann, gleich in der allerersten Nacht in Bangkok, sein ganzes Geld von einer Nutte geklaut wurde, fand ich amüsant. Und unterhaltsam war auch, wie er am nächsten Morgen, als er hungrig, elend und einsam in einem Café saß, von einem älteren Deutschen [19]angesprochen wurde, der seit Jahrzehnten in Thailand wohnte und ihm sofort Arbeit und einen Platz zum Wohnen anbot. Das war schon deshalb irgendwie witzig, weil dieser Deutsche ein mächtiger Unterweltler war, Herr über Hunderte von Prostituierten, über Dutzende von Puffs. Zu Besuch beim Paten von Bangkok – es gibt langweiligere, abgedroschenere Bargeschichten.
Gar nicht lustig kam mir aber der Rest dieser Geschichte vor, die mein Tabacco-Bekannter mir so unschuldig-unbeteiligt erzählte, als habe er die letzten Monate in einem Pfadfinderlager verbracht. Pfadfinderlager ist gut. Es war eher eine Art KZ gewesen, wo er sich einen langen, warmen, schwülen asiatischen Sommer lang aufhielt – aber nicht, wenn ich bei dem Bild bleiben darf, in den Baracken, nicht bei den Öfen, sondern mehr so im Offizierskasino, im schönen und geräumigen Haus des Aufsehers und natürlich auch im Lagerbordell.
Ja, ganz klar: Der Pate von Bangkok war nicht bloß ein alter Nazi gewesen, der nach dem Krieg aus Deutschland abgehauen war. Der Pate von Bangkok, das bekam mein Hippiefreund schnell mit, hatte einst höchstpersönlich in Polen, in den Lagern, die Judenverbrennung überwacht. Doch das störte den Jungen nicht. Der Alte hatte ihn sofort in sein Herz geschlossen, er gab ihm Wärme und Mädchen und Geld, er sah in ihm den Sohn, den er sich sein Leben lang gewünscht hatte, und irgendwann holte er seine alten Dokumente und Auszeichnungen heraus, er stellte den Filmprojektor auf und ließ alte Wochenschauen laufen, und er schien seine Taten von damals vor allem darum zu bereuen, weil sie in Gestalt einer ständig drohenden Strafverfolgung seine gehetzte Seele verfinsterten. Die Seele des Studenten verfinsterte aber überhaupt nichts. Als ich ihn als Kollaborateur zu beschimpfen begann, als ich sagte, er habe keine Ehre im Leib, er hätte doch sofort Simon WiesenthalWiesenthal, Simon verständigen sollen, sah er mich besonders verständnislos an, er sagte, der Alte sei gut zu ihm gewesen, und mit den [20]anderen Sachen habe er selbst, als 1970 Geborener, nichts zu tun, er könne das alles aus der Distanz heraus gar nicht beurteilen. Im Übrigen scheine es ihm so, dass der Alte damals all diesen Unsinn getrieben habe, weil ihn, den gutmütigen Kerl, die Frauen immer nur schlecht behandelt hätten. Und dann stand er auf, mein Hippiefreund, der bestimmt grün wählt, vegetarisch isst und während des Golfkriegs gegen die Amerikaner demonstriert hat, er stand auf und ging hinaus, ohne zu zahlen, und Hunderte matter Barlichter spiegelten sich hinter ihm in Gläsern, Gesichtern und Alkohollachen, und dann gingen sie plötzlich aus, und es war Sperrstunde.
In dieser Nacht begriff ich – endlich – alles. Das heißt, zunächst dachte ich nach. Ich fragte mich, wieso der Hippie gegen seinen KZ-Gönner nichts unternommen hatte, obwohl er selbst bestimmt kein NSDAP-Anhänger war. Und ich antwortete mir, es muss wohl daran liegen, dass er aus anderen historischen Verhältnissen kommt als du selbst, dass er eine andere biografische Herkunft hat, weshalb ihm bei dem Namen Blondie ein Popstar einfällt, dir aber der Hund von HitlerHitler, Adolf.
War das schon alles? War das der einzige Unterschied? Ich dachte weiter nach, mir kamen so blöde, leere, verbrauchte Worte wie »Täter« und »Opfer«, »Täterkinder« und »Opferkinder« in den Sinn, ich dachte, es sei doch ganz logisch, dass einer wie ich ein komplett anderes, geschärfteres Verhältnis zu einem KZ-Aufseher hat als so ein naiver, harmloser Müsli-Mensch. Doch das war mir nicht Erklärung genug. Dann aber fiel mir zu seiner Rechtfertigung und zur Rechtfertigung seiner Leute ein, dass es noch nie in der Menschengeschichte eine Nation gegeben hat, die so lange, so ausdauernd, so konsequent Tränen über den Gräbern eines Volkes vergossen hat, das von ihr beinah ausgerottet worden wäre.
Falsch. Die Deutschen haben wegen der toten Juden keine einzige Träne vergossen. Sie haben wissenschaftliche Arbeiten [21]über sie geschrieben, sie haben sie in Lexika und Archiven geordnet, katalogisiert und abgelegt, sie haben die Wochen der Brüderlichkeit genauso kalt und generalstabsmäßig abgewickelt wie die Hannover-Messe oder den Polenfeldzug, und jeder, der es jemals wagte, dem Nachdenken über den Holocaust das Mystifizierende, Abstrahierende und somit auch das Hermetisierende zu nehmen, jeder, der die Schoah als ein Menschendrama mit Menschen darstellte, jeder, der Gefühl einklagte bei der Betrachtung des angeblich Unbegreiflichen, der wurde als Feind der Großen Lehre von der Vergangenheitsbewältigung ausgemacht und aus dem Club dieser HegelianerHegel, Georg Wilhelm Friedrich der Holocaustologie exkommuniziert. Heute noch denke ich mit Lachen und mit Würgen an den Aufstand, den diese Nichtswisser veranstalteten, als in den 70ern zum ersten Mal die US-Serie Holocaust im Fernsehen lief, die mehr jungen Leuten die Augen über das Dritte Reich öffnete als all die streng wissenschaftlichen Traktate und Referate der deutschen Nachkriegszeit. Zu emotional, schrien sie damals allen Ernstes, und es war natürlich als Vorwurf gemeint. Zu emotional? Was denn sonst, ihr Arschlöcher, was sonst?!
In jener Nacht im Tabacco begriff ich also im Verlauf einer vielleicht nicht allzu stringenten Assoziationskette, dass die Deutschen das genaue Gegenteil von dem sind, zu was sie seit zweihundert Jahren von den Romantikern, von den WagnerianernWagner, Richard, von Thomas MannMann, Thomas, von SieburgSieburg, Friedrich Carl Maria und FestFest, Joachim, von AugsteinAugstein, Rudolf und KieferKiefer, Anselm und den Erfindern der Love Parade stilisiert werden: Nix Leidenschaft, nix Gemüt – sie kämpfen sich in Wahrheit ohne jede Empfindung durchs Leben, sie absolvieren das Schicksal wie eine Trainingseinheit, sie laufen wie programmierte, funktionstüchtige Zombies durch die Welt, und öffnet sich ein Programm, das sie nicht kennen, kommt das Signal »Fehlfunktion«. Darum sind sie auch absolut nicht imstande, andere wirklich zu verstehen, egal ob sie in deren Land [22]einmarschieren oder es ein halbes Jahrhundert später mit Stern, Günther JauchJauch, Günther und ZDF vor einer drohenden Hungerkatastrophe retten.
Nein – so wollte, so würde ich selbst hoffentlich niemals sein, dachte ich, und dann begann ich auch noch, meine Freunde und Bekannten durchzugehen. Ich fand natürlich jede Menge Ausnahmen und noch mehr Bestätigungen für mein so niederträchtiges, so aufhellendes Herumpauschalisieren, ich war berauscht von meinen Einsichten, aber schlechtes Gewissen machten sie mir natürlich auch, und als ich schon selbst beschämt auf »Fehlfunktion« drücken wollte, hielt ich inne.
Denn eines verbindet wirklich alle Menschen in diesem Land: Es ist diese vollkommene Geschichtslosigkeit, die ihnen allen eigen ist und die sie wohl deshalb in meinen Augen so kalt, so flach, so leer macht. Keiner – aber wirklich keiner – meiner deutschen Freunde erzählt jemals etwas über seine Familie, keiner spricht darüber, wo seine Wurzeln sind, welche Tragödien, welche Komödien seine eigene Familie zur allereigensten, allerbesondersten Familie der Welt gemacht haben. Die Menschen, die mir in Restaurants und Bars und Wohnzimmern gegenübersitzen, sind meist völlig eindimensionale Wesen, die über das Heute plappern, über Tschernobyl, David LynchLynch, David und Kinderkriegen, über Designermöbel, den Techno-Hype und das neue vietnamesische Lokal bei ihnen um die Ecke. Das Gestern aber interessiert sie offenbar nicht, sie verstehen sich nicht als Teil einer Kette, sie begreifen sich nicht als Fackelträger einer langen, auf faszinierende Weise in die Vergangenheit zurückreichenden Tradition, und wer jetzt entgegnet, dies sei auch verdammt schwer angesichts der ganzen peinlichen Nazisache, dem antworte ich, dass das vielleicht tatsächlich irgendwie richtig ist – und trotzdem kein Grund, auf eine eigene Identität zu verzichten. Denn wer keine eigene [23]Identität hat, wird anderen eine solche eben auch nicht zugestehen.
Geschichte ist in Deutschland immer nur MetternichMetternich-Winneburg, Clemens Graf von, BismarckBismarck, Otto von und HitlerHitler, Adolf, es ist der Westfälische Friede, der Siebenjährige Krieg, der Prager Fenstersturz. Geschichte steht in Deutschland immer nur in den Geschichtsbüchern, sie ist aber niemals ein realer Bestandteil der Gegenwart. Menschen erzählen sich Geschichte nicht, sie kippen sie in den Orkus ihres schlechten Nachkriegsgewissens, oder, viel häufiger noch, sie wird Opfer ihrer Zivilisationsdeutschen-Oberflächlichkeit. Es ist verdammt noch mal kein Zufall, dass die wenigen deutschen Künstler, die in den letzten Jahrzehnten nachhaltig Weltruhm errangen, egal ob BöllBöll, Heinrich oder GrassGrass, Günter oder FassbinderFassbinder, Rainer Werner, insofern untypisch deutsch waren, als dass sie die Geschichte ihres Volkes in die Geschichten von kleinen, normalen Menschen aufteilten und so überhaupt erst lebendig machten.
Das magische Wort heißt also Identität, nationale Identität, und damit hat dieses Land, natürlich, eine Menge Probleme. Denn dass die Sache mit dem Nationalismus in Deutschland von Anfang an schiefging, muss man niemandem lang erzählen. Der Nationalismus, der überall anderswo zunächst eine soziale Emanzipationsbewegung gegen Adel und Kirche war, das Solidarisierungsmodell der vielen kleinen, machtlosen Menschen gegen die wenigen Überprivilegierten, wurde in Deutschland schon immer von den Herrschenden als imperiales Instrument missbraucht: Er entstand nicht als revolutionäre Aufregung, sondern als Reaktion auf die französische Besatzung. Die erste nationale Hysterie erlebten die deutschen Staaten deshalb auch ausgerechnet 1813, als es darum ging, die Franzosen zu vertreiben. Das war nicht Sozialismus, Armen- und Entrechteten-Befreiung. Es war einfach nur ein brutaler, gemeiner Zurückeroberungskrieg von ein paar Aristokraten, [24]die – um die Masse der Fron-Soldaten für sich zu mobilisieren – allen versprachen: Wir sind ein Team.
Wir sind ein Team – so hieß es auch 1870/71, so hieß es auf den Schlachtfeldern von Verdun und im Tausendjährigen Reich. Es war, immer und immer wieder, ein hinterhältiger Karrieristentrick, es war eine große, fiese Cheflüge, eine Lüge, auf die der kleine, wehleidige, herumkommandierte Deutsche jedes Mal von Neuem willfährig und unüberlegt reinfiel.
Kein Wunder also, dass jene, die nach Weltkrieg und Holocaust im guten, aufregenden 68er-Taumel mit ihren Mitläufer-, Schweiger- und Tätereltern abrechneten und damit einen moralischen Standard für diese Republik setzten, der genauso meinungs- und tatbildend ist wie sonst nur die bundesrepublikanische Verfassung – kein Wunder, dass die umsichtigen, die nachdenklichen, die nichtegoistischen Deutschen so allergisch auf Worte wie »Nationalismus« und »Patriotismus« reagieren. In ihrem Fahrwasser schwimmt längst fast das ganze deutsche Volk mit, ein Volk, das nichts von Pflicht und Aufopferung fürs Vaterland wissen will.
Richtig so. Und falsch. Denn man darf natürlich den Reichsparteitag nicht mit dem Bundestag verwechseln, KohlKohl, Helmut nicht mit HitlerHitler, Adolf, die Wiedervereinigung nicht mit dem Anschluss Österreichs. Jeder, der das tut, jeder, der heute allen Ernstes Zuckungen und Krämpfe kriegt, wenn man ihm sagt, er solle gefälligst aufhören, das inzwischen so hohl und stumpfsinnig gewordene antideutsche Mantra der 68er herunterzubeten, ist in erster Linie ein Dummkopf, ein Heuchler, ein Nichtdenker, dem es in Wahrheit darum geht, in Ruhe sein selbstsüchtiges, wehleidiges Luxusdeutschen-Leben zu führen, ein Leben zwischen Stehitaliener und Ferienhaus in Südfrankreich, wie zwischen Ballermann und H & M. Gerade so einer muss aber endlich begreifen, dass ein demokratischer Staat, in dem er lebt, von ihm auf Dauer ein Kollektivbewusstsein einfordern wird, [25]damit er überhaupt funktionieren kann – ein Kollektivbewusstsein im Sinne eines JFKKennedy, John F. natürlich, nicht eines GoebbelsGoebbels, Joseph oder RosenbergRosenberg, Alfred, ein Kollektivbewusstsein, das sich nicht nach nationaler Herkunft oder Hautfarbe definiert, sondern allein nach dem Wohnort. So bedeutet, modern gedacht, nationales Selbstverständnis nichts anderes als Verantwortungsgefühl für die Gesellschaft, die man ernährt und von der man aber auch selbst ernährt wird, und das meine ich sozial ebenso wie politisch oder kulturell. Es ist wie beim Fußball: Wenn zu viele mit nichts oder nur sich selbst beschäftigt sind, geht die ganze Mannschaft baden.
Das Vakuum, das die so tüchtige, so kühle deutsche Vergangenheitsbewältigung hinterlassen hat, können wir schließen, wenn wir nur wollen. Und das müssen wir auch, und zwar sehr schnell, denn sonst werden sich tatsächlich – weil niemand ihnen Einhalt gebietet – andere hineindrängen: wirre Greise, verwirrte Kindsköpfe, Verlierer und Verlorene, die nur darauf warten, ihre persönlichen, allerprivatesten Niederlagen in einen Sieg über eine seit Jahrzehnten halbwegs anständig funktionierende Republik umzumünzen. Wenn die es schaffen, uns unser kleines liberal-demokratisches Paradies zu entreißen, dann ist tatsächlich bald wieder das Wort »deutsch« nur noch ein Synonym für rechtsradikal und anmaßend, fremdenfeindlich und imperial, und wir alle, fast alle jedenfalls, sind wieder einmal nur noch Fremde im eigenen Land.
Habe ich gerade »wir« gesagt? Ja, natürlich. Es ist nämlich verdammt kraftraubend und es macht nur selten wirklich Spaß, am Rand zu stehen und ein kommentierender, siebengescheiter Außenseiter zu sein. Dazuzugehören ist, so gesehen, auch nicht übel, eben Teil einer großen, coolen, lustigen Gang zu sein.
Wenn die Deutschen also eines Tages keine größenwahnsinnigen Wehleidigkeiten mehr kennen, wenn sie sich nicht [26]mehr als ewig Zukurzgekommene empfinden, wenn sie aufhören, misstrauisch gegenüber allem Fremden und Anderen zu sein und nachlässig-feige gegenüber den Faschisten-Karrieristen in ihrer Mitte, wenn sie Gefühle als Schlüssel zu jeder Art von Metaphysik entdecken, wenn sie Egoismus nicht für Gemüt ausgeben, wenn sie beginnen, einen Sinn für ihre eigene, kleine, persönliche Menschengeschichte zu entwickeln genauso wie für den großen Plan – und wenn sie vor allem endlich laut und überzeugt erklären, dies hier sei ihr Land und sie würden es sich nicht noch einmal von ein paar frustrierten chauvinistischen Pogrombrüdern kaputtmachen lassen, dann, ja, dann würde auch ich gerne ein Deutscher sein.
So eine Art Deutscher jedenfalls.
Ein Rückzieher, ich weiß. Aber ich mache ihn nicht etwa deshalb, weil ich jetzt wieder an Majdanek oder Treblinka denken müsste, an den Adoptivsohn des Paten von Bangkok oder an das Mädchen, das, statt mit mir zu schlafen, über die galizischen Juden sprach. Ich mache diesen Rückzieher, weil mir nun noch einmal mein armenischer GroßvaterGrigorewitsch, Schmil in den Sinn kommt.
Ich habe GroßvaterGrigorewitsch, Schmil nämlich sehr geliebt. Er war ein großer, schöner Mann gewesen, mit seiner Glatze sah er wie Pablo PicassoPicasso, Pablo aus oder wie Henry MillerMiller, Henry, und deshalb hatte er bei den Frauen auch genauso viel Erfolg wie sie. Er war ein Spieler und Soldat, ein Hypochonder und ein halbwegs anständiger Mensch, wir verbrachten immer sehr viel Zeit miteinander, er unterrichtete mich im Schach- und Backgammon-Spiel, er bastelte für mich Schiffe und Autos, er schenkte mir russische Briefmarken mit LeninLenin, Wladimir Iljitsch und GagarinGagarin, Juri Alexejewitsch drauf, er zeigte mir mit dem Fernrohr den Mond und den Mars, und da er einmal gegen seinen Freund, den Schachweltmeister PetrosjanPetrosjan, Tigran, eine Partie gewonnen hatte und mir, seinem Enkel und Schüler, wiederum kurz darauf unterlag, verdanke ich GroßvaterGrigorewitsch, Schmil, dass ich [27]heute sagen kann, ich hätte – im indirekten Vergleich jedenfalls – einmal im Leben einen echten Schachweltmeister geschlagen.
Ich habe GroßvaterGrigorewitsch, Schmil seit jenem Moskauer Frühling 1970, als wir zusammen im Bett lagen, Schokoladenbutterbrote aßen und uns im Fernsehen sowjetische Kriegsfilme anguckten, nicht mehr wiedergesehen. Bald darauf sind meine Eltern mit meiner SchwesterLappin, Elena und mir in den Westen geflohen, wir haben unsere Heimat verlassen, um uns in Deutschland einzurichten. GroßvaterGrigorewitsch, Schmil, der in Moskau geblieben war, hatte nichts mehr gewünscht und ersehnt, als uns einmal in Hamburg zu besuchen. Er stellte Anträge, lief bei den Behörden herum, er hoffte und fluchte, und bevor er etwas erreichen konnte, starb er.
Kurz vorher hatte er mir – ich glaube, zu meinem elften oder zwölften Geburtstag – einen Brief geschrieben. Ich weiß nicht mehr genau, was drin stand, ich weiß nur, dass meine Eltern damals im Gegensatz zu mir, dem Kind, von seinem Brief sehr beeindruckt waren.
Ich schätze, GroßvaterGrigorewitsch, Schmil wünschte mir alles Gute für mein Leben, und es werden bestimmt sehr warme Worte gewesen sein, die er gefunden hat, Worte, mit denen er vielleicht ausdrückte, dass alles Gute, was er selbst erlebte, auch mir widerfahren, das Schlechte jedoch von mir abgewendet werden soll. Aber vielleicht stand ja noch etwas ganz anderes in GroßvatersGrigorewitsch, Schmil Brief, vielleicht stand dort auch etwas darüber, wie man als Anderer unter Anderen man selbst bleiben kann und trotzdem glücklich wird.
Manchmal, GroßvaterGrigorewitsch, Schmil, denke ich an dich, und ich denke auch, wir hätten niemals in die Fremde ziehen sollen.
(1992)
[28]Ohne Zweifel links
Als ich mit zehn Jahren aus Prag nach Deutschland kam, wusste ich leider schon, wie gefährlich das Leben sein konnte. Die Bolschewiken hatten in der Sowjetunion meinen jüdischen GroßvaterGrigorewitsch, Schmil umgebracht, sie hatten in Prag meinen Onkel für Jahre ins Gefängnis gesteckt, sie hatten meinem VaterBiller, Jevsej »Semjon« verboten, zu studieren, und dann waren sie auch noch im Sommer 1968 mit ihren Soldaten, Politoffizieren und Panzerdivisionen in die Tschechoslowakei einmarschiert, weil sie von DubčekDubček, Alexander, HavelHavel, Václav und den dekadenten Filmen des Prager Barrandov-Studios genug hatten.
Ja, ich war wirklich sehr froh, in Deutschland zu sein, auf der anderen, der sicheren Seite der StalinStalin, Josef-BreschnewBreschnew, Leonid Iljitsch-Linie, hier würde mir bestimmt so schnell nichts passieren. Nur eine Sache wunderte mich und ging mir bald auf die Nerven: Fast keiner von denen, die ich hier in der Schule und in der Universität getroffen habe, hatte eine Ahnung davon, wie gefährlich das Leben sein konnte, wie dünn die Zivilisations- und Demokratieschicht war, auf der sich die Bewohner von US-Europa seit 1945 bewegten, wie schnell aus Freiheit Diktatur und aus freien Menschen Häftlinge und Tote werden konnten, wenn es ein charismatischer Massensadist und angeblicher Menschheitsretter unbedingt wollte.
Und schon gar nicht wussten meine von BrandtBrandt, Willy, SchmidtSchmidt, Helmut und KohlKohl, Helmut verwöhnten Mitschüler und Kommilitonen, dass in der zweiten, besseren Hälfte des 20. Jahrhunderts der Kommunismus und alles, was sie dafür hielten, der größte Feind ihres süßen und freien Westlebens war. Im Gegenteil, sie liebten ihn, in allen seinen vulgären, oberflächlichen Varianten und Variationen, auf einmal gab es in Deutschland mehr K-Gruppen als Brotsorten, und die kommende Revolution sollte der ganz reale Horrorfilm sein, von dem sie sich maximalen [29]Pubertäts-Thrill versprachen. Kommunismus – egal ob als müder, moskautreuer Bolschewismus-Aufguss, egal ob als schmutzige maoistischeMao Zedong Kulturrevolutions-Fantasie oder als jesuitische MG-Sophistik – war vor allem aber die Superpower-Ideologie, die sie fürs Erwachsenwerden brauchten. Mit ungelesenen MarxMarx, Karl-Bänden im Bücherregal, mit simplifizierenden Nieder-mit-dem-Bösen-Dogmen in den Köpfen und wirren Alles-wird-gut-Idealen in den Herzen fühlten sie sich überhaupt erst stark genug, nein zu sagen, wenn ihre wilhelminischWilhelm II. strengen SPD-, CDU- und Ex-NSDAP-Eltern von ihnen verlangten, dass sie endlich mal wieder zum Friseur gingen, mit achtzehn eine der damals üblichen drei Staatsparteien wählten und den 12-Uhr-Sonntagsbraten ganz aufaßen. Sie waren links, damit sie nicht rechts sein mussten, und weil so viele andere aus ihrer Generation auch links waren, konnten sie sich gemeinsam vor den reaktionären Erwachsenen etwas weniger fürchten.
Wie seltsam, naiv und unreif die Westjugend war, wurde mir besonders an diesem warmen, grauen Hamburger Tag im Frühling oder im Sommer 1972 klar, als vier Hamburger Polizisten unseren jungen kommunistischen Sozialkundelehrer an den Armen und Beinen aus der Klasse raustrugen, weil kurz vorher die sozialliberale BrandtBrandt, Willy-Regierung in einem Anfall machiavellistischerMachiavelli, Niccolò Klarsicht beschlossen hatte, dass Leute, die den Staat abschaffen wollten, der sie bezahlte, keine Beamten mehr sein durften. Die halbe Schule war wütend, die meisten Schüler und auch einige Referendare hatten sich zuerst sogar schützend vor den kleinen, bärtigen und plötzlich sehr verschreckten Mann gestellt, aber dann waren sie zur Seite gegangen und skandierten: »Polizei, SA, SS! Polizei, SA, SS!« Ich skandierte natürlich nicht mit. Ich konnte unseren Sozialkundelehrer nicht ausstehen, ich fand, er hatte es nicht anders verdient. Er wollte, dass wir Vietcong-Schriften auswendig [30]lernten und erklärten, was wir aus ihnen für den BRD-Klassenkampf lernen könnten, er war so autoritär wie Kaiser WilhelmWilhelm II., er hatte keinen Humor, und wenn ihm jemand widersprach, fing er an, zu schreien. Schade, dachte ich, dass nicht vier Jahre vorher ein paar nette westdeutsche Polizisten gekommen waren und alle sowjetischen Soldaten aus der ČSSR an allen vieren rausgetragen hatten.
Ungefähr zehn Jahre später war dann plötzlich alles ganz anders, es war besser, schöner, leichter, undogmatischer, freier und internationaler. Die Leute, die ich jetzt traf, in den Cafés, Bars und Diskotheken von München, redeten nicht mehr über MarxMarx, Karl, MaoMao Zedong und AdornoAdorno, Theodor W., sondern über Depeche ModeDepeche Mode, Vivienne WestwoodWestwood, Vivienne, Andy WarholWarhol, Andy und Hunter S. ThompsonThompson, Hunter S.. Die Jungs schnitten sich die Haare ab, die Mädchen rasierten sich die Beine und die Achseln, und jeder Zweite hatte Freunde in New York und wollte sie dort bald besuchen.
Die Dauerparty der frühen und mittleren 80er Jahre, dachten damals viele und sagen manche bis heute, sei nicht mehr als ein ästhetizistisches Spiel gewesen, gedankenlose, harmlose Anything goes-Dekadenz und die Lust an Jacketts, deren Schultern so breit waren wie die echten Schultern von Arnold SchwarzeneggerSchwarzenegger, Arnold. In Wahrheit war es aber etwas sehr Tiefes, Politisches, Essenzielles. Es war – für viele – die gut durchdachte und noch besser gelaunte Reaktion auf das düstere, apodiktische, linke, unintelligente Jahrzehnt davor, es war ein Nein, das jetzt nicht den Eltern, sondern der vorherigen Jugendgeneration entgegengeschleudert wurde, den ehemaligen Sozialkundelehrern, den heuchlerischen Stern-Redakteuren und neuen Grünen, es war ein Arschtritt für jeden, der glaubte, das Leben bestünde nur aus politischen und moralischen Direktiven, weshalb er beim Sex mit seiner hässlichen Hippiefreundin statt an Kim BasingerBasinger, Kim an Petra KellyKelly, Petra dachte. Und oft war es auch die Wiederentdeckung der eigenen Jugend, die man so [31]lange unter den ungelesenen, unverstandenen Bändchen der Edition Suhrkamp begraben hatte.
Die meisten sagten Pop dazu – ein Wort, das mich bald aufregte, denn wenn Leute wie Diedrich DiederichsenDiederichsen, Diedrich oder Kid P.Kid P. (d. i. Banaski, Andreas) es benutzten, klang es bloß wieder wie die allerneueste altpubertäre Kommunistenlehre. Mir war zunächst aber egal, wie das, was wir damals dachten und machten, genannt wurde. Ich war einfach nur froh, dass der Westen, in dem ich lebte, immer freier, liberaler und offener zu werden schien, also genauso, wie es mir meine Eltern und ihre tschechischen, polnischen und russischen Emigrantenfreunde versprochen hatten. Und je mehr Artikel ich über die Alt-68er und ihre Kinder schrieb – ich lebte inzwischen vom Schreiben –, desto klarer wurde mir, was mich an ihnen schon immer gestört hatte: Sie waren auch nicht viel besser als ihre Todfeinde, die echten und die eingebildeten Nazis, nur dass an ihren Händen meist kein Blut klebte. Sie fürchteten sich wie ihre Eltern und Großeltern vor Amerikas Vielfalt, Liberalität und absoluter Meinungsfreiheit, sie sprachen – in wiedererwachendem GoebbelsGoebbels, Joseph-Newspeak – von den Machenschaften der »Ostküste«, und überhaupt waren die USA aus ihrer Sicht an allem schuld, was auf der Welt nicht funktionierte, während sie zur Sowjetunion ein ähnlich taktisch-freundliches Verhältnis hatten wie Deutschland in Zeiten des HitlerHitler, Adolf-StalinStalin, Josef-Pakts. Dass sie Israel – zum Zweck einer leicht durchschaubaren Gewissensentlastung – immer lauter als das neue Dritte Reich beschimpften, fand ich sogar noch ziemlich unterhaltsam, weil es so verräterisch und unfreiwillig komisch war wie der Mann, der zum Psychiater kommt und sagt, er habe zwar kein Vaterproblem, würde aber komischerweise jede Nacht im Traum aus Papas Schädel Margaritas trinken.
Was ich aber an den Ur-68ern und ihren 70er-Jahre-Lehrlingen wirklich hasste, war ihr totalitärer, undemokratischer Idealismus, ihre 110-Dezibel-Besserwisserei, ihre offenbar fast [32]schon genetisch vererbte Unfähigkeit, ein Gegenargument zu analysieren und dann selbst eins zu entwickeln, um so der Lösung eines real existierenden Problems ganz pragmatisch ein wenig näher zu kommen. Die alten und nicht ganz so alten BRD-Linken, die sich allmählich in die von ihnen verachtete kapitalistische Gesellschaft professionell und institutionell hineinfraßen, waren die Sandinisten der freien Welt, und manchmal auch ihre Nordkoreaner. Wer anderer Meinung war als sie, musste darum aus dem Weg geräumt werden, in der Universität, in der Redaktion, sie wollten das Gute, schufen aber immer nur das Böse, und außerdem aßen sie Spaghetti mit Gabel und Löffel.
Meine neuen Pop-Freunde hatten offenbar das gleiche Problem mit ihnen wie ich, und das beruhigte mich, obwohl ich ahnte, dass auch sie sich ein intellektuelles und ästhetisches System aufbauten, in dem nur Ja-Sager zugelassen waren, also Leute, die so wie sie die singende Softporno-Krähe MadonnaMadonna