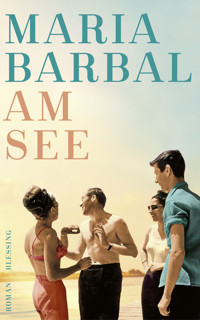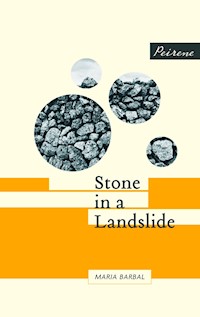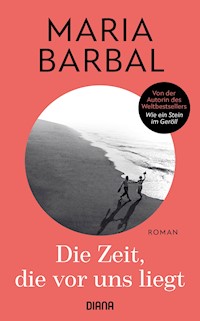9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diana Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Anfang des 20. Jahrhunderts: Conxa verlässt mit dreizehn Jahren ihre Familie, um auf dem Hof ihrer kinderlosen Tante zu arbeiten. Das Leben in dem katalanischen Bergdorf ist entbehrungsreich, geprägt von den Rhythmen der Natur und festen Traditionen. Als sie ihre große Liebe Jaume heiratet und drei Kinder bekommt, erfährt Conxa ein bescheidenes Glück. Doch trotz der Abgeschiedenheit der Pyrenäen hält der Spanische Bürgerkrieg Einzug in ihre Welt und reißt Conxa mit sich wie einen Stein im Geröll.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 181
Ähnliche
ÜBERDIEAUTORIN
Maria Barbal ist eine der einflussreichsten und erfolgreichsten Stimmen der katalanischen Literaturszene. Geboren 1949 in den Pyrenäen, lebt und schreibt die mehrfach preisgekrönte Autorin heute in Barcelona. Ihr Debüt Wie ein Stein im Geröll, in 16 Sprachen übersetzt und nun in einer überarbeiteten Fassung neu aufgelegt, gilt als moderner Klassiker. Auf die Frage, wie dieses Buch ihr Leben verändert habe, antwortete die Autorin: »Wie ein Stein im Geröll ist gleichsam in mein Leben eingebrochen und hat mich zur Schriftstellerin werden lassen. Der Roman hat mir einen Weg eröffnet, bewusster zu leben und er hat mich in meiner Liebe zu den Worten bestärkt, in deren Fähigkeit, Sinn zu vermitteln.«
2022 erscheint ihr aktuellster Roman Die Zeit, die vor uns liegt.
ÜBERDIEÜBERSETZERIN
Heike Nottebaum, geboren und aufgewachsen im Ruhrgebiet, studierte an der Ruhr-Universität Bochum Germanistik und Romanische Philologie und unterrichtete dort später spanische und katalanische Literatur. Zurzeit ist sie als freie Übersetzerin tätig, vor allem aus dem Katalanischen und Spanischen.
MARIA
BARBAL
Wie ein Stein
im Geröll
ROMAN
Aus dem Katalanischen
von Heike Nottebaum
Mit einem Nachwort
von Pere Joan Tous
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Aktualisierte Neuausgabe 09/2022
Copyright © 1985, 2015 Maria Barbal
Die Originalausgabe erschien 1985
unter dem Titel Pedra de tartera bei Editorial Laia, Barcelona,
die überarbeitete Neuausgabe 2015 unter demselbenTitel
bei Columna Editions, Barcelona.
Copyright © 2008 der deutschsprachigen Taschenbucherstausgabe
sowie dieser überarbeiteten Ausgabe © 2022 by Diana Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Die vorliegende Übersetzung basiert auf der
von der Autorin überarbeiteten Neuausgabe 2015.
Umschlaggestaltung: SERIFA, München
Umschlagmotiv: © Giovan Battista D’Achille/Trevillion Images
Satz: Leingärtner, Nabburg
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-641-29259-1V001
www.diana-verlag.de
meinen Eltern
ERSTER TEIL
Man sah gleich, dass wir bei uns daheim viele waren. Und eine schien man entbehren zu können. Ich war die fünfte von sechs Geschwistern, und auf die Welt bin ich gekommen, wie die Mutter sagte, weil Gott es so gewollt hat, und was Er einem gibt, muss man annehmen. Maria, das war die Älteste, kümmerte sich schon mehr um den Haushalt als die Mutter selbst, Josep, der Erstgeborene, würde einmal alles erben, und Joan ging aufs Priesterseminar. Von uns drei anderen, den Kleinen, habe ich oftmals sagen hören, wir würden mehr Arbeit machen, als von Nutzen sein. Rosige Zeiten waren das nicht. Es gab so viele Münder zu stopfen, und wir hatten so wenig, natürlich reichte es da nie. Aus diesem Grund wurde beschlossen, dass ich, die ich einen folgsamen Charakter hatte und schon sehr vernünftig war, von zu Hause fort sollte, um der Tante zu helfen, Mutters Schwester, die bereits die Hoffnung aufgegeben hatte, eigene Kinder zu bekommen. An Arbeit aber mangelte es ihr nicht. Sie hatte einen Erben geheiratet, der sehr viel älter war als sie. Er besaß Land, mindestens ein halbes Dutzend Kühe, dazu Geflügel und Kaninchen und sogar einen Gemüsegarten. Es fehlte ihnen an nichts, aber sie fühlten, dass sie langsam älter wurden, und sie hatten niemanden, der ihnen zur Hand ging und Gesellschaft leistete. So verließ ich mit dreizehn Jahren, ein Bündel unter dem Arm, Maria auf der einen und den Vater auf der anderen Seite, Familie, Elternhaus, Dorf und Berge. Von Ermita bis Pallarès ist es gar nicht so weit, doch zu Fuß brauchte man dafür einen ganzen Tag, und das bedeutete, ich verlor mein Zuhause. Und als ich ihm auf dem Weg hinunter den Rücken zukehrte, tat das mehr weh als alles andere, denn die einzige Welt, die ich bis dahin gekannt hatte, einfach alles, blieb hinter mir zurück.
Auf dem stundenlangen, schweigsamen Fußmarsch zum Markt von Montsent, wo Vater und Maria die Einkäufe erledigen und mich Onkel und Tante übergeben sollten, fielen mir bloß die schönen Dinge ein, die ich in dem Dorf erlebt hatte, in dem ich zur Welt gekommen war. Verlassen hatte ich es nur, um das Vieh auf die Bergwiesen zu treiben oder um im Nachbardorf, das gerade mal aus vier Häusern bestand, mit aufs Patronatsfest zu gehen. So viele Menschen, und die Erde gab so wenig her.
Ich erinnere mich noch gut an die drei Winter, die ich zur Schule gegangen bin. Ich war wohl eines der wenigen Mädchen, die etwas hatten lernen dürfen, denn daheim gab es ja schon größere Kinder, die zur Arbeit taugten. Was für ein Glück, zu den Kleinen zu gehören! Die Lehrerin brachte uns diese merkwürdig geschwungene Schönschrift bei, wo das Ende eines jeden Buchstabens nach oben zeigt und das r links einen Buckel hat, sodass ich immer an einen Korkenzieher denken musste. In der Schule war es schön warm, denn Fräulein Paquita ließ sich nicht davon beeindrucken, dass es bei uns allen zu Hause recht knapp zuging, und verlangte jede Woche einen ordentlichen Vorrat an Brennholz, um den Klassenraum zu heizen. Das ABC könne man sich schließlich nur einprägen, wenn man es auch ein bisschen warm habe, und wenn unsere Eltern wollten, dass wir etwas lernten, müssten sie »ihren guten Willen schon unter Beweis stellen«, wie sie auf Spanisch sagte. Auf Spanisch habe ich auch das Wenige gelernt, das ich weiß, selbst wenn ich später fast alles wieder vergessen habe. Die ersten Tage konnte ich es gar nicht fassen, dass das Fräulein Lehrerin, von der niemand so genau wusste, woher sie eigentlich kam, sich nicht verständlich machen konnte, wenn sie mit uns sprach. Schließlich haben wir sie aber doch verstanden, und auch sie konnte uns folgen, wenn wir etwas sagten. Ich weiß nur nicht, warum sie so tat, als ob sie sich schämen würde oder ihr das Ganze nicht recht sei. An diese Winter in der Schule erinnere ich mich, als wäre es erst gestern gewesen. Magdalena und ich setzten uns immer nebeneinander, und wenn wir etwas vorlesen sollten, musste ich vor Lachen losprusten, und Magdalena hörte auf zu lesen. Dann schob sich Fräulein Paquita ihre Brille auf die Nase und schaute uns an, wie ein Feldwebel so streng, und ich bekam diese Bauchschmerzen, weil ich versuchte, mir das Lachen zu verkneifen, und Magdalena las weiter, und ich merkte, wie mir etwas Pipi in den Schlüpfer lief.
Ich bin gerne zur Schule gegangen. Das war etwas Besonderes und gab mir das Gefühl, dass es auch etwas Gutes hatte, ein Kind zu sein. Daheim schien man immer zu stören. Wenn wir in der Scheune spielten, hieß es, wir Kinder würden alles durcheinanderbringen. Stocherten wir mit dem Schürhaken zwischen den Töpfen auf dem Herd herum, wurden wir fürchterlich gescholten, und alle sprachen von irgendeinem Unglück, und wenn wir einen Stein oder ein Stück Holz zum Spielen nahmen, wurden wir geschimpft, wir hätten bloß Unsinn im Kopf. Nur wenn man beim Melken geholfen hat, beim Kartoffelschälen, beim Aushülsen der Bohnen oder beim Brennholzholen, dann war man auf der sicheren Seite. Dafür warst du alt genug, doch eine Scheibe gebratenen Speck oder einen Schluck Wein aus dem porró hast du dann trotzdem nicht bekommen, denn dafür warst du ja noch zu klein.
Vom Küchenfenster aus kam mir das Dach der Sarals mächtig groß vor, und die Dachschiefer glänzten wie kleine Spiegel. Es hatte aufgehört zu regnen, und während Mutter ein grobes Leinentuch, das sie waschen wollte, mit Asche bestreute, fielen draußen ein paar Regentropfen vom Dach und zerplatzten auf der Fensterscheibe. Ich schaute zu, wie sich dort Rinnsale bildeten, und hörte, wie die Mutter die gleiche Geschichte noch einmal von vorne begann. Die Tante hätte ja so gerne ein Mädchen wie dich gehabt, doch Gott hat ihr keins geben wollen. Und du siehst ihr viel ähnlicher als Maria oder Nuri. Vor allem das rötliche Haar, und du wirst es nicht glauben, aber die Tante war die hübscheste von uns vier Schwestern, deshalb hat sie eine so gute Partie gemacht. Auch unsere Augen würden sich ähneln. Das sind die Augen deiner Großmutter, möge sie in Frieden ruhen, und Tante Encarnació hat sie geerbt.
Aber das war es ja nicht allein, sie brauchte einfach jemanden. Mutters Hände schichteten das Brennholz, um das Feuer anzuzünden. Und da sei es doch am besten, jemand aus der Familie habe einen Nutzen von all den Gottesgaben …
Ich brachte kein Wort heraus und hätte doch so gerne etwas gesagt, aber als die Mutter mit einem Mal schwieg, spürte ich einen Knoten im Hals wie eine Schlinge, an deren beiden Enden gleichzeitig gezogen wird. Das tat weh und der Schmerz ließ erst nach, als ich tief aufschluchzte. Da löste sich mit einem Mal der Knoten, und ein Sturzbach von Tränen brach aus mir hervor, und ich war so zornig, denn Weinen war das Letzte, was ich in diesem Augenblick wollte.
Es gab nichts mehr zu sagen. Ich wusste, wenn sich Mutter einen Morgen lang im Haus zu schaffen machte und sich dabei die Zeit nahm, mit mir zu reden, so ganz ohne Eile, ohne den Fluss der Worte immer wieder zu unterbrechen mit »mach dies« oder »wir müssen das noch erledigen« oder »hast du oben schon aufgeräumt?«, dann war das ein ganz besonders feierlicher Moment. Und solche feierlichen Momente gab es bei uns daheim nicht viele. Mutter zog ihr Taschentuch hervor und verlor sich in Erklärungen, die ebenfalls in Tränen endeten. Und so ballte sich das weiße Stück Baumwollstoff, erst durch meine und dann durch ihre Tränen, zu einem kleinen Klumpen, der nach und nach eine blaugraue Farbe annahm. Dann war es auf einmal still. Ich senkte die Augen, und in der Wärme, die sich langsam vom Feuer auszubreiten begann, wurde mir der Kopf ganz schwer und mich überkam eine große Müdigkeit.
Als ich Mutter dann wieder reden hörte, tat sie das wohl schon eine ganze Weile, und da merkte ich, gleich würde sich meine Kehle noch einmal zuschnüren. Und bevor das geschehen konnte, sagte ich kaum hörbar, dass ich ja bei Tante Encarnació leben wollte und wann sie mich denn holen kämen. Am Montag gehen sie zum Markt, und Vater und Maria werden dich dorthin begleiten.
Meine Mutter war eine Frau, die nur zwei Dinge kannte: arbeiten und sparen. Maria erzählte, dass sie bei der Geburt von Pere, unserem jüngsten Bruder, beinahe gestorben wäre. Das war ein Montag, doch schon am Freitag, wo noch nicht einmal eine Woche vergangen war, konnte keiner sie mehr dazu bringen, im Bett zu bleiben. Mit meinen dreizehn Jahren erinnerte ich mich nicht daran, jemals gesehen zu haben, dass sie auch nur einen Augenblick lang die Hände in den Schoß gelegt hätte, außer am Sonntag, in der Messe, wo sie auf der Bank vor mir saß.
Wenn wir morgens aufstanden, war sie schon eine ganze Weile bei der Hausarbeit oder mit dem Vater und Josep auf den Wiesen. Und wenn wir abends zum Schlafen hinaufgingen, nutzte sie die Zeit, um aufzuräumen oder um das Essen für den nächsten Tag vorzubereiten. Und manchmal, weil sie daran gewöhnt war, als Letzte von uns ins Bett zu gehen, nahm sie noch den Rosenkranz zur Hand. Doch so fromm sie auch war, ich bin mir sicher, dass sie noch nicht einmal bis zum zweiten Vaterunser kam, denn bestimmt hatte sie bis dahin längst der Schlaf überwältigt, so wie einen kleinen Vogel, der reglos in der Falle sitzt.
Natürlich liebte sie uns alle, aber das zeigte sie so gut wie nie. Für solche Sachen habe sie keine Zeit, sagte sie, wo es doch so viel Wichtigeres für sie zu tun gebe. Mußestunden kannte sie nicht, denn sie war davon überzeugt, dass ihr so etwas nicht zustand, und als sie ihr im Alter schließlich doch zukamen, zerrannen sie ihr Tag für Tag zwischen den Händen. Ich glaube, sie wollte lieber sterben, als sich zu Lebzeiten auszuruhen.
Und Arbeit gab es ja auch genug: das Vieh, das Land und mindestens sieben bis acht Leute um den Tisch. Alle halfen wir mit, aber Mutter legte sich am meisten ins Zeug, damit wir vorankamen. Die Frau ist die Seele des Hauses, sagte sie.
Vater war umgänglicher, manchmal sagte er allerdings grobe Worte zu uns, solche, die einem etwas wehtaten, wenn man später noch mal in Ruhe darüber nachdachte. Doch dann war er oft auch sehr lieb, setzte uns auf seine Knie und erzählte uns eine Geschichte, besonders im Winter, wenn wir alle am Feuer saßen, nach dem Abendessen, das zumeist aus Kohl und Kartoffeln bestand und manchmal auch aus einer Scheibe gebratenem Speck. Ich erinnere mich noch, wie sehr wir über die Geschichte von dem Alten aus Montenar lachen mussten, der eines Nachts aus einem Haus eine Unterhose hatte mitgehen lassen. Die lag in der Nähe des Kaminfeuers zum Trocknen über einer Bank, und auf die setzte sich der Mann, weil er sich aufwärmen wollte, und als er dann wieder aufstand, blieb die Unterhose an seinen Kleidern hängen. Erst auf halbem Weg nach Hause, inmitten dieser eiskalten Nacht, entdeckte er plötzlich, wie sie unter seiner Jacke hervorlugte und um sein Hinterteil schlotterte. Ganz erschrocken blieb er da stehen, denn er wusste nicht, was schlimmer war, für einen Dieb gehalten zu werden oder in der eisigen Kälte wie ein Vogel zu erstarren, wenn er den ganzen Weg noch einmal zurückgehen müsste.
Doch auf einem Hof sind es gewöhnlich nicht die Männer, die am schlechtesten dran sind, und während Vater uns mit seinen Geschichten verzauberte, stopfte Mutter im Schein des Feuers noch ein paar Strümpfe, die immer wieder an derselben Stelle Löcher bekamen.
Die Tante war stolz und selbstsicher, dabei ebenso sparsam und fleißig wie die Mutter. Sie hatte aber ein recht aufbrausendes Wesen und war es gewohnt, alles zu bestimmen, konnte sie doch in ihrem eigenen Haus auch ganz nach Belieben schalten und walten.
Wie ich mich so hinter dem Maultier herstolpern sah, fast im Laufschritt, denn das Tier witterte jemand Fremdes und wollte immer wieder Reißaus nehmen, da hätte ich am liebsten kehrtgemacht, die Beine unter den Arm genommen und ab nach Hause. Meine Augen füllten sich mit Tränen, aber mehr ließ ich nicht zu, und als ich merkte, dass ich gleich weinen würde, atmete ich tief durch und schluckte die Tränen hinunter. Die aufrechte Gestalt des Onkels dort oben auf dem Maultier schüchterte mich ein. Nicht einen Seufzer sollte er aus meinem Mund hören. Immer wieder sagte ich mir, dass sie mir ja einen Gefallen taten, und ich half meinen Leuten daheim. Bei jeder Mahlzeit ein Stück Brot weniger und … Der Onkel hatte mir mein Bündel abgenommen und es vor sich auf den Hals des Tieres gelegt. Irgendetwas schien ihn zu beschäftigen, und bislang hatte er kaum ein Wort an mich gerichtet. Deshalb traute ich mich auch nicht, ihm zu sagen, dass ich mir in meinen Leinenschuhen die Füße wundgelaufen hatte. Die Schuhe waren fast neu und eigentlich gehörten sie Maria. Sie hatte sie mir geschenkt, als ich von daheim fortging, weil sie mir eine Freude machen wollte, doch ihre Schuhe waren mir zu groß. Ich spürte, wie sie an meinen Füßen scheuerten, das war ein unglaublich schmerzhaftes Brennen. So schnell wie möglich wollte ich in Pallarès ankommen, damit diese Qual endlich ein Ende hätte. Der Schwanz des Maultiers schaukelte im Takt hin und her. Sobald sich Fliegen darauf setzten, warf es den Schwanz in die Höhe, wirbelte ihn einmal herum und ließ ihn dann wieder fallen, und so ging es in einem fort. Als ich schon nicht mehr daran glauben mochte, dass wir jemals ankommen würden, hörte ich den Onkel sagen: Wir sind da. Zum ersten Mal an diesem Tag stieg eine große Freude in mir auf, und daran merkte ich, wie schwer mir die ganze Zeit ums Herz gewesen war. Wie töricht von mir, als ob sie mich zum Markt gebracht hätten, um mich dort wie eine von den Kühen zu verkaufen. Aber das war es ja gar nicht. Ich wollte so gerne die Tante umarmen, die nicht mit nach Montsent zum Markt gekommen war. Sie war Mutters Schwester, und mit dem Onkel hatte ich doch nichts zu schaffen.
Ich weiß nicht, warum ich dachte, sie würden außerhalb der Ortschaft leben. Dass ich mich geirrt hatte, merkte ich, als der Onkel zwischen den Häusern einen Weg einschlug, der geradewegs zum Dorfplatz führte. Ich spürte, wie meine Wangen glühten, als die Leute den Onkel grüßten und mich dabei anstarrten. Schließlich blieben wir vor meinem neuen Zuhause stehen, und der Onkel stieg vom Maultier ab. Die Frauen, die inmitten einer Schar schreiender Kinder einen Schwatz gehalten hatten, hörten mit einem Mal auf zu reden, und alle kamen sie näher, um mich zu mustern und den Onkel auszufragen.
Ramon, was für ein hübsches Mädchen hast du denn da vom Markt mitgebracht. Wir hätten nicht gedacht, dass du so einen guten Geschmack hast … Das ist die Nichte aus Ermita, die wird den Winter bei uns verbringen.
Ich wusste nicht, wohin ich schauen sollte. Alle Augen waren auf mich gerichtet, und wie ich so still dastand, spürte ich, dass ich mich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Der Schweiß hatte mir die Oberschenkel wundgescheuert, und im Kopf war mir ganz schwindelig vor lauter Nachdenken und weil sich alle Gedanken im Kreis drehten. Da kam mir die Tante zu Hilfe. Sie schob die Neugierigen einfach beiseite und nahm mich ganz fest in ihre Arme. Und am Ende brach ich doch in Tränen aus, denn diese liebevolle Geste hatte die ganze Mauer aus Überlegungen, die ich gegen die Traurigkeit errichtet hatte, in einem einzigen, unerwarteten Augenblick zum Einsturz gebracht. Die Tante fasste mich um die Taille und hob mich dabei fast vom Boden hoch, wich den Leuten aus und brachte mich die Treppe hinauf ins Haus.
Erst in der Küche sagte sie etwas zu mir. Wir waren durch einen langen und dunklen Flur gegangen, und als ich dann auf der Bank saß, hörte ich sie fragen: Warum weinst du denn?
Das Haus von Onkel und Tante war sehr groß, fast so groß wie das der Eltern in Ermita. Früher war es dort sicher sehr lebhaft zugegangen, und bestimmt hatten einmal viele Menschen in diesem Haus gewohnt, denn außer dem Erdgeschoss gab es noch zwei Stockwerke und unter dem Dach einen Speicher.
Der Stall und die Tenne nahmen den gesamten unteren Teil des Hauses ein, das unmittelbar an den Dorfplatz grenzte, und auf den konnte man durch ein großes Tor gelangen. Seitlich davon führte eine Außentreppe hoch in den ersten Stock, der aber bloß aus einer kleinen Diele bestand, und von dort aus ging gleich wieder eine Treppe ins nächste Stockwerk. Auf der rechten Seite der Diele zweigte dann noch ein erst breiter und dann schmaler werdender Gang ab, der zu einem verschlossenen Zimmer führte und zu einem großen, offenen Raum, in dem vor allem die Feuerstelle auf dem Boden mit ihrem rußgeschwärzten Kamin ins Auge fiel, daneben ein kleiner Spülstein und dann noch ein langer Tisch mit einer Bank auf jeder Seite. Von diesem Raum aus konnte man in den Vorratskeller hinuntergehen, der einen winzigen Teil des Kuhstalls in Beschlag nahm. In dem verschlossenen Zimmer befand sich die gute Stube, die aber nur zu besonders festlichen Gelegenheiten benutzt wurde.
Hinter dem Raum, der als Küche diente und in dem auch gegessen wurde, lag der Heuschober. Er hatte Bodenklappen, durch die man das Heu gleich in die Futtertröge für das Vieh fallen lassen konnte. Besser, man wusste ganz genau, wo sich diese Fallklappen befanden, denn du konntest schon einen gehörigen Schreck bekommen, wenn du plötzlich mit einem Bein weggesackt bist, manchmal fast bis auf die Kopfhöhe einer Kuh. Neben dem Heuschober gab es einen Käfig, der sah aus wie ein richtiges kleines Haus. Das war der Kaninchenstall. Ein halbes Dutzend kleiner Kaninchen sprang dort herum und das Muttertier, sie hatten jede Menge Platz. Wenn ich ihnen ihr Futter brachte, musste ich nur ein wenig den Kopf einziehen, denn drinnen konnte ich fast aufrecht stehen.
Im zweiten Stock befanden sich vier Schlafzimmer, jedes mit einem großen Eisenbett und einer Schüssel samt Krug als Waschgelegenheit. In den beiden größeren gab es außer einem Fenster noch einen kleinen Schrank mit Regalen, der direkt in die Wand eingelassen war. Von diesem zweiten Stockwerk führte eine Stiege hoch zum Speicher, auf dem etwas geschah, das mich stets aufs Neue in Erstaunen versetzte. Man befand sich dort zwar an der höchsten Stelle im ganzen Haus, doch der Fluss schien zum Greifen nah zu sein. Es gab ein kleines Fenster, ziemlich hoch, und wenn man sich hinauslehnte, hörte man das Rauschen des Wassers und konnte meinen, man stünde daneben, in Wirklichkeit aber war da ein schrecklich tiefer Abgrund.
Vom ersten Tag an war der Speicher einer meiner Lieblingsplätze im ganzen Haus. Getreidesiebe lagen dort herum, Körbe, ein paar Werkzeuge, und eines Tages entdeckte ich sogar eine Truhe mit Kleidern aus der Zeit, als die Tante noch jung war, aber vielleicht waren die Sachen ja noch älter und stammten aus der Familie des Onkels. Sie waren verknittert und abgetragen, doch wenn ich etwas vom Speicher holen sollte, konnte ich einfach nicht widerstehen und öffnete jedes Mal die Truhe und zog über meine Schürze eines dieser Kleider, die mich von fernen Zeiten träumen ließen. Manchmal war ich in Versuchung, der Tante davon zu erzählen, vielleicht würde sie mir ja eines umändern, aber ich traute mich nicht, denn dann käme ja heraus, dass ich meine Nase in Dinge gesteckt hatte, die mich nichts angingen, und schon allein der Gedanke daran ließ mich rot werden.