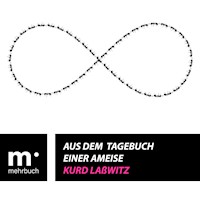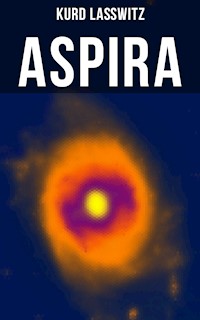Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mehrbuch
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Wirklichkeiten? Gibt es denn mehr als diese eine, in der wir leben? Aber wenn nun gerade erst in unserem Leben diese Wirklichkeiten zu finden wären nicht wir in der Wirklichkeit, sondern Wirklichkeiten in uns?Wirklichkeiten das soll hier heißen: Bedingungen, die wirksam sind, Bestimmungen, auf denen es beruht, daß die umfassende Macht des denkenden, wollenden, fühlenden Menschengeistes so sein muß, wie sie ist, und doch anders will und dichtet. Es sind Gebiete der Realität, die unser Leben schaffen, tragen, ordnen und verwirren. Sie müssen wir aufsuchen, trennen, in ihrem Wirklichkeitswerte auseinanderhalten, um uns selbst wiederzufinden in ihrer Einheit, unser Leben in der Idee der Menschheit zu begreifen, in einer Kultur, die sich als Selbstzweck versteht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 635
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wirklichkeiten
Kurd Lasswitz
Vorwort zur ersten Auflage
Wirklichkeiten? Gibt es denn mehr als diese eine, darin wir leben? Aber wenn nun gerade erst in unserem Leben diese Wirklichkeiten zu finden wären – nicht wir in der Wirklichkeit, sondern Wirklichkeiten in uns?
Wirklichkeiten – das soll hier heißen: Bedingungen, die wirksam sind, Bestimmungen, auf denen es beruht, daß die umfassende Macht des denkenden, wollenden, fühlenden Menschengeistes so sein muß, wie sie ist, und doch anders will und dichtet. Es sind Gebiete der Realität, die unser Leben schaffen, tragen, ordnen und – verwirren. Sie müssen wir aufsuchen, trennen, in ihrem Wirklichkeitswerte auseinanderhalten, um uns selbst wiederzufinden in ihrer Einheit, unser Leben in der Idee der Menschheit zu begreifen, in einer Kultur, die sich als Selbstzweck versteht.
Diese Einigung in der Menschheitsidee durch Trennung der wirkenden Gesetze hat der deutsche Geist am Ende des achtzehnten Jahrhunderts vollzogen; am Ende des neunzehnten haben wir keinen Lebenden, dessen schöpferischer Genius den kritischen Gedanken zur richtunggebenden Macht zu prägen verstünde. Mit Aphorismen und geistreichen Gedankenspielen ist es nicht getan; auch nicht mit der autoritativen Fesselung der Gemüter. Die Freiheit der menschlichen Vernunft ist nur zu begreifen und zu stützen durch systematischen Gang des Denkens; auf das eigene Denken müssen wir vertrauen. So versuchen wir, soviel ein jeder vermag, uns selbst zu sammeln und, was wir von unsern Vätern ererbt haben, zu erwerben, um es in der fast unübersehbar gesteigerten Stoffmenge der letzten hundert Jahre wiederzuerkennen und zu besitzen.
Einen solchen Beitrag zum Weltverständnis aus einer kritischen Weltauffassung heraus möchten die »Wirklichkeiten« liefern. Mit dem Streben nach Allgemeinverständlichkeit sind hier Ergebnisse langjähriger wissenschaftlicher Arbeit literarisch zusammengestellt, wie sie sich mir als eine persönliche Lebensansicht gestaltet haben.
Die ersten drei Aufsätze geben eine allgemeine historische Einleitung und gegen Ende des dritten einen kurzen Überblick der Weltanschauung, die das Buch näher begründen will. Diese entwickle ich im Zusammenhange bis zum zwanzigsten Abschnitt. Die letzten Aufsätze enthalten in freierer Anknüpfung weitere Ausführungen einiger Themata, die wie ich hoffe, zur Erläuterung der berührten Fragen nicht unwillkommen sein werden; man wird ihnen daher vielleicht nachsehen, daß ihre Schreibart mehr feuilletonistisch gehalten ist; es erschien mir kein Fehler, wenn dieselben Grundgedanken unter verschiedener Beleuchtung gezeigt werden. Den Artikel über unsere Träume habe ich aufgenommen, weil mir die darin enthaltenen Selbstbeobachtungen nicht ohne psychologisches Interesse schienen.
Die Anmerkungen am Schlusse des Buches berichten über diejenigen meiner bisherigen Veröffentlichungen, die m das vorliegende Buch hineingearbeitet sind, und machen die Teile kenntlich, deren Inhalt bis jetzt noch nicht gedruckt vorlag.
Gotha, im November 1899 Kurd Laßwitz
Vorwort zur vierten Auflage
Da die im März 1908 erschienene dritte Auflage der »Wirklichkeiten« vor Ende des Krieges vergriffen war, die Nachfrage danach aber rege blieb, hat sich die Verlagsbuchhandlung jetzt zur Herausgabe einer vierten Auflage entschlossen.
In der dritten Auflage, die eine Reihe kleinerer Zusätze enthielt, hatte der Verfasser in der Vorrede auf die Ergänzung seiner Ausführungen, durch das zu gleicher Zeit unter dem Titel: » Seelen und Ziele« erscheinende Buch hinweisen können; in der vierten Auflage kann er keinerlei Veränderungen an ihnen vornehmen, so sehr Zeit, Verhältnisse und Anschauungen sich gewandelt haben, da er seit Oktober 1910 nicht mehr unter den Lebenden weilt.
Das Buch in einer unveränderten, von Fehlern freien Ausgabe wieder den Lesern zu übergeben, betrachtet daher die Unterzeichnete als ihre alleinige Aufgabe.
Gotha, im Juni 1920 Jenny Laßwitz
I.Die Entdeckung des Gesetzes
Wann es war, weiß ich nicht mehr genau, aber ich war bereits so alt, daß ich das Einmaleins ganz gut auswendig wußte, und doch noch ein so kleiner Junge, daß ich mich sehr über die Tüte voll Zuckerplätzchen freute, die ich geschenkt bekommen hatte. Wie viele ich schon davon verspeist hatte, weiß ich nicht mehr, aber an den entschwundenen Genuß knüpfte sich etwas anderes, das ich nicht vergessen habe, weil es mir einen unauslöschlichen Eindruck machte, obwohl es etwas durchaus Selbstverständliches war. Ich kam nämlich auf den nicht fern liegenden Gedanken, nachzusehen, wie viel Plätzchen ich noch übrig habe, und zu diesem Zwecke ließ ich sie auf dem Tische in wohlgeordneten Reihen aufmarschieren, bis sie ein richtiges Rechteck bildeten. Und nun fing ich an zu zählen und war schon bis in die Zwanzig gekommen; da ging jemand am Tische vorüber, warf einen Blick auf meine Schlachtordnung und sagte: »Du hast ja vierzig Stück?« Ich fragte erstaunt: »Wie kannst du so schnell zählen?« »Nun, es sind doch in jeder Reihe fünf, nun zähle ich bloß die Reihen, sind acht, und fünf mal acht gibt vierzig.« Dies imponierte mir ungeheuer, ich traute aber doch nicht recht und zählte weiter; es waren wirklich vierzig. Ich wunderte mich und fragte: »Woher kommt denn das?« Da mir aber niemand mehr Antwort gab, so spielte ich weiter, nahm aus jeder Reihe ein Plätzchen fort und bildete daraus zwei neue Reihen. Nun waren doch bloß noch vier in jeder Reihe, und ich konnte mir nicht vorstellen, wie die Rechnung wieder stimmen könne; aber wahrhaftig, ich zählte jetzt zehn Reihen, und vier mal zehn ist vierzig; das wußte ich. Ich begann je sechs in eine Reihe zu legen, da bekam ich sechs Reihen und behielt vier Stück übrig, die ich passenderweise in den Mund steckte. Nun konnte es doch nicht stimmen? Sechs mal sechs gibt 36; ich zählte nach, und es stimmte wieder! In diesem Augenblicke ging es mir wie eine Offenbarung auf, das unbestimmte Gefühl, daß hier ein wunderbares Geheimnis läge. In diesen Plätzchen – und ich begriff wohl, daß die Operation mit irgend welchen andern Gegenständen auch gelingen würde – steckte eine Macht, der ich nichts anhaben konnte; wie ich die Dinge auch legte, wieviel ich auch fortnahm, sie gehorchten dem Einmaleins. Und was hatte doch das Einmaleins, das so langweilig in meinem Rechenbuche stand, mit den Zuckerplätzchen zu tun? Was konnten sie davon wissen? Ich stellte die Gruppen zusammen, wie ich wollte, und ich rechnete dann in meinem Kopfe, und was ich rechnete, das erwies sich als erfüllt in der Wirklichkeit. Zum ersten Male in meinem Leben war mir das Wesen des mathematischen Gesetzes zum Bewußtsein gekommen. Dies ist mir unvergeßlich; und noch oft hat mich dasselbe Gefühl beschlichen, als ich die Methoden der Algebra und Analysis kennen lernte und sah, wie die verschiedensten Arten, die Rechnung anzuordnen, doch zu demselben Resultate führten. Es ist ein Gefühl der Bewunderung, das uns gefangen nimmt, so oft wir erfahren, wie die Wirklichkeit einem logischen Gedankengebäude sich fügt, sobald wir erkennen, daß die objektive Realität in den Dingen dem Gesetze des Denkens gehorcht.
Was damals dem Kinde als eine erste dunkle Ahnung aufblitzte, war nichts anderes als die Erkenntnis, daß es etwas gibt, was Wissenschaft heißt. Eines der schönsten Gesetze, daß die Decendenztheorie entdeckt und bestätigt hat, ist das sogenannte phylogenetische Grundgesetz: Die biologische Entwickelung des einzelnen Organismus stellt eine abgekürzte Form des Entwickelungsprozesses vor, den die ganze Reihe seiner Vorfahren durchlaufen hat. Dies Gesetz gilt auch auf geistigem Gebiete. In der psychologischen Entwickelung der Kindesseele, in den Vorstellungen, die sich der einzelne über die Welt macht, bis er zur reifen Erkenntnis, zum wissenschaftlichen Denken durchdringt, finden sich die Spuren des Weges wieder, auf dem die Menschheit zur Kultur empor geschritten ist. Und wenn wir, zurückgreifend in der Geschichte des Denkens, uns fragen, wann und wo zum ersten Male der Begriff des mathematischen Gesetzes dem menschlichen Geiste als eine objektive Macht zum Bewußtsein kam, so scheint auch hier die Ordnung der Zahlen den Anstoß gegeben zu haben, so finden wir dies Bewußtsein bei Pythagoras, wenn er sagte, daß die Zahl das Wesen der Dinge sei. Die merkwürdige Beziehung der Seitenlängen im rechtwinkeligen Dreieck, die bei allen Dreiecken stimmte, man mochte sie sonst zeichnen wie man wollte – das Quadrat der Hypotenuse war immer gleich der Summe der Quadrate über den Katheten –, ferner die wunderbare Abhängigkeit der Konsonanz der tönenden Saiten von ihrer Länge und anderes mehr erweckte das Staunen und die Ahnung, daß in diesen Gesetzen das eigentliche Weltgeheimnis verborgen liege.
Dem Geiste der Hellenen erschloß sich dieses Geheimnis zum ersten Male; sie entdeckten die besondere Art der Realität, die, anders als alles sinnliche Fühlen und Empfinden, in dem objektiven Wert der Erkenntnis liegt. Und der Mann, bei welchem am schärfsten der Gedanke zum Durchbruch kam, daß die Realität der Dinge an ihre mathematische Gesetzlichkeit geknüpft sei, das war der große Schüler des Sokrates, es war Platon. Mit diesem Gedanken ward er der Begründer der Wissenschaft überhaupt: nicht der Wissenschaft, insofern sie die Sammlung und Sichtung des Erfahrungsstoffes allein zum Ziel hat, sondern insofern sie sich bewußt ist, in ihren Resultaten ein Objekt zu besitzen, dessen Erkenntniswert tiefer begründet ist als das Geltungsbereich der sinnlichen Mittel, durch die es gewonnen wird.
Was ist dies Eigenartige, wodurch Wissenschaft sich von andern Betätigungsgebieten des Bewußtseins unterscheidet? Wir finden uns in einem bunten Wechsel von Farben und Geräuschen, von Widerständen und Temperaturen, von Gefühlen und Strebungen. Einiges ist flüchtig wie der Hauch des Windes, wie der Blitz des Auges; anderes weilt länger, wie die feste Erde unter den Füßen. Aber dauernd bleibt nichts von dem, was wir wahrnehmen und erleben, unwiderruflich flieht die Zeit, und wir selbst vergehen in ihrem Strome. Wo ist der ruhende Pol in der Erscheinungen Flucht? Wo ist die Macht, die Ordnung schafft und Dauer verleiht? Wo ist das zu suchen, was wir Realität nennen?
Dieses Marmorstück ist weiß, schwer, hart, kalt; das nehme ich wahr. Aber sind es diese Eigenschaften, die den Stein zum Gegenstand machen, der dauert? Die Sonne bescheint ihn, und er ist warm; die Nacht umhüllt ihn, und er ist nicht mehr weiß. Ich finde dieselben Eigenschaften an anderen Körpern, ich kann sie mir zum Teil fortdenken von dem Körper, und er hört nicht auf Körper zu sein. Die sinnlichen Eigenschaften sind es also wohl nicht, in denen die Realität wurzelt? Vielleicht gehören sie dazu, aber sie sind es jedenfalls nicht allein. Und soviel ist sicher, die Ordnung, in welcher sie zusammen vorkommen, die Folge, in der sie wechseln, ist so mannigfach, so kompliziert, so unübersehbar, daß sie für den ersten Versuch des menschlichen Geistes, Gesetze zu entdecken, nicht als die Realität gelten kann, darin das gesetzliche Sein der Dinge begründet ist.
Aber es gibt etwas anderes in den Körpern, das nicht mehr sinnlich ist, das ist Gestalt und Zahl. Der Würfel behält sechs Flächen und acht Ecken, ob er aus Marmor oder Holz bestehe; die Winkelsumme im Viereck bleibt gleich vier Rechten, mag das Viereck auf die Wachstafel oder in den Sand gezeichnet sein; drei mal vier bleiben zwölf, ob du Menschen zählst oder Muscheln. Hier ist eine Wirklichkeit, Ordnung des Raumes und der Zahl, die nicht von den sinnlichen Eigenschaften berührt wird. Hier ist ein Beispiel für eine Ordnung, die für alle Körper allgemeingültig und notwendig ist. Hier ist etwas Neues, ein Gedanke im Menschengeist und doch eine reale Bestimmung in den Dingen, und dieses Neue, daraus die Herrschermacht der Wissenschaft entsproß, ist das Gesetz.
Eine neue Art des Seins hatte der griechische Geist entdeckt, als Arithmetik und Geometrie von ihm geschaffen und als Wissenschaft erkannt wurden – die erste reife Frucht gezogen aus der zählenden und messenden Erfahrung östlicher und südlicher Völkerschaften. Eine neue Art des Seins, die den sinnlich wahrnehmbaren Körpern nicht zukommt, und sie doch beherrscht; also ein Gesetz der Körper; und die ebenso das Denken über die Körper beherrscht; also ein Gesetz des Geistes, ein Begriff. Und so ward die Mathematik das Weckmittel der Erkenntnis; das mathematische Gesetz ergab sich als ein Gesetz, das Sein und Denken zugleich beherrscht; es vertrat die im Grunde der Dinge waltende Macht, welche die Bedingung ihrer Realität ist. »Die Gottheit verfährt stets mathematisch«, damit drückte Platon den Grundgedanken aus, auf dem sich das Gebäude der Wissenschaft erhob; und darum schrieb er über seinen Lehrsaal: »Ohne mathematische Vorbildung trete keiner in meine Halle!«
Der unmittelbaren Wahrnehmung gilt nur das als wirklich, was ihr sinnlich entgegentritt; und ein Zeichen von Wirklichkeit ist dies auch, aber kein sicheres. Dem ermattenden Wüstenwanderer erglänzt die spiegelnde Wasserfläche in der Ferne, gaukelt das Luftbild die rettende Oase vor; aber dem Nahenden schwindet es in nichts. Die sinnlichen Eigenschaften wirren sich in unergründlichem Wechselreichtum durcheinander, und was eben die Sicherheit der Existenz zu verbürgen schien, löst sich in neue, unerwartete Erscheinung auf. Wo blieb es? So erscheint das Sinnliche als das Vergängliche, Unklare, Unwirkliche. Die mathematischen Formen dagegen, Figur und Zahl, sie beharren im Wechsel, sie lassen sich klar erfassen im Denken; so sind sie das Sichere, das Ewige, das Reale. Sie sind das objektive Gesetz, wonach der Kosmos als Ordnung sich konstruieren läßt, sie verbürgen die Realität Seienden durch die Begründung der Gewißheit in dauernden Gedanken.
Wie weit die Erkenntnis vordringt und es ihr gelingt, das Geschehene im mathematischen Gesetz zu fixieren, soweit waltet Allgemeingültigkeit und Notwendigkeit, soweit beherrscht das Bewußtsein die Gegenstände. Die sinnliche Erfahrung ist zwar das Mittel, wodurch die Gesetze des Wirklichen allmählich aufgefunden werden, aber die Gültigkeit dieser Gesetze, die an der Erfahrung sich erprobt, wird ihnen nicht durch die Erfahrung verliehen; sie hat ihren Ursprung in etwas, das der Erfahrung selbst zu gründe liegt, das sie erst möglich macht, weil es die gemeinsame Bestimmung dafür ist, daß Gegenstände sind und daß sie als solche erkannt werden. Diese Bedingung der Erfahrung ist die Gesetzlichkeit, die der Philosoph das »Apriori« nennt. Dies soll nicht heißen, daß die Gesetze dem einzelnen vor der Erfahrung bekannt sind; wir erkennen sie erst im Verlaufe der Erfahrung. Die Menschen zählen und rechnen und finden sich im Räume zurecht, ohne etwas von den Grundsätzen der Arithmetik oder Geometrie zu wissen, so gut wie sie atmen und verdauen, ohne die physiologischen Gesetze des Stoffwechsels studiert zu haben. Aber indem sie rechnen und sich bewegen, werden sie sich allmählich bewußt, daß in ihrem Erlebnis gewisse gesetzliche Bestimmungen vorhanden sind. Es wäre nicht möglich, daß die Erfahrung überhaupt als eine feste Ordnung der Erscheinungen zustande kommt, wenn es nicht Bestimmungen gäbe, die nicht von ihr, sondern von denen sie selbst abhängig ist. Und diese Bedingungen müssen derart sein, daß in ihnen die Übereinstimmung der Dinge mit unsern Vorstellungen von den Dingen begründet ist. Die Wirklichkeit der Dinge muß auf denselben Gesetzen beruhen, auf denen es beruht, daß wir gerade diese und keine anderen Vorstellungen von den Dingen uns machen können. Daß dieses Weiße, Harte, Schwere eine Einheit bildet, und daß sie als solche unter dem Begriff Marmor gedacht werden muß, ist ein und dieselbe Bestimmung. Das ist der Sinn des »Apriori«: Es gibt Bestimmungen, unter denen die Bildung gewisser Einheiten sich auf solche Weise vollzieht, daß ihre reale Wirklichkeit als Objekte zugleich als eine subjektive Realität im Bewußtsein auftritt. Das Ergebnis dieser Bildung ist die Erfahrung. Stellen wir uns auf den Standpunkt der Objekte, so können wir sagen, unsere Vorstellungen sind abhängig von den Gegenständen; stellen wir uns auf den Standpunkt der Subjekte, so können wir auch sagen, die Gegenstände sind abhängig von der Art, wie wir sie vorstellen. Falsch ist weder das eine noch das andere, aber beide Behauptungen, die realistische und die idealistische, sind nicht ganz vollständig. Es ist zwischen objektiv und subjektiv nicht ein Verhältnis wie zwischen Ursache und Wirkung, sondern eher wie zwischen Stoff und Form, zwischen Mannigfaltigkeit und Einheit; es ist nicht eins vom andern bedingt, sondern jedes ist zugleich mit dem anderen gesetzt.
Das ist nun die Voraussetzung, wenn überhaupt Wissenschaft möglich sein soll, daß es eine solche Realität gibt, welche die Übereinstimmung des Denkens mit dem Sein verbürgt. Und das mathematische Gesetz war das erste Beispiel in der Geschichte der menschlichen Erkenntnis, woran man sich überzeugen konnte, daß das Schwanken der sinnlichen Erscheinung von Bestimmungen a priori beherrscht wird, die wir zu erkennen vermögen. Deshalb darf man Platon, soweit nicht schon Sokrates das Vorrecht gebührt, als den Vater der Wissenschaft bezeichnen. Er entdeckte das Recht der wissenschaftlichen Erkenntnis; sie ist ein Verfahren, Realitäten zu erzeugen. Aus dem unbestimmten Erlebnis des einzelnen, aus dem Kampf entgegengesetzter Vorstellungen, aus der Unklarheit widerspruchsvoller Gefühle und wechselnder Stimmungen und Triebe hebt sie heraus ein Gebiet des Gesetzes, schafft sie eine neue Welt, worin nichts gilt, als was sich widerspruchslos zusammenfügt.
Die moderne Naturwissenschaft beruht auf dem Verfahren, den Wechsel der Erscheinungen darzustellen und zu festigen im mathematischen Gesetz. Was wir heute unter Naturnotwendigkeit verstehen, das ist nichts anderes als der Zwang des widerspruchslosen Denkens, der uns nur das als Wirklichkeit anerkennen läßt, was in der Form des allgemeingültigen Gesetzes beschrieben werden kann. Unerschöpflich führen die Sinne neuen Stoff unserm Bewußtsein zu, und ebenso unermüdlich ist die Wissenschaft an der Arbeit, ihn in die Form des Gesetzes einzuordnen und damit den realen Inhalt des Naturgeschehens zu ermitteln. Das ist eine unendliche Aufgabe. Nenn der Inhalt des einzelnen Gesetzes erfordert eine fortwährende Umgestaltung unter dem Einfluß der sich erweiternden Erfahrung; bleibend ist nur der Charakter des Gesetzes, jeden Widerspruch von sich auszuschließen, indem seine Gestalt neuen Erfahrungen sich anpaßt. Die Erde war solange der Mittelpunkt der Welt, als die astronomischen Beobachtungen sich mathematisch durch das Ptolemäische Weltsystem darstellen ließen; als sich Widersprüche zeigten, mußte es dem Coppernikanischen weichen. Die Gewißheit der mathematischen Berechnung hat sich dabei nicht geändert; sondern nur die Voraussetzungen, von denen sie ausgeht, sind andere geworden und haben eine andere Gestalt der mathematischen Darstellung erfordert.
Auch jener Grundgedanke der Naturwissenschaft, die Wirklichkeit der Erscheinungen im mathematischen Gesetz zu sichern, geht auf Platon zurück; und die Entstehung der mathematischen Naturwissenschaft ist in der Tat ein Lebendigwerden platonischer Gedanken. Der machtvolle geistige Umschwung, den wir als Renaissance bezeichnen, ist zugleich die Erneuerung der platonischen Philosophie. Und die bahnbrechenden Denker, die im Beginn des 17. Jahrhunderts die Naturwissenschaft schufen, Galilei und Kepler, fanden ihre Stütze in dem platonischen Gedanken, daß die Realität der Natur in ihrer mathematischen Ordnung zu suchen sei. In diesem Sinne sagt Kepler, daß der Mensch nichts richtiger erkenne als die Größe selbst, und Galilei, daß die Philosophie im Buche des Universums geschrieben stehe in mathematischer Sprache, deren Zeichen Dreiecke, Kreise und andere geometrische Figuren seien. Warum aber, so wird man fragen, mußten zwei Jahrtausende vergehen, seit Sokrates den Giftbecher trank, bis der Scheiterhaufen auf dem Campo dei Fiori um Giordano Bruno flammte, ehe jene Naturwissenschaft entstand, deren Prinzip Platon so deutlich bezeichnet hatte? Dies erstaunliche Problem bis in seine innersten Tiefen zu Verfolgen, das hieße die gesamte Geschichte der Menschheit von Jahrtausenden aufwühlen. Denn im letzten Grunde sind zwar Begriffe und Ideen das Bestimmende in der Entwicklung der Kultur (vgl. Abschnitt XXII), aber die Mittel, wodurch sie in den Trieben und Interessen der einzelnen und der Völker wirken, sind so verwickelt, daß sie schwer, wenn überhaupt, zu durchschauen sind.
Die Erforschung der Natur setzt ein unmittelbares Interesse an der technischen Beherrschung der Natur voraus, denn nur durch dieses spitzen sich die Probleme zu, und das ungeheure Material praktischer Erfahrung wird herangeführt. Technische Probleme waren es auch, welche den äußeren Anstoß zur wissenschaftlichen Untersuchung gaben. Man denke nur an die Bedürfnisse der Baukunst, der Kriegsführung, der Schiffahrt, der Heilkunde. Wer vermag nun zu sagen, inwieweit der Mangel an naturwissenschaftlichem Interesse durch die soziale Entwickelung der Menschheit bedingt war? So lange eine kleine Anzahl von Herren durch die Arbeit der Sklaven ihre Muße gesichert sah, mochte wohl in den Spitzen der Menschheit eine hohe intellektuelle Kultur zur Blüte gelangen können. Aber für sie lag nicht das Bedürfnis vor, die Kräfte der Natur in umfassender Weise in den Dienst der Arbeit zu stellen, die Natur in dem Maße zu beherrschen, daß durch die Erweiterung der Machtmittel der Menschheit immer weitere Kreise auf eine höhere Bildungsstufe gehoben werden konnten. Es liegt daher der Gedanke nahe, daß für die Kultur der europäischen Menschheit erst jene höhere sittliche Aufgabe zu lösen war, die Gleichberechtigung der Menschen zum Bewußtsein zu bringen, wie sie in der Grundidee des Christentums enthalten ist. Nicht die Unterschiede der Macht, des Besitzes, der Bildung, der Abstammung, der Nationalität sind es, die den Wert des Menschen bestimmen, sondern allein die gute Gesinnung, die sittlich-religiöse Kraft der Persönlichkeit, der Glaube an die Liebe Gottes, vor dem alle gleich sind, die in seinen Wegen wandeln. Diese sittlich-religiöse Erziehung der Menschheit mußte erst zu einem gewissen Ziel kommen, ehe die intellektuelle Kultur aufs neue einsetzen konnte, um nunmehr unter dem Bewußtsein der Verpflichtung zur gemeinsamen Arbeit die Menschheit auf eine höhere Stufe zu heben. Gutenberg, Coppernikus, Columbus, Luther bezeichnen den Umschwung in den Mitteln der neuen Kultur; nun erst ward die Bevormundung des Geistes gebrochen und die Erde dem Menschen zum neuen Eigentum gegeben; und nun gelang es auch den Denkern, die Stelle zu finden, an der die Erscheinungen der Natur sich in mathematische Gesetze fassen ließen. Denn daran hatte es Platon gefehlt; daß die Natur nur mathematisch zu realisieren sei, hatte er gelehrt; aber wie und wo diese Anwendung der Mathematik anzusetzen hatte, das wußte er nicht; dazu mangelte seiner Zeit nicht nur die Fülle der Tatsachen, sondern auch vor allem das Interesse für diese Richtung der Kultur.
Was wir hier aus der tatsächlichen Entwickelung der abendländischen Kultur als den Plan der Erziehung des Menschengeschlechts mutmaßen, das läßt sich andererseits aus dem Gedankengange Platons erläutern, durch den der Begriff des »Apriori« sich ihm gestaltete. Es kam ihm darauf an, Realitäten aufzufinden, welche die Wirklichkeit der Dinge sicherer verbürgten als der oft täuschende Schein der sinnlichen Erfahrung. Als eine solche Realität hatte ich bisher nur das mathematische Gesetz genannt, weil es für die Möglichkeit der Naturwissenschaft entscheidend ist. Für Platon jedoch als den Schüler des Sokrates, war noch eine andere Realität die ursprünglichere und bestimmende, das war die Idee des Guten, d.h. die Frage nach dem Wesen der Tugend, die ethische Beurteilung. Und diese Realität, welche über die Wirklichkeit der Dinge entscheidet nach dem Werte, den sie in sittlicher Hinsicht als Vorbilder besitzen, sie war es, die für die nächsten zwei Jahrtausende das Interesse der Menschheit vor allem in Anspruch nahm.
Was gut ist, was schön, was vollkommen ist und als Muster gelten soll, das findet sich ja in seiner Reinheit nirgends in der Erfahrung, das ist vielmehr eine Förderung, die an die Erfahrung gestellt wird. Hier also ist ein solches Prinzip der Beurteilung, das der Erfahrung vorschreibt, wie sie sein soll, ein Apriori; Platon nennt es eine Idee, eine Bestimmung, die über dem vergänglichen Sein der sinnlichen Dinge steht. Die Realität der Dinge besteht in ihrer Anteilnahme an den Ideen; inwieweit sie der Idee der Vollkommenheit entsprechen, insoweit sind sie der flüchtigen und nichtigen Erscheinung entzogen und besitzen Dauer. Für den Hellenen aber besteht das Wesen der Vollkommenen, womit das Gute und das Schöne zusammenfällt, in dem harmonisch Maßvollen, in der richtigen Abmessung. Das Maß verbürgt die Zweckmäßigkeit. Insofern also werden die sinnlichen Dinge auf die Realität der Idee Anspruch erheben können, als in ihnen die Bedingung zweckvoller Abmessung erfüllt ist. Die Wissenschaft des Maßes aber ist die Mathematik. Darum sind es nach Platon die mathematischen Beziehungen in den Dingen, welche sie über die Vergänglichkeit der Sinne erheben und ihnen Realität verleihen. In der Gesetzmäßigkeit der Figuren und Zahlen sind die Dinge mit Sicherheit zu erkennen: daher sagt Platon, daß das Mathematische die Verbindung herstelle zwischen den sinnlichen Dingen und den Ideen.
Damit nun auf diesem Grundgedanken eine Wissenschaft von der Natur sich wirklich aufbaue, mußte man aber wissen, welches besondere Verhalten der sinnlichen Dinge so beschaffen sei, daß sich in ihm mathematische Gesetze auffinden ließen. Dieser Punkt wurde verfehlt. Es führte dabei irre, daß sowohl bei Platon selbst als in der ganzen nachfolgenden Zeit das Interesse auf die ethische Idee gerichtet war, und daher auch die Natur unter dem Gesichtspunkt des Zwecks betrachtet wurde. Der Zweck aber setzt voraus, daß man bereits den Begriff dessen hat. was erreicht werden soll. Er ist deshalb ein unentbehrliches Erkenntnismittel für das menschliche Handeln. Man glaubte nun, daß auch die Natur in ihrer Gesetzmäßigkeit sich erkennen lasse, indem man die Zwecke aufzusuchen sich bemüht, denen sie dienen soll. Aber dadurch werden stets die Beweggründe des menschlichen Handelns und seine Ziele in die Natur hineingetragen, und es kommt nicht zum Bewußtsein, daß in der Natur eben eine andere Art des Geschehens vorliegt als im sittlichen und künstlerischen Gestalten. Man gelangte nicht zu der Einsicht, daß gerade die Notwendigkeit des gesetzlichen Geschehens es sei, wodurch die Natur als ein besonderes Gebiet abgegrenzt werde; und obwohl Platon lehrte, daß eine solche Notwendigkeit im mathematischen Gesetz gegeben sei, so suchte man das Gesetz doch an einer falschen Stelle, man suchte es in der fertigen Anordnung der Eigenschaften, statt in ihrem zeitlichen Werden. So konnte man wohl zu einer systematischen Einteilung und Beschreibung der Natur mit Erfolg vorschreiten, aber nicht zur Erkenntnis des gesetzlichen Geschehens; man erkannte wohl die Verschiedenheit der Dinge, aber nicht das Gesetz ihrer Veränderung. Die kausale Erklärung der Natur konnte auf diesem Wege nicht gelingen.
Platon selbst war sich sehr klar der Beschränkung bewußt, die er durch seine Lehre der Naturerkenntnis auferlegte. Aber er hielt diese Beschränkung für unvermeidlich, weil in dem Wesen der Sache selbst begründet. Er hatte ja deutlich gesehen, daß die großen und einfachen Gesetze, wie die Gebote der Sittlichkeit, in der Welt der ewigen Ideen und nicht im Wechsel der sinnlichen Erscheinungen zu suchen seien. Und diese unveränderliche Körperwelt mit ihren Eigenschaften hielt er für etwas so Kompliziertes, daß es dem menschlichen Geist überhaupt nicht möglich sei, die absolute Wahrheit hier zu erkennen, daß es dieser vielmehr stets nur zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit bringen könne. Wer möchte deshalb Platon tadeln? Es ist ja wahr, die Fülle der Erfahrung ist unermeßlich, und die Erkenntnis der Natur besteht in der unablässigen Korrektur ihres Bestandes; aber das eben ist Wissenschaft. Daß trotzdem diese »Wahrscheinlichkeit« des Naturerkennens sich der Gewißheit so weit nähern könne, daß sie mit Sicherheit Naturerscheinungen vorauszusagen gestattet, daß sie Vorgänge berechnet, die kein Auge sieht, und Körper beschreibt, deren Dasein die Erfahrung erst nachträglich bestätigt, das würde Platon als eine herrliche Bestätigung seiner Lehre betrachtet haben; er hatte nur nie zu hoffen gewagt, daß die Naturwissenschaft eine solche Höhe erreichen könne, weil zu seiner Zeit noch alle Erfahrung darüber fehlte, welche Größenverhältnisse im Wechsel der sinnlichen Erscheinungen sich nachweisen ließen. Er wußte nicht, daß die Veränderung der Farbe sich als eine Veränderung der Größe der Wellenlänge messen läßt, nicht, daß bei der Verbrennung des Holzes vor und nach dem Verbrennungsprozeß alle Bestandteile auf der Wage zu kontrollieren sind, kurzum er kannte nicht die Einzelheiten, in denen die quantitativen Bestimmungen der Dinge bestehen. Daher zeigt sich zwischen der platonischen und der modernen Auffassung über die Grenzen, welche der menschlichen Erkenntnis gesetzt sind, eine höchst eigentümliche Umkehrung. Wir sind der Ansicht, daß innerhalb der Erfahrung, soweit die Kontrolle der sinnlichen Wahrnehmung reicht, durch die Methoden der Naturwissenschaft eine sichere objektive Erkenntnis der Dinge möglich ist, daß dagegen jenseits der Erfahrung, wo Raum und Zeit ihre Ordnung uns nicht mehr leihen, auch die Kraft der Erkenntnis erlahme und das Reich des Glaubens beginnt. Platon – und damit beherrschte er die zwei folgenden Jahrtausende – war entgegengesetzter Ansicht; in der Erklärung der Körperwelt sieht er nur eine Übung des Scharfsinns, die zu beweisbaren Resultaten nicht führen könne. Darum sagt er: »Und wenn einer zur Erholung die Untersuchungen über das Ewige beiseite legen und die wahrscheinlichen Ansichten über das Werden genau in Betracht ziehen wollte, um sich einen Genuß zu verschaffen, dem keine Reue folgt, so dürfte er wohl ein geziemendes und verständiges Spiel im Leben treiben.«
Also ein Spiel nennt Platon die Versuche, die Veränderungen der Körper auf mathematische Gesetze zurückzuführen; zwar ein geziemendes und verständiges Spiel ist es, ein Genuß, dem keine Reue folgt, weil er kein sinnlicher Genuß ist, aber doch ein Unternehmen, dem eine Sicherheit des Erfolges nicht entspricht; nicht darum, weil jene Gesetze nicht vorhanden wären, sondern nur darum, weil sie zu versteckt lägen. Nichtsdestoweniger entschließt sich auch Platon, dieses Spiel zu versuchen. In seinem Gespräch, das den Namen »Timäus« führt, entwickelt er eine Reihe von Hypothesen, zum Teil in dichterischem Gewande, um die Bildung des Kosmos aus der Materie zu erklären, wie sie der Weltbaumeister vielleicht nach mathematischen Gesetzen vollzogen hat.
Manches in diesen Erklärungen, auf die ich jedoch nicht eingehen will, mutet uns ganz modern an. Die Lehre von den Elementen entnahm er der Schule der Pythagoreer, aber er formte sie geometrisch. Die kleinsten Teilchen der Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde denkt er sich als regelmäßige Körper; die des Feuers haben die Gestalt von Tetraedern, die der Luft von Oktaedern, die des Wassers von Ikosaedern. Diese drei Elemente können sich in einander verwandeln, indem sich die Dreiecke, von denen die Partikeln der Elemente begrenzt sind, sowohl zu Tetraedern, wie Oktaedern oder Ikosaedern vereinigen können. Für Platon besteht nämlich das Wesen des Körpers in seiner Begrenzung, weil diese das Gesetz der Gestalt und Größe enthält; die Grenze bestimmt in der unbestimmten Ausdehnung des Raumes das, was als Körper zusammengehört. So meint Platon, daß z.B. aus dem acht Begrenzungsflächen des Oktaeders (eines Luftteilchens) zwei Tetraeder, d.h. zwei Feuerteilchen entstehen können. Ebenso ist ein Wasserteilchen als Ikosaeder äquivalent 2-1/2 Luft- oder 5 Feuerteilchen.
Man kann hieraus die Ähnlichkeit und den Unterschied seiner Auffassung und der modernen recht deutlich erkennen. Auch bei Platon ist ein Teil der Körper in andere verwandelbar, indem sich ihre Molekeln in Urbestandteile zerlegen und zu anders gestalteten Molekeln zusammensetzen, gerade wie in unserer Chemie. Daß er dabei Luft, Wasser und Feuer, d.h. das Warme, als Elemente betrachtet, ist unwesentlich; charakteristisch für die mathematische Begründung der Naturwissenschaft ist, daß Platon bereits ein Gesetz der chemischen Äquivalente aufstellt, wonach nur bestimmte Mengen von Luft, Wasser, Wärme in einander verwandelbar sind. Aber hier zeigt sich zugleich der fundamentale Unterschied von der modernen Methode. Die Äquivalentzahlen sind nicht aus der Erfahrung durch Abwägen und Messen entnommen, sondern durch eine kühne Konstruktion a priori dekretiert; und selbst dieses würde ja als Hypothese berechtigt sein; aber es wird gar nicht daran gedacht, diese Hypothese aus der Erfahrung durch Messungen zu bestätigen. Eben weil eine solche Bestätigung des vermeintlichen mathematischen Gesetzes Platons unmöglich schien, darum beschränkte er die Physik auf das Gebiet der Mutmaßungen. Und diese mußten allerdings um so unsicherer erscheinen, als ihnen die Wirklichkeit in der Tat nicht entsprach.
Verhängnisvoll für die Entwickelung der Physik in den beiden folgenden Jahrtausenden ward nun der Ausweg, den Platon ergreifen mußte, um das Eintreten einer Veränderung überhaupt, um die Bewegung der Elementarteilchen zu erklären. Ganz wie in unseren kinetischen Theorien der Materie beruht auch bei Platon jede Veränderung körperlicher Eigenschaften auf Bewegung. Ein Körper wird durch Wasser aufgelöst, nicht durch Luft, weil die Teilchen des Wassers infolge ihrer Größe die Teilchen des Körpers (der Erde) auseinander treiben, während die kleineren Luftteilchen zwischen jenen hindurchgehen können, ohne den Zusammenhang zu schädigen. Ist aber der Körper fest zusammengepreßt, so sind nur die Feuerteilchen imstande sich hindurchzudrängen und ihn zu schmelzen. Alle Veränderungen geschehen allein durch die gegenseitige Verdrängung der kleinsten Körperteilchen. Auch die Anziehung der Körper, wie beim geriebenen Bernstein oder beim Magneten, ist nur eine scheinbare, keine wirkliche; auch sie beruht auf einem Druck, den die sich nähernden Körper von außen erleiden. Denn da es nach Platon keinen dauernd leeren Raum geben kann, so sind die Elemente gezwungen, in einem Kreislauf nach ihrem natürlichen Orte, dem sie zustreben, zurückzukehren.
Warum aber, wird man hier fragen, setzen sich die Elemente überhaupt in Bewegung? Warum teilen sich die Elementarkörperchen? Wo sind die mathematischen Gesetze, welche diese Veränderungen bestimmen? Im letzten Grunde muß die Ordnung der Bewegung von den ewigen Ideen, den zwecksetzenden Bestimmungen abhängen. Aber wie können diese die Materie bewegen? Das Gesetz der Veränderung, das zwar als Zweckmäßigkeit in den Ideen liegt, muß auch zugleich im Raum, im gestaltlosen Stoffe, als gestaltbildend tätig sein. Und zu diesem Zwecke führt Platon eine neue Hypothese ein, das ist die Weltseele. Die Weltseele ist das All, insofern es Selbstbewegung enthält. Sie knüpft die sinnliche Erscheinung an die ewigen Ideen und realisiert in jener das mathematische Gesetz der Bewegung; mit einem Worte, sie enthält das Gesetz der Wechselwirkung.
Mit dieser Auffassung der dynamischen Wechselwirkung als der Betätigung einer Weltseele ist nun der Verzicht auf eine mathematisch-mechanische Welterklärung vollendet die in dem Grundgedanken Platons so verheißungsvoll angestrebt war. Die dichterische Weltauffassung hat die mathematische zurückgedrängt. Es ist ja für die junge unerfahrene Wissenschaft der Natur der nächstliegende Gedanke. Veränderungen in der Welt sehen wir vor allem ausgehen von unserem eigenen Körper, und wir sind uns bewußt, diese Veränderungen mit Bedacht hervorzubringen. Woher also sollen die Veränderungen in der Natur überhaupt stammen, zumal wenn sie vernünftigen Zwecken dienen sollen, als von einer Vernunft? Also von einer Seele, die in der Welt ebenso bewegend schafft wie unser Geist in unserem Körper. Oder richtiger: Wie die Bewegungen
II.Von der Weltseele zum Weltäther
Das Grundproblem aller Naturerklärung ist gleichbedeutend mit der so einfach klingenden Frage: Worin besteht die Wechselwirkung der Dinge? Die Realität des mathematischen Gesetzes, die den Gedankengang Platons beherrschte, gibt uns nur einen Teil der gesuchten Aufklärung über die Realität der Dinge. Die majestätische Ordnung des Gesetzes steht zu unvermittelt über dem bunten Inhalt der sinnlichen Erfahrung. Es muß noch eine andere Realität geben als die mathematische Form, einen Inhalt in den Dingen, der im Raum sich stößt und treibt, den wir als Empfindung in Ton und Farbe, als Druck und Wärme erleben. Wie kann sich die Wissenschaft dieses Inhalts bemächtigen? Die Geschichte der Erkenntnis geht auch hier von der naiven Anschauung kindlicher Erfahrung aus.
Daß wir unseren Körper bewegen und diese Bewegung auf andere Körper übertragen, ist eine Wahrnehmung, durch die wir überhaupt in unser Ichbewußtsein hineinwachsen. Wir suchen daher zunächst keine Erklärung dafür, sondern nehmen im Gegenteil diese Tatsache als Ausgangspunkt aller Erklärung. Aber auch für die Übertragung und den Ursprung der Bewegung pflegt es für den Menschen, der über seine Umgebung nachzudenken beginnt, eines schönen Tages irgend ein Weltmittel der Erkenntnis zu geben, das ihn plötzlich vor die Frage stellt: Wie ist das möglich? Irgend ein künstlicher Mechanismus, gewöhnlich eine Uhr, vielleicht eine Dampfmaschine oder Ähnliches, bringt dann eine plötzliche Erleuchtung: Es gibt ganz bestimmte mechanische Gesetze, die in den Gegenstände die Bewegung beherrschen, und deren Wirkung wir zugleich in der Empfindung sinnlich spüren.
In einem Uhrwerk freilich können wir noch die Wechselwirkung der bewegten Teile sozusagen mit den Händen greifen. Das Geheimnisvolle, in welchem die Tiefe des Problems der Wechselwirkung unserem Geiste aufgeht, tritt erst dann auf, wenn eine ungewohnte Wirkung durch unsichtbare und untastbare Mittel von uns wahrgenommen wird. Bei jedem, dem physikalische Experimente oder ähnliche technische Verrichtungen nicht vertraut sind, erweckt es stets ein bewunderndes und immer zu neuen Versuchen anspornendes Staunen, zu beobachten, wie die Magnetnadel sich von selbst wieder nach Norden einstellt, oder wie sie durch die Annäherung eines Magnetpols von der einen Seite abgestoßen, nach der anderen angezogen wird. Man kann dann mit Sicherheit auf die Frage rechnen: Wie kommt das? Aber wie kommt es, daß wir an der Erde haften und der geworfene Stein wieder herabfällt? Und warum fällt der Mond nicht auf die Erde, die Erde nicht auf die Sonne? Der Gelehrte wird uns zwar sagen, sie fallen tatsächlich, bloß immer ein bißchen vorbei; Newton hat uns ja gelehrt, daß Stein, Mond und Erde nach demselben Gesetze fallen. Aber dieses Gesetz? Das ist es eben! Wie machen es die Körper, daß sie wissen, was das Gesetz von ihnen verlangt? Warum müssen sie? Und wie macht es das Gesetz, daß ihm die Körper gehorchen? Was verbindet die Magnetnadel und den Nordpol, die Erde und die Sonne?
Wie machen wir es denn selbst, wenn wir uns bewegen? Wenn wir ganz ehrlich sind und uns genau beobachten, so wissen wir es allerdings selber nicht. Es kitzelt uns jemand, und wir lachen oder stoßen ihn fort; es winkt uns jemand, und wir laufen auf ihn zu; wir hören und erheben die Stimme zur Antwort. Wir wissen nicht, wie es geschieht, aber wir machen es eben. Dagegen, wenn wir tot sind, so kann uns ganz dasselbe geschehen, Kitzeln, Winken, Rufen – wir rühren uns nicht. Also, das scheint klar, wir bewegen uns, weil wir lebendig sind. Wodurch aber sind wir lebendig?
Darauf ist nun die uralte Antwort die: Wir leben, weil wir eine Seele haben. Das wäre ja auch ganz schön, wenn man genau wüßte, was eine Seele ist. Es gibt zwar viele kluge Leute, die behaupten, es ganz genau zu wissen, sogar, daß sie unsterblich sei; nur sind die Ansichten darüber leider außerordentlich mannigfaltig. Vielleicht könnte man mit nicht minder gutem Rechte sagen: Wir haben eine Seele, weil wir leben.
Früher habe ich behauptet, man könnte ebensogut annehmen: »Wir haben Vorstellungen, weil es Objekte gibt«, als: »Es gibt Objekte, weil wir Vorstellungen davon haben.« Dieselbe Frage tritt hier wieder auf, nur eingeschränkt auf das Objekt, das wir den Lebensprozeß des menschlichen Körpers, speziell des Nervensystems, nennen. Leben wir als organische Wesen, weil wir eine Seele haben, oder haben wir eine Seele, weil wir als organische Wesen leben? Beides zu bejahen ist richtig und doch nicht genau. Das organische Leben und das Beseeltsein ist wieder nur der Ausdruck für dieselbe Tatsache, von zwei verschiedenen Gesichtspunkten gesehen. Leben und Seele verhalten sich nicht wie Ursache und Wirkung oder wie Grund und Folge. Vielmehr betrachten wir uns als Körper, deren Teile und Organe durch das Nervensystem mit den übrigen Körpern in gesetzlicher Wechselwirkung stehen, so dürfen wir sagen, weil wir solche Körper sind, sind wir beseelt; und betrachten wir uns als Seelen, die als eine Einheit sich ihrer Zustände bewußt sind, so dürfen wir sagen, weil wir Seelen sind, so leben wir. Tatsächlich können wir nicht eins durch das andere erklären. Aber es scheint so, da beide Tatsachen aneinander haften, daß wir das eine erklärt haben, wenn wir das andere zu erklären vermöchten. Wüßten wir genau, wie alle Wechselwirkungen zwischen der Welt und unseren Organen und dem Gehirn vor sich gingen, so wäre uns – vielleicht – geholfen. Nun wissen wir das aber nicht. Dagegen scheint es dem naiven Bewußtsein ganz selbstverständlich, daß wir wissen, was in uns selber als beseelten Wesen vor sich geht. Und das ist ja auch gewiß, daß wir uns als lebendige Wesen in Wechselwirkung mit unserer Umgebung fühlen. Daher ist denn in der Geschichte des Denkens der Versuch, die Wechselwirkung der Körper zu begreifen, nicht von der mechanischen Bewegung, sondern von der Seele ausgegangen. So lange wir eine Seele haben, leben wir und bewegen uns: also wird auch das ganze Universum, da es sich bewegt, leben und eine Seele haben.
Heute erscheint uns dieser Schluß sehr fraglich. Durch die Entwickelung der Naturwissenschaft haben wir eben die Wechselwirkung der Körper als eine besondere Realität kennen gelernt, die in dem Gesetze notwendigen Geschehens begründet ist, während die Erscheinungen des Bewußtseins vom Gefühl der Freiheit begleitet sind. Deswegen sträuben wir uns gegen die Annahme der Weltbeseelung, welche die Natur gesetzlos zu machen droht; zum mindesten ist sie für das Naturerkennen überflüssig. Aber im Beginn der Naturerkenntnis, als Platon den Begriff der Weltseele für die Wechselwirkung der Körper in Anspruch nahm, lag die Sache nicht so. Damals waren die Begriffe Bewegung und Bewußtsein, körperlich und seelisch noch keineswegs in strenger Weise geschieden. Alles Geistige wurde zugleich körperlich gedacht, und so konnte auch die Veränderung des Körperlichen aus seelischen Vorgängen erklärt werden.
Es ist eine volkstümliche Ansicht, welche die wissenschaftliche Betrachtung der griechischen Philosophen schon vorfand und in ihre Weltauffassung mit aufnahm, daß die Seele, insofern sie Leben und Bewußtsein bedingt, ein Stoff sei, der Ausdehnung im Räume besitzt. Das Wort für Seele – Psyche – Anima – bedeutet den Atem, den Lebenshauch. Er ist das Zeichen des Lebens: wir hauchen die Seele aus. Mit dem Atem beginnt und verschwindet das Leben. Und der Atem ist warm; hören wir auf zu atmen und zu leben, so werden wir kalt und starr. Darum gilt die Seele zugleich als Lebenswärme. So wird denn auch die Weltseele als ein seiner Stoff gedacht, der das Universum erfüllt, die Wärme desselben bedingt und das Ganze in Bewegung erhält. Diesen Gedanken hat Heraklit, genannt der dunkle Philosoph, bereits ein Jahrhundert, bevor Platon wirkte, zur Grundlage seiner Welterklärung gemacht. Durch Verschmelzung mit der platonischen Lehre von der mathematischen Wirkungsweise der Weltseele ist daraus eine Vorstellung entstanden, die noch heute der modernen Naturwissenschaft unentbehrlich ist, nämlich nichts Geringeres als der Begriff vom Weltäther.
Wie Platon durch die ewige Geltung des mathematischen Gesetzes der Naturwissenschaft ihr Fundament gab, so lieferte Heraklit ihr eine Anschauung, die ihr den Zusammenhang mit dem bunten Wechsel der sinnlichen Erscheinung zu erhalten vermochte. Denn wenn die platonische Idee die Realität für sich allein in Anspruch nahm, so mußte die sinnliche Empfindung schließlich als trügerischer Schein betrachtet werden, und dadurch verlor sich das Interesse für die Natur. Heraklit dagegen lehrte umgekehrt, daß gerade der unablässige Wechsel, daß die Veränderung selbst das eigentliche Wesen der Dinge sei; die Dinge vergehen; die Veränderung bleibt. Nach Platon ist auch die Veränderung Schein, es bleibt nur das Gesetz. Heute sagen wir: Das Gesetz der Veränderung ist es, wodurch die Natur bestimmt wird. Die Realität eines Zustandes sehen wir darin begründet, daß mit ihm zugleich der auf ihn folgende Zustand notwendig, d .h. durch ein Gesetz, bedingt ist. Wir nennen das Kausalität. Beleuchten wir einen bewegten Körper, etwa einen fallenden Tropfen, durch einen momentanen Lichtblitz, so scheint er zu ruhen: ob er ruht oder wirklich fällt, wird bestimmt durch die Folgen, die an diesen Zustand geknüpft sind, d. h. sein Zustand ist der der Ruhe oder der Bewegung, je nachdem sich seine Lage zu benachbarten Körpern im nächsten Zeitteil verändert; diese Veränderung ist entscheidend über die Natur eines gegebenen Zustandes. Der moderne Gedanke der Naturerklärung ist also, die Natur zu beschreiben als den gesetzlichen Zusammenhang zwischen den Veränderungen der Zustände. Der Wert, den Heraklit auf die Veränderung als das Wesen der Dinge legte, konnte daher wesentlich dazu beitragen, auf den Punkt hinzuweisen, an welchem die Naturwissenschaft den Hebel der Erkenntnis anzusetzen habe, den Platon im mathematischen Gesetze entdeckt hatte. Wenn es möglich wurde, das Gesetz der Veränderung mathematisch zu formulieren, so war damit der Eingang in die Naturwissenschaft gewonnen. Dieses Mittel bietet seit Leibnitz die Differenzialrechnung.
Doch was hat dies mit der Weltseele und dem Weltäther zu tun? Eben dies, daß das Suchen nach dem Gesetz der Wechselwirkung der Dinge im Universum darin bestand, die Vorstellungen von der Weltseele und dem Weltäther auszubilden, bald, indem man sie phantastisch in eins zusammenzog, bald, indem man die mechanische Wirkung im Äther von der zweckmäßigen der Seele zu trennen suchte.
»Die Welt hat weder der Götter noch der Menschen einer gemacht, sondern sie war immer und ist und wird sein, ein ewig lebendes Feuer«, so lehrte Heraklit, und er wollte damit sagen, der Bestand der Welt beruht darauf, daß sie in fortwährendem Vergehen und Neuentstehen begriffen ist. Es gibt nichts Beharrendes, sondern »alles wird umgetauscht gegen Feuer, und Feuer gegen alles, wie Waren gegen Gold, und Gold gegen Waren.« Denn »Feuer« – damit meint er aber nicht bloß die Flamme, sondern die Wärme überhaupt – ist der Stoff, der alles umwandelt und aus dem alles wieder hervorgeht. Die Harmonie der Welt hat ihren Grund in der gegenseitigen Spannung der Gegensätze, wodurch eben alles, was ist, nur die Bedeutung eines Durchgangspunktes besitzt, während der in dieser Spannung bedingte Umtausch der Zustände in einander das wahrhaft Reale ist. Das Feuer, man könnte sagen der Äther, wie man im achtzehnten Jahrhundert der »Wärmestoff« sagte, ist der Träger dieser Umwandlungen. Wer denkt dabei nicht an die Energie und ihre Formen, die das Äquivalent der umzutauschenden Werte mißt, und deren gegenseitige Spannung den Eintritt des Geschehens bestimmt? Es ist in der Tat derselbe Gedanke, der bei Heraklit vorliegt, und was ihm zur modernen Auffassung fehlt, ist nur die Kenntnis des mathematischen Gesetzes, die quantitative Äquivalenzbeziehung und damit freilich das, was die Wissenschaft von der Dichtung unterscheidet.
Wäre dieser Gedanke Heraklits von den Schülern Platons so mit dessen Lehre verbunden worden, daß man die Auffindung des mathematischen Gesetzes der Veränderung als Ziel der Naturerklärung angestrebt hätte, so wäre vielleicht die Entwickelung der Naturwissenschaft in einer weniger verschlungenen Linie verlaufen. Aber der große Nachfolger des Platon, Aristoteles, schlug eine andere Richtung ein, er machte den Zweck zum Prinzip der Naturerklärung. Und Aristoteles, im Mittelalter der anerkannte Philosoph der Kirche, beherrschte die Wissenschaft der ganzen abendländischen Welt. Wir finden daher die Spuren von Heraklit und Platon nur in einer Reihe nebenhergehender Weltanschauungen, die erst dann von maßgebendem Einfluß wurden, als die neuen Entdeckungen der empirischen Forschung das aristotelische Weltsystem sprengten.
In dieser Hinsicht war die Lehre der Stoiker ganz besonders wirksam. Sie nahm den heraklitischen Gedanken auf und übermittelte ihn der Neuzeit in der Form, daß alle Veränderung eine stoffliche Grundlage besitze. Auch die Atomistik des Altertums, die namentlich durch Epikur neue Verbreitung fand, hätte den gleichen, für die Naturwissenschaft kaum entbehrlichen materialistischen Zug unterstützen können. Aber zwei Umstände machten sie für diese Vermittlerrolle weniger geeignet als die stoische Weltansicht. In physikalischer Hinsicht stand nämlich die Atomistik dem herrschenden System des Aristoteles, der die Teilbarkeit der Materie ins Unendliche lehrte, viel schroffer gegenüber als die Lehre der Stoiker, die als Gegner der Atomistik in diesem Punkte wenigstens mit Aristoteles übereinstimmten. Galt doch die aus der stoischen Schule hervorgegangene Schrift »über den Kosmos« durchweg als eine echte Schrift des Aristoteles. Dazu kam zweitens, daß Epikur seiner Moral wegen als ein höchst verwerflicher Philosoph galt, während die strenge Tugendlehre der Stoiker bei der christlichen Welt größeres Vertrauen zu erwecken imstande war.
Die Stoiker sind in der Physik konsequente Materialisten. Für sie gibt es nichts anderes, das wirklich ist, als das Körperliche; denn wirklich sei nur das, was wirkt oder leidet, und das kann ihrer Ansicht nach nur der Körper. Daher ist sowohl die Seele als selbst die Gottheit ein Körper, und auch alle Eigenschaften der Körper haben eine materielle Grundlage; sie gelten als körperliche Ausströmungen der Dinge. Das Zusammenwirken dieser Eigenschaften, das sie sich als eine gegenseitige Durchdringung der Körper mit ihren Ausströmungen vorstellen, denken sie sich nun vermittelt durch einen die ganze Welt durchsetzenden Lebenshauch, das »Pneuma«. Es ist dies eine warme luftartige Substanz, ein feuriger Dunst, daraus alle Dinge hervorgegangen sind, und in das sie sich einst in einem ungeheuren Weltbrande wieder auflösen werden, um diesen Prozeß bis ins Unendliche zu wiederholen. Dieser Weltäther also ist die Urkraft; aber da durch sie die gesamte Welteinrichtung zweckmäßig geordnet ist, so muß sie auch zugleich die Weltseele, die Gottheit selbst sein. Als Vernunft und als Verhängnis enthält so der Weltäther das gemeinsame Gesetz für alles Geschehen. Durch Verdichtung und Verdünnung erzeugt er die Elemente und gibt den Dingen die Spannung, den »Tonos«, die innere Intensität ihres Wesens, Lebens und Beseelung.
Als im sogenannten Neuplatonismus, vornehmlich durch Plotinus im dritten Jahrhundert nach Christus, die Lehren Platons neues Leben gewannen, wurde nun auch die Theorie der Weltseele weiter ausgebildet. Bei Plotin beruht das ganze Dasein der Körperwelt überhaupt auf der Weltseele, die allein den Körpern die Teilnahme an der Idee, d.h. an der unendlichen Weltvernunft, und damit an der Existenz und dem Leben verleihen kann. Nicht die Seele tritt in den Körper ein, sondern sie erfüllt Universum als ein Ganzes, ohne Quantität, ohne Masse, und sie läßt den Körper in sich eintreten. Ihre Selbstbewegung ist die Zeit, und indem der Körper in die Weltseele eintritt, erhält er erst Existenz in der Zeit, er entsteht als sinnlich wahrnehmbares Wesen; sie gibt ihm das Gesetz (Logos) seines Seins in der Erfahrungswelt. Die sinnliche Erscheinungswelt hat also ihren gesetzlichen Zusammenhang in der Wechselwirkung, die als Weltseele das Leben des Universums bedingt.
Will man diese Verbindung und Wechselwirkung der Körper im Interesse der Naturerkenntnis verwerten, so liegt es nahe, nach einer Veranschaulichung zu suchen, und dadurch wird man sich wieder der stofflichen Auffassung der Weltseele als Weltäther nähern. Diese Veranschaulichung findet sich schon in der neuplatonischen Schule selbst. Platon hatte ja bereits gelehrt, daß die Weltseele zwischen den Ideen und den sinnlichen Dingen, entsprechend dem geometrischen Gesetz, vermittle. Dieses Gesetz ist der Raum. Bei den Stoikern erfüllt die Weltseele den Raum. Nun wird der Raum mit der Weltseele selbst für identisch erklärt. Bei Proklus, im fünften Jahrhundert nach Christus, wird der Raum als ein körperliches und beseeltes Wesen betrachtet, das aus dem feinsten Lichte besteht. Das Licht zeigt ein Beispiel der gegenseitigen Durchdringlichkeit von Körpern; so scheint es begreiflich, wie die Weltseele die Körper in sich aufnehmen kann; als lichterfüllter Raum enthält sie die Materie; als lebendige Seele bewegt sie diese; als Gesetz der Wechselwirkung gestaltet sich die Materie zur Ordnung der sinnlichen Dinge. In jedem Zustand ist bereits durch das Wesen der Weltseele der folgende Zustand angelegt, die Tendenz zur Veränderung ist das Wirkliche, was den Dingen als Weltseele innewohnt. Wer nur wüßte, wie diese Tendenz im einzelnen Falle beschaffen ist! Was muß hier an dieser Stelle geschehen, in diesem, Samenkorn, damit es aufgeht, in diesem Fieberkranken? damit er gesundet, in dieser Schmelzmasse, damit sie sich in lauteres Gold verwandelt?
Wer das wüßte, der wäre der Herr der Natur, der große Magus, der die Dinge verwandeln könnte, nicht als ein Zauberer, sondern als ein Wissender ihrer Gesetze. Jeder Zustand ist eine reale und gesetzliche Bedingung der folgenden Zustände; alle Körper stehen durch die räumlich-seelische Kraft des Weltäthers in Wechselwirkung: dieser allgemeine Gedanke ist als Bedingung einer Naturwissenschaft und Naturbeherrschung vom Altertum der Neuzeit überliefert. Aber die Vorstellung ist zu unbestimmt; daher bleibt sie phantastisch. Die Wissenschaft verlangt die Kenntnis des einzelnen, isolierten Vorgangs, die Kenntnis des quantitativen Gesetzes zur Berechnung dessen, was wirklich eintreten muß.
Wir überspringen das Jahrtausend, dessen geistiges Leben fast durchaus vom kirchlichen Interesse erfüllt ist. Das sechzehnte Jahrhundert ist angebrochen, die großen Umwälzungen der Kulturgeschichte haben begonnen. Die Gedanken sind in ihrer Verbreitung nicht mehr beschränkt auf die handschriftliche Vervielfältigung; die Erde ist umsegelt, ihre Kugel steht nicht mehr im Mittelpunkte der Welt, und es gibt Länder, in welchen der Bannstrahl des Papsttums die neue Auffassung der Dinge nicht mehr erreicht. Die Wissenschaft kann aus ihrem Schlummer erwachen. Aber eine Naturerkenntnis gibt es noch nicht. Die Wechselwirkung der Körper ist noch nicht mathematisch gefesselt, die Weltseele feiert zunächst ihre Auferstehung als Spiritus mundi.
Im ganzen sechzehnten Jahrhundert stellt man sich die Körperwelt als belebt vor, und diese Weltseele ist zugleich körperlicher Natur, ein Weltgeist, Spiritus, und ein Element, das den andern übergeordnet ist. Die Auffassung stimmte insoweit mit Aristoteles, als auch er eine allgemeine Lebenswärme, einen Weltäther, als fünftes Element zugelassen hatte. Diese »quinta essentia« die Quintessenz der Alchymisten, hat jetzt durch die Verschmelzung mit den stoischen und neuplatonischen Vorstellungen die Bedeutung des Prinzips aller Wechselwirkung gewonnen. Wer sie herzustellen vermag, der beherrscht die Umwandlung der Dinge; sie ist der eigentliche Stein der Weisen. Agrippa von Nettesheim († 1535) erzählt, er habe den Spiritus mundi selbst aus Gold gezogen, aber nicht mehr Gold daraus machen können, als das Gewicht des Goldes betrug, aus welchem die Quintessenz extrahiert wurde. Denn als ausgedehnte Größe kann sie nicht über ihr eigenes Maß hinaus wirksam sein.
Dieser Versuch ist indessen bereits kennzeichnend für den jetzt erfolgenden Übergang von der Weltseele zu quantitativen Gesetzen. Agrippa mißt die Menge des aufgelösten und des aus der Lösung wieder niedergeschlagenen Goldes, und er bemerkt die Äquivalenz; die Weltseele ist hier eine extensive, mit der Wage bestimmbare Größe. Mag auch immer noch das physische Geschehen als Tätigkeit eines in den Elementen wirksamen Lebensgeistes aufgefaßt werden, dieser Lebensgeist hat doch die Vertrauen erweckende Eigenschaft, Gewicht und Ausdehnung zu besitzen. Er ist nicht mehr der phantastische Kobold, der nur der dunkeln Verschwörungsformel gehorcht, sondern es ist Hoffnung, daß ein durchsichtiges Gesetz seine Umwandlung bestimmt. Siegreich drängt sich dem Bewußtsein der Zeit die klare Überzeugung auf: Wohl mag die Natur ein Reich der Geister sein, aber diese Geister sind nichts anderes als die Gesetze, nach denen die Körper aufeinander wirken; es gibt keine Willkür im Naturgeschehen; die Natur ist erkennbar.
Es war das große Verdienst des berühmten Arztes Theophrastus von Hohenheim, genannt Paracelsus, daß er die Auffassung der Natur als einen gesetzlichen Umwandlungsprozeß zur Geltung brachte. Zwar beruht auch nach ihm die Wirksamkeit der Elemente auf den in ihnen befindlichen »Archei« oder Lebensgeistern. In jedem Elemente steckt ein »Fabrikator«, ein Arbeiter, der für uns durch den Befehl Gottes sorgt Tag und Nacht. Aber dieser Archeus soll die Gesetzmäßigkeit der Welt nicht aufheben, sondern gerade begründen. Die Archei sind nach Ansicht des Paracelsus nicht persönliche Geister, sondern Naturkräfte, die schaffenden Prinzipien oder wirkenden Kräfte in den Dingen, sie wirken nur als stoffliche Elemente. Das Sein der Dinge ist ihr Wirken. Das Leben des Wassers ist seine Flüssigkeit, das des Feuers seine Flüchtigkeit, die wesentlichen Eigenschaften der Dinge sind das, was ihr Leben ausmacht. So wird bei Paracelsus das Leben zum chemischen Prozeß, und damit bereitet er den Übergang zur naturwissenschaftlichen Erkenntnis durch Maß und Zahl vor. An Stelle der Elemente des Aristoteles, die durch die sinnlichen Eigenschaften »Wärme, Kälte, Feuchtigkeit, Trockenheit« definiert waren und sich somit jeder exakten Bestimmung entzogen, setzt er die unzerlegbaren Grundsubstanzen, auf welche die chemische Analyse führt. Diese kann die experimentelle Untersuchung mit Hilfe der Wage ermitteln; und so zeigt sich doch wenigstens ein Punkt, wo die Erfahrung, durch eigenes Zusehen und Probieren sich der Natur zu. bemächtigen vermag.
Immer aber waren diese Prozesse noch zu kompliziert, als daß die damaligen Mittel der Erkenntnis einen tiefer greifenden Erfolg hätten erzielen können. Es mußten einfachere Probleme gefunden werden, um aus der Mannigfaltigkeit der sinnlichen Erfahrung Ereignisse herauszulösen, die eine mathematische Darstellung gestatteten. Dies waren die Aufgaben, welche Astronomie und Mechanik darboten; Kepler und Galilei brachten die Lösung.
Kepler bietet in seinem eigenen Entwicklungsgange ein höchst interessantes Beispiel, wie sich im Anfang des siebzehnten Jahrhunderts der Umschwung von der Seelentheorie zur mechanischen Auffassung gestaltet. Wir können in Keplers Werken literarisch die Umwandlung der Weltseele in die mechanisch vermittelte Wechselwirkung anziehender Kräfte deutlich verfolgen. Es handelt sich um die Bewegung der Planeten.
In der ersten Ausgabe seines Werkes »Mysterium Cosmographicum« (1596) nimmt Kepler noch an, daß die Planeten durch Seelen bewegt werden, die entweder in ihnen selbst oder in der Sonne ihren Sitz haben. Da sich die entfernteren Planeten langsamer bewegen, so meint er, daß entweder die bewegenden Seelen der Planeten um so schwächer sein müssen, je weiter sie von der Sonne entfernt sind, oder daß es eine bewegende Sonne geben müsse, welche die näheren Planeten kräftiger anregt. Auch in den »Paralipomena ad Vitellionem« (1604) schreibt er der Sonne noch eine Seele zu. In der Schrift über den Planeten Mars dagegen, die unter dem Titel »Astronomia nova« 1609 erschien und die beiden ersten der berühmten nach ihm genannten Gesetze enthält, bestreitet er ausdrücklich, daß es bewegende Seelen der Planeten gäbe. Er faßt seine Gesetze als physische auf, die Bewegung als beruhend auf einer körperlich vermittelten Anziehung, als eine reine Wechselwirkung. Schon in einem Briefe an Fabricius im Jahre 1605 hatte er die irdische Schwere, die den geworfenen Stein herabfallen läßt, als eine Kraft betrachtet, die wie der Magnet Ähnliches zusammenzieht; nun überträgt er diese Vorstellung auch auf kosmische Verhältnisse. Die Anziehung ist eine gegenseitige zwischen allen Körpern. Wenn zwei Steine sich irgendwo ohne äußere Beeinflussung befänden, würden sie sich ähnlich wie zwei magnetische Körper einander nähern. Dies gelte ebenso von den Planeten und der Erde in Bezug auf die zu ihnen gehörigen Körper wie auch in Bezug auf den Mond, und wechselseitig von diesem auf die Erde, deren Wasser er erhebt; ja es gelte auch für die Sonne in bezug auf die Erde.
Die Ursache der langsameren Bewegung der Planeten sucht Kepler jetzt in ihrer Trägheit, und in der zweiten Ausgabe des »Mysterium Cosmographicum« macht er endlich folgenden höchst belehrenden Zusatz:
»Wenn man für das Wort »Seele« das Wort »Kraft« einsetzt, so hat man das eigentliche Prinzip, worauf die Physik des Himmels in der Abhandlung über den Mars begründet und im 4. Buche der Epitome Astronomiae ausgebaut ist. Ehemals glaubte ich, daß die bewegende Ursache der Planeten durchaus eine Seele sei, da ich nämlich vollgesogen war von den Lehren J. C. Scaligers über die bewegenden Intelligenzen. Aber als ich erwog, daß diese bewegende Ursache mit der Entfernung sich abschwäche, daß auch das Licht der Sonne mit der Entfernung von derselben sich verringere, so schloß ich daraus, daß diese Kraft etwas Körperliches sei, wenn nicht im eigentlichen, so doch wenigstens im übertragenen Sinne.«
Was könnte bezeichnender sein für die Vertreibung der Weltseele durch das Gesetz der Mechanik als dieses Selbstbekenntnis Keplers? Die Berücksichtigung der quantitativen Verhältnisse fordert eine Erklärung der Naturerscheinungen, die sich aus den tatsächlichen Messungen bestätigen laßt.; eine solche kann die Seelentheorie nicht gewähren. Die Astronomie will von nun ab nach Prinzipien der Mechanik behandelt sein. Und diese bot ihr Galilei dar. In derselben Zeit, in welcher Kepler sich für die mechanische Erklärung der Planetenbewegung entschied, entdeckte Galilei die Grundgesetze der Bewegung.
In Galilei ist die Auffassung überwunden, daß die Wechselwirkung der Körper in einer Betätigung der Weltseele bestehe. Die Bewegung gilt ihm als ein Vorgang, dessen Realität eine Gesetzlichkeit besonderer Art darstellt, die sich mathematisch ausdrücken läßt. Wenn ein Körper in Bewegung ist, so geschieht dies nicht weil ein Lebensgeist in ihm steckt und die Bewegung erhält, verzögert oder beschleunigt, sondern die Bewegung ist selbst eine intensive Größe, sie ist bestimmbar als Wirkungsfähigkeit des bewegten Körpers. Wie diese Erhaltung, Veränderung und Zusammensetzung der Bewegungen meßbar sind, das lehrte Galilei; damit schuf er die neue Wissenschaft, die Mechanik, und damit vertrieb er die Seelenkräfte aus der Materie, indem er eben die neue Realität der Wirkungsfähigkeit der Materie als das Prinzip der Wechselwirkung einführte, woraus der Begriff der Energie sich entwickelt hat. Galileis Weltanschauung ist daher durchaus mechanisch. Die Dinge und ihre Eigenschaften beruhen ganz allein auf der Verteilung der Materie im Räume und ihrer Bewegung, d.h. auf der Wechselwirkung der bewegten Materie mit unserm eigenen Körper. Hiermit ist der Übergang von der organisch-beseelten Körperwelt zur mechanischen Naturauffassung vollzogen. Die Natur hat ihre eigenen Gesetze, und wir erkennen sie.
Diese Grundlage der modernen mathematischen Naturwissenschaft gewinnt ihren vollständigen Sieg im weiteren Verlaufe des siebzehnten Jahrhunderts. Bewegung ist der Inhalt der Wirklichkeit. Aber wir sehen Wirkung auftreten auch dort, wo sinnlich keine Bewegung wahrnehmbar ist, durch den scheinbar leeren Raum hindurch und zwischen den unsichtbaren Teilchen der Körper. Die Weltseele hat ihre bewegende Kraft eingebüßt, die Bewegung jedoch bedarf eines Trägers, der zwischen den Körpern ihre Mitteilung ermöglicht. Somit wird die Weltseele zum Weltäther. Sie verliert ihre psychische Qualität, behält aber die physische Eigenschaft der Ausdehnung und Raumerfüllung. Noch immer stellt sie den feinsten aller Stoffe dar, der aus den kleinsten, mit der größten Geschwindigkeit sich bewegenden Teilchen besteht. Aber sie ist nur noch Stoff, der von Anfang an, von der Weltschöpfung her mit bestimmten Bewegungen begabt ist, und diese nun nicht mehr nach Maßgabe von Lebensgeistern, sondern lediglich nach mechanischen Gesetzen im Räume von Körper zu Körper überträgt.
Auch dieser Begriff des Weltäthers hatte seine Quelle in der griechischen Philosophie und zwar in der Atomistik Demokrits, die, wie schon erwähnt, durch Epikur