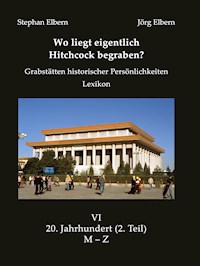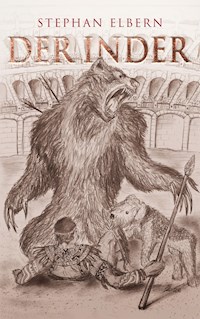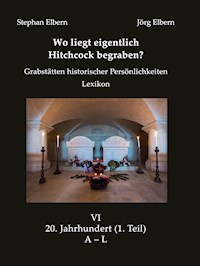24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Napoleon ruht im Invalidendom, Friedrich d. Gr. auf der Schloßterrasse von Sanssouci, Goethe und Schiller in der Fürstengruft zu Weimar – wo aber wurden Caesar und Hannibal, Platon und Perikles, Echnaton und Nebukadnezar bestattet? Diese Fragen will das vorliegende Werk beantworten und damit eine Lücke in der historischen Forschung schließen. Dabei entspricht der wissenschaftliche Apparat den Ansprüchen der Fachwelt; durch seinen klaren und leichtverständlichen Stil wendet sich das Buch aber gleichzeitig an das allgemein geschichtlich interessierte Publikum. Es folgt zugleich einer zunehmenden Hinwendung der geisteswissenschaftlichen Disziplinen zu dem uralten Phänomen der Sepulkralkultur. Denn von Anbeginn der Menschheit bewahren Totenritual und Grabkult die Erinnerung an die Verstorbenen; aus religiösen Motiven, aber auch aus historischem Interesse wurden die Gräber bedeutender geschichtlicher Gestalten bereits in der Antike aufgesucht. In dieser Tradition sieht sich das vorliegende Buch, in dem die archäologischen Spuren und literarischen Zeugnisse von nahezu 600 Grabstätten historischer Persönlichkeiten aus dem Alten Orient und dem Klassischen Altertum zusammengetragen sind – von Abraham bis Thutmosis, von Alexander bis Zarathustra.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 414
Ähnliche
Für Jörg und Karin
Inhaltsverzeichnis
VORWORT
ALTER ORIENT
A
C
D
E
H
I
J
K
M
N
P
R
S
T
U
KLASSISCHES ALTERTUM
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Z
FACHBEGRIFFE
Liste der römischen Vornamen
Bildnachweis
VORWORT
Wolkenlos wölbte sich der Himmel über dem Bosporus, ruhig glitt das Schiff über das Meer. Monoton verkündete die Stimme des einheimischen Reiseleiters, an den Ufern wären auch zwei bedeutende Deutsche begraben – Colmar von der Goltz, der preußische Feldmarschall in osmanischen Diensten (das war mir bekannt) und Helmuth von Moltke, der Sieger von Königgrätz und Sedan – und das konnte nicht sein! Aber ich hatte den Ausführungen des Cicerone in diesem Augenblick kein gesichertes, unangreifbares Wissen entgegenzusetzen; ich kannte den Werdegang des berühmten Feldherrn der Einigungskriege, auch seinen mehrjährigen Aufenthalt in der Türkei, auf dem der Irrtum erkennbar beruhte – aber wo war er bestattet worden?
In diesem Augenblick durchzuckte mich ein Gedanke – es müßte ein Nachschlagewerk für die Grabstätten aller bedeutenden Persönlichkeiten der Weltgeschichte geben! Das Projekt erschien mir bald noch wichtiger, da ich bei meinen Recherchen nach dem Grab Moltkes (auf seinem Gut im schlesischen Kreisau) schon bald feststellen mußte, daß auch umfangreiche Enzyklopädien diesen Aspekt nur in wenigen Fällen berücksichtigen. Bald gelang es auch, eine junge Mitstreiterin für die Aufgabe zu begeistern; gemeinsam begannen wir unser Werk, dessen Umfang sich bereits nach kurzer Zeit abzeichnete.
Ohne die Unterstützung einer wissenschaftlichen Institution oder eines großen Verlages erschien die gleichzeitige Bearbeitung des unüberschaubar reichen Materials durch alle Epochen von A bis Z als unmöglich. Daher entschieden wir uns für eine Gliederung nach den historischen Großepochen; so wird dem ersten Band über den Alten Orient und das Klassische Altertum zunächst ein weiterer über das Mittelalter folgen.
Grundlage für die Auswahl war die geschichtliche Bedeutung der Person, nicht der Grabstätte. So sind etwa das Mausoleum der Caecilia Metella an der Via Appia vor Rom oder das Jakobusgrab in Santiago de Compostela zweifellos von höchstem kunsthistorischen bzw. religionsgeschichtlichen Rang; aber die dort Beigesetzten wird man doch wohl kaum zu den bedeutenden Gestalten der Antike zählen. Eine gewisse Subjektivität der Entscheidung war naturgemäß unvermeidbar, doch dürfte weitgehende Übereinstimmung darüber bestehen, welche Staatsmänner und Feldherren, Künstler und Literaten zu den Großen des Altertums zählen. Die Herrscher der bedeutendsten Reiche – die persischen Großkönige, die Herrscher der wichtigsten hellenistischen Staaten sowie die römischen Kaiser – wurden vollzählig aufgeführt; nur auf wenige kurzlebige Prätendenten wurde verzichtet. Auch die Päpste sind ausnahmslos behandelt; zwar ist den Autoren bewußt, daß den römischen Bischöfen der ersten Jahrhunderte nur geringe historische Bedeutung beizumessen ist, doch legt die Bearbeitung der späteren Papstgräber in den geplanten folgenden Bänden bis in unsere Zeit nahe, die Nachfolger Petri seit der Antike vollzählig aufzuführen.
Als sinnvoll erschien, auch die bewußte Verweigerung der Bestattung, die Schändung und Verstümmelung von Leichen zu dokumentieren, ebenso das Fehlen von jeglicher Überlieferung. Denn auch darin kann eine geschichtliche Aussage liegen: So spiegelt sich das Chaosv.a. des späten Seleukidenreiches in der fehlenden Kenntnis der Herrschergräber, ebenso die Wirren in der Epoche der „Soldatenkaiser“ und in der Agonie des Weströmischen Reiches.
Einen Grenzfall bedeuteten die Grabstätten mythischer Gestalten, die der Antike als historisch galten, etwa der Helden des Trojanischen Krieges oder der legendären Könige Roms. Da sie als Teil der geschichtlichen Identität von Griechen und Römern ein gewisses historisches „Eigenleben“ entwickelt haben, wurden sie – in beschränktem Umfang – berücksichtigt.
Für die alphabetische Reihenfolge wählten wir die gebräuchliche Form (also „Scipio“ statt „Cornelius“, „Varus“ statt „Quinctilius“). Dabei diente – wie auch für Datierung und Abkürzungen – mit wenigen Ausnahmen das „Lexikon der Alten Welt“ (Artemis) als Leitfaden; bei den biblischen Gestalten folgten wir dem „Lexikon für Theologie und Kirche“ (Herder), für Ägypten dem „Lexikon der Ägyptologie“ (Harassowitz). Zugunsten des leichteren Leseflusses wurde bei den vorderasiatischen Namen die einfachste Schreibweise gewählt.
Das Nachschlagewerk soll gleichsam „zwei Herren dienen“: Den Anforderungen der Fachwelt entspricht der wissenschaftliche Apparat, wobei Kontroversen der Forschung im Interesse der Lesbarkeit kurz gehalten sind; weiterführende Literatur ist jeweils angegeben. Dem historisch gebildeten Laien eröffnen kurze Einführungstexte den Zugang zu den geschichtlichen Gestalten. So soll das Buch zum Blättern, Schmökern - und manchmal auch zum Staunen anregen, zudem eine Lücke in der historischen Forschung schließen; es sieht sich der schlichten Forderung Leopold von Rankes verpflichtet, zu zeigen, wie es eigentlich gewesen sei. Zugleich mag es dazu ermuntern, sich neuen geschichtlichen Fragestellungen zuzuwenden, wie etwa:
„Wo liegt eigentlich Caesar begraben?“
Den Verfassern ist bewußt, daß ein derartiges Werk stets für Fehler und inhaltliche Lücken anfällig bleibt; für jede Anregung zu Ergänzung und Verbesserung sind wir daher verbunden. Unser Dank für Rat und Hilfe gilt vor allem Frau Elisabeth Surawski (Berlin), Herrn Dr. phil. habil. Jürgen Wiesner (Berlin) und Herrn Hans Wunner (Bad Aussee), ebenso den Bildleihgebern und dem Fotohaus Bark (Bad Frankenhausen) für die Gestaltung von Umschlag und Bildteil. Dank schulden wir auch den wissenschaftlichen Kollegen im Ägyptologischen Seminar und im Institut für Altorientalistik der Freien Universität Berlin, den stets hilfsbereiten Mitarbeitern der Institutsbibliotheken und der Urania Berlin für ihre Gastfreundschaft bei den Studienaufenthalten in der Stadt. Er gebührt auch unseren Ehepartnern, die das entstehende Werk mit stetem Interesse begleitet und durch zahlreiche Ideen und Anregungen gefördert haben.
Bad Frankenhausen / Gera, im Oktober 2006
Stephan Elbern Katrin Vogt
ALTER ORIENT
A
AbrahamAbb. 1
Israelitischer Patriarch (19.–17. Jh. v.Chr.)
Nach der biblischen Überlieferung wandert er von Ur in Chaldäa in das „Gelobte Land“ Kanaan aus; an seinem Wohnort in Mamre bei Hebron empfängt er die göttliche Verheißung zahlreicher Nachkommenschaft und ihrer ewigen Herrschaft über das Land. Seine Historizität ist umstritten.
Abraham galt wie seine Nachkommen Isaak und Jakob als einer der drei Erzväter (Patriarchen) der Israeliten; im späten Judentum von zahlreichen Legenden umwoben, wurde er zur dominierenden Gestalt des jüdischen Volkes. Auch in Christentum und Islam genoß er hohe Verehrung.
Der Patriarch wird von seinen Söhnen Isaak und Ismael bei Hebron in der Höhle von Machpela bestattet, gegenüber von Mamre auf dem Feld, das der Verstorbene von dem Hethiter Ephron für seine Grablege erwarb; auch seine Frau Sara wird hier beigesetzt (Gen 25,9f.; 49,29-32). Ihre Ruhestätte und die Gräber der Nachfahren werden seit über zwei Jahrtausenden an dieser Stelle verehrt; wahrscheinlich bestand hier bereits in der Zeit der Makkabäer ein Heiligtum. →Herodes d. Gr. ließ die Grabhöhle mit den prächtigen Marmorsarkophagen der Erzväter durch eine Mauer umschließen (Ios. BJ 4,9,7, erwähnt nur die Sarkophage, doch ist die Datierung des Bauwerkes durch die typische herodianische Mauertechnik gesichert). Seit dem 2. Jh. n.Chr. war die Höhle nicht mehr zugänglich.
In der Spätantike wurde die heilige Stätte von christlichen Pilgern – wie auch von Juden – besucht; sie wird als rechteckiger Bau in hervorragender Steinmetzarbeit beschrieben (Itin. Burd. 599), in den wahrscheinlich später eine byzantinische Basilika eingefügt wurde. Nach der arabischen Eroberung wurden die Grabstätten auch zum Ziel moslemischer Pilgerfrömmigkeit.
Gottfried von Bouillon befestigte das Heiligtum als „Castellum ad S. Abraham“; Augustiner-Chorherren wurden hier angesiedelt, die nach eigenen Angaben die Gräber in der Höhle wiederentdeckten. Der Fund war Anlaß zur Errichtung einer Kreuzfahrerkirche, die durch Spenden der Pilger finanziert wurde. Nach der Katastrophe von Hattin (1187) wieder in moslemischem Besitz, wurde die heilige Stätte unter Baibars für alle Nichtmoslems gesperrt; die Kirche wurde zur Moschee, die Höhle für alle Besucher unzugänglich.
Der heutige Bezirk von Haram el-Chalil („Heiligtum des Freundes“; „Freund“ bezeichnet im islamischen Sprachgebrauch Abraham) wird noch immer von der herodianischen Mauer (59 x 34 m; Höhe fast 20 m) umschlossen, die unter Baibars erhöht wurde; damals entstanden auch die vier (j. zwei) Minarette. Das Heiligtum besteht aus einem offenen Hof und der angrenzenden Moschee (der früheren Kirche der Kreuzfahrer).
In ihrer Vorhalle erhebt sich der oktogonale Kenotaph Abrahams, daneben die sechseckige Memoria seiner Frau Sara; auf der gegenüberliegenden Seite des Hofes stehen als getreue Kopien die Gedenkgräber für →Jakob und Lea; die Kenotaphe von →Isaak und Rebekka fanden im Inneren der Moschee Aufstellung. Durch die Lage seines Grabes im Zentrum des Heiligtums ist Abraham der Ehrenplatz in der Mitte zuerkannt. Die sechs Memorien wurden 1332 von einemmamelukischen Statthalter in Syrien gestiftet.
Von der Moschee führen in die (unzugänglichen) eigentlichen Grabhöhlen der Patriarchen zwei Öffnungen, in die Pilger Bittschreiben an Abraham hinabwerfen können; nach dem Bericht der Kreuzfahrerzeit sind die Grotten durch einen Gang miteinander verbunden. Frommer Volksglaube lokalisiert im Heiligtum auch die Grabstätten von Adam und Eva, von Joseph und seinen elf Brüdern.
Lit.: O. Keel – M. Küchler, Orte und Landschaften der Bibel. 2. Bd. Der Süden, Zürich 1982, 680-96
Absalom
Sohn Davids (um 1000 v.Chr.)
Er beseitigte →Davids ältesten Sohn, erlangte aber die Aussöhnung mit dem Vater. Gegen diesen erhob sich Absalom zum König und zwang David zur Flucht. In der Schlacht im Walde Ephraim besiegt, floh der rebellische Sohn und wurde gegen den Befehl seines Vaters getötet.
Die Krieger des Königs warfen den Leichnam in eine tiefe Grube im Wald und bedeckten sie mit einem großen Steinhaufen (2 Sam 18,17). Zu Lebzeiten hatte sich Absalom bereits ein Grab im Königstal errichten lassen (2 Sam 18,18); daher wurde seit dem 16. Jh. ein hellenistisches Grabmal im Kidrontal mit seinem Namen bezeichnet.
Da er als abschreckendes Beispiel eines ungehorsamen Sohnes galt, führten in späteren Jahrhunderten die Einwohner von Jerusalem ihre Kinder zu seiner angeblichen Grabstätte; diese mußten dort schreien und Steine auf das Grabmal werfen, um auf das Ende böser Kinder hinzuweisen, die gegen das fünfte Gebot verstießen (Encyclopaedia Judaica I, Jerusalem 1971, 175).
Achab
König von Israel (875–854 v.Chr.)
Er baute die Hauptstadt Samaria aus und sicherte das Land durch Festungen. Sein Versuch, den Baalskult in Israel durchzusetzen, führte zu erbittertem Widerstand der Anhänger Jahwes unter der Führung des →Elias. Die Beteiligung des Königs an der Schlacht bei Karkar gegen die Assyrer ist das erste außerbiblisch bezeugte Ereignis der jüdischen Geschichte (854 v.Chr.). Auf einem seiner zahlreichen Kriegszüge gegen Damaskus fiel Achab bei Ramoth Gilead.
Der König wurde in seiner Residenz Samaria begraben (1 Kön 22,37).
Ahmose
Ägyptischer König (18. Dyn., um 1580–1550 v.Chr.)
Er setzte den Aufstand seines Vaters (?) →Kamose gegen die Hyksos fort und begründete mit ihrer Vertreibung aus Ägypten das Neue Reich. Örtliche Machthaber wurden beseitigt, das Land unter König, Heer und dem Tempel von Theben neuverteilt. Ein Feldzug nach Süden sollte die frühere Herrschaft der Ägypter in Nubien wiederherstellen. Mit den Bauten des Königs begann die grandiose Architektur des Neuen Reiches.
Seine ursprüngliche Grabstätte ist unbekannt, lag aber – nach dem Fundort der Mumie zu schließen – in Theben-West. Diese wurde – wohl nicht in ihrem originalen Holzsarg – in der Cachette von Deir el-Bahari entdeckt.
Wegen der allgemeinen Unsicherheit und der Zunahme von Grabräuberei barg der thebanische Hohepriester Pinudjem I. unter der 21. Dynastie Mumien von Pharaonen und ihren Angehörigen aus bereits geplünderten oder bedrohten Gräbern, restaurierte sie notdürftig und bestattete sie erneut; später wurden sie mehrfach umgebettet, zuletzt in das Mumienversteck (Cachette) von Deir el-Bahari, das erweiterte Grab der Gemahlin Ahmoses. Im 19. Jh. zunächst von Arabern, dann von G. Maspero wiederentdeckt, wurden sie in das Ägyptische Museum von Kairo gebracht.
Die dortige, vielfach als unwürdig empfundene Ausstellung der Mumien veranlaßte den ägyptischen Präsidenten Anwar el-Sadat, die Umbettung der Pharaonen in das Tal der Könige anzuordnen; wegen der dort erneut drohenden Gefährdung durch Grabräuber wurde dieser Plan aufgegeben, der Mumiensaal des Museums allerdings für Besucher geschlossen.
Lit.: R. B. Partridge, Faces of Pharaohs. Royal Mummies and Coffins from Ancient Thebes, London 1994, 45-47
E. Thomas, The Royal Necropoleis of Thebes, Princeton 1966, 70
Amasis
Ägyptischer König (26. Dyn., 569–526 v.Chr.)
Nach dem Sieg über →Apries verfolgte der König eine Politik der Versöhnung gegen die Nachbarstaaten; allerdings scheiterte sein Versuch, die wachsende Macht des Perserreiches durch ein Bündnis mit Lydien und Babylon einzudämmen. Im Inneren gelang dagegen die Beseitigung der Spannungen zwischen Einheimischen und Griechen, für die als Handelszentrum die Stadt Naukratis gegründet wurde. Der philhellenische Herrscher („Ägyptens König“ in Schillers „Ring des Polykrates“) förderte die Heiligtümer Griechenlands durch großzügige Stiftungen. Wenige Monate nach seinem Tode wurde Ägypten von den Persern erobert.
Er wurde im Hof des „Athene“ (Neith)-Tempels von Sais bestattet; seine Grabkapelle ruhte auf palmenartigen Säulen und war mit Flügeltüren geschlossen; sie lag etwas weiter vom Heiligtum entfernt als die Grablege der früheren legitimen Herrscher der saitischen Dynastie (Hdt. 2,169; 3,10).
Nach der Eroberung Ägyptens ließ der siegreiche →Kambyses die Leiche exhumieren, geißeln, ihre Haare ausreißen und sie auf vielfache Weise schänden; schließlich wurde sie in bewußter Verletzung des ägyptischen Totenglaubens verbrannt (Hdt. 3,16).
Amenemhet I.
Ägyptischer König (12. Dyn., 1991–1961 v.Chr.)
Zunächst Wesir Mentuhoteps IV., begründete er als König eine neue Dynastie in Ägypten. Er verlegte die Hauptstadt des Reiches von Theben nach Memphis, erneuerte die Verwaltung und mehrte die königliche Autorität. Das Reich wurde durch Grenzbefestigungen gesichert; Feldzüge gegen die Nachbarvölker unternahm der Herrscher erst in späteren Jahren. Zur Sicherung der Nachfolge erhob er seinen Sohn →Sesostris (I.) zum Mitregenten. Der König fiel einer Palastrevolution zum Opfer.
Nahe der neuen Hauptstadt Itj-tawi beim heutigen Lischt ließ Amenemhet seine Pyramide (ursprünglich 58 m hoch) auftürmen. Während die Gesamtanlage in bewußter Anknüpfung an das Alte Reich dem Vorbild der Bauten von Sakkara verhaftet ist, entsprechen der zweistufige Unterbau, der offene Aufweg und der senkrechte Schacht zur Grabkammer thebanischer Sitte. Der Kernbau ist unterhalb der Verkleidung unregelmäßig errichtet, wobei Kalksteinblöcke von älteren Bauten, v.a. aus Gizeh und Sakkara verwendet wurden; dadurch blieben auch Reliefs vom Taltempel des →Cheops als Spolien erhalten. Östlich der Pyramide lag der Totentempel, den Sesostris I. erneuern ließ; den Grabbau umgaben Schachtgräber von Mitgliedern der königlichen Familie und Mastabas hoher Würdenträger.
Lit.: B. Porter – R. L. B. Moss, Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs, and Paintings IV, Oxford 1934, 77-81
R. Stadelmann, Die ägyptischen Pyramiden, Mainz 1985, 230f.
Amenemhet II.
Ägyptischer König (12. Dyn., 1929–1895 v.Chr. )
Als Mitregent und Nachfolger seines Vaters →Sesostris I. setzte er dessen Politik fort; die unumstrittene außenpolitische Stellung des Reiches machte militärische Maßnahmen unnötig. Daher war seine Regierung von Frieden, Wohlstand und kultureller Blüte geprägt.
Bei Dahschur entstand die „Weiße Pyramide“ des Königs, deren Blöcke vielfach Beute von Steinräubern wurden. Auch ihr inneres Gerippe war aus dem hellen Kalkstein errichtet und mit Sand aufgefüllt. Am Eingang des Bezirkes erhoben sich zwei Pylonen; zur Pyramide gelangte man über einen offenen Aufweg. Von der Grabkammer mit dem Sandsteinsarkophag des Herrschers führte ein Korridor in einen kleinen Schacht.
Westlich des Baus liegen Gräber von Prinzessinnen, die reiche Funde aufwiesen; der Totentempel blieb nicht erhalten.
Lit.: B. Porter – R. L. B. Moss, Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs, and Paintings III, Oxford 1981, 885f.
R. Stadelmann, Die ägyptischen Pyramiden, Mainz 1985, 234
Amenemhet III.Abb. 2
Ägyptischer König (12. Dyn., 1842–1797 v.Chr.)
Seine friedliche Herrschaft brachte dem Nilland eine wirtschaftliche und künstlerische Blüte, die sich in zahlreichen großartigen Bauten manifestierte. Die von seinen Vorgängern begonnene Kultivierung des Fayum wurde durch die Anlegung eines einzigartigen Kanalsystems vollendet.
Der König ließ nahe dem Grab seines Vaters →Sesostris III. in Dahschur eine Pyramide anlegen. Über den offenen Aufweg gelangte man zu dem steil aufragenden Bau, der aus großformatigen Ziegeln errichtet und mit Kalkstein verkleidet war; der Taltempel blieb erhalten, der Totentempel ist dagegen weitgehend zerstört. Labyrinthartige Gänge führen zur königlichen Grabkammer mit dem grandiosen Granitsarkophag, weitere Gangsysteme zu den Grabstätten der Königinnen. Der schlechte Baugrund zwang zur Aufgabe dieser Pyramide, nachdem sich Risse im Bau gezeigt hatten (Stadelmann, 241; Porter – Moss III, 887f.).
Daher errichtete Amenemhet bei Hawara am Fayum eine zweite Grablege, ähnlich der Pyramide von Dahschur. Auch hier sollten verzweigte Gänge etwaige Räuber in die Irre führen. Die Grabkammer, aus einem gewaltigen Quarzmonolith (110 t) ausgehauen, barg den königlichen Sarkophag aus Quarzit; dieser war beraubt, die Mumie verbrannt.
Nach Süden schloß sich der – fast vollständig zerstörte – Pyramidenbezirk mit zahlreichen Säulenhallen und Einzelkapellen an; der in seiner Funktion (Totentempel oder Palast?) umstrittene Komplex galt späteren griechischen Besuchern als „Labyrinth“ (Stadelmann, 241-46; Porter – Moss IV, 100f.; vgl. Hdt. 2,148).
Lit.: B. Porter – R. L. B. Moss, Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs, and Paintings III, Oxford 1981, 887f.; IV, Oxford 1934, 100f.
R. Stadelmann, Die ägyptischen Pyramiden, Mainz 1985, 241-46
Amenophis I.
Ägyptischer König (18. Dyn., 1550–1528 v.Chr.)
Der Pharao drang in Nubien bis zum zweiten Nilkatarakt vor und warf auch die in das Delta eingedrungenen Libyer zurück. Als großer Bauherr ließ er u.a. den Amun-Tempel in Karnak erweitern.
Sein Grab lag wohl in Dra abu’l Naga; die Mumie wurde in der Cachette von Deir el-Bahari (→Ahmose) entdeckt und in das Ägyptische Museum von Kairo gebracht.
Lit.: R. B. Partridge, Faces of Pharaohs. Royal Mummies and Coffins from Ancient Thebes, London 1994, 63-65
E. Thomas, The Royal Necropoleis of Thebes, Princeton 1966, 70f.
Amenophis II.
Ägyptischer König (18. Dyn., 1448–1422 v.Chr.)
Gegen den Sohn und Nachfolger →Thutmosis’ III. erhoben sich beim Tod seines Vaters die vorderasiatischen Vasallenstaaten, wurden aber bald niedergeworfen; danach sicherte der Pharao die ägyptische Herrschaft über Nubien. Der Frieden mit den anderen Großmächten des Alten Orients ermöglichte eine großzügige Baupolitik.
Er wurde im Tal der Könige (→Thutmosis I.) in einem Grab (Nr. 35) beigesetzt, das in der Gesamtanlage der Gruft seines Vaters folgte. Stufen und Gänge führen über einen zum Schutz vor Grabräubern angelegten senkrechten Schacht zu einem schmucklosen Saal auf zwei Stützen, von dort zu einem zweiten Saal. Dieser ruht auf sechs Pfeilern, die erstmals den Pharao vor den Totengöttern Osiris, Anubis und Hathor zeigen; die Wände tragen Illustrationen zum „Unterweltbuch“, die Decke einen gestirnten Himmel.
In der angrenzenden Krypta steht der Granitsarkophag des Königs, in dem seine unversehrte Mumie lag; nach der Beraubung des Grabes war sie hier unter der 21. Dynastie erneut bestattet worden; daß seine Ruhe danach nicht mehr gestört wurde, zeigten die bei der zweiten Beisetzung erneuerten Kränze.
Wegen seiner hervorragenden Lage wurden die Seitenkammern des Grabes gleichzeitig von dem thebanischen Hohenpriester Pinudjem I. als Cachette für mehrere andere Pharaonen genutzt (→Ahmose).
Lit.: R. B. Partridge, Faces of Pharaohs. Royal Mummies and Coffins from Ancient Thebes, London 1994, 82-84
E. Thomas, The Royal Necropoleis of Thebes, Princeton 1966, 77f.
Amenophis III.
Ägyptischer König (18. Dyn., 1413–1375 v.Chr.)
Unter seiner Regierung erlebte Ägypten eine einzigartige Blüte: Von Nubien bis Syrien herrschte Frieden, die wirtschaftliche Prosperität ermöglichte reiches künstlerisches Schaffen; v.a. in den gewaltigen Tempelanlagen von Karnak und Luxor manifestierte sich eine neue Tendenz zur Kolossalarchitektur, die für das Neue Reich charakteristisch wurde.
Sein Grab im Tal der Könige (Nr. 22; →Thutmosis I.) folgt in der Reihung von Schacht, Vorraum, Halle und Krypta der Gruft Thutmosis’ IV. (Nr. 43). Die Gewölbe zeigen den Sternenhimmel, Wände und Pfeiler den König vor den Gottheiten der Unterwelt; dabei erscheint der Herrscher erstmals von seinem „Ka“ begleitet. In der Krypta fand sich ein zerbrochener Sarkophagdeckel aus rötlichem Granit; die schwerstbeschädigte Mumie wurde dagegen in der Cachette im Grab →Amenophis’ II. entdeckt und in das Museum von Kairo verbracht.
Vom Totentempel des Pharao blieben lediglich die beiden monumentalen Skulpturen erhalten, die einst den Eingang des Heiligtums flankierten, von der Nachwelt nach dem mythischen Helden des Trojanischen Krieges „Memnonskolosse“ genannt.
Lit.: R. B. Partridge, Faces of Pharaohs. Royal Mummies and Coffins from Ancient Thebes, London 1994, 118-20
E. Thomas, The Royal Necropoleis of Thebes, Princeton 1966, 83-87
Amenophis IV.
→Echnaton
Amenophis (Hapu)
ÄgyptischerWesir (um 1400 v.Chr.)
Vom Armeeschreiber stieg der Sohn des Hapu unter →Amenophis III. zu einem der bedeutendsten Würdenträger des Neuen Reiches auf; u.a. war er Befehlshaber der königlichen Garde, führte die Steueraufsicht und leitete die Grenzsicherung; schließlich erlangte er als Wesir das höchste Amt im ägyptischen Staat. Nach seinem Tod im Alter von etwa 80 Jahren wurde er als Weiser, später als Gott verehrt.
Als einzigartige Ehrung erhielt er einen eigenen Totentempel in Theben in der Nähe des Totentempels seines königlichen Herrn (dazu: C. Robichon – A. Varille, Le temple du scribe royal Amenhotep, fils de Hapou (FIFAO 11, 1936), Kairo 1936).
Das Grab des Amenophis (Hapu) kann angesichts seines hohen Ranges und der Lage des Totentempels gleichfalls in Theben-West vermutet werden, nahe den Königsgräbern und diesen ähnlich angelegt. Hypothetisch wurde ihm das Felsgrab Bab el-Maaleg nordwestlich von Deir el-Medineh auf dem Weg zum Tal der Könige zugeordnet. Die in mehreren Museen bewahrten Fragmente seiner beiden Sarkophage aus schwarzem Granit bezeugen durch ihre Qualität und die Ähnlichkeit mit königlichen Särgen die außergewöhnlich ehrenvolle Beisetzung des Wesirs.
Das ihm ebenfalls zugeschriebene Grab in Qurnet Murrai hatte Amenophis vielleicht vor seinem kometenhaften Aufstieg als private Ruhestätte angelegt; darauf läßt auch schließen, daß diese – nunmehr nicht mehr benötigte – Grablege unvollendet blieb.
Lit.: D.Wildung, Imhotep und Amenhotep. Gottwerdung im alten Ägypten (MÄS 36), München 1977, 287-89
Apries
Ägyptischer König (26. Dyn., 588–567 v.Chr.)
Er unterstützte den König von Juda gegen die Macht Babylons; nach anfänglichen Erfolgen der Ägypter entschied die Eroberung von Jerusalem durch →Nebukadnezar II. den Krieg (587 v.Chr.). Eine zweite schwere Niederlage erlitt der König gegen das griechische Kyrene. Die Revolte der einheimischen Soldaten wegen der Bevorzugung der griechischen Söldnerführte zur Erhebung des →Amasis; im Bürgerkrieg gegen den Usurpator kam Apries ums Leben.
Der siegreiche Amasis ließ ihn mit königlichen Ehren in der Grablege der saitischen Dynastie im Tempelbezirk der „Athene“ (Neith) zu Sais beisetzen und ordnete für ihn Totenopfer an (Hdt. 2,169; J. H. Breasted, Ancient Records of Egypt IV, Chicago 1906, 1007).
Asarhaddon
Aššurahiddin, assyrischer König (680–669 v.Chr.)
Der Sohn (und vielleicht Mörder) →Sanheribs wandte sich von der Politik seines Vaters ab und ließ das zerstörte Babylon erneuern. Trotz seiner von Götterfurcht und Aberglauben geprägten Wesensart führte er erfolgreiche Kriege gegen die benachbarten Völker; die assyrischen Truppen drangen tief in das iranische Hochland ein. In einem einmonatigen Feldzug eroberte der König Unterägypten (671 v.Chr.); als er wegen eines Aufstandes dorthin zurückkehren wollte, starb er auf dem Weg in das Nilland.
Bei neuen Untersuchungen in der königlichen Nekropole von Assur (→Assurnasirpal II.) fand man in der Gruft IV (→Assurbanipal) drei kleine Steinfragmente mit Resten von Keilschriftzeichen; sie lassen darauf schließen, daß die Grabkammer Asarhaddon oder (eher) seinen Sohn Assurbanipal barg (St. Lundström, „Es klagen die großen Kanäle…“. Die Königsgrüfte im Alten Palast von Assur, in: J. Marzahn – B. Salje, Wiedererstehendes Assur. 100 Jahre deutsche Ausgrabungen in Assyrien, Mainz 2003, 129-35 (133f.)).
Die in einer neuassyrischen Inschrift (K 7865, →Assurnasirpal II.) geschilderte aufwendige Beisetzung eines Königs bezieht E. Frahm auf die Bestattung Asarhaddons (Nabû-zuqupkēnu, das Gilgameš-Epos und der Tod Sargons II., JCS 51, 1999, 73-90 (86)).
Assurbanipal
Aššurbânapli, assyrischer König (669–um 631 v.Chr.)
Der jüngere Sohn →Asarhaddons setzte den Feldzug seines Vaters gegen Ägypten erfolgreich fort, verlor aber wenige Jahre später das Land am Nil durch den Aufstand des →Psammetich (655 v.Chr.). In vierjährigem Krieg warf er die Erhebung seines älteren Bruders in Babylon nieder (648), dann zerschlug er nach jahrelangen Kämpfen endgültig das Reich von Elam. Der ursprünglich als Gelehrter ausgebildete König besaß umfassende geistige Interessen und gründete in seiner Residenz Ninive eine riesige Bibliothek. Obwohl er den Bestand des Reiches weitgehend wahrte, wurde er – zusammen mit anderen assyrischen Herrschern – von der Legende zur weibischen Gestalt des →Sardanapal umgestaltet.
Bei neuen Untersuchungen in der Königsnekropole von Assur (→Assurnasirpal II.) wurden in der Gruft IV drei Steinfragmente mit Resten einer Inschrift entdeckt; sie lassen darauf schließen, daß Assurbanipal in der Grabkammer beigesetzt war (St. Lundström, „Es klagen die großen Kanäle…“. Die Königsgrüfte im Alten Palast von Assur, in: J. Marzahn – B. Salje,Wiedererstehendes Assur. 100 Jahre deutsche Ausgrabungen in Assyrien, Mainz 2003, 129-35 (133f.)).
Bei dieser Gruft handelt es sich um eine Grabkammer (4,6 x 2,1 m), die durch ihren eigenen Zugang von der Nekropole abgesondert ist; die Mauern sind aus Backstein errichtet und mit Lehmziegeln ummantelt. Im Inneren befinden sich Basaltfragmente, wohl von einem Sarkophag, und drei kleine Pfeiler, deren Zweck ungeklärt ist (A. Haller, Die Gräber und Grüfte von Assur, Berlin 1954, 178).
Assurnasirpal II.Abb. 3
Aššurnâsirapli, assyrischer König (883–859 v.Chr.)
Der erste große Herrscher des neuassyrischen Reiches führte zahlreiche Kriege in Südarmenien, Kleinasien und Syrien, die von grausamen Massenhinrichtungen und Deportationen ganzer Völker begleitet waren; bis zum Mittelmeer drang der König vor. Gleichzeitig wurden Verwaltung und Armee modernisiert. Die Residenz →Salmanassars I. in Kalach (Nimrud) wurde erneuert; hier entstand der bedeutendste assyrische Palastkomplex mit zahlreichen hervorragenden Reliefdarstellungen.
Bei den Ausgrabungen der Deutschen Orient-Gesellschaft in Assur wurden 1912 die assyrischen Königsgrüfte entdeckt; sie liegen innerhalb des Areals des Alten Palastes an seiner Südostseite. Die unterirdischen Grabstätten sind ineinander verschachtelt und werden durch gewölbte Rampen und Treppen mit dem Palast und untereinander verbunden. Bei den Grabungen wurden sechs Grüfte freigelegt, die bis auf die Gewölbe erhalten waren. Allerdings waren sie nicht nur ausgeraubt, sondern zeigten auch Spuren furchtbarer Verwüstung: Die Sarkophage waren in kleinste Partikel zerschmettert, die Gebeine zerstört, von den Beigaben nur Bruchstücke erhalten.
Aufgrund der Inschriften wurde die Gruft V als Grablege Assurnasirpals II. identifiziert. In den Gruftraum (7,3 x 3,75 m) führt eine schwere Basalttür, auf beiden Seiten von der Königsinschrift flankiert, die aus Bruchstücken zusammengesetzt werden konnte. Die Mauern sind aus Backstein errichtet und mit Lehmziegeln ummantelt; sie erheben sich über drei Schichten von Basaltplatten, auf denen in ständiger Wiederholung gleichfalls die Königsinschrift erscheint. Auch der Fußboden besteht aus Basaltplatten, in die Wände sind Lampennischen eingelassen.
Teilweise in den Boden versenkt war der gewaltige Basaltsarkophag (3,95 x 1,85 m, Höhe 1,82 m; j. im Pergamon-Museum: G. R. Meyer, Durch vier Jahrtausende altvorderasiatischer Kultur, Berlin 1962, 218-21); Knäufe auf Schmalseiten und Deckel dienten wohl zu seiner Versiegelung. Nahezu alle Wände des Sarges trugen die Königsinschrift, auch die nicht sichtbare Unterseite (Haller, 178-80); sie lautete:
„(Das ist der) Palast des Assurnasirpal, des Königs der Gesamtheit,
des Königs von Assur, Sohn des Tukulti-Ninurta, des Königs von Assur,
des Königs der Gesamtheit, Sohn des Adadnirari, des Königs von Assur,
des Königs der Gesamtheit“ (Lundström, 132).
Die für Menschen unsichtbare Namensinschrift des Königs begegnet auch auf den Lehmziegeln und der Unterseite der Bodenplatten; sie scheint den Verstorbenen wie eine schützende Hülle zu umgeben (Lundström, 133).
Das Bestattungsritual der assyrischen Herrscher, mit dem die durch den Tod des Königs gestörte kosmische Ordnung wiederhergestellt werden sollte, läßt sich aus sumerischen und babylonischen Parallelen erschließen (→Nebukadnezar II.); die Konservierung der Leichen kann vermutet werden (vgl. Hdt. 1,198). Mit dem Grabzeremoniell begann die für den Fortbestand des Staates unabdingbare Ahnenverehrung; im Alten Palast von Assur, der politischen und sakralen Metropole des Reiches, fanden zweimal im Monat Opfer und Anrufungen der verstorbenen Könige statt (Lundström, 129f.). Offenbar waren aber nicht alle Herrscher Assyriens hier beigesetzt; ob sie in den anderen Residenzen des Reiches ruhten oder ihre Grabstätten zerstört wurden, ist nicht bekannt.
Die Königsgräber müssen ungeheure Schätze geborgen haben; eine Vorstellung ihres Reichtums vermitteln die vor wenigen Jahren in Kalach (Nimrud) entdeckten Ruhestätten der assyrischen Königinnen des 9./8. Jhs. v.Chr., unter ihnen auch der Gemahlin Assurnasirpals II., mit ihren kostbaren Goldfunden (dazu: M. S. B. Damerji, Gräber assyrischer Königinnen aus Nimrud, Mainz 1999, mit reichem Bildmaterial); in ihrer Architektur gleichen sie den Königsgrüften von Assur. Die Annahme reicher Grabbeigaben bestätigt eine neuassyrische Inschrift (K 7856) mit der Beschreibung einer königlichen Beisetzung: Der Leichnam wurde gesalbt, der Sarkophag gesiegelt und durch einen starken Zauber gesichert; reiche Gewänder und Textilien, kostbare Gefäße und Schmuck wurden dem Toten in das Grab gelegt, ferner zehn Pferde, 30 Ochsen und 300 Schafe (Mc Ginnis, 4f.); die Beigaben dienten wohl ebenso für das künftige Leben im Jenseits wie als Geschenke für die Götter der Unterwelt, die Tiere zur Nahrung und als Zugtiere auf dem weiten Weg (Mc Ginnis, 9f.).
Daß die Schätze, die wir für die Gruft Assurnasirpals ebenfalls voraussetzen dürfen, bei der Eroberung Assurs durch die Meder im 7. Jh. geraubt wurden, kann nicht verwundern. Aber die Spuren der Zerstörung weisen weit über den üblichen Vandalismus beutegieriger Krieger hinaus; systematisch wurden die Gebeine der Ahnenkönige der besiegten Assyrer und ihre Inschriften als Träger der Erinnerung zu kleinsten Teilchen zermalmt. Dabei handelte es sich offenbar um eine brutale Rache für die ebenso grausame Vernichtung der elamischen Herrschergräber durch den letzten bedeutenden Assyrerkönig →Assurbanipal. Die Zerstörung der Gebeine aber war von höchster religiöser und politischer Bedeutung: Sie unterbrach die Verbindung in das Jenseits zu den Ahnen und beraubte so das Volk einer entscheidenden Quelle seiner Kraft (Lundström, 134f.).
Lit.: A. Haller, Die Gräber und Grüfte von Assur, Berlin 1954, 170-81
St. Lundström, „Es klagen die großen Kanäle…“. Die Königsgrüfte im Alten Palast von Assur,
in: J. Marzahn – B. Salje,Wiedererstehendes Assur. 100 Jahre deutsche Ausgrabungen in
Assyrien, Mainz 2003, 129-35
J. Mc Ginnis,ANeo-Assyrian Text describing a Royal Funeral, SAAB I/1, 1987, 1-12
C
CheopsAbb. 4/5
Ägyptischer König (4. Dyn., 2553–2530 v.Chr.)
Der Sohn des →Snofru ließ zahlreiche Tempel errichten und erneuern. Seine Macht und die wirtschaftliche Blüte des Alten Reiches spiegeln sich v.a. in seiner gewaltigen Pyramide, die auch die organisatorische Leistungsfähigkeit des ägyptischen Staates zeigt: An jedem Tag der überlieferten 23jährigen Herrschaft des Königs wurden – nur für den Grabbau – durchschnittlich 800 t Kalkstein verarbeitet – vom Herausbrechen aus dem Fels bis zum Einfügen in den Bau.
Bei Gizeh ließ der König seine Pyramide errichten, die mit den benachbarten Grabbauten des →Chephren und →Mykerinos zu den Sieben Weltwundern des Altertums zählte. Mit einer Seitenlänge von 230 m und einer ursprünglichen Höhe von 146,6 (j. 137) m übertraf sie ebenso wie in der Größe ihrer ohne Mörtel verlegten Blöcke alle anderen Pyramiden des Nillandes. Die ursprüngliche Ummantelung aus Kalkstein ist verloren. Beeindruckend ist die Masse des Bauwerkes mit 6 Mio. Tonnen Stein, mehr noch die Exaktheit seiner Ausführung – die größte Abweichung in der Horizontalen beträgt 16 mm. Die ungeheure Grabstätte spiegelt die Vorstellung des Alten Reiches, daß der König auch nach seinem Tod Heil und Wohlstand des Landes gewährleistete.
In verschiedenen Bauphasen entstanden in ihrem Inneren drei Gangsysteme; das erste im Fels nach dem Vorbild der ältesten Pyramiden; ein zweites über dem Felskern des Baus; der jüngste Gang führt in die Mitte der Pyramide und wandelt sich zu einer hohen Galerie, die in eine granitene Grabkammer mit Giebeldach mündet. Der schmucklose Raum birgt einen schlichten Granitsarkophag; Reste der Mumie wurden nicht entdeckt.
Um die Cheopspyramide liegen drei Königinnenpyramiden und Mastabas seiner Söhne, Reste des Totentempels sowie Schiffsgruben für die Barken des Sonnengottes und das Schiff des Königs, das wohl seinen Leichnam zur Grabstätte gebracht hatte.
Lit.: R. Stadelmann, Die ägyptischen Pyramiden, Mainz 1985, 105-26
ChephrenAbb. 4/6
Ägyptischer König (4. Dyn., 2522–2496 v.Chr.)
Über die Regierungszeit von Cheops’ jüngerem Sohn ist wenig bekannt. Die gewaltigen Ausmaße seiner Pyramide und des vorgelagerten Sphinx lassen auf die Prosperität des Reiches unter Chephrens Herrschaft schließen.
Südlich der Grabstätte des Vaters ließ der König seine Pyramide (215 m Seitenlänge, ursprünglich 143,5 m Höhe) errichten, die durch ihre wesentlich größer geplanten Ausmaße und die höhere Lage den Bau des →Cheops noch übertreffen sollte. Prunkvoll muß ihre (an der Spitze erhaltene) Verkleidung gewirkt haben – an der Basis aus Granit, in den oberen Lagen aus Kalkstein. Die Grabkammer barg einen schlichten Granitsarkophag, dessen Deckel bei der gewaltsamen Öffnung zerbrochen wurde.
Der Pyramidenbezirk umfaßte eine Kultpyramide, den Taltempel mit Aufgang, den Totentempel und fünf Bootsgruben, v.a. aber die gewaltige Wächterfigur des Sphinx mit dem Kopf des Königs und dem Leib eines Löwen.
Lit.: R. Stadelmann, Die ägyptischen Pyramiden, Mainz 1985, 130-39
D
Daniel
Jüdischer Prophet (2. Jh. v.Chr.)
Nach biblischem Bericht lebte Daniel als jüdischer Seher amHof →Nebukadnezars II. zu Babylon; geschildert werden seine oft gefahrvollen Erlebnisse und Visionen. In der Lehre von den vier Weltreichen hat eine seiner Traumdeutungen das christliche Geschichtsdenken durch Jahrhunderte geprägt.
Tatsächlich entstand das Buch Daniel erst in seleukidischer Zeit; weder Verfasser noch Prophet sind historisch faßbar.
Angebliche Gräber des auch von den Moslems verehrten Sehers werden in Alexandria (Nebi-Daniel-Moschee), Babylon, Mal Amir (Iran) und bei Susa gezeigt.
David
Jüdischer König (um 1000 v.Chr.)
Bereits als Jüngling am Hofe des Königs →Saul wurde er beim Volk beliebt, v.a. durch den erfolgreichen Zweikampf gegen den Philister Goliath; vor dem Neid des Herrschers mußte er zunächst fliehen, wurde aber nach dessen Tod zum Nachfolger erhoben. David einte die jüdischen Stämme, begründete eine Verwaltung nach ägyptischem Vorbild und gab Israel durch Siege über die Nachbarvölker die größte Ausdehnung seiner Geschichte; Jerusalem wurde zur Hauptstadt des neuen Reiches. Der König traf Vorbereitungen zum Bau eines Tempels für seinen Gott, den er nach der Überlieferung mit seinen Psalmen besang.
Er wurde in der Davidsstadt von Jerusalem mit großem Aufwand bestattet (1 Kön 2,10; Ios. AJ 7,15,3). Die Ruhestätte umschloß auch die Grabkammer seines Sohnes →Salomon; dreizehn weitere Herrscher wurden später hier beigesetzt. Die königliche Nekropole lag oberhalb des Siloah-Teiches nahe der Stadtmauer; sie war noch Jahrhunderte später bekannt (Nem 3,16; Apg 2,29) und wurde von den Juden verehrt (Dio 69,14,2).
Nach legendärem Bericht öffnete der Hohepriester Hyrkanos I. während der Belagerung Jerusalems durch →Antiochos VII. Sidetes die Grabstätte und entnahm ihr 3.000 Talente Silber, mit denen er den Abzug des seleukidischen Herrschers erkaufte (Ios. AJ 7,15,3). SeinemBeispiel folgte →Herodes d. Gr., der angeblich aus dem Grab weitere Schätze raubte; der Versuch, bis zu den verborgenen Grabkammern selbst vorzudringen, scheiterte jedoch an der Entzündung von Erdgasen, die als Strafe für den Frevel empfunden wurde. Zur Sühne ließ der König am Eingang der Gruft ein marmornes Denkmal errichten (Ios. AJ 7,15,3, u. 16,7,1), das während des →Bar-Kochba-Aufstandes ohne gewaltsame Einwirkung einstürzte (Dio 69,14,2).
Vermutlich wurde das Grab Davids in diesem Krieg oder bei der Errichtung der hadrianischen Stadt Aelia Capitolina zerstört, später vergessen und vom Volksglauben nach Zion verlegt (Encyclopaedia Judaica V, Jerusalem 1971, 1329); dort wird es heute unterhalb des Abendmahlssaales der Christen als jüdisches Heiligtum verehrt.
Einige monumentale Gräber im Süden der Davidsstadt wurden hypothetisch als die biblisch bezeugte Königsnekropole identifiziert; doch ist zur Klärung dieser Frage weitere archäologische Forschung notwendig (Encyclopaedia Judaica IX, Jerusalem 1971, 1525).
DjoserAbb. 7
Ägyptischer König (3. Dyn., 2632–2613 v.Chr.)
Er erweiterte den ägyptischen Machtbereich im Süden bis zum ersten Nilkatarakt. Mit der Errichtung seiner Stufenpyramide und des Totentempels bei Sakkara begründete er die Tradition der steinernen Monumentalgräber für die Herrscher des Nillandes.
Auf dem Gräberfeld der Hauptstadt Memphis bei Sakkara errichtete →Imhotep für den König eine Stufenpyramide (Stufenmastaba), den ersten monumentalen Steinbau der Geschichte; die gewaltige Grabanlage sollte die Verehrung des Herrschers auf ewige Zeit gewährleisten. Die Grablege entstand in mehreren Abschnitten: Zunächst wurde eine Mastaba angelegt und mehrfach erweitert; später setzte man vier zurücktretende Aufbauten, zuletzt zwei weitere Stufen auf. Der vollendete Bau, mit Kalkstein verkleidet, ragt auf einer Grundfläche von 109 x 121 m zu einer Höhe von etwa 60 m auf.
Die königliche Grabkammer aus Granit ist von außen durch einen Gang erreichbar; sie liegt unterhalb eines Schachtes, in dem Reste der Mumie und ein vergoldeter Schädel gefunden wurden. Das Innere umschließt weitere Grabkammern für die Angehörigen des verstorbenen Herrschers sowie Magazine mit Tausenden von Gefäßen zu seiner Versorgung. Einige Gänge mit Wanddekor aus blaugrüner Fayence wurden als „Mattenpalast“ gedeutet, dessen Farbgebung den in Oberägypten üblichen Wandbehängen aus Schilfmatten glich.
Die Stufenmastaba liegt in einem gewaltigen Baukomplex (545 x 280 m), der weitere Vorratsräume, den Totentempel und eine Kammer mit der Statue des Königs sowie den „Totenpalast“ umschloß; dieser sollte wohl als ewige Residenz für die auch nach dem Tod weiterwirkende Kraft des Verstorbenen dienen. Die Räume waren mit Steinen aufgefüllt, so daß jedem Lebenden der Zugang verwehrt war. Die steinerne Architektur folgte den baulichen Formen von Holz und Lehmziegeln, aus denen der Palast errichtet war, der dem Herrscher zu Lebzeiten als Wohnsitz gedient hatte.
Im Süden der Pyramide lag ein zweites Grab, gleichfalls mit Magazinen und Fayenceschmuck ausgestattet; wahrscheinlich handelte es sich dabei um ein Scheingrab für die Kanopen oder das „Ka“ des Königs.
Lit.: R. Stadelmann, Die ägyptischen Pyramiden, Mainz 1985, 36-71
E
Echnaton
Ägyptischer König (18. Dyn., 1375–1358 v.Chr.)
Der Sohn und Nachfolger →Amenophis’ III. setzte in revolutionärer Abkehr von jahrhundertealten Traditionen seinen Gott Aton – die Sonnenscheibe – an die Stelle des ägyptischen Götterkosmos; seinen alten Namen Amenophis IV. legte er ab und nannte sich nach dem neuen Gott, den er in einem Hymnus besang. Unklar ist, ob Echnatons Monotheismus auf religiösem Idealismus beruhte oder dem Wunsch, die einflußreiche Priesterschaft zu entmachten. Der Pharao gründete eine neue Hauptstadt in Amarna; nach ihr wurde der künstlerische Stil seiner Epoche benannt, der von realistisch-karikaturenhaften Porträts und bisher unerhört privater Darstellung der Herrscherfamilie geprägt war. Die Vernachlässigung der Außenpolitik führte zum Zerfall der ägyptischen Herrschaft in Vorderasien.
Nahe seiner neuen Residenz Achet-Aton (Amarna) ließ der König ein Felsgrab anlegen, das einige Abweichungen von dem in der 18. Dynastie üblichen Grundriß aufwies. Ein Korridor führte vom Eingang zu einem Schacht, der den Zugang zur Hauptgrabkammer versperrte. Diese weist eine fast unmerkliche Bodenerhebung für den Sarkophag auf; der ursprüngliche Wanddekor ist weitgehend zerstört. Eine der drei Nebenkammern umschloß das Grab der Prinzessin Meketaton; die hier erhaltenen Stuckreliefs illustrieren die Hymne ihres Vaters auf seinen Gott und zeigen die Trauer des Herrscherpaares um die Verstorbene (Martin, 1989).
Drei große Granitsarkophage aus dem Königsgrab von Amarna, die aus den Bruchstücken rekonstruiert wurden, bewahrt das Ägyptische Museum Kairo; ihre Reliefs zeigen Herrschersymbole und Szenen der Verehrung Atons; auf den Ecken erscheint →Nofretete, einer Schutzgöttin gleich. Der Grabausstattung des Königs entstammen auch der (unbenutzte) Kanopenschrein aus Alabaster sowie zahlreiche Uschebtis (Martin, 1974, 13-72). Diese Funde lassen darauf schließen, daß Echnaton hier bestattet wurde (H. A. Schlögel, Amenophis IV. Echnaton, Reinbek 1986, 116), zumal er auf einer Stele inschriftlich verfügt hatte, ihn selbst, seine Gemahlin Nofretete sowie die Tochter Meretaton an diesem Ort beizusetzen (Davies, 30).
Das spätere Schicksal der Gebeine des „Ketzerkönigs“ ist umstritten; seine Mumie wurde bisher nicht entdeckt. Ein zweifelhafter Bericht beschreibt die Auffindung einer in Stücke gerissenen Mumie vor seinem Felsgrab (Thomas, 89). Die Vermutung, das Grab Nr. 55 im Tal der Könige (→Thutmosis I.) sei von den Anhängern Echnatons als Versteck seiner Leiche vor der Zerstörungswut der siegreichen Anbeter Amuns benutzt worden (A. Gardiner, The socalled Tomb of Queen Tiye, JEA 43, 1957, 10-25; C. N. Reeves, A Reappraisal of Tomb 55 in the Valley of the Kings, JEA 67, 1981, 48-55), darf seit der Untersuchung der dort aufgefundenen Mumie und ihrer höchstwahrscheinlichen Identifizierung mit dem Pharao Semenchkare als widerlegt gelten (R. G. Harrison, An anatomical Examination of the Pharaonic Remains purported to be Akhenaten, JEA 52, 1966, 95-119).
Lit.: N. de G. Davies, The Rock Tombs of El Amarna, London 1908
G. Th. Martin, The Royal Tomb at El-Amarna I. The Objects, London 1974. II. The Reliefs,
Inscriptions, and Architecture, London 1989
J. D. S. Pendlebury, Report on the Clearance of the Royal Tomb at El-Amarna, ASAE 31, 1931, 123-25
E. Thomas, The Royal Necropoleis of Thebes, Princeton 1966, 87-89
Elias
Jüdischer Prophet (9. Jh. v.Chr.)
Er war der religiöse Führer der monotheistischen Erhebung gegen den von König →Achab geförderten Kult des syrischen Fruchtbarkeitsgottes Baal; sein Wirken trug zum Sturz des Königshauses bei. Allerdings ist der historische Kern des Geschehens hinter legendärer Umformung schwer erkennbar. Hochverehrt wurde Elias im späten Judentum, im Islam und in der Ostkirche.
Nach dem biblischen Bericht wurde er „in einem feurigen Wagen mit feurigen Pferden“ in den Himmel entrückt (2 Kön 2,11); daher konnte keine Grabstätte existieren. Dennoch wurde in Jerusalem ein legendäres Grab des Propheten gezeigt (Jüdisches Lexikon II, Berlin 1928, 354).
H
Hammurabi
Hammurapi, König von Babylon (1728–1686 v.Chr.)
Als Herrscher des bis dahin unbedeutenden Babylon mehrte er seine Macht durch eine geschickte Bündnispolitik zwischen den Mächten des Zweistromlandes und durch militärische Erfolge; mit der Eroberung von Babylonien, Assyrien und des syrischen Mari schuf der König ein Großreich. Universalhistorische Bedeutung aber erlangte er als erster großer Gesetzgeber der Geschichte; Straf-, Zivil- und Handelsrecht faßte er in seinem Codex zusammen, der auf einer in Susa gefundenen Stele erhalten blieb (j. im Louvre). Auch wenn seinem Reich keine Dauer beschieden war, begründete Hammurabi für Jahrhunderte die führende geistige und kulturelle Rolle Babylons in Mesopotamien.
Keine Überlieferung.
Haremhab
Ägyptischer König (18. Dyn., 1346–1321 v.Chr.)
Unter →Tutanchamun einflußreicher Militär, stieg Haremhab in der folgenden Zeit der Anarchie zum König auf. Er wandte sich von den religiösen Neuerungen →Echnatons ab und stellte die Verehrung der alten Götter wieder her. Der Machtmißbrauch der Beamten wurde energisch bekämpft, die ägyptische Herrschaft in Palästina erneuert. Mit der Erhebung seines Freundes →Ramses (I.) zum Wesir, später zum Mitregenten schuf der Pharao die Grundlage für den Aufstieg der Ramessiden.
Vor der Erhebung zum König hatte sich Haremhab bei Sakkara ein reich ausgestattetes Privatgrab errichtet, in dem seine erste Gemahlin beigesetzt wurde. Die Reliefs mit Opferszenen und Darstellungen aus der militärischen Laufbahn des Stifters zählen zu den bedeutendsten Zeugnissen des Amarna-Stils.
Als Pharao ließ er eine neue Grablege im Tal der Könige (Nr. 57; →Thutmosis I.) anlegen. Ein Korridor führt geradewegs – ohne die sonst üblichen Knicke in der Achse – zu Pfeilerhalle und Krypta. Decke und Wände zeigen die typischen Darstellungen: den gestirnten Himmel und den Herrscher vor den Göttern, unter denen erstmals Horus als Sohn der Isis erscheint, ebenso Illustrationen aus dem „Buch der Pforten“. Da der Dekor unvollendet blieb, werden die Arbeitsgänge in ihrem Ablauf sichtbar.
Unter dem Sarkophag aus rötlichem Granit waren kleine Vertiefungen ausgehauen, in denen hölzerne Götterstatuetten gleichsam den Sarg des Königs stützten; zu den Grabfunden zählten zwei Holzfiguren, die für die Zeremonie der „Mundöffnung“ gedient hatten. Über die hier entdeckten menschlichen Gebeine liegen höchst widersprüchliche Berichte vor; in jedem Fall stammen sie von mehreren Personen. Die Mumie Haremhabs wurde nicht gefunden (Thomas, 95f.).
Lit.: E. Hornung, Das Grab des Haremhab im Tal der Könige, Bern 1971
E. Thomas, The Royal Necropoleis of Thebes, Princeton 1966, 92-96
G. Th. Thorndike, The Memphite Tomb of Horemheb, Commander - in - Chief of Tutankhamun, London 1989
HatschepsutAbb. 8
Ägyptische Königin (18. Dyn., 1502–1481 v.Chr.)
Die Tochter Thutmosis’ I. sowie Halbschwester und Witwe Thutmosis’ II. führte die Regentschaft für →Thutmosis III.. Später nahm sie selbst den Pharaonentitel an; obwohl offiziell gemeinsam mit dem jungen König, führte sie tatsächlich allein die Regierung. In Abkehr von der expansiven Politik ihrer Vorgänger widmete sie sich der Sicherung von Frieden und Wohlstand; diesem Ziel diente auch die Expedition in das Weihrauchland Punt.
Das Ende ihrer Herrschaft liegt im Dunkeln; ihr Neffe und Stiefsohn Thutmosis III. verhängte über die erste bedeutende Frau der Geschichte die Damnatio Memoriae.
Das berühmteste Monument der Königin ist ihr terrassenförmig angelegter Totentempel in Deir el-Bahari bei Theben mit den Reliefdarstellungen ihrer mythischen Geburt und der Expedition nach Punt. In seiner Achse liegt im Tal der Könige (→Thutmosis I.) das Grab der Hatschepsut (Nr. 20).
Von den anderen dortigen Grabstätten unterscheidet es sich durch eine ungewöhnliche Länge (213 m) und Tiefe (97 m), die vielleicht auf den Wunsch der Königin zurückgeht, ihre Ruhestätte möglichst nahe an das Sanktuarium ihres Totentempels heranzuführen. Das Grab blieb unvollendet und daher ohne Dekor; lediglich Kalksteinplatten mit Illustrationen zum „Unterweltbuch“ wurden gefunden.
In der Grabkammer standen zwei Sarkophage für die Königin und ihren Vater Thutmosis I., dessen Grabausstattung teilweise hierher verbracht wurde; unter den Funden ragt ein Kanopenschrein hervor. Ob Hatschepsut tatsächlich an diesem Ort beigesetzt wurde, bleibt angesichts ihres unbekannten Schicksals und der Tilgung ihres Andenkens ungeklärt.
Lit.: Th. Davis – E. Naville – H. Carter, The Tomb of Hatchopsitu, London 1906
E. Thomas, The Royal Necropoleis of Thebes, Princeton 1966, 75-77
Hattusili III.
Hattušili, hethitischer König (um 1275–1250 v.Chr.)
Der Bruder →Muwatallis stürzte seinen Neffen, den rechtmäßigen König – auf göttlichen Befehl, wie er in seiner ausführlichen Rechtfertigungsschrift darlegte. Mit →Ramses II. schloß er dauerhaft Frieden; das lange umkämpfte Syrien wurde zwischen den beiden Großmächten geteilt, zwei Töchter des hethitischen Herrschers mit dem Pharao vermählt. In seiner Residenz Hattusa ließ der König großartige Bauten errichten.
Keine Überlieferung.
Es ist zwar anzunehmen, daß die Hethiterkönige nahe der Hauptstadt Hattusa beigesetzt wurden, doch wurden bisher keine Herrschergräber entdeckt (V. Haas, Geschichte der hethitischen Religion, Leiden 1994, 218f.). Als Kultstätten für Tuthalija I., →Mursili II. und Hattusili III. wurden drei kleine Heiligtümer im Tempel 5 von Hattusa hypothetisch identifiziert (P. Neve, Hattuša – Stadt der Götter und Tempel, Mainz 1993, 34-36).
Das vierzehn Tage währende Totenritual der Könige vollzog sich in ihrer Residenz; es glich den bei Homer beschriebenen Bestattungsbräuchen (→Achilleus) und weist so auf die gemeinsame indogermanische Wurzel von Griechen und Hethitern.
Am ersten Tag wurde allgemeines Fasten gehalten, ein Rind sowie Wein als Opfer dargebracht. Tags darauf überführte man den Leichnam des Königs auf den Verbrennungsplatz „ukturi“ („ewig“); nach der Totenklage wurde er – wohl in der Nacht zum dritten Tag – verbrannt, die Gebeine geborgen und mit Linnen umhüllt, danach eine Beschwörungszeremonie abgehalten. Am sechsten Tag erfolgte die Beisetzung des Toten im „Steinhaus“ auf einem Bett, dann die Totenopfer. Die Grabbeigaben wurden am achten Tag an ein Bild des Verstorbenen übergeben: Rinder und Schafe, Pferde und Maultiere, ein Stück Wiese sowie zerbrochenes bäuerliches Gerät symbolisierten, daß auf den Toten im Jenseits ein Leben als Bauer und Viehzüchter harrte. Man schlug einen Weinstock als Sinnbild des Lebens ab, dann wurde das Bild des Herrschers verbrannt (13. Tag), zuletzt seine Seele durch die Opferung von Broten besänftigt (Haas, 216-29).
I
Imhotep
Ägyptischer Architekt (um 2630 v.Chr.)
Imhotep wirkte als Ratgeber und Arzt, Priester und Magier am Hof König →Djosers. Für ihn errichtete er die Stufenpyramide von Sakkara, den ersten monumentalen Steinbau der Welt; auch die Säule wurde erstmals in seinen Bauwerken verwendet. Durch Jahrhunderte blieb er unvergessen, als Gott und Beschützer der Schreiber verehrt. Auch die Griechen kannten ihn als „Imuthes“ und setzten ihn mit Asklepios gleich.
Aufgrund von archäologischen und literarischen Hinweisen wurde sein Grab in Sakkara-Nord lokalisiert; bisher konnte es aber nicht gefunden werden.
Lit.: D.Wildung, Imhotep und Amenhotep. Gottwerdung im alten Ägypten (MÄS 36), München 1977, 13
Isaak
Israelitischer Patriarch (19.–17. Jh. v.Chr.)
Der Sohn Abrahams gilt als der zweite der Erzväter (Patriarchen) des jüdischen Volkes; in den Erzählungen der Genesis tritt er jedoch hinter seinem Vater und den Söhnen Esau und →Jakob zurück. Wegen der von Gott geforderten Opferung durch den eigenen Vater galt er später den Christen als Symbol des Opferlammes Christus.
Die Söhne Esau und Jakob bestatten ihn im Grab seiner Vorfahren in Mamre bei Hebron, ebenso seine Frau Rebekka (Gen 35,28f.; 49,29-31); dort wird noch heute ihre Grabstätte verehrt (→Abraham).
Isaias
Jüdischer Prophet (8. Jh. v.Chr.)
Der erste der Großen Propheten Israels verkündet den Ruhm Jahwes als des einzigen und allmächtigen Gottes, auf den das Volk alle Hoffnung setzen muß. Er beklagt die Sünden der Juden und verkündet das kommende Gottesreich, das mit der Geburt des göttlichen Kindes seinen Anfang nehmen wird; daher galt er später als Künder →Christi.
Keine Überlieferung.
J
Jakob
Israelitischer Patriarch (18./17. Jh. v.Chr.)
Der Sohn des →Isaak nimmt seinem Bruder Esau mit List das Erstgeburtsrecht und muß daher fliehen; bei der Rückkehr erhält er den neuen Namen „Israel” („Streitet für Gott“). Gegen Ende seines Lebens verläßt er wegen einer Hungersnot das „Gelobte Land“ und zieht nach Ägypten. Auf seine zwölf Söhne werden in der jüdischen Tradition die Stämme Israels zurückgeführt. Seine Gestalt ist historisch nicht gesichert.
Wie seine Vorfahren Abraham und Isaak wird er auf eigenen Wunsch im Grab der Sippe in Mamre bei Hebron bestattet, wo er zuvor seine Frau Lea begrub (Gen 49,29-32); dort wird noch heute ihre Grabstätte verehrt (→Abraham).
Jeremias
Jüdischer Prophet (um 600 v.Chr.)
Trotz aller Widerstände trat er mit Bußpredigten und politisch-religiösen Mahnungen gegen die königliche Politik seiner Zeit auf; dennoch konnte er den Fall Jerusalems (587 v.Chr.) nicht verhindern. Nach der Katastrophe floh er in das ägyptische Exil. Das Buch Jeremias ist geprägt von dem tiefen Mitgefühl des Predigers mit dem Los seines besiegten Volkes.
Nach legendärer Überlieferung – die allerdings mit der Tradition seines Todes in Ägypten nicht vereinbar ist – lag sein Grab auf einem Felsvorsprung nahe den „Jeremiasgrotten“ nordöstlich des Damaskus-Tores von Jerusalem (LThK 5, 895).
Josue
Führer der Israeliten (13. Jh. v.Chr.?)
Von →Moses zum Nachfolger berufen, wird Josue zum militärischen Führer des jüdischen Volkes bei der Landnahme in Kanaan; er erobert Jericho und erringt weitere Siege. Im Alter von angeblich 110 Jahren stirbt er in Timnat-Serach (bei Nablus?). Seine Historizität ist umstritten; vielleicht wurden mehrere Wellen der semitischen Zuwanderung von der jüdischen Tradition unter seinem Namen zusammengefaßt.
Nach biblischer Überlieferung wird er auf seinem Besitz in Timnat-Serach auf dem Gebirge Ephraim nördlich vom Berg Gaasch begraben (Jos 24,30).
Judas Maccabaeus
→Klassisches Altertum.
K
Kamose
Ägyptischer König (17. Dyn., um 1580 v.Chr.)
Zu Beginn seiner Regierung in Theben noch Vasall der Hyksos, setzte er den Befreiungskrieg seines Vaters →Sekenenre-Taa gegen deren Fremdherrschaft fort; dabei drang er bis in die Gegend von Memphis vor und erneuerte die Königstitulatur der 12. Dynastie. Sein Sohn (?) →Ahmose vollendete sein Werk.
Der König wurde in Dra abu’l-Naga bei Theben in einem schlichten Sarg beigesetzt, der auf eine eilige Bestattung schließen läßt. Noch gegen Ende der 20. Dynastie war seine Ruhestätte unversehrt, dann wurde der Sarg im Sand vergraben, um ihn vor Grabräubern zu bewahren. Bei der Auffindung zerfiel die Mumie zu Staub (1857). Als Beigaben fanden sich u.a. ein Dolch und Teile eines goldenen Armreifs mit zwei Löwen und der Kartusche seines Nachfolgers; vermutlich wurde das Schmuckstück bei der Umbettung mehrerer Mitglieder der königlichen Dynastie vertauscht und gelangte so versehentlich in das Grab des Kamose.
Lit.: J. v. Beckerath, Untersuchungen zur politischen Geschichte der Zweiten Zwischenzeit in Ägypten, Glückstadt 1964, 190f.
E. Thomas, The Royal Necropoleis of Thebes, Princeton 1966, 39f.
Kroisos
→Klassisches Altertum
Kyaxares
Hvahštra, medischer König (623–584 v.Chr.)
Der dritte König der Meder gab seinem Reich eine politische und militärische Organisation. Erfolgreich kämpfte er gegen Skythen und Assyrer; gemeinsam mit den Babyloniern eroberte er Ninive und besiegelte damit das Ende des assyrischen Reiches (612 v.Chr.). ImKrieg gegen Lydien kam es zur Schlacht am Halys, die infolge der von →Thales von Milet vorhergesagten Sonnenfinsternis abgebrochen wurde (585).
Keine Überlieferung.
M
Menes
Ägyptischer König (1. Dyn., um 2900 v.Chr.)