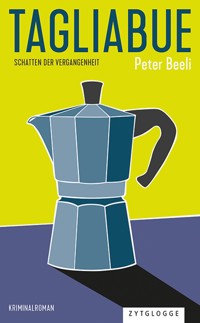Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zytglogge Verlag
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Davos, im Winter 1430: Ein Pferd kehrt allein nach Hause zurück. Vergebens wartet die Familie auf den Vater, den Landammann. Dafür trifft der älteste Sohn ein, verletzt von der Jagd mit den Wolfseisen. Zudem findet ein Fremder in der Streusiedlung Aufnahme. Mit den Schneemassen, die das Dorf von der Aussenwelt abschneiden, wächst der Hunger. Der Tod rafft die Talbewohner dahin, die Särge stapeln sich vor der Friedhofsmauer. In Abwesenheit des Landammanns macht eine andere Familie ihren Führungsanspruch geltend. Der ungewohnt lange und harte Winter weckt bei den Menschen den Verdacht, vom Herrn für ihre Sünden bestraft zu werden. Mit dem spät einsetzenden Frühling kommt der Vogt mit seinen Kriegs- und Folterknechten im Gefolge ins Tal, um Blutgericht zu halten. Seine Untersuchung fördert grausige Geheimnisse und einen Schuldigen zutage. Doch das Sterben nimmt kein Ende. Ein neuer Pfarrer predigt zwar Hoffnung, aber der Sommer bringt keinerlei Entlastung. Und dann kommt der nächste Winter.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 380
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Titel
Prolog – Eine kühle Begegnung
Der Sturm kündigt sich an
Die Fremde im Spiegel
Eine rätselhafte Wunde
Der Landammann bleibt weg
Von wärmeren Zeiten
Der Einäugige erkennt die Dinge
Die Bestie schlägt zu
Der angekündigte Abschied
Anker und Haken
Der Wolf kommt zum Mahl
Eine geht. Eine bleibt.
Tumult auf dem Totenacker
Ein Riese kommt selten allein
Feuchtfröhlicher Totenreigen
Sünde gebiert Sünde
Konzil und Exil
Der Besuch auf der Burg
Auftritt aus der Wand
Ein gutes Geschäft
Unerfreuliche Heimkehr
Sprung ins kalte Wasser
Unerwarteter Besuch
Die Carbonari ziehen ein
Hans Peters Aufbruch
Entfernte Hoffnung
Ein Blitz sorgt für Ruhe
Die Satteltasche ist zurück
Der verlorene Schatz
Ein ungebetener Gast
Nächtlicher Damenbesuch
Auge um Auge
Noch eine Machtdemonstration
Fisch. Wurm. Fischer.
Ein Baum schlägt zurück
Hunger und andere Waffen
Neuigkeiten von Vater
Messer und Münzen
Der Streit artet aus
Ein reinigendes Feuer
Epilog – Eine abgemachte Sache
Nachwort
Über den Autor
Über das Buch
Peter Beeli
Wolfseisen
Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur miteinem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2024 unterstützt.
Autor und Verlag danken für die Unterstützung:
© 2022 Zytglogge Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, BaselAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Thomas GierlKorrektorat: Anna Katharina Müller
Peter Beeli
Wolfseisen
Davoser Totenreigen
Roman
Prolog – Eine kühle Begegnung
«Weshalb versuchst du, dich von hinten anzuschleichen? Ich habe dich von Weitem gehört. Ich kenne deine Schritte. Und dann das Klirren in deinem Beutel. Die Eisen? Deine Jagd war nicht erfolgreich, wie ich sehe. Das wundert mich nicht. Das Tier nicht gefangen, und den Köder hat es wohl auch noch vom Haken gerissen. Oder hast du ihn selber gefressen? Lecker, so ein fauliges Stück Eingeweide, etwas Aas, nicht wahr?»
«Mehr bleibt uns nicht. Weil Ihr nicht für uns sorgt. Und macht trotzdem Pause? Bald zieht der erste Schneesturm des Winters auf. Ihr solltet Euch allmählich aufmachen, damit Ihr rechtzeitig ankommt, um wieder nichts für uns zu erreichen.»
«Du scheinst dich auch ohne Sturm zu verirren. Was suchst du sonst auf dieser Seite? Du solltest nicht hier sein. Treibst dich herum wie ein Landstreicher und Vagabund, der irgendwann seiner gerechten Strafe zugeführt und aufgeknüpft wird. Oder kümmerst du dich für einmal nicht um dich? Fürchtest du gar um mich?»
«Ich ängstige mich nicht um Euch, vielmehr um uns alle. Ich fürchte den nächsten Winter. Er wird für viele der letzte sein. Vor allem, wenn Ihr zurückkommt. Den Weg durch Schnee und Sturm mögt Ihr vielleicht finden, aber nicht aus unserer Not.»
«Und du glaubst, die Lösung gefunden zu haben? Deshalb suchst du mich hier auf? Selbst mein Pferd weiß sich besser zu helfen als du. Es hat mehr Kraft und vor allem mehr Kopf.»
«Wo ist es denn, Euer Ross?»
«Mein Pferd kennt deine Schritte und dich besser als ich. Es hat dich gehört, sich davon gemacht, um deiner Unberechenbarkeit auszuweichen.»
«Immerhin Euer Ross findet einen Weg. Wenn schon nicht auf uns Menschen, so solltet Ihr wenigstens auf das Tier hören.»
«Die Menschen? Kennen sie die Antwort auf die Macht Gottes, die Gewalt der Natur?»
«Es gibt eine Lösung, wenn wir bereit sind, Opfer zu bringen.»
«Gerade du, der zuerst und zuletzt an sich denkt?»
«Ihr habt recht: Ich denke auch jetzt an mich. Und Ihr irrt: Es geht mir ebenso um die anderen. Vor allem weiß ich, dass Ihr ein Opfer für alle bringt, wenn Ihr den Weg endlich frei macht.»
Der Sturm kündigt sich an
«Wann kommt Vater heim? Er sollte längst hier sein.» Die Tochter des Hauses blickte von ihrer Handarbeit auf. Die Sonne versank bereits hinter der hohen Bergkette.
«Nutze den Rest des Tages und konzentriere dich auf deine Arbeit», kam die Antwort aus der engen Nische hinter dem Ofen. Die weiche Stimme übertönte das regelmäßige, harte Klappern des Webstuhls. «Hab keine Angst. Vater kommt schon bald. Sein Heimweg ist lang und gefährlich.» Die Mutter dachte an Klein Martin, ihren Ehegatten. Ohne sie zu fragen, hatte man sie damals mit dem Unbekannten verheiratet. Sie hatte ihm fünf Kinder geschenkt und im Laufe der gemeinsamen Jahre gelernt, ihn vielleicht nicht zu lieben, aber zu achten.
Das blonde Mädchen war beruhigt, beugte sich wieder über die Stickerei. Das letzte Sonnenlicht betonte die Schönheit seines Gesichts zusätzlich. Die blauen Augen standen wie die dichten Brauen eng zusammen. Die schmale, leicht zu groß geratene Nase verlieh seinem Ausdruck etwas Majestätisches und verriet viel über seinen Durchsetzungswillen. Um seinen Mund spielte ein Lächeln, die roten Lippen bildeten einen Kontrast zu seiner weißlichen Haut und zum Grau der schlichten, groben Werktagstracht.
Gedankenverloren arbeiteten die Frauen wortlos weiter.
«Du darfst aufhören, Ursula. Hast für heute genug erledigt», unterbrach die Mutter wenig später die Stille.
Das Mädchen ließ seine Handarbeit in den geflochtenen Korb gleiten. Im Aufstehen zupfte es die Kopfbedeckung zurecht, glättete den schweren Rock und glitt zwischen Wand und Tisch über die gezimmerte Holzbank in den Raum hinein. «Ich bereite das Nachtessen.» Ursula nahm die Kerze, die auf dem Tisch gebrannt hatte, «wann kommen Paul, Martin und Hans Peter?»
«Deine Brüder sind noch vor Einbruch der Nacht zurück. Sie müssen das letzte Gras für den Winter einbringen.»
Sie verließ die enge, niedere Stube. Bei der Eingangstür duckte sie sich kurz, um sich den Kopf nicht anzuschlagen. Das Gewicht der Holzbalken, des Dachs und des Schnees hatte das Haus über viele Jahrzehnte zusammengepresst und abgedichtet, sodass es immer besser vor Kälte, Sturm und Wetter schützte.
In der Küche legte sie Holzscheite in die offene Feuerstelle. Ursula mochte die Ruhe des Raumes. Das Rühren des Breis verlangte keine Aufmerksamkeit. Sie nutzte die Gelegenheit, ihren Gedanken und Tagträumen nachzuhängen. Sie dachte an Johannes. Im Tal riefen ihn alle Klein Hans. Nicht wegen der Größe. Nur damit er nicht mit seinem Vater verwechselt wurde. Für die Messe vergangenen Sonntag hatte sich Klein Hans in die gleiche Reihe wie sie gesetzt. Von der Männerseite her hatte er den Blickkontakt gesucht. Ihr zugelacht. Grimassen gezogen. Sie musste lachen. Die Mutter und, was sie jedoch nicht beeindruckte, der Pfarrer warfen ihr tadelnde Blicke zu. Klein Hans war anders als Jöri Ambüel, den Vater zu ihrem Mann, zum Vater ihrer gemeinsamen Kinder bestimmt hatte: Für sie stimmte die getroffene Wahl nicht.
Vor hundertfünfzig Jahren hatte Ursulas Clan zu den ersten Siedlern des Tales gehört. Seit damals führte ihre Familie das Geschick der Gemeinde umsichtig und gerecht. Mit den schlechten Ernten, den kurzen Sommern und kalten Wintern der letzten Jahre waren die Zweifel und die Kritik an ihrer Vorherrschaft lauter geworden. Und Klein Martin, Ursulas Vater, hatte keinen Weg gefunden, die Ausfälle an Heu und Gras, Gemüse und Getreide, Milch und Fleisch auszugleichen. Sein gefährlicher Ausflug ins Nachbartal war ein weiterer verzweifelter Versuch, die Not in Davos zu lindern.
Jöris Familie hingegen war spät in diese Gegend gezogen. Ambüel züchtete Vieh, verkaufte es nach Norditalien, hatte sich Vermögen und Ansehen, beträchtlichen Einfluss in- und außerhalb der Gemeinde erarbeitet. Sein Reichtum erlaubte es ihm, Vorräte anzulegen und abzugeben, Sympathien zu erwerben, Abhängigkeiten zu schaffen und die Kritik der Menschen an Klein Martin zu erhöhen. Dieser hatte erkannt, dass die Auseinandersetzung mit Ambüel für niemanden von Vorteil wäre. Als guter Taktiker hatte er darum entschieden, sich mit seinem Widersacher zu verbünden, seine einzige Tochter als Pfand und Sicherheit einzusetzen und sie mit Jöri zu verkuppeln.
Nahende Stimmen rissen Ursula aus ihrer Arbeit, störten sie bei dem Versuch, der väterlichen Entscheidung etwas Gutes abzugewinnen. Von draußen drangen laute Geräusche durch die dicken Wände. Das rasche Anschwellen des Lärmpegels zeigte, dass sich die Gruppe vor Einbruch der Dunkelheit in die Sicherheit des Hauses retten wollte.
Sie hörte, wie die Haustür kraftvoll aufgestoßen wurde, um wenig später wieder in den Rahmen zu fallen.
«Ist Vater nicht daheim?», hörte sie Paul fragen. In der Stimme des Jüngsten schwang die Sorge deutlich mit.
«Du hast Angst vor der Nacht, dem Wolf, dem Winter, dass Vater nicht heimkehrt», stichelte Hans Peter.
«Dass du dich mit uns nach draußen wagst. Wir könnten dich vor Hunger schlachten, braten und fressen», legte Martin, der mittlere Bruder, eine fürchterliche Grimasse schneidend nach.
«Das finde ich nicht lustig. Wo ist Vater?», wandte sich Paul an seine Mutter hinter dem Webstuhl, von wo sie den Disput aufmerksam verfolgte.
«Vater ist bald zurück. Sein Aufenthalt hat länger gedauert. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Und Hans Peter soll dich nicht fortwährend hänseln.»
«Und der Älteste?», wechselte Martin das Thema.
«Ulrich sieht auf der Alp nach dem Rechten. Er bereitet das Haus und die Stallungen für den Winter vor. Er verbringt die Nacht droben.» Die Frau erhob sich ungelenk von ihrem Webstuhl, um Ursula zu helfen.
«So gibt es wenigstens für jeden von uns mehr zu essen», flüsterte Hans Peter. Er fischte seinen selbstgeschnitzten, zu groß geratenen Holzlöffel aus einer Tasche. Die drei Brüder setzten sich einer nach dem anderen an den Tisch.
«Seltsam, oben war kein Licht zu sehen», überlegte Martin.
«Paul, du sprichst das Gebet», hörten sie die Mutter aus der Küche.
Kaum hatte der Jüngste sein Amen gesagt und das Kreuz auf den dünnen Körper gezeichnet, stellte Ursula den Kessel lauter als beabsichtigt auf den Tisch.
«Ist so viel drin?», fragte Martin erwartungsfroh.
«Ein Brei mit wenig Roggen, noch weniger Rüben, dafür viel Wasser», antwortete der Mittlere für seine Schwester. Diese zog etwas Brot und Käse unter ihrem Rock hervor und zauberte damit ein Lächeln auf die Gesichter ihrer Brüder.
«Esst», trat die Mutter an den Tisch. «Ein neuer mühsamer Tag liegt vor euch. Das Wetter dreht, und wer weiß, wann wir die Sonne wiedersehen.»
«Wieso gibt es wieder kein Fleisch?», streckte Martin seinen Holzbecher aus, den Ursula mit frischer Milch füllte.
«Selbst wenn du jetzt der älteste Mann im Hause bist, weißt du genau, was Vater gesagt hat ...»
«... Wir wissen nicht, wie lange der Winter dauert, wie hart er sein wird und wie lange unsere Vorräte reichen», unterbrach Hans Peter seine Mutter vorlaut. «Die Jagd war viel zu kurz, das Wild ist im Gegensatz zu uns schon weitergezogen. Nur wir müssen im Tal bleiben. Auf dem Markt gibt es für Fremde nichts oder es ist viel zu teuer zu kaufen. Bleibt uns der Fisch aus dem See oder unser Vieh im Stall.»
Mutter und Tochter tauschten einen Blick aus; traurig, dass sie den Buben nichts anderes aufzutischen und ihnen nicht zu widersprechen vermochten.
«Die Tiere zu schlachten», startete die Frau den Versuch einer Entschuldigung, «das ...»
«... wäre das Dümmste. Dann hätten wir bald keine Milch und keinen Käse mehr», ergänzte Paul mit dem Löffel im Kessel rührend. Er schaufelte sich den Brei in den Mund, schob Brot und Käse nach. Ohne den Blick vom Kupfertopf zu nehmen, schmatzte er: «Denkt mal nach, ihr Ochsen!»
Die Mutter war froh, dass sie immerhin einen der Söhne nicht überzeugen musste, für die kommende harte Zeit zu sparen. Sie schenkte ihrem Jüngsten ein Lächeln – trotzdem war ihr die Sorge wegen des anstehenden Winters anzusehen.
«Und unser Schwein», ließ der Mittlere das Thema nicht auf sich beruhen, «haben die Herren vor wenigen Tagen geholt, um es selber zu schlachten und zu fressen. Schwein zu ...»
«Lass jetzt endlich gut sein, Hans Peter», fuhr die Frau dem Sohn ungewohnt scharf ins Wort. «Sie haben uns immer gut behandelt. Unser Geld hat dieses Jahr nicht für den Zehnten gereicht. Sie waren mit dem Schwein, dem Käse, dem Tuch und dem Holz zufrieden. Sie haben gesehen, dass uns nicht mehr möglich war. Vater hat das gut gemacht», huschte ein vages Lächeln über ihr schmales Gesicht, «er hat mit einem kleinen Teil unseres Zehnten ein kleines Ferkel gekauft und mit einem ausgewachsenen Schwein den Hauptteil unserer Abgaben geleistet.»
«Es ist doch nicht gerecht, gleich viel Käse zu fordern, wenn unsere Kühe viel weniger Milch gegeben haben ...», tönte es hinter einem großen Löffel hervor.
«Ich begreife nicht», begann der Mittlere. Wie seine Brüder hatte er nicht den Mut, der Mutter direkt in die Augen zu schauen. Er konzentrierte sich auf die Unebenheiten und Risse im dunklen Tisch. Als ob er diese bislang nie gesehen hätte. «Ich begreife nicht», wiederholte er sachte, um seinen gravierenden Konflikt zu betonen, «warum wir für alle im Tal den Zehnten für unsere Herren verantworten.»
«Das ist nun mal so im Freiheitsbrief festgehalten. Aus mehr Recht ergibt sich auch mehr Pflicht.»
«Ambüel», mischte sich Martin nun ein und merkte nicht, wie seine Schwester kurz errötete, «könnte den Zehnten für das ganze Tal bezahlen. Der ist reich. Der hat Geld.»
«Vater fürchtet sich mehr davor, Ambüel um Hilfe zu bitten, als diese gefährliche Reise nach Arosa zu unternehmen, um ihre Abgaben einzutreiben», schluckte Hans Peter mit einem weiteren Löffel Brei auch seinen Ärger hinunter.
«Vater ist nicht furchtsam. Er ist einfach zu stolz», beendete die Mutter die Unterhaltung. Sie nickte ihrer Tochter zu, den Tisch abzuräumen.
Die Fremde im Spiegel
Ein für den Frühherbst ungewohnt kühler Tag erwartete die zwei Frauen und drei Knaben am darauffolgenden Morgen.
«Sieht nach Schnee aus», bemerkte Martin beim Blick durch ein schmales Fenster. Die Innenseite des Glases zeigte sich mit filigranen Eisblumen dekoriert.
Wenig später saßen die drei Burschen am Tisch, den Topf mit den aufgewärmten Resten vom Vorabend vor sich.
Als Ursula vor sie trat und den irdenen Milchkrug auf die Holzplatte stellte, schenkte das Trio dem Mädchen nicht die geringste Beachtung. Kein Morgengruß. Kein Dank.
Erst als Ursula sich heftig am Tisch stieß und die Milch zum Überschwappen brachte, blickten die Brüder auf.
«Wie siehst du denn aus?», begann Hans Peter.
«Wie der Leibhaftige selbst», schlug Paul schnell das Kreuz. Die sonntägliche Predigt des Pfarrers hatte einen bleibenden Eindruck beim Jüngsten hinterlassen.
«Du bist beinahe so schwarz wie die Wände deiner rußigen Küche. Aber sicher dunkler als deine Kleidung», lachte Hans Peter.
Ursula überlegte kurz, wie sie reagieren sollte. In der kalten Zeit gehörte es zu den Hauptpflichten der Mädchen, zu Herd und Haus zu schauen. Und weil sie die einzige Tochter war, fiel diese Verantwortung ihr zu. Sie hatte die ganze Nacht beim Feuer verbracht und gut aufgepasst, dass die Flamme nicht erlosch. Oder, noch schlimmer, außer Kontrolle geriet und das Haus in Schutt und Asche legte. Unbequem hatte sie auf dem nackten Fußboden geschlafen. Als Einzige im Haus musste sie wenigstens nicht frieren. Das Feuer band sie vom Herbst bis zum Frühling ans Haus. Lediglich in der kurzen Zeitspanne dazwischen durfte sie mit ihren Brüdern länger nach draußen, um im Freien herumzutollen oder auf den Feldern, Äckern und im kleinen Garten zu helfen. An kalten Tagen wie diesem war sie froh darüber, dass niemand auf den Gedanken kam, sie in die Kälte hinauszuschicken. «Während ihr im warmen Bett lagt, wollte ich Wasser holen. Der Brunnen ist über Nacht eingefroren. Nichts da, um sich das Gesicht zu waschen. Und wie ich aussehe, kann euch ja egal sein. Seid doch froh: So gibts für euch keinen noch wässrigeren Brei, ich habe ihn mit Milch und Getreide gestreckt», bewies sie ihre Kochkünste und Schlagfertigkeit.
Als ob die Mutter auf ihren Einsatz gewartet hätte, betrat sie die Stube. «Heut dürft ihr die Schuhe anziehen», begrüßte sie die drei Burschen. «Es ist frisch. Der Boden ist gefroren. Esst, dann holt ihr das Heu zum Trocknen ein. Seht zu, dass zuerst die Stadel in der Nähe aufgefüllt werden. Wer weiß, ob wir das Vieh diesen Winter zum Heu führen können. Falls es wieder so viel schneit.» Beunruhigt blickte sie aus dem Fensterchen zum Tinzenhorn.
«Mutter», warf Martin ungeduldig ein, «wir wissen, was zu tun ist. Bevor Vater aufgebrochen ist, hat er mir und Ulrich genau erklärt, wie wir das letzte Gras aufhängen, damit es trocknet. Wie wir die Ähren dreschen, dass nicht ein einziges Roggenkorn verloren geht. Und trotzdem werden wir diesen Winter wieder nicht genug zu essen haben ...»
Sachte hob die Mutter ihre Linke, um Tränen wegzuwischen. Im spiegelnden Fensterglas blickte ihr eine Fremde entgegen. Das lag nicht an den trüben, kleinen Scheiben. Der Hunger hatte ihr deutlich mehr zugesetzt als dem Rest ihrer Familie. Immer wieder hatte sie auf ihren Anteil verzichtet, damit ihre Kinder etwas mehr zu essen hatten. Dass es dennoch nicht reichte, die größte Not zu tilgen, hatte sie alt gemacht. Sie glich der eigenen Mutter, als diese mit wächsernem Gesicht und völlig ausgemergelt auf dem Totenbett lag, um endlich von der lebenslangen Mühsal befreit zu werden. Sie hatte der Mutter die Augen zugedrückt mit dem Versprechen, Klein Martin, den Sohn des damaligen Landammanns, zu heiraten, um ein gutes Leben zu führen.
Inzwischen machte sich ihr Mann Sorgen um sie. Seine Frau war nicht wiederzuerkennen: Die vor Lebenslust und Tatendrang leuchtend blauen Augen waren erloschen, hatten sich in den Schädel zurückgezogen. Als wollten sie nicht sehen, was um sie herum geschah. Die Haut spannte sich wie vergilbtes Pergament über ihr Gesicht. Die Backenknochen ragten hornartig über den eingesackten Wangen hervor. Die ehemals roten Lippen gingen jetzt direkt in die Haut über. Die dunkle Haube versteckte ihr schütteres Haar. Zuerst nur vereinzelt, entdeckte sie nun Abend für Abend mehr ausgefallene Strähnen im derben Kopftuch. Der Hunger ließ auch ihre Hülle platzen. In ihren Handflächen zeigte sich das bloße Fleisch. Ob Tiere oder Werkzeuge, Leder oder Wolle, ob Kinder oder Ehegatte: Jede Verrichtung, jede Berührung tat weh. Sie gab vor zu frieren, um ihre fingerfreien Handschuhe im Sommer zu erklären. Mehrere Zähne hatten sich aus dem Zahnfleisch gelöst. Sie redete wenig, sie schimpfte weniger, lachte nicht mehr. So konnte niemand die Lücken erkennen. Dass sie bis auf das Skelett abgemagert war, verdeckten die grauen Röcke, die sie in mehreren Schichten übereinander trug. Das verlieh ihr wenigstens etwas Volumen und erinnerte schwach an ihre einstige Robustheit. Denn als Frau des Landammanns hatte sie auch lange gute Zeiten erlebt. Bis das Wetter änderte. Jetzt litt sie darunter, dass hinter ihrem Rücken getratscht und getuschelt wurde. Dass der Platz in der Kirchenbank neben ihr frei blieb. Dass die Leute in ihre Häuser verschwanden, sobald sie sich näherte. Dass die Gemeinde nicht mehr bei ihrem Mann, sondern bei Ambüel Unterstützung und Rat holte.
Das Scharren und Kratzen der Holzlöffel auf dem Topfboden hatte aufgehört.
«Macht euch schnell auf. Es bleibt nicht viel Zeit. Und schaut, dass ihr vor dem Unwetter wieder daheim seid», lenkte sich die Mutter von ihrem Spiegelbild ab.
Beim Abschied vor dem wuchtigen Holzhaus drückte Ursula den drei Brüdern etwas Käse, den sie aus dem Keller geholt hatte, und eine Schnitte Brot in die schmutzigen Hände. Sie sah ihnen lange nach. Wie sie friedlich in die Felder zogen. Sie war besorgt: Im Gewölbe unter dem Haus gab es viel zu viel freien Platz für Vorräte.
Im niedrigen Stall schaute Ursula nach dem Vieh. Die Kühe, Schafe und Ziegen ahnten den nahen Wetterwechsel. Sie wussten, was das hieß: monatelang eingesperrt sein. Keine Bewegung. Wenig Futter. Auch heute durften sie nicht auf die Wiesen. Die Tiere im hohen Schnee zu suchen und nicht mehr zu finden, konnte sich die Familie nicht leisten. Zu viel Vieh hatten sie schon verloren. Und damit jedes Mal auch Milch, Butter, Käse und Dünger für die Felder. Das Fleisch der toten Tiere ließ sich nicht lange aufbewahren. Für Salz, das auf einem fernen Markt gekauft werden musste und mit Gold aufgewogen wurde, reichte das Geld nicht.
Sie kletterte in den oberen Teil des Holzgebäudes. Auch da viel zu viel Platz für Heu und Stroh. Wenigstens mussten nicht mehr so viele Tiere durch den Winter gebracht werden. Durch die kleine Öffnung ließ sie Futter in die Krippe fallen. Sie beobachtete die Tiere zu ihren Füßen. Was, fragte sie sich traurig, unterscheidet uns noch vom Vieh? Eingepfercht und hungernd über Monate und Monate.
Wieder in der Stube hörte sie ihre Mutter beim Ofen weben. Ursula begab sich zu ihrem Platz in der Ecke. Hier war das Licht zwar schwächer. Dafür drückte der kühle Wind weniger durch die Ritzen.
Über ihre Handarbeit gebeugt sorgte sie sich um die Mutter. Diese löste sich allmählich auf. Verzichtete auf alles. Sie wollte kein Kind mehr verlieren. Ein Junge und ein Mädchen hatten die ersten Stunden nach der Geburt nicht überstanden. Nicht einmal fürs Taufen hatte die Zeit gereicht. Der Pfarrer konnte die Ungetauften weder im Kirchenbuch noch im Gottesacker aufnehmen. Blieb die Hoffnung, dass der kleine Wilhelm und die winzige Ruth doch noch ihre Plätze im Jenseits erhalten hatten. Schon im Diesseits hatten die zwei Kinder gekämpft. Nicht gegen den Tod, sondern für das Leben.
Hufschläge näherten sich. Rissen Ursula aus ihren Gedanken. «Vater!» Sie zog sich an der Tischkante entlang in die offene Stube. Sie hörte das Klappern des Webstuhls. «Vater!» Sie duckte sich in der Tür, trat in den dunklen Gang, lief zum Eingang, drehte das schwere Holzblatt auf. Bereit, die paar Steinstufen nach unten zu stürzen, um den sehnlichst Vermissten in Empfang zu nehmen. «Vater?»
Auf dem kleinen, quadratischen Plateau zwischen Haus und Stufen blieb sie stehen, schaute sich um. Das Pferd bewegte sich zum Brunnen. Als das Tier erkannte, dass das Wasser gefroren war, drehte es den Kopf fassungslos in ihre Richtung. Die beiden gingen langsam aufeinander zu, trafen sich auf halbem Weg. Sachte ergriff Ursula die Zügel. Strich dem Tier durch die Mähne. Tätschelte den Hals. Fühlte den regelmäßigen Puls. Streichelte sein verschwitztes Fell, auf dem sich die ersten Flocken in Tropfen verwandelten.
«Wo ist Vater?», hauchte Ursula dem Braunen ins Ohr. Das Tier schüttelte den Kopf und gab schnaubend zu erkennen, dass es getränkt, gefüttert und ins Trockene geführt werden wollte. Bereitwillig ließ es sich von ihr in den Stall bringen.
Eine rätselhafte Wunde
Nach einem kurzen Abstecher in ihre Küche, um etwas Holz nachzulegen, kehrte Ursula in die Stube zurück. «Wo ist Vater?», hörte sie die dünne Stimme hinter dem Ofen.
«Ich weiß nicht. Der Braune kam alleine zurück.»
«Vater hat ihn losgeschickt, damit das Tier im Gewitter nicht scheut und den Weg noch anstrengender macht. Er trifft bald ein, du wirst sehen.»
«Hast recht.» Die Tochter sah die bedrohlich nahe, schwarze Mauer, die sich zwischen den Talwänden zum Haus hin schob. Sie machte sich Sorgen. Um ihren Vater. Die Brüder. Die Mutter. Den bevorstehenden Winter würden sie nicht alle überleben.
«Vater, wo bist du?» Paul trat voller Vorfreude in die Stube. Die Schwester wandte sich ihm langsam zu. Ihr Gesicht ließ sein Lachen gefrieren.
«Ist etwas passiert?»
«Nein», versuchte sie beruhigend zu klingen, wie sie es von der Mutter kannte. «Vater kommt später. Er hat den Braunen vorausgesandt, um besser durchs Unwetter zu kommen, das ihn offenbar schon eingeholt hatte.»
«Und wo ist seine Satteltasche?» Hans Peter tauchte hinter seinem jüngeren Bruder im niedrigen Raum auf.
«Die Satteltasche?», wiederholte Ursula.
«Hast du dem Braunen die Satteltaschen abgenommen?»
«Nein, warum meinst du?»
«Verstehst du denn nicht? Weshalb sollte Vater die schwere Tasche selbst durch Wind und Wetter tragen und gleichzeitig das Pferd allein losschicken, um schneller hier zu sein.»
Ursula hatte verstanden, wusste aber auch keine Antwort.
«Geh' in deine Küche», half ihr Martin, der als Letzter in den Raum getreten war, «wir haben Hunger. Und ihr», richtete er sich an seine Brüder, «lasst sie endlich in Ruhe. Vater wollte seine Tasche bei sich wissen.» Und zu sich murmelte er: «Nur Gott und er kennen die Gründe dafür.»
Trotz der Entfernung zwischen Stube und Küche hörte Ursula die Diskussion der Brüder, die rasch zu einem Streit anwuchs. Die Ruhe, die plötzlich eintrat, hing wohl mit ihrer Mutter zusammen: Weniger ihre Autorität als ihre schwache Verfassung musste die Burschen bewegt haben, die Unterhaltung auf andere Themen zu lenken und leise zu disputieren. Das gab Ursula die Gelegenheit, ihren eigenen Gedanken nachzugehen. Die Satteltasche hatte sich nicht auf dem Rücken des Pferds befunden. Dass diese verloren gegangen sein könnte, schien ihr nicht möglich. Zu erfahren waren die Männer des Tals im Beladen und Bepacken, im Ein- und Ausspannen ihrer Last- und Reittiere. Vater hatte die Tasche zu sich genommen, um nicht auch noch das Letzte, was ihm an Wert geblieben war, durch missliche Umstände zu verlieren. Das Wetter hatte ihn um den größten Teil des ehemals großen Vermögens und schon beinahe um den Verstand, sicher aber um seinen Mut und seine Entschlusskraft gebracht. Gerade dieses Zaudern und Zögern ließ bei den Leuten immer stärkere Zweifel und lautere Kritik aufkommen, ob er der Richtige sei, um die Gemeinde durch die harten Zeiten in eine bessere Zukunft zu führen.
«Wieder Brei», maulte Martin, als die Schwester den Kessel auf den Tisch wuchtete. Während er den Löffel zückte, holte sie diesmal neben Käse und Brot auch eine Wurst aus ihrer Schürze hervor: «Das habt ihr euch verdient. Wer weiß, ob und wann es wieder eine Möglichkeit gibt. Ich muss zurück zum Feuer», entschuldigte sie sich und überließ den anderen das Essen. «Das Wetter drückt gewaltig. Wenn ich nicht aufpasse, weht es mir die brennende Glut aus dem Herd und zündet das Haus an. Es hat zu schneien begonnen.»
Sofort drehten sich die drei Köpfe zu den kleinen Fenstern. Nahrung, Worte und Lachen blieben ihnen im Hals stecken.
Kaum hatte Ursula den Topf zum offenen Herd zurückgetragen, brachte ein unerwarteter Windstoß, hervorgerufen durch die unvermittelt aufgerissene Tür, die Flammen ebenso wie die Familie in Aufruhr. «Vater!» Die Buben stürmten aus der Stube und das Mädchen aus der Küche zum Eingang. Im langen Flur, der das Erdgeschoss des Hauses in zwei Hälften mit der Küche und dem Zimmer für die Frauen auf der einen und der Stube mit Ofen auf der anderen Seite teilte, blieben die Kinder wie angewurzelt stehen. Vor ihnen stand eine Figur, die kaum zu erkennen war. Von Kopf bis Fuß in Kleider und Decken eingewickelt waren nur Ulrichs starr blickende Augen zu sehen. Der dunkle, dicke Stoff war vom Weiß des Schnees zugedeckt. Der Älteste der vier Brüder sah aus wie ein Schneemann mit zwei schwarzen Kohlestücken als Augen – was die Jüngeren unter glücklicheren Umständen zum Lachen und Scherzen veranlasst hätte. So blieb ihnen allein ihr Entsetzen über die Erscheinung vor ihnen. Und ihre viel größere Enttäuschung, dass nicht der Vater, sondern der Erstgeborene eingetroffen war.
«Hast du Vater gesehen?», meldete sich eine dünne Stimme hinter den Knaben.
«Nein, Mutter. Ist er noch nicht zurückgekehrt?», antwortete die unheimliche Gestalt mit tiefer Stimme.
Langsam schmolz der Schnee zu Wasser, das rund um den jungen Mann einen nassen Kreis auf dem matten Steinboden bildete. Niemand traute sich, die Linie zu überschreiten, um dem Neuankömmling aus seinen schweren, nassen Kleidern zu helfen. Um ihn mit einem Handschlag, einer Umarmung endlich willkommen zu heißen.
«Komm zum Ofen!», befahl die Mutter trotz kraftloser Stimme mit unerwartetem Nachdruck.
Ulrich zwängte sich durch seine Geschwister, die sich an die Wände drückten, um für den Ältesten Spalier zu stehen. Auf der Höhe von Ursula angekommen, streifte er die Decke ab, die als oberste Schutzschicht gedient hatte. «Bring das zum Trocknen zu deinem Herd!», bellte er, ohne der Schwester in die Augen zu blicken. «Und pass gut auf, dass der Überwurf nicht Feuer fängt!»
Er folgte seiner Mutter in die mit einer Kerze dürftig beleuchtete Stube an den Tisch.
«Was ist das?», behutsam griff sie Ulrichs Linke und drehte diese zum fahlen, nervös flackernden Licht.
«Nichts», winkte der Älteste mit dem anderen Arm ab.
«Nichts?» Sie blickte auf den aufgeschlitzten, vollständig durchtränkten Stoff und den muskulösen Unterarm. Die klaffend breite Wunde schien einen Teil seines Arms der Länge nach zu spalten und gab den Blick auf den Knochen und das Fleisch, auf Adern und Haut frei. Die jüngeren Brüder wichen vor Ekel zurück.
«Der Wolf», beantwortete Ulrich die stumme Frage in den Augen der Mutter. Diese verlangte nach heißem Wasser, um die tiefe Wunde sauber auszuwaschen.
«Der Brunnen ist eingefroren», war Martins Stimme aus der Dunkelheit zu hören.
«Dann holt doch Schnee und schmelzt ihn über dem Feuer. Es gibt inzwischen wahrlich genug davon, ihr Simpel!»
«Der Wolf?» Die Frage schwebte wie ein böses Menetekel im Raum.
«Ja. Der Wolf.»
«Warum ist dann die Unterseite nicht auch verletzt?» Die Mutter drehte seinen Arm noch einmal um, um sich zu versichern, dass sie sich nicht getäuscht hatte.
Er dachte nach. «Wo bleibt denn das warme Wasser?», versuchte er abzulenken.
Sie richtete sich auf, ging in die Küche, gab dem Ältesten etwas Zeit für eine Antwort. Als sie mit dem Kessel, einem Leinentuch und ihren Heilkräutern zurückkam, hatte er eine Erklärung gefunden: «Ich hatte die Wolfsangel zwischen die Äste gehängt. Ich wollte den Haken an der Kette befestigen, als der Wolf mich angriff. Der Köder und sein gieriger Hunger haben ihn wohl angelockt. Ich schnelle herum, versuche, ihn mit dem Wolfshaken in meiner Hand zu erschlagen und habe meinen Arm getroffen.»
«Den linken Arm?»
«Wie meinst du das?»
«Du isst mit deiner Linken, du schnitzt mit links, du führst die Tiere und Waffen mit der Linken. Wie willst du dir mit der linken Hand den linken Arm verletzen?» Die Brüder rückten gespannt näher, um alles verstehen zu können.
«Ich halte mit der Rechten das Wolfseisen. Die grobe Arbeit. Ich versuche, mit der Linken die Kette in das Loch am Widerhaken einzuhängen. Die feine Arbeit. Dass ich mir in den eigenen Arm schlage, wäre mir mit der Linken nie passiert. Hätte ich mit der stärkeren Hand zugehauen, wäre nicht der Arm, sondern der Wolf kaputt.»
«Wann ist es passiert?» Die Mutter tupfte die Verletzung behutsam und sorgfältig sauber. Trotzdem zuckte Ulrich bei jeder Berührung zusammen. Sie riss einen schmalen Streifen graues Tuch und verband die Wunde. Sie verteilte die Kräuter auf dem Stoff und umwickelte die verletzte Stelle noch einmal. Die Kompresse verfärbte sich. Er blieb vor Schmerz stumm.
«Das Blut holt sich die heilende Wirkung der Kräuter», stellte sie befriedigt fest. «Jetzt musst du bloß den Arm stillhalten. So bleibt dir nur eine Narbe. Und eine Erinnerung mehr.»
«Wenigstens etwas.»
«Ihr geht jetzt schlafen», wies sie ihre anderen Kinder aus der kühlen Stube in die kalten Kammern, ohne den Blick von der Verletzung zu nehmen. Ohne Murren, aber auch ohne Gruß, leerte sich der Raum.
«Was ist mit deinem schmutzigen Gesicht?», fragte sie, den Blick weiterhin auf das rote Tuch gerichtet. Ulrichs Blutung schien fürs Erste gestillt. Sie war erleichtert, nicht noch mehr teuren und raren Stoff für das Verarzten ihres Ältesten verwenden zu müssen.
«Lass mich endlich in Ruhe mit deiner Fragerei. Was soll das?»
«Überall Blut. Auch auf deinem Gesicht.»
«Es wird aus der Wunde gespritzt sein.»
«Der Stoff des Hemdes und der dicke Mantel haben das Blut zurückgehalten.»
«Dann ist es vom Wolf. Ich habe ihn mit dem zweiten Streich verletzt. Er ist geflüchtet. Ich konnte ihn nicht verfolgen, weil ich keine Zeit mehr verlieren durfte. Der Sturm war schon im Anzug. Zum Glück habe ich es nach Hause geschafft.»
Die Mutter nickte nur leicht mit dem Kopf: «Und Vater?»
«Was meinst du?» Er wich ihrem Blick aus.
«Hast du ihn noch getroffen?»
«Warum?»
«Die Alp liegt auf dem Weg nach Arosa.»
«Nein. Ich hatte zu tun und war nicht immer beim Haus.»
«Hast du Hunger?», wechselte die Mutter das Thema, stand auf. Sie versuchte ein Lächeln, ohne ihm ins Gesicht zu sehen.
«Ich habe den Wolfsköder auf einem Feuer gekocht und mit meiner Schnitte Brot und ein wenig Käse gegessen», ging er nicht auf ihre Frage nach seinem Hunger ein. «Ich lege mich hin. Etwas Ruhe tut nicht allein meiner Wunde gut.» Er stand auf, um sich im Rücken der Mutter durch die niedrige Tür zu bücken. Er konnte weder ihren Gruß hören, noch ihre Tränen sehen.
Der Landammann bleibt weg
Am nächsten Morgen lag so viel Schnee wie noch nie zu dieser Jahreszeit. Noch vor ihrem Morgenbrei machten sich Martin, Hans Peter und Paul daran, die kurzen Wege vom Haus zum Stall und zum Stadel freizuschaufeln. Die weiße Masse war zäh und aufgrund ihrer Feuchtigkeit schwer. Kaum hatten sie den Schieferplattenweg vor ihren Füßen freigelegt, war das feuchtglänzende Grau hinter ihnen erneut mit einer dichten Schicht überzogen. Als sie den Kanal endlich gegraben hatten, wurden die drei von ihren Tieren schon ungeduldig erwartet.
Nach dem Füttern, Misten und Melken machten sie sich auf zum Frühstück. Zwischen den drei Gebäuden lag eine dichte Mischung aus Nebel und Schnee, der ohne Unterbruch vom Himmel niedertaumelte.
«Wenig Milch», bemerkte Ursula, als sie die Kanne traurig lächelnd am Eingang zur Küche entgegennahm.
«Zu wenig Futter, zu wenig Milch», erwiderte Paul, ohne die Schwester anzusehen: «Wo bleibt das Essen?»
«Auf dem Tisch.»
Der Jüngste stürzte in die Stube, um seinen Anteil gegen die Brüder zu verteidigen. Erst nachdem er mit seinem Holzlöffel mehrmals erfolglos nach Brei gegraben und geschabt hatte, fragte er nach Ulrich.
«Seine Wunde hat sich böse entzündet. Er liegt mit Fieber in Vaters Kammer.»
«Und wenn der zurückkommt?»
«Der bleibt in Arosa», antwortete Hans Peter.
Es kam ab und zu vor, dass sich der Vater bei der Familie seiner Frau einquartierte, wenn eine Rückkehr nicht möglich war. Dann wuchsen die vorgesehenen drei bis vier Tage zu einer mehrwöchigen Abwesenheit an.
«Und der Braune?», ließ Paul nicht locker.
«Sein Pferd haben die zu uns zurückgeschickt, damit wir es durchfüttern. Weil sie wie wir zu wenig zu essen haben und keiner weiß, wie lange der Schnee liegen bleibt», kommentierte Ulrich, der lautlos in die Stube getreten war. «Es ergibt ja keinen Sinn, dass ein nutzloses Pferd den Kühen, den Ziegen und Schafen, die wenigstens etwas Milch geben, das wenige Futter wegfrisst. So, wie ihr mir alles weggefressen habt ...» Er blickte wütend in die eingefallenen Gesichter seiner Brüder. «Habt ihr die feine Schramme nicht gesehen? Drüben haben sie ihm mit der Peitsche auf die Flanke geschlagen, damit er so rasch wie nur möglich wieder bei uns ist und unser letztes Futter verbraucht.»
«Deshalb fehlte die Satteltasche», flüsterte Martin aus Angst vor der brüderlichen Reaktion. «Vater hat sie abgenommen, weil er die Sachen für den Aufenthalt in Arosa brauchte.»
«Genau», bestätigte Ulrich und hockte sich neben den Kleinen auf die Bank. Er legte ihm die Rechte gönnerhaft auf die Schulter, schaute in die Runde. Während der Abwesenheit des Vaters nahm der Älteste den Platz als Familien- und Gemeindeoberhaupt ein. «Und weil er schlau ist, wagt er sich bei dem Wetter auch die nächsten Tage nicht auf die Heimreise. Man sieht die Hand vor Augen nicht. Da kann man sich leicht verirren und einen falschen Schritt machen. In ein Tobel stürzen, in eine Lawine geraten, um nicht mehr heimzukehren. Besser bleibt er bei Nani. Das Pferd hat einfach Glück gehabt und den Heimweg gerade noch geschafft.»
Die drei Brüder waren beruhigt. Hinter dem lauwarmen Ofen saß die Mutter im Halbdunkel. Schnee verklebte die Fenster, verwehrte dem schwachen Licht den Eintritt ins Zimmer. Wie zum Trotz jagte sie das Holzschiffchen hin und her, um den Faden zu einem rauen, grauen Tuch zu verweben.
«Ich gehe jetzt in den Stadel, um die Wolfseisen zu putzen.»
«Warum?», wagte Ursula die Frage, «du hast ja gar nichts gefangen.»
Ulrich drehte sich gemächlich zu ihr um, als ob er sich seine Reaktion und Antwort gut überlegen müsste: «Der Köder hing lang an der Angel. Darum ist alles verklebt. Koch Schnee auf, bring mir das Wasser in den Stadel!»
«Auf der Flanke des Braunen war keine Schramme, als er angetrottet kam», raunte sie, als sich ihr Bruder blick- und wortlos an ihr vorbei durch die Tür drückte.
Von wärmeren Zeiten
Erst nach sechs Tagen zeigte sich die Sonne zwischen den Wolken. Während die Pfade zwischen den Hofgebäuden freigehalten wurden, war die Verbindung zur Außenwelt völlig abgerissen. Die Nachbarn, die in Rufnähe lebten, schienen von den Massen verschluckt, waren weder zu sehen noch zu hören. Der Schnee sog jedes Geräusch ein. Die höher wachsenden Schneemauern und der Nebel vereitelten jeden Blick in die Weite. Am Sonntag war immerhin die Glocke der Kirche auf der Felsnase als vage Ahnung zu vernehmen. Für einmal bot der Pfarrer lediglich zeitliche Orientierung. An den gewohnten Besuch der Messe war nicht zu denken. Mutter bekam Angst, dass sie ihren erhofften Seelenfrieden verlöre. Ursula fürchtete, Klein Hans könnte sie vergessen, wenn sie nicht zum Gottesdienst erschien.
Am siebten Tag wurde es hell. Die Sonne schien, die Krähen kehrten als schwarze Punkte vor blauem Himmel zurück. Die weiße Oberfläche warf jeden Strahl vielfach zurück. Nach den Tagen der Düsternis mussten sich die Menschen zuerst wieder an das grelle Licht gewöhnen. Ursula trat aus der Haustür. Sie kniff die Lider zusammen, nahm die Umwelt nur in Konturen wahr. Vorsichtig öffnete sie die Augen, erkannte das kanalverbundene Gebäudetrio aus Wohnhaus, Stall und Stadel. Die Spuren ihrer Brüder waren in den Schnee gedrückt. Das Vieh hatten sie versorgt, jetzt waren sie endlich mit Essen an der Reihe. Das Mädchen mochte sich die Enttäuschung der Knaben über die karge Kost nicht anhören. Sie schritt ins Freie. Über den Schneewänden erkannte sie die vertrauten Bergspitzen. Durch das Geschrei der Vögel, das Scharren und Schieben, das Schnaufen und Schnauben des Viehs vernahm sie plötzlich eine altbekannte Stimme ihren Namen rufen. Vor schierer Aufregung vergaß sie zu antworten.
«Wir schaufeln uns von hier durch, ihr grabt immer Richtung Jatzhorn, wir treffen uns in der Mitte», vernahm sie die klare Anweisung von Klein Hans.
Gegen Mittag war die schmale Schneise fertig ausgehoben. Als die Männer von beiden Seiten aufeinanderstießen, gab es ein freudiges Wiedersehen. Nur Ulrich gefiel es gar nicht, dass auf der anderen Seite bereits ein weitverzweigtes Netz von Kanälen angelegt worden war und ihr Haus als letztes angeschlossen wurde.
«Lasst uns nach Hause gehen. Vielleicht gibt es nach dieser schweren Arbeit auch etwas Schweres zu essen», sammelte er seine Brüder ein. Drinnen erwartete sie Roggenbrot und eine Suppe, die Ursula aus ausgekochten Arvenspänen, Wasser, Milch sowie getrockneten Kräutern gezaubert hatte. Nur für sehr kurze Zeit waren Hunger und Ärger vergessen.
«Wieso», fragte Hans Peter am Ende der Mahlzeit, bei der er unablässig in seine Holzschale gestarrt hatte, wie um dort die Antwort auf seine Frage zu finden, «graben wir eigentlich mühsam die tiefen Gänge? Mit Schneeschuhen kommen wir doch einfacher ans Ziel.»
«Und unsere Kühe, Schafe und Ziegen?», antwortete Martin. «Willst du unserem Vieh auch Schneeschuhe umbinden, um sie zu den Stadeln mit dem Futter zu treiben?»
«Da gibts sowieso nicht viel zu finden», sagte Paul kleinlaut und, um abzulenken: «Aber Vater kann mit Schneeschuhen von Arosa nach Hause kommen.»
«Und die Lawinen?», beendete Ulrich das Gespräch schroff, um seine Brüder wieder nach draußen in den Stall oder in den Stadel an ihre Arbeit zu schicken. «Willst du Vater nicht mehr lebend sehen?»
Die Hoffnung, eine späte Wärmephase würde den zu frühen Schnee zum Schmelzen bringen, wurde mit jedem Herbsttag geringer. Das Tal blieb schneebedeckt, wie Inseln ragten die weit verstreuten Höfe aus der Landschaft. Für die Einwohner bestand die Hauptarbeit darin, die Wege durch das zugeschneite Tal freizuhalten. Die Gemeinschaft war auf sich gestellt. Und je länger der Winter andauerte, desto mehr wuchs der Hunger, wurde zu einem ständigen, immer aufdringlicheren Begleiter, der sich wie ein Krebsgeschwür in jeden Bereich vorfraß. Der den Menschen zuerst die tägliche Routine, danach die nächtliche Ruhe raubte. Für anspruchsvolle Aufgaben fehlte jede Kraft, die Auseinandersetzung mit dem Tagewerk wich dem Kampf gegen den allgegenwärtigen Hunger.
War die Arbeit in Haus, Stadel und Stall erledigt, hockte sich die ganze Familie an den Tisch, um den über Generationen weitererzählten Geschichten zuzuhören und sich in diese weit entfernte, bessere und friedlichere Vergangenheit zurückzuversetzen.
In die Zeit vor mehr als hundertfünfzig Jahren, als die ersten Siedler vom Westen her in die dicht bewaldete Hochebene vorstießen. Die anhaltende, ungewöhnliche und unerklärbare Wärme brachte die Gletscher zum Schmelzen. Machte die Pässe selbst für den Transport von Materialien, Tieren und Hausrat überquerbar, sodass die rauen Menschen aus den vallis sich auf die Suche nach einer neuen Heimat machten. Zu eng waren die Täler geworden. Die günstigen geografischen und klimatischen Bedingungen, vor allem ihr Fleiß und ihre Zähigkeit hatten sie zu Erfolg und Freiheit, zu Wohlstand und Wachstum gebracht. Diese Entwicklung bedeutete auch Gefahr: Die Böden und Wälder gaben schon unter optimalen Bedingungen nicht mehr genug her, um die rasch wachsende Bevölkerung mit Nahrung, mit Werk-, Bau- und Brennstoffen zu versorgen. Und mit jeder Generation verkleinerten sich die kultivierbaren Flächen und die Höfe als Folge der Erbteilung noch weiter. Auf der Suche nach einer Lösung hatte sie die Nachricht der Herren von Vaz erreicht.
Diese boten ihnen weitreichende Freiheiten bei tiefem Zins an. Im Gegenzug sollten sie die wilde Hochebene mit ihrem See für Mensch und Tier nutzbar machen.
So trat der kleine Trupp Verwegener, die sich in den Erinnerungen der Erzähler immer freiwillig gemeldet hatten, den beschwerlichen, gefahrvollen Weg ins Unbekannte an. Vierzehn – der Pfarrer redete in Anlehnung an die Bibel nur von zwölf – Familien kamen Monate später an und begannen, das Hochtal in ihre neue Heimat zu verwandeln. Jeder Clan wählte seinen Platz für seinen Hof, mit genug Land, um Menschen und Vieh sicher zu ernähren. Die Weiler lagen so weit auseinander, dass sich jede Familie selber zu versorgen wusste. Aber im Notfall lag das nächste Haus in Rufweite.
«Im Freiheitsbrief erhielten wir Walser damals das Recht auf Selbstbestimmung, auf Eigenverwaltung, die niedere, jedoch nicht die Blutgerichtsbarkeit», belehrte Ulrich seine Brüder. «Darum haben fremde Richter bei uns das Sagen. Was freie Leute nie akzeptieren dürfen. Was euer Vater einfach nicht einsehen wollte.»
Die Erinnerung an den Vater ließ die Zeit für einen Moment stillstehen, die Kinder erstarrten.
«Erzähl weiter!»
Ulrich war erleichtert, dass Mutter die Stille zerschnitten hatte. Trotzdem bekundete er Mühe, den Faden wieder aufzunehmen: «Bald dehnten wir unseren Einfluss über das Tal aus. Um für jeden genügend Land und Essen zu haben, zogen wir über die nächsten Pässe gegen Norden, bis nach Arosa. Für unsere Freiheit entrichten wir einen Zehnten und leisten Kriegsdienst für den Schirmherrn.»
«Erzähl von Wilhelm», forderte Paul erwartungsfroh.
«Zu ihrem ersten Landammann wählten sie jenen Mann, der sie über Berge und Pässe, durch Täler und große Gefahren hierher in unsere Heimat geführt hatte.» Er wandte sich dem Jüngsten zu, der den Worten des großen Bruders aufmerksam gefolgt war: «Er hieß genau wie unser Erstgeborener, der viel zu früh zum Herrn heimkehrte. Und wahrscheinlich wäre es besser gewesen, nicht er, sondern du hättest diesen Weg genommen.»
Paul erschrak. Auch seine älteren Brüder wussten nicht, wie sie auf den hinterlistigen Angriff reagieren sollten. Bis Martin antwortete: «Leider hast du von ihm die Rolle übernommen, die ihm als Erstgeborenem zustand. Aber er hätte diese Aufgabe besser erfüllt als du. Wieso ich das weiß?», er schaute Ulrich in die Augen, «gemeiner als du kann man nicht sein. Nur schade, dass Vater in Arosa ist. Er hätte dir schon gezeigt, wie ...»
Eine ungebremst harte Ohrfeige beendete die Unterhaltung. Das regelmäßige Klappern des Webstuhls hinter dem Ofen verstummte. Ursula kehrte lautlos in ihre Küche zurück, gefolgt von den drei Brüdern. Trotz Hunger ließen sie Ulrich alleine am Tisch hocken, kehrten nicht zur Arvensuppe zurück.
Der Einäugige erkennt die Dinge
«Jesus erblickte in einem Stall das Licht der Welt. Lag nicht auf Fellen, sondern im Heu seiner Krippe und machte schon früh viele körperliche Entbehrungen und Schmerzen durch», bei diesen Worten blickte der Pfarrer durch die Reihen, die von Krankheit und Tod gelichtet waren. «Er durchlitt mit seinen Eltern die Reise durch die Wüste nach Ägypten. Und als Knabe pilgerte er zu Fuß von Nazareth bis nach Jerusalem. Nach der Taufe im Wasser des Jordans fastete er für vierzig Tage in der Einöde. Bei den Reisen durch Dörfer und Städte erduldete er Hitze und Kälte, Hunger und Durst, ertrug Regen und Trockenheit. Am meisten schmerzten ihn allerdings der Hohn, der Spott und der Verrat jener Menschen, die ihm am nächsten standen.» Er wandte den Gläubigen den Rücken zu, um seine Kräfte noch einmal zu bündeln. «Bis zu seinem Tod am Kreuz, um uns von den Sünden zu erlösen. Sie spannten seinen Leib, rissen an seinen Händen und Füßen. Sie schlugen ihn lebendig ans Kreuz, verletzten ihn mit dem Speer, ließen ihn langsam und qualvoll sterben. Und trotz seines Leidens drohte er ihnen nicht, beklagte und bemitleidete sich nicht. Er gab sich ihrem elenden Willen hin, um sein Werk der Erlösung zu vollbringen.» Der Pfarrer legte eine Pause ein, ließ seine Worte wirken. Langsam drehte er sich wieder um. «Und ihr?», klagte er die kleine Gemeinde plötzlich direkt an, «Wagt ihr, an der göttlichen Vorsehung zu zweifeln? Das ist Frevel! Denn die Wege des Herrn sind unergründlich. Und ihr vergesst über eurem Leid sein Leiden.»
«Du weißt ja nicht, was leiden heißt», flüsterte Martin, «du mit deinem vollgefressenen Wanst. Dir fehlt es an nichts.»
Als ob er diese Bemerkung gehört hätte, fixierte er die Bank mit den drei Knaben: «Mit seinem Leiden gab er das Beispiel der Geduld. Er versetzte alle in den Stand der Gnade und er machte uns zu Kindern Gottes.»
«Da hat er recht: Wenn das so weiter geht, sind wir bald im Reich Gottes.» Der Jüngste spürte einen heftigen Schlag auf seinem dünnen Oberschenkel.
Der Pfarrer ließ sich durch die Unruhe nicht stören: «Sein Leiden weist uns den rechten Weg und zeigt, dass keiner von uns die ewige Herrlichkeit erlangen kann, außer durch Trübsal und Entbehrungen. Ihr alle seid töricht und ihr irrt, falls ihr es versäumt, dem Herrn, unserem Schöpfer zu folgen. Er ist nur für uns den Weg allen Leidens gegangen. Er hat gelitten, um uns zu zeigen, dass darin das Glück und die Erhabenheit von uns Menschen besteht. Wer von euch», er ließ den Blick durch die Bänke schweifen, «wagte es, am Segen von Leid und Schmerz zu zweifeln?»
«Ich wüsste da allerdings jemanden», wisperte Martin.