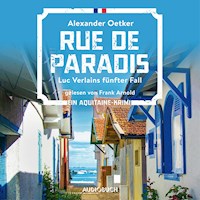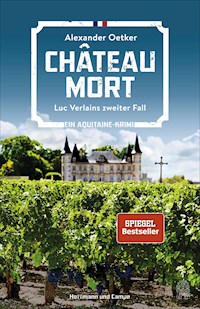14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die zypriotischen Krimis
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Sonne, Meer, Zedern und Zypressen - und ein dunkles Geheimnis Im beschaulichen Bergdorf Kato Koutrafas auf Zypern geht das Leben einen ruhigen Gang. Hin und wieder müssen Police Officer Sofia Perikles und ihr Kollege Kostas Karamanlis ausrücken, wenn übermütige Jugendliche mal wieder den Zaun zur griechisch-türkischen Pufferzone aufgeschnitten haben, doch ansonsten herrscht Frieden im Dorf. Bis zu dem Tag, an dem in der Zone zwischen dem griechischen und türkischen Teil der Insel ein Toter mit dunkler Vergangenheit gefunden wird. Als bei den Ermittlungen eine ebenso beliebte wie illegale zyprische Tradition in Sofia Perikles Visier rückt, werden sie und Kostas überraschend von dem Fall abgezogen – doch Sofia Perikles gibt sich nicht geschlagen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 267
Ähnliche
Alexander Oetker | Yanis Kostas
Zyprische Geheimnisse
Kriminalroman
Yia Panicos
Prólogos
Bergdorf Kyperounda
Er konnte sich nicht sattsehen.
Sattsehen. Was für ein merkwürdiges Wort das war. Sich sattsehen.
Wie hätte er sich auch sattsehen können? An dieser Schönheit. Es war schlicht nicht möglich.
Und genau deshalb hatte er die Hängematte hier oben auf die Terrasse gehängt, an die beiden Balken aus dunklem Holz, unter das rote Dach. Ein wenig Schatten, immerhin.
Von hier fiel sein Blick über die Dächer der Häuser ringsum, über die kleine Kirche in der Dorfmitte, wo sie abends ihre Feste feierten, eine lange Tafel im Kerzenschein, fast bis auf den letzten Quadratzentimeter besetzt von Dutzenden Platten mit den Köstlichkeiten des Troodos und so vielen Flaschen Wein, dass nach ein paar Stunden alle auf den Tischen tanzten, einschließlich der ganz Alten.
Er liebte diese Abende. Nein, das war nicht ganz richtig: Er hatte sie immer geliebt – so musste er es sagen. Denn sie hatten ihn lange nicht mehr eingeladen.
So schlimm fand er das nicht. Redete er sich zumindest ein. Es war der Lauf der Zeit. Als er hier ankam, vor so vielen Jahren, da war er ein Fremder gewesen. Und jetzt war er wieder einer. Wenn die Gründe dafür heute auch andere waren als damals.
Karl spürte den Luftzug, der über seine Arme strich und ihm eine leichte Gänsehaut verursachte. Im Frühling kam die Abendkühle hier oben in den Bergen ganz schnell. Dabei war es am Nachmittag so warm, dass die alten Pflastersteine auf der Dorfstraße glühten. Dass die Zikaden sangen, als wäre schon Hochsommer. Doch sobald die Sonne hinter dem Troodos verschwand und sich die letzten Lichtstrahlen aus den Wipfeln der Zypressen zurückzogen, verlor sich auch die Wärme, sodass die Menschen sich in ihre Häuser verkrochen und die alten Öfen anheizten.
Dann war klar, dass es noch eine Weile dauern würde, bis der Sommer begann.
Und doch hörte er sie schon in den Wipfeln, die Vorboten ebendieses Sommers. Es waren nur die Ersten von ihnen, der erste Spähtrupp sozusagen, der sich in den Bäumen ringsum niedergelassen hatte. In zwei oder drei Tagen würden sie alle kommen, all die schönen und sonderbaren und einzigartigen Wesen, die so bunt und wunderbar waren, ein jedes für sich. Ihre Reise, so regelmäßig und planbar wie die Jahreszeiten, hatte ihnen wie immer alles abverlangt, der lange Weg durch die Wüste und über das Meer, die Sandstürme, der Regen – und nun bräuchten sie eine Pause, bevor sie sich auf den zweiten Teil ihrer Reise machten.
Was sie nicht wussten: Diese Pause war die eigentliche Gefahr – hier lauerten jene, die verhindern wollten, dass sie wieder abhoben und sicher ihr Ziel erreichen.
Über viel zu viele Jahrzehnte hatten sie ihr dreckiges Handwerk völlig unbehelligt ausüben können.
Doch er war hier – er, Karl. Und er hatte es sich zur Aufgabe gemacht, ihnen ein für alle Mal das Handwerk zu legen. Lange hatte er allein auf weiter Flur gekämpft, es gab keine Organisationen, keine Verbündeten. Aber nun hatte sich das geändert. Endlich. Zum ersten Mal in all der Zeit hatte er eine reelle Chance. Und er wollte den großen Schlag landen. Er wollte, dass die Vögel auf ihrer langen Reise auf Zypern in aller Ruhe Rast machen und dann ohne Gefahr und ohne Sorgen wieder in den Himmel steigen konnten.
Im Morgengrauen würde seine Mission beginnen. Er erhob sich von seiner Hängematte, sein Knie knackte, und er musste grinsen. Ja, sie waren unbarmherzig, die Jahre. Aber noch gehörte er nicht zum alten Eisen. Das würde er allen beweisen. Zusammen mit seinen neuen Verbündeten. In dieser Hinsicht hatte die Zeit ihm geholfen.
Karl zog die Schiebetür auf und klappte das Moskitonetz weg, kurz nur, er wollte nicht schon wieder Fledermäuse im Haus haben. Dann besah er sich das Gepäck, das er schon bereitgestellt hatte, die Zelte, den Proviant, den sie brauchen würden, wenn sie mehrere Nächte draußen zubrachten. Dann ging er zu dem Schrank im hinteren Teil des Raumes und zog die Schublade auf. Der Anblick des Inhalts gefiel ihm nicht, aber er hatte zu viele Geschichten gehört, als dass er einfach nur darauf vertraute, dass alles gutging. Schwer und kalt und metallisch lag die Waffe in seiner Hand. Er verstaute sie in der Tasche, die nur er tragen würde.
Er würde jetzt zu Bett gehen, denn sein Wecker klingelte um vier Uhr. Dann würde er in den Südwesten der Insel fahren, ein Weg von einer Stunde, vielleicht etwas mehr. Noch immer würde ihn das Dunkel des frühen Morgens beschützen. Ihn. Und seine Helfer.
Wenn sie getan hatten, was sie tun mussten, würde ihn ganz sicher niemand im Dorf mehr einladen – zu keiner Feier, keinem Abendessen.
Mit dieser Einschätzung lag Karl sicher nicht ganz falsch – anders kam es dennoch.
Taverna Troodos, Kyperounda
»Noch eine Flasche?« Ihre Stimme hallte durch den Raum. Als der Gast am hinteren Ende des Raumes nickte, nahm Xenia die Flasche Xynistéri-Wein aus dem Kühlschrank, schraubte den Korkenzieher hinein und zog den Korken mit einem Ruck aus der Flasche. Sie trat hinter dem Tresen hervor und durchschritt den Raum, stellte die Flasche auf den Tisch und sah auf die Teller, die allesamt so leer geputzt waren, dass sie im Grunde nicht mal hätte spülen müssen. Auch in der Schüssel mit dem griechischen Bauernsalat waren nur noch winzige Tomatenreste und ein paar Feta-Krümel.
»War gut, nehme ich an?«
»Hervorragend«, sagten die beiden Gäste, eine Frau und ein Mann in den Fünfzigern, im Duett. Sie stammten aus dem Nachbardorf und waren lange nicht mehr hier gewesen. »Und nun freuen wir uns auf die Souflaki«, ergänzte die Frau.
»Kommt sofort, ich habe sie schon auf dem Grill«, erwiderte Xenia.
Sie wollte gerade gehen, als sich der Mann leise räusperte. Als sie in seine fragenden Augen blickte, ahnte sie schon, was nun kam:
»Sagen Sie, ich weiß, es müsste bald so weit sein, aber ich bin mir nicht sicher, ob Sie es überhaupt noch anbieten.« Er senkte die Stimme. »Aber ich wollte fragen, ob wir schon einen Tisch für die Ambelopoulia reservieren können.«
Xenia sah sich um, so, als hätten die Wände auf einmal Ohren. Sie spürte, wie ihr die Hitze aufstieg, was merkwürdig war, weil sie nun schon vierzig Jahre hinter diesem Tresen stand und die Frage noch vor zwanzig Jahren nicht geflüstert worden war – sondern einfach lauthals gestellt, ohne dass es irgendjemanden gestört hatte. Doch auch sie senkte ihre Stimme, als sie antwortete.
»Ich glaube, wir müssten zu nächstem Wochenende eine Lieferung bekommen.« Sie hoffte, dass man die Unsicherheit in ihrer Stimme nicht hörte. »Es liegt ja immer … na ja, an den Lieferanten. Aber nächstes Wochenende, da sollten wir sicher … da sollten wir es sicher anbieten. Soll ich Ihnen für den Samstag einen Tisch reservieren?«
»Ja, das wäre wunderbar«, sagte der Mann. »Ich freue mich schon wieder seit einem halben Jahr darauf. Und nirgendwo sind sie so gut wie bei Ihnen.«
»Gut, dann schreibe ich das gleich ins Buch. Wollen Sie noch Wasser?«
»Efaristo, erst mal nicht. Wir sind zufrieden.«
Sie ging wieder vor zum Tresen, doch dann hielt sie inne, weil sie im Fenster eine Bewegung wahrgenommen hatte. Sie trat einen Schritt näher und sah, wie sich draußen zwei Männer begrüßten, indem sie sich lange und herzlich umarmten. Der linke war Lefteris, der Handwerker, der allen im Dorf Sachen reparierte. Und der rechte, der große Hüne mit dem vollen Bart, war der andere Lefteris, ihr Mann und der beste Freund seines Namensvetters. Sie hatte er lange nicht mehr so freundlich in den Arm genommen. Nach einer Weile ließen sich die Männer wieder los und griffen die Eimer und die Teleskopstangen mit den Pinseln am Ende, die sie für ihre Umarmung hatten stehen lassen. Mit dieser Ausrüstung gingen sie in Richtung von Lefteris’ Jeep. Xenia sah ihnen lange und grübelnd nach.
Lara Beach, Akamas-Halbinsel
Magisch. Sie konnte es nicht anders nennen. Diese Bucht war einfach magisch. Sie saß zwischen den beiden Jungs der Gruppe, verborgen im Schutz der Düne ein kleines Stück unterhalb der Felsen. Von dort beobachtete sie durch das Fernglas den Strand weiter unten. Die Bucht war eine halbrunde Sichel, in diesen Minuten in ein goldenes Licht getaucht, da die Abendsonne ganze Arbeit leistete. War das Wasser des Mittelmeeres hier am Morgen und am Vormittag türkis wie auf den Malediven, so leuchtete es jetzt am Abend so goldgelb, als seien darin Schätze verborgen.
Als sie diesen Ort vor vier Wochen zum ersten Mal gesehen hatte, war sie sprachlos gewesen, beinahe den ganzen Nachmittag lang. Alles hier hatte sie überwältigt: Die Abgeschiedenheit – sie hatten über einen kargen, kurvigen Weg fast eine Dreiviertelstunde hierher gebraucht. Die Felsen, die die Bucht begrenzten. Der weiße Sand, der dort unten lag, durchzogen von kleinen, silbrigen Muschelschalen, die klare Grenze zwischen Land und Meer. Das Wasser, so klar und weich, und als sie zum ersten Mal darin eintauchte, setzte sich ihre Sprachlosigkeit fort, weil sie sich nicht erinnern konnte, jemals in so warmem Wasser gebadet zu haben.
Das hier war Magie. Das hier war Lara Beach.
Während am Strand von Coral Bay südlich von Paphos die Liegeschirme dicht an dicht standen, sich dort fliegende Händler von Handtuch zu Handtuch schoben, man zu Kiosken und Eisbuden nur durch endloses Schlangestehen gelangte – war hier: niemand. Oder fast niemand.
Der Weg in die Bucht auf der Akamas-Halbinsel war beschwerlich, die Halbinsel war ein steiniges Naturschutzgebiet am äußersten westlichen Rand Zyperns. Wenn es geregnet hatte, wurden die Wege so matschig, dass nur noch Allrad-Jeeps durchkamen – aber gut, es regnete hier so gut wie nie.
Pauschalurlauber mieden den aufwendigen Weg hierher, sie bevorzugten die Hotelstrände nahe den großen Städten. Einzig Naturliebhaber und verliebte Paare kamen hierher, um ganz in Ruhe den Tag zu verbringen. Abends war das Baden hier verboten, genau wie nächtliches Kampieren.
Der Grund dafür befand sich in den kleinen Käfigen aus Metall, die unten am Strand im feinen, noch sonnenwarmen Sand befestigt waren. Alle zehn Meter ein Käfig, beinahe symmetrisch waren sie dort aufgestellt, in Reihen à zehn oder elf Stück – und sie beschützten etwas ganz Besonderes: die Eier der grünen Meeresschildkröten nämlich. Vor zwei Wochen waren die majestätischen Muttertiere an den Strand gekommen und hatten begonnen, mit ihren Füßen Löcher zu buddeln, um darin ihre Eier abzulegen, und es war für sie so aufregend gewesen, dabei zuzusehen, dass Annika immer noch eine Gänsehaut bekam, wenn sie daran dachte. Schließlich waren die Tiere wieder ins Wasser verschwunden, aber nicht ohne vorher ihre Spuren zu verwischen. Denn natürlich spürten sie instinktiv, dass ihre Nachkommen in großer Gefahr waren. Es gab Strandfüchse hier, die nichts sehnlicher wollten, als sich an den kleinen Eiern zu laben, aber auch Raubvögel hätten sich im Sturzflug auf die Eier gestürzt – wären da nicht Annika und ihre Freunde gewesen, die, sofort nachdem die Schildkröten verschwunden waren, die Metallkäfige über den Nestern befestigten, um die Fressfeinde abzuhalten.
Doch es waren nicht nur die tierischen Feinde, die die Eier und ihre – vom Aussterben bedrohten – Bewohner gefährdeten, es waren auch jene, wegen denen sich Annika und ihre Freunde auf der Düne versteckt hielten.
Seitdem die Reiseführer und das Internet von der Schildkrötenstation an Lara Beach berichteten, kamen immer wieder Menschen, um sich die Eier anzusehen, aber auch um eventuell eine große Schildkröte zu Gesicht zu kriegen. Die meisten waren dabei sehr rücksichtsvoll und hielten sich an die Regeln, doch immer wieder kamen auch jene, die sich zu nah an die Nester wagten oder vielleicht sogar auf die dämliche Idee kamen, ein Ei als Souvenir mit nach Hause zu nehmen.
Annika ließ ihren Blick von den Nestern zum Horizont schweifen – der schönste Moment des Tages. Die Sonne war nur noch eine rote Sichel, und sie sank langsam, Zentimeter für Zentimeter Richtung Meer, als würde sie darin untergehen. Annika musste grinsen. Bei Instagram sah sie ihre Freundinnen, die nach dem Abitur mit Gruppenreisen oder riesigen Rucksäcken auf Reisen um die halbe Welt gegangen waren und nun Fotos posteten, wie sie mit einem Cocktail in der Hand die Beine in irgendeinen Pool hielten. Und sie saß hier mit einem zerrissenen T-Shirt und braungebrannten Beinen in einer kurzen Shorts und passte auf Schildkröten auf. Ehrlich gesagt gefiel ihr das viel besser als eine sinnlose Reise in irgendein Luxus-Resort. Und das lag auch an … verstohlen sah sie zu dem Jungen, der links neben ihr saß. Aris. So ein schöner Name. Und so ein schöner Junge.
Er war der zweite Grund gewesen, warum Annika an jenem Nachmittag Anfang Juli sprachlos gewesen war. Als sie zum ersten Mal an diesen Strand gekommen war, kurz nach ihrer Ankunft am Flughafen von Larnaca. Sie hatte die kleine Baracke betreten, die im Norden des Strandes eine informative Ausstellung über die Schildkröten beherbergte – und in ihrem hinteren Teil einen winzigen Aufenthaltsraum für die Schildkrötenbewacher. Und da war sie Aris begegnet, der sie mit einem strahlenden Lächeln begrüßte. Wie ein griechischer Gott kam er ihr vor, mit seinem Dreitagebart, den langen Surferhaaren, den braunen Augen und dem dunklen Teint. Annika hatte nur dagestanden und gestottert, vor Aufregung wollten ihr die wenigen griechischen Wörter, die sie kannte, rein gar nicht einfallen.
In den Tagen darauf waren noch vier weitere Neulinge angekommen, die das Team ergänzten: zwei Jungs aus Frankreich und zwei andere Deutsche, Carla, eine quirlige Bayerin, und Stephan, ein ruhiger und schüchterner Mann Anfang zwanzig, der eigentlich sehr gut aussah – aber als er ankam, war Annika nun mal schon längst in Aris, den Zyprioten, verschossen gewesen. Von Anfang an hatte sie seine Nähe gesucht, aber bisher war nichts passiert, nicht mal bei den allabendlichen Lagerfeuern am Strand, bei denen Aris hinreißend Gitarre spielte und alte zyprische Lieder sang. Dabei hatte sie eines Abends sogar angeregt, dass alle zusammen noch im Mondschein schwimmen gehen könnten. Aber Aris hatte abgewunken – das könnte die Schildkröten stören. Verdammt, sie hatte sich wahnsinnig über sich selbst geärgert, sie war doch hier, um die Tiere zu schützen, stattdessen wollte sie wegen ihrer Libido eine Runde im Naturschutzgebiet nackt baden – wie dämlich von ihr. Und peinlich noch dazu.
Doch heute hatte sie den ganzen Nachmittag gespürt, dass der sonst so souveräne Aris ganz anders war, nachdenklich, wie innerlich hin- und hergerissen. Sie fragte sich, was mit ihm los war.
Stephan riss sie aus ihren Gedanken, als er zusammenzuckte, mit der Hand auf den Strand wies und leise zu ihr sagte: »Doch nicht umsonst gekommen.«
Annika beobachtete, wie sich zwei Schatten in Richtung der Metallkäfige bewegten. Sie hielten Händchen, der Mann war blond, und eine Kamera baumelte vor seiner Brust. »Touristen«, sagte sie leise.
»Wer will?«, fragte Aris.
Annika straffte sich. »Ich gehe.«
Wenn die Eier so kurz vorm Schlüpfen waren, nutzten sie das Megafon nicht mehr, um die Touristen zu vertreiben. Es konnte immer sein, dass eine Schildkröte zu früh schlüpfte, dann würde der Lärm das kleine Tier verrückt machen. Also stand Annika rasch auf und ging die Düne hinunter.
»Hey«, zischte sie, um dann auf Englisch fortzufahren. »Was machen Sie hier?«
Der junge Mann sah sie hektisch an, er bekam rote Wangen, während die junge Frau mit trotzigem Blick fragte: »Wieso?«
»Ich bin Annika von der Schutzstation – das hier ist ein Brutgebiet der Meeresschildkröten. Es ist verboten, sich hier nach Sonnenuntergang aufzuhalten. Sie müssen den Strand verlassen.«
»Und wenn wir das nicht tun?« Noch hatte die Frau ihren Trotzblick nicht verloren. Es schien ihr nicht zu behagen, den Anweisungen einer Frau zu folgen, die noch jünger war als sie selbst.
»Dann funken wir die Polizei an – und dann werden Sie verhaftet«, entgegnete Annika trocken. Diese dumme Kuh würde sie nicht einschüchtern.
»Ist ja okay. Komm, wir gehen.« Sie griff nach der Hand des Manns, der Annika noch immer ansah, und zusammen zogen sie von dannen. Annika sah ihnen noch eine Weile nach, dann ging sie wieder nach oben.
»Gut gemacht«, sagte Aris und lächelte sie an. »Da hatten wohl wieder mal zwei vor, hier ein romantisches Stündchen zu verbringen.«
»Es ist ja auch wunderschön hier, ich kann sie verstehen«, sagte Annika und sah Aris einen Moment zu lange an.
»Wir sind noch eine Woche hier, dann werden die Schildkröten schlüpfen«, erwiderte er. »Eigentlich müsstet ihr dann alle zurück – aber es gibt noch etwas anderes, wo wir vielleicht helfen können.« Er verzog das Gesicht. »Eine richtige Schweinerei.«
»Was denn?«, fragte Annika schnell. Die Aussicht, noch länger mit Aris zusammenarbeiten zu können, elektrisierte sie.
»Es geht auch um Tiere – und um eine alte Tradition, an der hier auf der Insel immer noch festgehalten wird, obwohl sie so grausam ist.«
»Erzähl …« Sie spürte, wie das Adrenalin sie durchflutete, aber da war sofort auch noch etwas anderes: tiefe Wut.
»Kommt, wir gehen in die Hütte. Von dort können wir den Strand auch überblicken, dann erzähle ich euch alles. Es wäre toll, wenn ihr dabei seid. Der Mann, der den Folterern das Handwerk legen will, ist auch Deutscher. Und er ist eine echte Legende.«
Aris hatte zu flüstern begonnen und sah nun beinahe ehrfürchtig drein. Annika ahnte, dass dies der Beginn einer wirklich folgenschweren Geschichte war. Aber sie hatte sich längst entschieden, dabei sein zu wollen.
Zwei Wochen später
Taverna Troodos, Kyperounda
Die Zikaden hatten schon vor Stunden aufgehört zu zirpen, als die Temperatur in Kyperounda unter die 20-Grad-Marke gefallen war. Seither war es ganz still, bis auf den leichten Wind, der durch ihr Schlafzimmerfenster drang und sie ein wenig kühlte.
Die Tage auf dem Hochplateau waren in diesem Frühling viel zu heiß, und es tat gut, dass es wenigstens in der Nacht ein wenig frische Luft gab. Nicht auszudenken, welche Hundstage ihnen erst im Sommer bevorstünden. Dann kam die Luft hier oben förmlich zum Stehen, und die Steine des Troodos heizten das Dorf noch zusätzlich auf.
Sie schlief für gewöhnlich tief und fest wie ein Stein. Die Arbeit in der Taverne war hart, all das Gerenne auf dem Steinfußboden, die alten Männer, die sie hetzten, noch ein Bier, noch einen Kaffee, noch ein paar Oliven, und dann waren auch noch die Touristen gekommen, viel früher als sonst im Jahr. Es war ein anstrengender Tag gewesen. Und doch hatte sie nicht zur Ruhe gefunden, seit sie um elf das Licht gelöscht hatte.
Irgendetwas arbeitete in ihr. Xenia war eine gläubige Frau, und sie hatte immer innere Ahnungen gehabt, schon als sie ein Kind war, hatte das begonnen, ihre Mama hatte sie einmal Hexe genannt. Wahrscheinlich war sie nicht gerne allein im Bett – ja, darauf konnte sie es schieben, denn das war sonst anders. Um vier Uhr hatte sie noch immer kein Auge zugemacht.
Dann endlich, um halb fünf, bekam sie einen weiteren Grund für ihre innere Unruhe geliefert – auch wenn der schlimmer war, als sie hätte ahnen können.
Sie hörte in der Ferne zuerst den lauten Motor und schlug die Augen auf. Xenia hätte ihn unter Tausenden von Motoren erkannt. Es war der Diesel des alten Pick-ups. Als die Bremsen quietschten, war sie schon aus den Federn und stapfte mit nackten Füßen die Stufen der Treppe hinab.
Sie ging durch den dunklen Gastraum und riss die Tür auf, die wie die eines jeden Hauses in Kyperounda nie abgeschlossen war.
Draußen sah sie im Licht der einzigen Straßenlaterne weiter unten auf der Straße, wie zwei Schatten auf sie zukamen. Der eine, größere, stützte den kleineren, der sich nur mühsam vorwärtsbewegte, schwankend und stöhnend.
»Lefteris!«, entfuhr es ihr, und es klang ein wenig kreischend, dann rannte sie los, auf die beiden zu, und blieb wie angewurzelt vor ihrem Mann stehen.
»Was ist passiert?«, flüsterte Xenia, als sie sein geschundenes Gesicht sah, doch er schaffte es tatsächlich, sie einfach mit dem Arm zur Seite zu schieben.
»Lass mich in Ruhe«, zischte er, während er weiterhumpelte, offenbar hatte auch sein Bein etwas abbekommen.
Sie war wie gelähmt, doch dann spürte sie die Wut aufsteigen. »Lefteris!«, rief sie, lauter diesmal, und griff den Hünen am Arm. Der Handwerker drehte sich um, ohne sie anzusehen.
»Sag schon, was ist passiert?«
»Verdammt, ich muss ins Bett«, sagte ihr Mann stöhnend, befreite sich aus der Umklammerung seines Freundes und schleppte sich Richtung Haus. Der andere Lefteris versuchte, der wütenden Xenia auszuweichen, auch er konnte ihrem Blick nicht standhalten.
»Jetzt rede mit mir – oder ich erzähle das alles deiner Frau«, forderte Xenia ihn auf.
Jeder in Kyperounda wusste, dass Lefteris zwar draußen ein echter Macker war, aber hinter den heimischen vier Wänden hatte jemand anders die Hosen an.
»Ich war zu spät«, flüsterte er. »Ich war am Pick-up, um mehr Netze zu holen. Da habe ich ihn brüllen gehört. Nur ein Mal, dann hatten sie ihn am Boden. Ich bin runter von der Ladefläche, aber ich wusste nicht genau, wo er war. Ich hab das ganze Feld abgesucht, bis ich ihn unter seinem Netz habe liegen sehen. Die haben ihn übel fertiggemacht.«
»Wer denn?«
»Die verdammten Tierschützer.« Er zischte das Wort wie eine Verwünschung.
»Du meinst …«
Lefteris zuckte mit den Achseln. »Der hängt da bestimmt mit drin. Aber ich hab nur ein paar Leute rennen sehen. Ich wollte eigentlich hinter denen her, aber Lefteris hat sich gar nicht mehr gerührt. Also hab ich mich erst mal nur um ihn gekümmert. Verdammt, wenn ich die erwische …«
»Warum macht ihr auch diese Scheiße«, fauchte Xenia, die spürte, wie ein unkontrollierbares Zittern ihren ganzen Körper erfasste.
Lefteris’ Blick veränderte sich, er war jetzt kühl und kontrolliert. Die Leute hielten ihn immer für einen grobschlächtigen Kerl ohne Hirn, dabei wusste Xenia, dass er durchaus klug war, bauernschlau zumindest. »Du weißt, warum wir das machen«, gab er knapp zurück. »Deinen Laden gäbe es sonst nicht mehr.«
Nun war sie es, die den Blick senkte. »Er … er hätte tot sein können.«
Lefteris zuckte mit den Achseln und seufzte. »Soll ich dir noch helfen mit ihm?« Er wies mit dem Kopf zum Inneren des Hauses.
»Nein. Fahr nach Hause. Ich kümmere mich um ihn.«
»Kühlt das Gesicht. Sonst sieht er morgen aus wie eine verfaulte Birne.«
»Danke, Herr Doktor«, gab sie knapp zurück, dann drehte sie sich um und stapfte ins Haus. Als sie drinnen war, hörte sie das Geräusch fließenden Wassers aus der ersten Etage. Langsam ging sie die Treppe hoch. Sie hätte den folgenden Moment lieber hinausgezögert – oder ihn sich ganz erspart. Aber das war unmöglich.
Sie ging am Schlafzimmer vorbei und zu dem kleinen Bad mit den braunen Fliesen, das sie so gern mal renoviert hätte. Aber wovon denn? Er stand unter der Dusche und hatte sich gegen die Wand gelehnt, ganz krumm hing er da, er trug noch seine Hose, das Wasser lief darüber. Er sah sie an, sein Blick ganz sanft, beinahe entschuldigend, dann sagte er: »Ich habe sie nicht ausgekriegt. Das … das tut so weh.« Sie ging zu ihm, trat ganz nah an ihn heran, angezogen, wie sie war, in ihrem Nachthemd, sie hob ihre Hand und legte sie an sein malträtiertes Gesicht, als wolle sie es abdecken, sie sah das Blut, das ihm aus der Nase lief, sein linkes Auge war zugeschwollen und die Augenbraue aufgeplatzt, die obere Lippe war dick.
»Was haben die mit dir gemacht?«, fragte sie und nahm ihn in die Arme. Im Nu war sie klitschnass, sie schloss die Augen, es war ihr egal.
»Die Füße waren überall. Ihre Füße …«
»War er dabei?«
Lefteris wusste gleich, wen sie meinte.
»Die kamen von hinten. Ich … ich hab keine Ahnung.«
Sie drückte ihn fest an sich und flüsterte: »Du lebst. Du lebst. Gott sei Dank.«
Xenia wusste, dass die Gäste morgen wütend sein würden. Dutzende hatten reserviert – und nun würde sie ihnen nicht das Gewünschte servieren können, das, wofür ihre Kunden zum Teil aus Nikosia angereist kamen. Aber sei’s drum. Lefteris lebte – und das war das Wichtigste.
Der Tote am Strand
Éna – 1
»Wie soll man denn bei dem Staub sein Haus schmücken?«, rief Adonis wütend und schwang den Besen in der Hand, als wolle er die Bagger mit purer Manneskraft angreifen. »Also wirklich, wann sind die denn endlich fertig? Bald ist Ostern …« Eigentlich war der junge Wirt ein sehr freundlicher und gemächlicher Mann, der nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen war. Aber der Zustand, in dem sich sein Heimatdorf in diesen Tagen befand, ließ ihn zunehmend dünnhäutig werden.
Und Sofia? Verstand ihn bestens. Auch sie fuhr mit den Händen immer wieder durch die Luft, um die Mischung aus Staub, kleinen Sandkörnern und den Blütenblättern, die in der Mittagshitze herumflogen, wegzuwedeln. Während Adonis die Terrasse seines Kafenions fegte – und dabei den Staub einfach von der einen in die andere Richtung bewegte.
Sie dauerten nun wirklich schon ewig, diese Bauarbeiten – und doch konnte Sofia ihren Stolz nur schwer verbergen. Denn immerhin hatten die Arbeiter den Winter über schon das Haus geschafft, einen einstöckigen Bungalow aus hellrotem Stein, mit großen Fenstern, die vorsichtshalber vergittert waren, falls über Kato Koutrafas ein Aufruhr hereinbrechen sollte.
Sofia kannte die Bürger des Dorfes längst gut genug, um zu wissen, dass das jederzeit möglich war – da musste gar kein Feind von außen kommen.
Nun waren die Arbeiter damit beschäftigt, die Zufahrt zu dem Haus zu pflastern – damit wäre der Weg zu ihrem neuen, alten Arbeitsplatz die einzige Straße im Umkreis von fünf Kilometern, die überhaupt befestigt sein würde.
Ihr neuer Arbeitsplatz. Sie grinste. Denn der Bungalow würde das neue Polizeirevier von Kato Koutrafas sein. Und damit das Hauptquartier der zyprischen Polizei in dieser Region im Nirgendwo, eine halbe Stunde westlich der Hauptstadt Nikosia und zehn Minuten entfernt vom Grenzstreifen zur Pufferzone, hinter der das absolute Niemandsland lag – der annektierte Norden, der für die Zyprioten im Süden eigentlich gar nicht existierte.
Hier ermittelte seit einem Jahrzehnt Chief Inspector Kostas Karamanlis – und seit nun gut zwei Jahren eben auch Sofia Perikles. Als Junior Officer war sie in den Job ein- und mit ihrem ersten gelösten Mordfall zur Officer aufgestiegen. Bevor sie kürzlich, am letzten Tag des alten Jahres, zur Sergeant ernannt worden war. Der kommunistische Innenminister hatte keine andere Wahl gehabt: Alle Zeitungen des Landes – das waren immerhin drei – und der einzige Fernsehsender hatten so lange über den Schatz von Bellapais und den aufsehenerregenden Ermittlungserfolg von Sofia berichtet, bis der Druck so groß geworden war, dass er nicht mehr anders konnte. Also hatte er Sofia befördert, genau wie Kostas, der nun Superintendent der Polizei geworden war. Und als großes Dankeschön hatte der Minister sogar noch etwas Geld in die Hand genommen. Wobei das neue Revier durchaus mehr sein sollte als eine reine Lobhudelei – das wussten sowohl Sofia als auch Kostas. Der Minister stellte damit sicher, dass sich die beiden Störenfriede aus dieser Region am Ende der Welt nicht mehr wegbewegten. Hatten sie es erst mal schön, dann würden sie hoffentlich Ruhe geben. Und sich um die Aufgaben kümmern, die in ihrem Zuständigkeitsbereich eben so anfielen.
Viel war das nicht: Mal war es ein Viehdiebstahl, weil ein besoffener Bauer die Schafe des Nachbarn für seine gehalten und auf seinen Pick-up geladen hatte. Oder ein besonders schwerer Fall von Sachbeschädigung, weil drei vorlaute Kids den Grenzzaun zur Pufferzone mit einem Seitenschneider aufgeschnitten hatten – wobei Sofia ihnen dafür eigentlich einen Orden hätte verleihen wollen. Bis vor Kurzem hatten sie dann und wann eine Radarfalle auf der Hauptstraße von Kato Koutrafas aufgestellt. Doch als beim letzten Mal den ganzen Tag lang nur drei Autos durchgefahren waren, hatte selbst die eifrige Sergeant Perikles eingesehen, dass das reichlich sinnlos war.
Weil nicht nur das Dorf, sondern auch die Hauptstraße so ausgestorben war, hörte sie den schweren Motor, bevor sie den Wagen sah. In dem flirrenden Baustaub war er ohnehin kaum zu erkennen, doch schließlich brach er förmlich durch die Staubwand und kam genau vor dem Kafenion zum Stehen. Sofia und Adonis standen die Münder offen.
Auf dem im Grunde – vernachlässigte man den angesammelten Baustaub – schneeweißen Pick-up der Marke ISUZU prangte in dunkelblauer Metallic-Farbe die Aufschrift Police und daneben das Wappen der Polizeibehörde. Der Wagen war offensichtlich brandneu, und als sich die Fahrertür öffnete und Kostas ausstieg, war ihm der Stolz von der Stirn abzulesen.
»Das letzte Geschenk des Ministers«, verkündete er. »Hab’s eben abgeholt. 181 PS. Unglaublich, oder?«
»Na, die werden wir ja auf der Dorfstraße richtig ausfahren können«, erwiderte Sofia.
Kostas sah sie stirnrunzelnd an. »Was ist denn los, Tausendschön? Seit wann bist du denn so negativ? Hier, hilf mir mal bitte.«
Sie traten an die Ladefläche des Pick-ups und hoben ein riesiges Schild aus Emaille an, um es zum Revier zu tragen.
»Ich habe darauf bestanden, dass wir es selbst anbringen.«
»Na, dann ran ans Werk, taufen wir unsere Station!«, grinste Sofia und nickte den Bauarbeitern zu, die ihnen schon die Schraubendreher entgegenhielten.
Sie erklommen je eine der beiden rechts und links der Tür platzierten Leitern, um schon kurze Zeit später wieder herunterzuklettern, sich die staubig gewordenen Hände an den Hosen abzuklopfen und einen Schritt zurückzutreten, um ihr Werk zu betrachten.
»Wow«, murmelte Sofia. »Das ist echt cool.«
Nun prangte das Schild über der Tür und zeigte genau zur Dorfmitte: Police Station of Kato Koutrafas.
»Unser neues Zuhause«, sagte Kostas mit unverkennbarem Stolz in der Stimme. Was durchaus bemerkenswert war. Schließlich hatte er vor vielen Jahren einen viel wichtigeren Posten innegehabt, als Leiter der Polizei der großen Hafenstadt Limassol unten im Süden. Aber dieser verlassene Ort hier – und die Menschen, die in ihm lebten – war ihm längst zur Heimat geworden. »Darauf sollten wir ein Glas trinken.« Er fing Sofias Blick auf. »Na komm. Wegen eines Glases werde ich sicher nicht wieder zum Säufer von Kato Koutrafas. Heute ist ein Tag zum Feiern. Komm schon, keine Sorge.«
»Na gut.« Sie ließ sich von Kostas hinüberführen an einen der drei Tische, die vor dem Kafenion standen.
»Adonis?«
»Jawohl, Superintendent?« Der Wirt sagte es nicht ohne Ironie – und doch war auch ihm der Stolz anzumerken, jetzt einen so wichtigen Polizeibeamten in diesem Ort zu haben.
»Wir nehmen eine Flasche Eddial, ja?«
Adonis sah ihn fragend an. »Eddial? Sicher? Der ist wirklich … teuer.«
»Ja, eben – wir haben was zu feiern.«
»Eine Flasche zyprischer Champagner, in Ordnung, kommt sofort.«
Der Wirt verschwand im Inneren des Kafenions und kam nach ein paar Minuten tatsächlich mit einem Sektkühler und drei Gläsern wieder. Drei? Kostas sah ihn fragend an. Adonis zuckte mit den Schultern.
»Na, wenn ihr mich hier schon kurz vor Ostern vollstaubt und jetzt dieses edle Gesöff auspacken lasst, dann lade ich mich doch direkt mal selbst ein.«
Er öffnete die bauchige Flasche, indem er den Korken ganz vorsichtig kommen ließ, und schenkte das golden perlende Getränk in die Gläser.
»Der beste – na ja gut, zugegeben, auch der einzige – Schaumwein, den wir auf der Insel bisher zustande gebracht haben. Aber dafür ist er wirklich toll.«
Sofia kannte die Geschichte, die sich die Zyprioten seit Jahren stolz erzählten – eine der vielen Varianten jener Grunderzählung, in der ein Inselbewohner sich aufmachte, irgendein Produkt des alten Kontinents zu kopieren und ihm dabei gleichzeitig einen zyprischen Stempel aufzudrücken, was den Stolz der Zyprioten zuverlässig anfachte. Vor Jahren war es die Vlassides Winery gewesen, die mit ihren Winzern aus zyprischen Trauben einen Sekt gekeltert hatten – echte Pionierarbeit war das. Doch die Winzer waren belohnt worden. Der seltene Schaumwein war auf Jahre hinweg ausverkauft – über welche dunklen Kanäle sich Adonis einige Flaschen davon gesichert hatte, war sein Geheimnis.
»So. Auf euch. Yamas!«
»Yamas!«
Sie alle erhoben ihre Gläser und stießen miteinander an. Sofia nahm einen Schluck und war baff. Es war ihr erster Schluck zyprischer Sekt – dabei liebte sie Schaumwein jeder Couleur –, und sie musste zugeben: Dieser hier war wirklich gut. Dem edlen französischen Vorbild beinahe ebenbürtig. Tief und mineralisch und perlend und total erfrischend.
»So – und nun sagt mal: Ist eure Zufahrt denn bald fertig, damit wir alle in Ruhe und ohne Bagger Ostern feiern können?«
Ostern. Sofia wurde heiß, als sie dieses Wort hörte. Noch heißer als ohnehin schon in dieser frühsommerlichen Mittagshitze.
Ostern war in Deutschland und England, wo sie studiert hatte, ein einfaches Fest. Ein Fest für kleine Kinder. Es gab Ostereier, ein paar Hasen in Lila, ein Essen en famille. Das war’s.
Auf Zypern war Ostern das