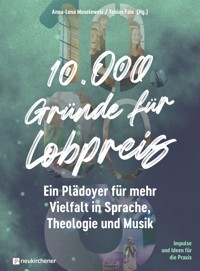
10.000 Gründe für Lobpreis E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neukirchener Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Weltweit berührt Lobpreis Menschen und prägt ihren Glauben. Längst hat er sich in Gemeinden neben klassischer Kirchenmusik mit Chorälen und Orgel etabliert. Gleichzeitig kann und muss Lobpreis sich weiterentwickeln und den vielfältigen Fragen des Lebens und Glaubens stellen. Genau dafür wirbt dieses Buch in Theorie und Praxis. Vom Worship-Schlager und Gospelsong über Spoken Word bis hin zu Kirchenkunst: Das Buch nimmt Lobpreis ganzheitlich in den Blick. In drei Bereichen - Musik, Theologie und Sprache - entfalten die Autor:innen ihren Blick auf Lobpreis und ergänzen sich gegenseitig zu einem tiefschürfenden Buch, das dieses gemeinderelevante Thema durchleuchtet und neue Ideen und Impulse für die Praxis gibt. Mit bekannten Autor:innen wie: Albert Frey, Arne Kopfermann, Lara Neumann, Thorsten Dietz, Jelena Herder, Marco Michalzik, Janina Crocoll, Martin Pepper, u.v.m. "Statt pauschaler Verteidigung oder Kritik schauen wir nun genauer hin: Was ist stark an Lobpreis, was hat uns die "Generation Lobpreis" zu sagen? Und wo braucht es Ergänzung, Korrektur, Weiterentwicklung? Das Buch ist ein wichtiger, vielschichtiger und äußerst lesenswerter Beitrag zur Diskussion und liefert wertvolle Impulse für die Praxis." (Albert Frey, Autor und Musiker)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Soweit nicht anders angegeben, sind die Bibelverse entnommen aus:
Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im
Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2023 Neukirchener Verlagsgesellschaft mbH, Neukirchen-Vluyn
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Grafikbüro Sonnhüter, www.grafikbuero-sonnhueter.de
unter Verwendung eines Bildes von © Kvitka Nastroyu, Monkey Business Images, Halfpoint, TuiPhotoEngineer (shutterstock) austin neil, alex wong (unsplash)
Lektorat: Hauke Burgarth, Pohlheim
DTP: dtp studio eckart | Jörg Eckart
Verwendete Schriften: Breva, FF Tisa
eBook: PPP Pre Print Partner GmbH & Co. KG, Köln, www.ppp.eu
ISBN 978-3-7615-6936-8 (Print)
ISBN 978-3-7615-6937-5 (E-Book)
www.neukirchener-verlage.de
Es ist Dienstagvormittag, acht Uhr. Etwa 70 eigentlich begeisterte, aber noch recht unausgeschlafene Studierende sitzen im Seminarraum. Zum Einstieg in die Vorlesung gibt es einen interaktiven Gesprächsteil, weshalb den Studierenden eine Diskussionsfrage gestellt wurde. Eine Studentin meldet sich zu Wort, zitiert einen Bibelvers und begründet damit ihre Aussage. Irgendetwas ist jedoch komisch, so wirklich richtig klingt der Satz nämlich nicht. Der zitierte Bibelvers entpuppt sich beim genaueren Hinschauen gar nicht als Bibelwort, sondern als Vers aus einem Lobpreislied. Als die Gruppe dies feststellt, geht ein Raunen durch die Reihen, der eine oder die andere verkneift sich ein kleines Lächeln, aber eigentlich geht es ziemlich schnell unaufgeregt mit der Diskussion weiter.
Solche oder ähnliche Situationen haben wir – Anna-Lena Moselewski und Tobias Faix – schon einige Male in Vorlesungen, Seminaren oder Gesprächen mit Studierenden an der CVJM-Hochschule erlebt. Es ist eine eher witzige Momentaufnahme, die uns dennoch bewegt: Zu sehen, wie prägend Texte aus Lobpreisliedern für (junge) Menschen sind, wie präsent diese im Leben verankert und wie stark sie mit eigenen theologischen Vorstellungen verknüpft werden, lässt uns immer wieder über das Verhältnis von Lobpreis und Theologie und die Verantwortung für eine positive Lobpreispraxis in der Jugend- und Gemeindearbeit nachdenken. Denn nicht nur uns und unseren Studierenden ergeht es so. Diese Befunde, die wir im Miteinander mit unseren Studierenden, aber auch auf Tagungen und in Gesprächen mit Ehren- und Hauptamtlichen aus der Jugend- und Gemeindearbeit entdeckt haben, lassen sich empirisch belegen und sind somit auch ein Trendanzeiger, welche Rolle Lobpreis im Leben und Glauben von religiösen und hochreligiösen Christ:innen sowie in Gottesdiensten und Gemeinden spielt.
Bereits vor fünf Jahren veröffentlichte die CVJM-Hochschule und ihr Forschungsinstitut empirica für Jugend, Kultur und Religion eine hochinteressante und aufschlussreiche Jugendstudie. Nicht zufällig trägt diese den Namen „Generation Lobpreis“. In der empirica Jugendstudie wurden 3.187 evangelische Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 29 Jahren durch eine umfassende Onlinebefragung erforscht. Ziemlich genau drei Viertel (75 Prozent bzw. 2.386) der befragten evangelischen Jugendlichen konnten als hochreligiös identifiziert werden; dies bedeutet, dass deren Glaubensüberzeugungen eine prägende Kraft auf die unterschiedlichen Bereiche des Lebens haben und somit zentrales Anliegen sind. Hochreligiöse gibt es dabei in allen konfessionellen Prägungen, so hat dies nichts mit theologischen Inhalten zu tun. Zusätzlich wurden 62 ausführliche qualitative Interviews durchgeführt, wo die Jugendlichen selbst zu Wort kamen und über ihren Glauben erzählten. Eine in dieser Studie gestellte Frage war, was den eigenen Glauben stärkt. Sie zeigt, was Jugendlichen für ihren eigenen Glauben besonders wichtig ist, welchen Einflüssen sie sich aussetzen und aus welchen Glaubensquellen sie in ihrem Alltag schöpfen. Die höchste Zustimmung auf die Frage, was den eigenen Glauben stärkt, erhielt „Lobpreismusik / Worship“ mit 64 Prozent. Dieses Ergebnis überrascht, da gerade Hochreligiöse traditionell zuerst mit „Gebet“ (auf Platz zwei) und „Bibellesen“ (auf Platz sechs) in Verbindung gebracht werden. Erwartet hoch bei der Frage nach der Stärkung des eigenen Glaubens waren die „Gespräche mit Freunden und Familie“ (mit 54 Prozent auf Platz drei) und „christliche Freizeiten“ (mit 47 Prozent auf Platz vier). Dass „Predigen im Gottesdienst“ mit 44 Prozent auf Platz fünf noch vor „Bibellesen“ kommt, ist auch überraschend und interessant1. Für uns bringt der Begriff „Generation Lobpreis“ etwas zum Klingen, das sich durch fast alle Ergebnisse zieht und stimmig ist mit dem Gesamtbild, das wir aus der Vielzahl und Vielfalt der Ergebnisse gewonnen haben. Einerseits spielt der Lobpreis faktisch für junge Menschen eine wichtige Rolle. Uns war das vorher bewusst, jedoch hat es uns überrascht, wie intensiv Lobpreis im Glauben der evangelisch-hochreligiösen Jugendlichen verortet ist und welch tiefe und beispielhafte Bedeutung er für das eigene Glaubensleben hat. Dabei geht es nicht nur um Lobpreis als Musik, sondern es geht um das Lebens- und Glaubensgefühl, das Lobpreis vermittelt. Hierin zeigt sich auch das, was man Individualisierung, Emotionalisierung oder Subjektivierung des Glaubens nennt. Dies gilt für das Gottesbild (höchster Wert: Gott liebt mich bedingungslos) wie für die Glaubenspraxis (Lobpreis ist eine wichtigere Quelle des Glaubens als Gebet und Bibellesen), für die Kirche (höchster Wert: Gemeinschaft) oder die Motivation zum Ehrenamt (höchster Wert: weil es Spaß macht). Die Studie zeigt also deutlich, wie wichtig Lobpreis für junge Menschen ist. Er ist zu einem zentralen Element der Glaubenspraxis von Christ:innen geworden, sowohl in Gottesdiensten mit einer enormen Prägekraft für die Gottesbeziehung, in theologischen Vorstellungen als auch in Glaubensansichten.
Mit dieser Prägekraft geht allerdings auch eine hohe Verantwortung einher. Die Studienergebnisse, aber auch zahlreiche Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass Jugendliche nicht unwesentliche Teile ihrer Theologie auf Inhalte im Lobpreis zurückführen. Und auch für Erwachsene stehen Lobpreis, die Liedtexte und -formen und theologische Ansichten in direkter Verbindung. Das bedeutet, dass eine Verantwortung darin liegt, welche Lobpreislieder mit welchen Inhalten, musikalischer oder sprachlicher Form in Gemeinden oder christlicher Gemeinschaft gesungen werden. So beobachten wir, dass bisherige Formen im Lobpreis in Gottesdiensten, Gemeinden, aber auch in der Produktion als Konsumgut via Spotify oder Youtube oft einseitig sind. So wie manche Predigten vielleicht zu kognitiv oder inhaltlich einseitig sind, kann auch Lobpreis wichtige Dimensionen und Perspektiven aussparen – bewusst und unbewusst. Der Titel dieses Buches lautet: „10.000 Gründe für Lobpreis. Ein Plädoyer für mehr Vielfalt in Musik, Theologie und Sprache“ – und damit meinen wir genau das. Es gibt 10.000 Gründe, Lobpreis zu gestalten, ihn einzusetzen und die positiven Seiten zu stärken. Ganz im Sinne des Songs „Zehntausend Gründe“ (von David Hanheiser, Matt Redmann et. al.), der uns als Titelinspiration diente:
„Du liebst so sehr und vergibst geduldig,
schenkst Gnade, Trost und Barmherzigkeit!
Von deiner Güte will ich immer singen,
zehntausend Gründe gibst du mir dafür.“
Wir finden es wunderbar und unterstützen es, dass Lobpreis eine solche Kraft zur Glaubensstärkung hat. Und gleichzeitig benötigt es einen ganzheitlicheren Blick darauf. Wir brauchen neue Formen, Impulse und Inhalte, die Lobpreis weiterdenken, biblisch fundiert und lebensweltorientiert in die Weite führen, um die Einseitigkeiten zu balancieren und die Verantwortung, die mit Lobpreis einhergeht, ernst zu nehmen. Dabei geht es uns nicht darum, bisherige Formen von Lobpreis zu ersetzen oder abzuwerten, sondern durch und mit neuen Impulsen zu ergänzen. Wir wollen anregen, Lobpreis ganzheitlicher, vielfältiger und weiterzudenken und zu leben – persönlich und in der Gemeinde.
Dieses Buch steht, ausgehend von der Veröffentlichung der Studie „Generation Lobpreis“, im Zusammenhang mit einer Reihe von Angeboten und Formaten rund um das Thema „Theologie & Lobpreis“, die alle zu diesem neuen Nachdenken über Lobpreis anregen sollen. Wir als CVJM-Hochschule wollen und müssen die Studienergebnisse ernst nehmen und möchten deshalb Impulse geben, eine verantwortungsvolle, vielfältige und kreative Lobpreispraxis in der Gemeinde- und Jugendarbeit zu etablieren bzw. weiterzuentwickeln. Für uns als Hochschule war deshalb schnell klar, dass wir insbesondere in der Aus- und Weiterbildung von Haupt- und Ehrenamtlichen, die in Gemeinden für Inhalte, Theologie und Lobpreis Verantwortung übernehmen, ansetzen möchten. Deshalb haben wir 2021 begonnen, das Thema Lobpreis fest im Lehrplan für unsere Studierenden der Gemeindepädagogik und Sozialen Arbeit zu integrieren. So können sich die Studierenden ein ganzes Semester lang tiefgehend mit dem Zusammenhang von Musik, Sprache und Theologie im Lobpreis beschäftigen und werden durch unterschiedlichste Gäste, Praxisbeispiele und Projekte auf ihre berufliche Tätigkeit und Verantwortungsübernahme vorbereitet. Neben diesem Angebot für unsere Studierenden haben wir außerdem ein offenes Netzwerk von interessierten Musiker:innen, Sprachkünstler:innen und Theolog:innen aufgebaut, die sich bereits selbst der Weiterentwicklung von Lobpreis widmen.
Sie werden durch dieses Netzwerk gestärkt und führen gemeinsam Projekte durch. Daraus entstanden 2021 und 2022 zwei Online-Werkstatttage: „Theologie & Lobpreis“ und „Die vier Jahreszeiten des Lobpreises“ mit mehreren Hundert ehren- und hauptamtlichen Teilnehmenden aus der Gemeinde- und Lobpreisarbeit. Ein weiterer Werkstatttag in Präsenz ist für Juni 2024 geplant, zu dem alle an diesem Thema Interessierten herzlich eingeladen sind. Neben dem Werkstatttag ist mit einigen Begeisterten aus diesem Netzwerk zudem ein Podcast entstanden, der sehr zu empfehlen ist. Alle Infos zu den Werkstatttagen und dem Podcast finden sich hier: www.theologie-und-lobpreis.de. So versuchen wir insgesamt, die Inhalte und das Know-how, welches wir uns im Laufe der letzten Jahre mitsamt der Menschen, die mit uns unterwegs sind, angeeignet haben, Studierenden und Interessierten zugänglich zu machen.
So ist letztlich dieses Buch entstanden: ein zentraler Ort, an dem die vielen wertvollen Impulse – ganz im Sinne der 10.000 Gründe für Lobpreis – der Menschen gesammelt werden, die die Themen rund um Musik, Sprache und Inhalte im Lobpreis bereits seit vielen Jahren durchdenken, voranbringen und die zum großen Teil selbst in der Lobpreisszene aktiv sind. Dieser Herausgeber:innenband ist demnach ein Mosaik unterschiedlichster Persönlichkeiten, Erfahrungen und Ideen, der zeigen soll, dass das Thema Lobpreis vielschichtig und vielfältig und auch noch lange nicht fertig durchdacht ist. Ein Mosaik, das uns zum Weiterdenken anregt und das auch selbst immer nur ein Teilstück des großen Mosaiks auf der Suche nach guten Wegen für Lobpreis bleibt. Ein Mosaik aus unterschiedlichsten Themen und Formen. Das Buch ist aufgeteilt in drei große Bereiche: Musik, Theologie und Sprache. Mit Beiträgen über die Schöpfungsverantwortung im Lobpreis oder „mindful worship“ bis hin zu Familienlobpreis in der Kirche Kunterbunt oder der Verhältnisklärung von Kunst, Sprache und Formen im Lobpreis sind die Perspektiven abwechslungsreich, unkonventionell und vielfach bereichernd für die eigene Haltung und Lobpreispraxis. Neben inhaltlichen Beiträgen vervollständigen außerdem künstlerische und lyrische Elemente sowie Anregungen für die Praxis, Reflexionsfragen und Platz für Notizen das Mosaik. Ein ganz großes Dankeschön gilt deshalb allen, die zu diesem wunderbaren Mosaik beigetragen haben: zu allererst und in tiefer Dankbarkeit den Autor:innen der 22 Beiträge, die hier ihre Gedanken und Herzensthemen beigetragen sowie einige der 10.000 Gründe für Lobpreis mit Leben gefüllt haben. Des Weiteren auch Marco Michalzik und Jelena Herder, die uns ihre lyrischen Texte, und Rebecca Bauder, die uns ihre LineArt-Illustrationen zur Verfügung gestellt haben. Außerdem bedanken wir uns herzlich beim Neukirchener Verlag und den Ansprechpartner:innen Ruth Atkinson, Laura Hirschberg, Hauke Burgarth, dem Grafiker Jörg Eckart, unserer studentischen Hilfskraft Ben Walther, der CVJM-Hochschule und allen anderen, die uns auf dieser Reise mit Theologie & Lobpreis an den verschiedensten Stellen unterstützen. Danke!
Wir wünschen dir deshalb viel Freude und inspirierende Gedanken beim Lesen von „10.000 Gründe für Lobpreis“ sowie gute Gespräche darüber mit Freund:innen, Musiker:innen, Künstler:innen, Pastor:innen, Lobpreisteams, Bands und Verantwortlichen für Lobpreis in deiner Gemeinde. Wir hoffen, dass die Beiträge und Elemente dein persönliches Lobpreismosaik bereichern. Als kleines I-Tüpfelchen haben wir außerdem eine Spotify-Playlist zum Buch mit anregenden Songtipps von unseren Autor:innen zusammengestellt. Natürlich ist auch unsere Namensinspiration „Zehntausend Gründe“ von David Hanheiser, Matt Redman et. al. dabei sowie z. B. Arne Kopfermanns Evergreen-Lieblingslobpreissong „Du bist mein Zufluchtsort“ als auch neue, unbekanntere Songs wie „Heile du uns wieder“ oder „Ich glaube an das Gute“ von Songs of Peace. Viel Spaß beim Reinhören, Mitsingen und vielleicht sogar Ausprobieren in der Gemeinde.
Anna-Lena Moselewski Tobias Faix
3x3 Impulse zur Worship-Kultur
Albert Frey
Ich freue mich, dass mit diesem Buch, mit der Initiative „Theologie & Lobpreis“ und mit vielen anderen Initiativen in der Kirche und in der christlichen Musikszene das Thema Worship weiterentwickelt wird und ich mit meinem Artikel das Kapitel „Musik & Klänge“ eröffnen darf. Genau genommen ist die aktuelle junge „Generation Lobpreis“ bereits die vierte Generation, seit in den 1960ern die Verbindung von Popmusik und Gebetstexten einen weltweiten Siegeszug antrat. Demnach würde ich mich mit meinen ersten Worship-Erfahrungen in den 1980ern in der zweiten Generation verorten und kann jetzt schon als „Großvater“ sprechen, hoffentlich mit der entsprechenden Weisheit! Jede Generation hat selbst einen Weg von der ersten Naivität über sich steigernde Komplexität und Selbstkritik bis hin zur Reife zu gehen.
Aber auch insgesamt steht die Worshipkultur – zwischen traditioneller Kirchenmusik und übertriebener Jugendkultur, konservativer Radikalisierung und Zersplitterung in einzelne Szenen – in vielen Spannungen und an einem entscheidenden Punkt: Wird es gelingen, den Zauber des Anfangs zu einer reifen und gesunden Kultur weiterzuentwickeln, an der viele teilhaben können? Oder wird diese Musik mit ihren Formen und Inhalten immer mehr zum Klischee, ja, zum Feindbild? Als Eröffnungsbeitrag zu dieser wichtigen Diskussion und Reflektion möchte ich meine Erkenntnisse und Beobachtungen der letzten Jahre in 3x3 Impulsen auf den Punkt bringen:
Gott ist nah
Es ist und bleibt das Frohe an der Frohen Botschaft und das Gute an der Guten Nachricht: Gott ist nah, das Reich Gottes ist mitten unter uns, Gott wendet sich den Menschen voller Gnade und Liebe zu. Lobpreislieder bringen diese Nähe nicht nur durch ihre Texte, sondern auch durch die Musiksprache zum Klingen. Persönlich, emotional, ohne historische und kulturelle Distanz. Das thematisiert nicht nur die „persönliche Beziehung zu Gott“, die Vater- und Mutterliebe Gottes, die Freundschaft mit Jesus und dem Heiligen Geist, es ermöglicht sie, gibt ihr Raum und Nahrung. Es ist meine Überzeugung, dass diese beglückende Erfahrung der Nähe, des Angenommenseins und der Zugehörigkeit – individuell und kollektiv – die Basis unseres Glaubens ist.
Wenn Lobpreis in diesem Sinne provoziert, dann ist es eine gute Provokation: Kann man so kindlich glauben? Ja – und nur so finden wir den Eingang in dieses geheimnisvolle Reich Gottes (Mk 10,5). Ist Lobpreis nur etwas für besonders Emotionale oder Fromme? Nein – uns allen steht die Tür zur himmlischen Party offen! Warum finden dann viele keinen Zugang, bleiben in der Distanz? Vielleicht, weil sie den Schritt auf die Tanzfläche noch gar nicht gewagt haben und als Beobachtende von außen nicht beurteilen können, wie schön und befreiend dieser „göttliche Tanz“ ist. Und vielleicht, weil wir Kirchenmusiker:innen und Lobpreisleiter:innen als „Gottes Discjockeys“ unseren Job nicht gut genug gemacht haben! Diesen Markenkern, nicht nur der Lobpreissongs, sondern der christlichen Botschaft überhaupt, sollten wir bewahren, entdecken, zugänglich machen und immer wieder neu gestalten!
Gloria
Lobpreis ist keine Neuerfindung der letzten Jahrzehnte. Von den Psalmen Israels über die gregorianischen Gesänge des Mittelalters und die Messen großer Komponisten bis zu den Reformationsliedern klingt das Lob Gottes durch alle Zeiten. Aber vielleicht stand es in der sperrigen Kirchenmusik der letzten 100 Jahre, im Neuen Geistlichen Lied und bei den christlichen Liedermachern nicht mehr so im Fokus. Erst ein „So groß ist der Herr“ (ein internationaler Hit der Nullerjahre von Chris Tomlin, der heute noch weltweit viel gesungen wird) konnte wieder inhaltlich, aber auch durch seine Reichweite und seinen Mut zum Pathos an „Großer Gott, wir loben dich“ anknüpfen. So steht die Lobpreisbewegung für die Wiederentdeckung eines kraftvollen und fröhlichen Gotteslobes, das im liturgischen GLORIA seine kirchliche Urform hat. Ehre sei Gott in der Höhe! Auch die Einfachheit des liturgischen Textes („wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an“) sollten wir bei ähnlichen Lobpreisliedern – wenn sie denn gut gemacht sind – nicht geringschätzen, sondern als Reduktion auf das Wesentliche und als Konzentration auf Gott willkommen heißen. Das ist die Kraft von Lobpreis: dass wir unabhängig von den Umständen auf Gott und seine Möglichkeiten schauen. Das brauchen wir wieder, das brauchen wir weiter. Das GLORIA muss durch alle Zeiten und Stile hindurch erklingen und unsere Augen für die Herrlichkeit – gloria, doxa – Gottes im Himmel und auch auf der Erde öffnen.
Sanctus
Das SANCTUS steht für eine weitere Farbe der Anbetung, die in der Messliturgie auf den Punkt kommt. Auch in der evangelischen und freikirchlichen Welt und eben auch durch die Lobpreisbewegung werden die großen Linien der Messgesänge fortführt – sei es bewusst oder unbewusst. Das dreifache Heilig findet sich in vielen Worshipsongs und auch dieselbe Grunderfahrung: das Staunen über den heiligen, allmächtigen und geheimnisvollen Gott. Fascinans et tremens – ein Erschrecken, das uns zugleich fasziniert: Wir haben es mit dem lebendigen Gott zu tun, mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde, jenseits aller Lichtjahre und Galaxien. Wem das biblisch-traditionelle Bild des Thronsaals dafür zu abgenutzt ist, der kann vielleicht innerlich oder tatsächlich in den Sternenhimmel blicken, auf die majestätischen Berge oder den unergründlichen Ozean. Diese Suche nach dem „heiligen Raum“ prägt übrigens aktuellen Worship mehr als das fröhliche und manchmal oberflächliche Lob Gottes der 1980er und 90er. Langsame Tempi, große Gefühle. Es kommt alles wieder. Wo früher der Weihrauch den Raum füllte, wabert jetzt der Bühnennebel, statt Lichtstrahlen durch geheimnisvoll farbige Kirchenfenster leuchten jetzt stimmungsvoll bewegte Scheinwerfer, und statt erhebender Orgelklänge dringen Klangteppiche aus sphärischen Keyboards und effektvollen Gitarren, tiefen Bässen und bombastischen Trommeln aus den Lautsprechern. Im besten Fall hilft uns das tatsächlich zu einer beglückenden Erfahrung, der Vorhang unserer begrenzen Sicht öffnet sich zu einem Blick auf die unsichtbare Welt und wir erleben die Verbundenheit mit Gott und seiner ganzen Schöpfung, die ihn ohnehin aus sich selbst heraus preist. „Wenn die Sterne dich anbeten, dann auch ich“ (aus „So will I“, Hillsong United).
Diese Erfahrung der Anbetung ist wertvoll und wichtig, und sie kann die Lobpreisbewegung in die ganze Kirche einbringen!
Exklusivität
Ich finde in der Bibel eine manchmal verwirrende Gleichzeitigkeit von Aussagen, die entweder Menschen ausschließen oder alle Menschen einbeziehen. Nur in der Zusammensicht beider Pole – der schöpfungsgemäßen Würde jedes Menschen und der bedingungslosen Liebe zu allen Menschen einerseits und der Notwendigkeit der Entscheidung und Unterscheidung bis hin zur Scheidung vom Bösen anderseits – kann sich gesunder Glaube entwickeln. Ich bin überzeugt, dass wir beides brauchen, vielleicht auch als einen Weg mit unterschiedlichen Betonungen: von einer abgrenzenden Selbstfindung und Gruppenidentität bis hin zur alles umfassenden Barmherzigkeit Gottes. In Worshipsongs finde ich aber weitgehend ausgrenzende Formulierungen: Wir, dein Volk, die Gläubigen – du, unser Gott. Als ob er uns exklusiv gehören würde! Die Coronakrise und die weiteren Krisen unserer Zeit haben nicht überall unsere weltweite Solidarität gestärkt, sondern manchmal leider auch das Gefühl der kleinen erretteten Schar, die sich gegen alle anderen durch die Endzeit kämpft. So will ich nicht glauben, und zu solch einem Verein will ich nicht gehören. Und ich reagiere mittlerweile allergisch auf Lieder, die auch nur so verstanden werden können, auch wenn sie ursprünglich anders gedacht waren. Mein Gott ist größer? Als deiner? Mir scheint es offensichtlich, dass wir es hier nicht mit der Botschaft der Liebe zu tun haben, sondern mit Angst und einem großen, aber fromm verbogenen Ego. Prüfen wir also selbstkritisch: Feiern wir einen großen Gott oder die Großartigkeit unserer Gruppe und unserer Überzeugungen und das Gefühl, dass wir „drinnen“ und andere „draußen“ sind? Das wäre Ego-Worship.
Es muss alles gut sein
Manche haben sich vielleicht schon gefragt, ob es noch kommt: Wo bleibt das KYRIE?! Ja, das „Herr, erbarme dich“, der Raum für das Negative vor Gott, ist und bleibt wichtig. In der Weisheit der Liturgie kommt vor dem Gloria das Kyrie! Und dieser Raum wird in der Lobpreisszene oft übersprungen. Wenn Gott gut ist, dann muss doch alles gut sein, oder? Statt den biblischen und liturgischen Weg erst nach unten, in die Wirklichkeit, in die Selbsterkenntnis und Buße zu gehen und uns von dort erheben zu lassen, lassen wir das KYRIE aus und steigen direkt auf zum Gloria, ja, wir singen nur noch Gloria und schweben fast unter der Decke! Das ist aber kein Zeichen für einen größeren Glauben, sondern eher ein Zeichen von Unreife, Verdrängung und Schönfärberei. Die Psychologie nennt das „spiritueller Bypass“. Was wir nicht anschauen wollen, überbrücken wir mit erhabenen Gedanken und Gefühlen. Das mag eine Zeit lang gut gehen, eine Zeit lang vielleicht auch notwendig zu sein, um aus einem negativen Strudel herauszukommen. Auf Dauer ist es aber ungesund und führt dazu, dass ein solcher Glaube irgendwann in eine ernsthafte Krise kommt und ins Gegenteil umschlagen kann. Die Lobpreisszene hat inzwischen viele Ex-Gläubige hervorgebracht, die so einseitig unterwegs waren, dass sie den Glauben komplett über Bord werfen mussten und nicht mehr zwischen ungesunden Prägungen und der befreienden Botschaft des Evangeliums unterscheiden konnten. Deshalb brauchen wir dringend Raum für Fragen ohne schnelle Antworten, Klage, Buße und Fürbitte, Lieder mit spiritueller Weisheit und seelsorgerlicher Tiefe. Ich muss nicht auf alles eine Antwort haben. Es muss nicht alles gut sein. Es ist, wie es ist – und Gott bleibt trotzdem gut!
Kulturelle Einseitigkeit
Wer heute in Seminaren und Kursen, in Büchern oder Lernmedien ein grundlegendes Verständnis von Lobpreis weitergeben will, hat es zunehmend schwer. Viele Junge wollen nicht mehr mühsam lernen und ihren eigenen Weg finden, sondern möglichst schnell und mit geringem Aufwand so klingen und aussehen wie ihre Worship-Vorbilder auf Youtube. Vielleicht ist diese scheinbar schnelle Machbarkeit die Illusion jeder jungen Generation, aber in unserer mediendominierten Welt ist es schwerer denn je, einen inneren Weg zu gehen. Viel spannender scheint das Äußere: die richtigen Geräte zu kaufen und dann die großen „Four-Chord-Hits“ nachzuspielen – Lieder mit vier sich ständig im selben Schema wiederholenden Akkorden, die tatsächlich viele Worshipsongs leicht nachspielbar machen. So setzt sich aber nicht geistliche Substanz durch, sondern kulturelle Dominanz, geschicktes Marketing, das größte Budget. Ich bin überzeugt: Auch die großen internationalen Player haben ein gutes und ernsthaftes Anliegen, aber es ist für Anbieter und Anwender schwer, dem Sog von Markt und Erfolg etwas entgegenzusetzen und der Mehrheitskultur zu trotzen. Ein Beispiel aus der Tontechnik, die mein ursprünglicher Beruf war: Seit Jahren ist es im Worship „in“, einen besonders wuchtigen und knalligen Schlagzeugsound zu haben. Wenn ich einen Pop-Radiosender einschalte, höre ich dagegen ganz unterschiedliche Sounds: Da gibt es auch mal leisere und leichtere Drums oder gar keine. Wollen wir mit diesem „großen“ Sound besonders cool sein, um ja nicht bei einer weichgespült-christlichen Variante moderner Popmusik zu landen? Braucht Gott, unser Glaube, unsere Hoffnung auf ein überwältigendes Erlebnis dieser „Macht“? Wir bauen nach, was wir bei Bethel, Hillsong und Co. hören – mit schallisolierenden Glaskäfigen, in denen Schlagzeuger „voll reinhauen“ können und einer beindruckenden Anzahl an Subwoofern für den nötigen Druck in der Magengegend.
Ich weiß einen satten Drumsound zu schätzen, aber hier ist diese Monokultur mit Händen zu greifen. Musik ist so vielseitig, Musik kann viel mehr, als beeindrucken und erhabene Gefühle zu erzeugen. Ich würde in einem Gottesdienst mit moderner Musik gerne auch mal schmunzeln und lauschen, melancholisch und albern sein, feine Saiten zum Schwingen bringen und stille Momente genießen.
Wir brauchen mehr Mut zum Eigenen und Ungewöhnlichen, die Individualität der Musiker:innen, verschiedene Musikstile und Instrumente, laut und leise, schnell und langsam, vorsichtig tastend und überzeugt vorangehend – und alles dazwischen. Wie schön ist es, wenn all die unterschiedlichen Blumen auf Gottes großer Wiese in ihren „true colours“, ihren wahren Farben, leuchten!
Und wir brauchen eine Vereinfachung, eine Anpassung unserer Musik an die real existierende Situation vor Ort. Fast niemand hat eine Halle mit ein paar tausend Menschen, eine riesige Bühne und eine gigantische Ton-, Licht- und Videoanlage. Warum versuchen wir dann trotzdem, dem Vorbild nachzueifern? Kleine Besetzungen, akustische Alternativen, weniger Technik, weniger neue Lieder. Simplify your worship! Mach das, was du tust, einfach, aber mit der Sicherheit, die aus Übung und Erfahrung kommt. Und mach es mit ganzem Herzen und ganzer Hingabe, aber ohne Anspruch auf Perfektion.
Schöpfungsperspektive
Nochmals zwei biblische Perspektiven, die in scheinbarem Gegensatz stehen. Vielleicht muss es bei den großen geistlichen Wahrheiten so sein, dass sie sich für uns in unserem begrenzten Denken nur als Paradoxon, als scheinbarer Widerspruch mit zwei sich ergänzenden Sichtweisen darstellen lassen. Die Schöpfungsperspektive ist grundlegend, fundamental, und sie zeigt sich nicht nur in den Schöpfungserzählungen in 1. Mose 1+2, sondern auch in vielen Schöpfungspsalmen, in den Naturgleichnissen Jesu, ja, überhaupt in seiner Lehre vom Reich Gottes, das wächst: Gott hat alles gut gemacht, einen guten Samen gesät, und der entwickelt sich jetzt mit der Zeit – mit Rückschlägen, aber auf ein gutes Ziel hin. Gott segnet und der Segen vermehrt sich. Diese grundoptimistische, naturverbundene und weltoffene Sicht ist zutiefst biblisch! Aber auch die andere Geschichte ist wichtig, ja, zentral, die in 1. Mose 3 voller archetypischer Weisheit erzählt wird: Da kommt etwas Zerstörerisches, Spaltendes in Gottes gute Welt, Menschen schaden sich gegenseitig und sehen nur noch den eigenen Vorteil. Wir brauchen Umkehr, Vergebung, Erlösung, Verwandlung – Metanoia!
Davon handeln Lobpreislieder überwiegend: Schuld und Gnade, Kreuz und Erlösung. Wenn das aber zur einzigen Perspektive wird, dann ist die Welt nur noch ein verlorener Ort, dem wir entkommen müssen; dann sind der Körper und die Materie unwichtig, dann sind „Ungläubige“ gefährlich oder Missionsobjekte. In gewisser Weise haben viele Lobpreislieder, so modern sie klingen mögen, ein sehr altmodisches, konservatives und negatives Weltbild. Viele moderne Menschen halten diesen „alten Glauben“ für überholt und wollen lieber selbst die Welt retten und vielleicht noch einen Gott dazu, der alles und alle gut findet. Ich nicht. Aber ich glaube, wir brauchen beide Perspektiven. Und die Schöpfungsperspektive fehlt uns schmerzlich. Dabei würde sie wunderbare Möglichkeiten für Lobpreis bieten. Das Lob des Schöpfers, die Freude über die Schönheit und Vielfalt, das Stauen über die Wunder in der Schöpfung samt Anregungen aus der modernen Wissenschaft. Auch die Musik könnte dadurch anders und vielfältiger und vielleicht natürlicher klingen. So könnten wir das große Thema unserer Zeit, die Bewahrung der Schöpfung, mitten in unsere Lieder und unseren Gottesdienst nehmen, anstatt es an den Rand zu drängen.
Multiperspektivisches Kreuzesverständnis
Schauen wir uns das Kreuz und sein Verständnis in Lobpreisliedern genauer an. Ich habe mich die letzten Jahre intensiv mit den sogenannten „sieben Worten vom Kreuz“ beschäftigt und darüber ein größeres Werk geschrieben. Es sind sieben berühmte letzte Sätze, die Jesus in der Zusammenschau aller vier Evangelien am Kreuz spricht. Letzte Worte großer Persönlichkeiten sind immer spannend, eine Charakterisierung, ein Vermächtnis. Von Jesus hören wir nicht nur aus vier verschiedenen Evangelien, die unterschiedliche Perspektiven bieten, sondern wir haben sogar sieben ganz verschiedene Worte, die das Kreuzesgeschehen erhellen. Welches dieser sieben Worte wird wohl am meisten in Worshipsongs zitiert? Mit Abstand: „Es ist vollbracht!“ Das war zu erwarten: die Deutung des Kreuzes als Sieg, Erlösung, Opfertod (englisch: sacrifice). Aber nicht so schnell: Erst kommt ja „Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“. Feindesliebe, Gewaltlosigkeit, Vergebung bieten eine ganz andere Perspektive! Am Kreuz ist Jesus auch victim, Opfer von ungeheurer Ungerechtigkeit und damit ein Zeichen der Solidarität und des Trostes für alle, die Opfer von Ungerechtigkeit werden. Und in seiner Selbsthingabe ist er auch offering: Er selbst ist die Botschaft, er selbst ist die Gabe und damit auch ultimatives Vorbild: „Vater, in deine Hände …“. Es geht noch weiter: Besonders Katholik:innen und Künstler:innen lieben das Bild von Maria und Johannes unterm Kreuz: „Sieh, deine Mutter, sieh, dein Sohn“ – nicht nur Jesu Sorge um seine Angehörigen kommt darin zum Ausdruck, sondern ein ikonisches Bild einer neuen Familie, die Jesu stiftet, Jung und Alt, Mann und Frau. So bedeutungsvoll, so vieldeutig ist das Kreuz. Sollen wir in unserer Zeit immer noch von dem alten rauen Holz des Kreuzes singen? Ja, unbedingt, aber so vielfältig, wie die Bibel selbst über das Kreuz spricht! Und dabei sollten wir immer offen sein für andere Sichtweisen. Das Kreuz bleibt ein Geheimnis. Wir haben es nicht, es hat uns ergriffen.
Offenere Gottesbilder
Manche würden nicht nur gerne das Kreuz entsorgen, sondern auch den patriarchalen Vater und den himmlischen König samt Hirten, Schafen und Lämmern. Ich verstehe das. Lobpreislieder sind in ihren Gottesbildern und ihrer Bildsprache sehr „biblisch“, wenn man es freundlich sagen will. Oder altmodisch, unverständlich, inhaltlich und künstlerisch wenig innovativ, wenn wir mal für einen Moment unsere Insiderbrille ablegen. Ich glaube aber nicht, dass wir die alten Bilder entsorgen sollten. Wir sollten sie vielmehr neu zum Leuchten bringen, erklären, erschließen, ergänzen und behutsam erweitern. Das Lamm auf dem Thron ist ein geniales, universales Bild, wenn wir nur einen Moment tiefer eintauchen: Das sanftmütigste Tier bekommt die Herrschaft, nicht das mächtigste und gewalttätigste! Auch der König ist bei genauerem Hinsehen ganz anders: nicht egoistisch oder schwach, wie viele Herrscher, die wir in der Geschichte erlebt haben und zu Recht ablehnen. Es ist der König mit der Dornenkrone, der Ohnmächtige, der am Ende alle Macht in Händen hält. Ich verwende das Wort „Herr“ in meinen Gebeten und Liedern inzwischen nicht mehr als Standardgottesanrede, sondern nur noch, wenn ich meine Beziehung zu ihm als meinem Herrn und Meister in besonderer Weise zum Ausdruck bringen will. Zunächst ist Gott für mich aber Jahwe – der „Ich bin da“, „Ich bin für dich da“. Das ist nicht besonders männlich und auch nicht herrschaftlich, sondern sehr fürsorglich! „Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet“ (Jes 66,13).
Wir müssen in der Bibel manchmal tiefer graben, durch die patriarchale Prägung vieler Jahrhunderte hindurch. Da entdecken wir die weibliche und auch die transpersonale Seite Gottes: Ruach (hebräisch weiblich für Wind, Geist), die heilige Geistkraft, Wind, Wasser, Feuer, Kraft, Energie (dynamis), Gott als Urgrund, die Liebe, der Unfassbare, der Unverfügbare, der ganz Andere. Und plötzlich sind die Bilder gar nicht mehr so naiv und altmodisch! Vielleicht müssen wir manche christlich-kulturelle Prägung beiseitelassen und wie Paulus in Athen den Weg noch einmal von außen nach innen gehen: Diesen unbekannten Gott, der uns umgibt, in dem wir leben, weben und sind (Apg 18,28), hat uns Jesus von Nazareth persönlich vorgestellt. Er ist an uns interessiert wie ein liebevoller Vater (und eine liebevolle Mutter!). So viele Bücher müssen noch geschrieben, so viele Predigten noch gehalten und Songs verfasst werden, um diese anderen Zugänge zu Gott auszuloten und ein allzu naives und altmodisches Verständnis von Gott so zu erweitern, dass auch moderne, kritisch denkende Menschen sich darin wiederfinden.
Wir haben erst angefangen, die Kultur der Anbetung zu bauen, und es gibt noch viel zu tun, viele wunderbare Aufgaben für Praktiker:innen und Theoretiker:innen, für Musiker:innen und Poet:innen, für Techniker:innen und Gestalter:innen. Auch wenn wir zwischendurch frustriert sind, weil der Thronwagen im Schlamm unserer kleinen Kämpfe und engen Begrenzungen festzustecken scheint: Der Strom fließt! Die Liebe Gottes und ihr Echo im Himmel und in der ganzen Schöpfung fließen, es ist ein ewiger Strom der Anbetung. Wir müssen und wir können Lobpreis nicht „machen“, wir können nur einstimmen.
Reflexionsfragen:
Was finde ich persönlich an Lobpreis stark, und was sollten wir bewahren? Was stört mich daran, und was sollten wir ändern? Was fehlt mir dabei, und was sollten wir entwickeln?Quo vadis Worship Movement?Was wir aus derGeschichte lernenkönnen
Arne Kopfermann
Zu allen Zeiten des Christentums wurde der Gott Abrahams und Saras, Isaaks und Rebekkas und Jakobs und Leas angebetet. Der Gott, der das All schuf und das Schicksal der Menschheit in seinen Händen hält. Der Gott, der mit seinen Geschöpfen in Beziehung leben will, dessen Wesen von Liebe geprägt und dessen Handlungen von Gnade motiviert sind. Der Gott, der auf geheimnisvolle Art und Weise in Form von Vater, Sohn und Geist in Gemeinschaft mit sich selbst lebt. Der diese Gemeinschaft auch auf seine Schöpfung, den Menschen, ausdehnen möchte. Der sich in Jesus auf diese Erde begibt, selbst Mensch wird und stellvertretend für unsere Schuld einen grausamen Tod erleidet. Der von den Toten aufersteht, seine Kirche begründet und zum Himmel auffährt. Der Gott, der sich und uns für alle Zeiten treu bleibt und dessen starker Arm doch bewegt werden kann. Der Gott, der Ursprung und Ziel unserer Lebensreise ist wie auch der von Generationen von Christ:innen vor und nach uns.
Zu allen Zeiten des Christentums wurde auch Musik verwendet, um diese Anbetung auszudrücken. Musik, die stilistisch dem Zeitgeist nachempfunden wurde, die aber zu anderen Zeiten von den Kirchenführern ganz bewusst vom Zeitgeist entkoppelt wurde, damit das Heilige nicht mit dem Profanen vermischt würde, bis die Musik und die Sprache der Anbetung teilweise nur noch von den kirchlichen und bürgerlichen Eliten geschätzt und verstanden wurde. Gerade im Mittelalter und danach wurde deshalb der Ruf nach Allgemeinverständlichkeit und Volksnähe lauter. Dann kam das letzte Drittel des 20. Jahrhunderts. Und die Anbetung der westlichen Kirche änderte sich fundamental. Angetrieben von der Moderne, dem Siegeszug des Individualismus über das Kollektiv, dem „Wir“-Gefühl der Gläubigen über die Institution Kirche als solche und der Globalisierung, aber auch von der Entstehung einer Vielzahl von neuen musikalischen Genres wie Jazz und Beatmusik, Pop, Fusion, Rock und später Hip-Hop und EDM, entstanden auf einmal Zehntausende von neuen Kirchen. Kirchen, die sich oft nicht mehr in erster Linie durch ihre theologischen Standpunkte voneinander unterschieden, sondern in denen die Anbetungsmusik zum in vielen Fällen wichtigsten konstituierenden Merkmal wurde. Und der Unterschied zu früheren Kirchenepochen war so gewaltig, dass diese Praise- und Worshipbewegung (wie sie schnell genannt wurde) von vielen als Ausdruck des Priestertums aller Gläubigen schlechthin gesehen wurde. Mit der Jesus-People-Bewegung an der Westküste der USA Ende der 1960er Jahre als Vorreiter erwachte eine tiefe Sehnsucht nach unmittelbarer Begegnung mit dem dreieinigen Gott, und die nun entstehenden schlichten Chorusse der Anbetung eroberten die westliche Kirche im Sturm, zuerst die charismatisch-pfingstlerische Domäne und später auch die evangelikale Welt.
Gut 50 Jahre ist diese Bewegung nun alt. Sie hat mich beinahe mein ganzes Leben begleitet, war zuerst mein Betätigungsfeld in der Gemeinde und wurde später auch zu meinem Berufsfeld. Ich habe sie seit ihren frühen Jahren studiert und im deutschen Sprachraum sicher auch durch Veranstaltungen, Übersetzungen, eigene Lieder, Seminare, Bücher und Artikel mitgeprägt. Wenn ich in der Folge von fünf Bereichen schreibe, in denen ich mir Veränderung wünsche, dann tue ich das als Insider, nicht als außenstehender Kritiker. Als jemand, für den der Lobpreis und die Anbetung Gottes zu einem Lebensthema geworden sind. Der persönlich viele bewegende Momente in sogenannten Lobpreiszeiten erlebt hat. Und der sich wünscht, dass die Bewegung erwachsen wird: breiter, ehrlicher, vielschichtiger, poetischer und authentischer.
Performance und Partizipation
Mindestens die ersten 15 Jahre der Worshipbewegung waren geprägt von sehr schlichten Liedern. Sie bestanden wie „Du bist der Höchste“, „Das Höchste meines Lebens“ oder „Ich lieb dich, Herr“ oft nur aus Vierzeilern und wurden wohl deswegen auch „Chorusse“ genannt, was ja ein anderes Wort für Refrain ist. Es gab keine komplexen Songstrukturen mit Versen und Bridge: Diese Lieder sollte man auch ohne Beamer (damals: Tageslichtprojektor) sofort mitsingen können. Die Performance der Lobpreisleiter:innen stand nie im Vordergrund. Wie sonst hätte sich auch ein so uninspirierter Name wie Ansingeteam durchsetzen können? Seit den 1980er-Jahren ist viel passiert. Waren es früher vielleicht ein paar Dutzend Lieder, die sich in einem Jahr als Kassette, Vinyl oder später CD verbreiteten und im besten Fall um die Welt gingen, sind jetzt jährlich mehrere zehntausend Worshipsongs im Umlauf, die aus aller Herren Länder über Spotify, Youtube und Konsorten zu uns kommen. Die Kompositionen sind deutlich komplexer geworden und die Aufnahmen professioneller, weil mittlerweile eine ganze Musikindustrie dahintersteht. Während in den 1980er-Jahren Praise & Worship maximal der kleine Bruder von CCM (Christian Contemporary Music) war, ist es nun das vorherrschende Genre christlicher Musik. Nicht zuletzt, weil sich nach dem Niedergang physischer Tonträger über die Nutzung von Liedern in weltweiten gemeindlichen Veranstaltungen, abgerechnet über CCLI (Church Copyright Licensing International), am meisten Geld verdienen lässt.
Wo Lobpreisleiter:innen zu Popstars werden können, hat sich der Fokus seit den frühen Tagen der Lobpreisbewegung schon stark verschoben. Denn damals war die Prämisse der Verantwortlichen, dass der:die Leitende in den Hintergrund tritt, damit Gott im Zentrum der Anbetung stehen kann.
Den Gesang der Gemeinde konnte man gut hören, weil die Saal Lautstärke es (noch) zuließ. Das war dem gemeinschaftlichen Lobpreis sehr zuträglich! Und die Bühne mit Leinwand, Lichttechnik und Band stand nicht annähernd so sehr im Fokus wie heute. Wir können die Jahre nicht zurückdrehen. Aber es ist gut, sich ab und zu an die Wurzeln zurückzuerinnern. Manchmal ist weniger mehr. Man kann sich in einer Gemeindeveranstaltung heute durch die musikalische Anbetung bestens unterhalten fühlen. Und als Gemeinde trotzdem in der Zuschauerrolle bleiben. Das war zugegebenermaßen auch damals schon der Fall, denn Partizipation kann nicht verordnet werden. Aber eine Rückbesinnung kann uns helfen, die Prioritäten geradezurücken.
Professionalität und Authentizität
In den frühen Jahren ließ die professionelle Gestaltung der Worshipmusik oft zu wünschen übrig. Nach dem Motto „jeder Christ ein Gitarrist, jede Christin eine Flötistin“ wurde eine gemeindliche Musikgruppe oft zu einer recht abenteuerlichen Ansammlung von Instrumentalist:innen und Sänger:innen. Die Songs wurden eher begleitet als geprobt oder in einem Arrangement gespielt. Qualitätsansprüche wurden landauf landab eher selten in den Fokus gerückt. Seitdem hat sich viel verändert. Es gibt Webseiten mit konkreter Anleitung für christliche Ton-, Licht- und Projektionstechnik. Webseiten, die den einzelnen Musiker:innen zeigen, wie die Einzelparts von bestimmten Songs zu spielen sind, damit das Bandarrangement wie auf der Originalaufnahme klingt. Es gibt sogar Webseiten, auf denen man Sound-IRs kaufen kann, damit der eigene Gitarrensound im Multieffektgerät exakt so klingt wie auf der CD-Version von Elevation Music, Bethel oder Hillsong. Und man kann Multitracks von Originalaufnahmen kaufen, also aufgenommene Schlagzeug-, Bass-, Keyboard- und Gitarren-Einzelspuren, die dann im Gottesdienst mitlaufen, damit der Saalsound voluminöser und professioneller klingt. Die Band benutzt In-Ear-Monitoring, um sich selbst besser zu hören und zu intonieren, aber es laufen auch ein Klick und Ansagen der Songteile mit, um sich seltener zu verspielen. Das alles ist der Qualität der Musik zuträglich, aber es hat den Fokus natürlich auch deutlich in Richtung der technischen Aspekte der Musik verschoben.
Diejenigen, die diesen Schritt der Professionalisierung teilweise oder ganz mitgegangen sind, sollten sich ab und an Zeit dafür nehmen, den Ist-Zustand zu analysieren. Was habe ich durch den vermehrten Einsatz von Technik gewonnen? Durch welche Hilfsmittel bin ich zu einem besseren Gitarristen oder einer besseren Keyboarderin geworden? Von welchen Tools habe ich mich mittlerweile vielleicht zu sehr abhängig gemacht? Und brächte ich nur mein Instrument und ein paar Textblätter mit: Könnte ich auch dann mit Selbstvertrauen eine Lobpreiszeit gestalten, in der sich viele Menschen wohlfühlen? Die drastisch ansteigende Zahl von Livestreams seit der Coronapandemie macht uns die Aufgabe nicht gerade leichter. Schnell wurde den Verantwortlichen deutlich, dass man ganz andere Qualitätsansprüche an die Musik ansetzen muss, wenn man eine Veranstaltung auch auf Youtube überträgt, anstatt sie nur live vor Ort im Gottesdienst zu gestalten. Fremdschäm-Momente können da schnell eine reale Erfahrung werden. Und der Einsatz von moderner Digitaltechnik inklusive der Möglichkeit, den Gesang in Realtime zu „tunen“, ist einer besseren Qualität sehr zuträglich, denn aufgrund dieses Einsatzes von digitaler Studiotechnik hören wir seit 20 Jahren bei Aufnahmen in den Medien keine schiefen Töne mehr, und das hat unsere Hörerwartung stark verändert. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist: Ab wann „kippt“ die Lobpreiszeit von einer Gebetszeit zu einem konzertanten Geschehen, das eher konsumiert wird, anstatt daran als Beter:in teilzuhaben? Und was begünstigt Letzteres?
Die Wiederentdeckung des freien Gebetes





























