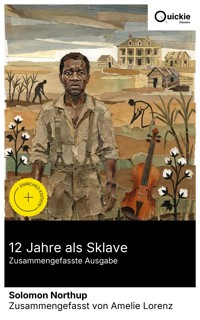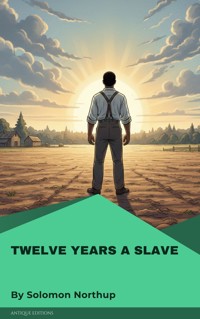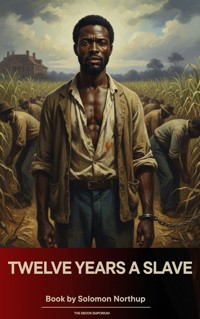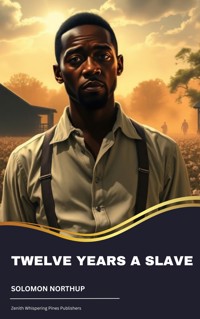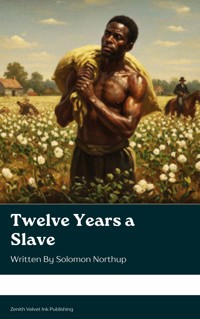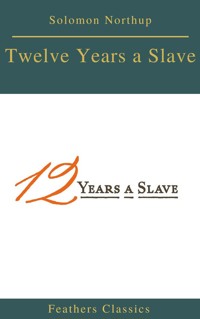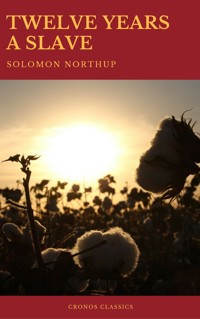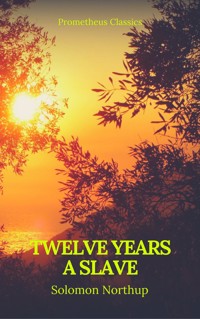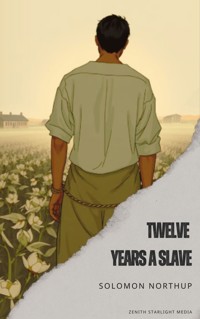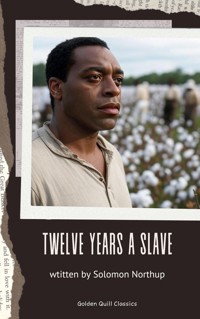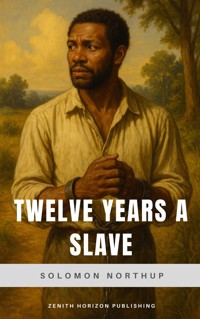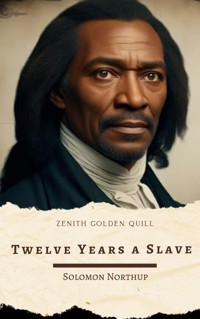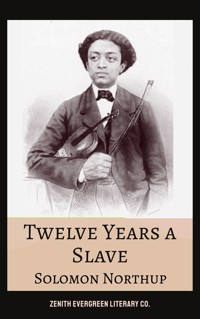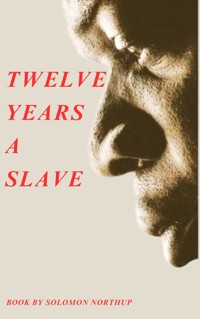Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Solomon Northup, ein freier Bürger des Staates New York, wird 1841 unter einem Vorwand in die Südstaaten gelockt, vergiftet, entführt und an einen Sklavenhändler verkauft. 12 Jahre lang schuftet er auf den Plantagen im Sumpf von Louisiana, und nur die ungebrochene Hoffnung auf Flucht und die Rückkehr zu seiner Familie hält ihn all die Jahre am Leben. Die erfolgreiche Verfilmung der Autobiographie Solomon Northups hat das Interesse an diesem Werk neu geweckt. Neben der dramatischen Geschichte von Solomon Northups zwölfjähriger Gefangenschaft ist dieses Buch zugleich ein zeitgeschichtliches Dokument, das die Institution der Sklaverei und die Lebensweise der Sklaven in den Südstaaten eindrucksvoll und detailliert beschreibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Solomon Northup
12 Jahre als Sklave
12 Years A Slave: Die Geschichte des Solomon Northup
Dieses eBook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Widmung
VORWORT DES HERAUSGEBERS VON 1853
KAPITEL I.
KAPITEL II.
KAPITEL III.
KAPITEL IV.
KAPITEL V.
KAPITEL VI.
KAPITEL VII.
KAPITEL VIII.
KAPITEL IX.
KAPITEL X.
KAPITEL XI.
KAPITEL XII.
KAPITEL XIII.
KAPITEL XIV.
KAPITEL XV.
KAPITEL XVI.
KAPITEL XVII.
KAPITEL XVIII.
KAPITEL XIX.
KAPITEL XX.
KAPITEL XXI.
KAPITEL XXII.
ANHANG
A. Artikel 375
B. Eingabe von Anne
C. Freilassungsurkunde
Impressum
Widmung
Für Harriet Beecher Stowe:
Deren Namen man auf der ganzen Welt mit der Großen Reform identifiziert;
Ihr ist diese Erzählung, die einen weiteren Schlüssel zu Onkel Toms Hütte bietet, voller Respekt gewidmet.
„So närrisch an Gebräuchen hängt der Mensch,
verehrt das Alte, was schon lange Zeit
befolgt wird, ja sogar die Sklaverei,
eines der schlimmsten aller Übel, weil
der Herr sie weiter reichet an den Sohn,
als heilig Ding besorgt gehütet wird.
Doch taugt sie was, verkraftet sie den Schock
Vernünft’ger Diskussion, dass denn ein Mann
aus selbem Stoff gemacht wie andre auch,
aus wirren Elementen, wozu Lust
und Torheit gleichermaßen zählen,
wie in dem Herz des Sklaven, den er lenkt,
als absoluter Herrscher sich dann rühmt
VORWORT DES HERAUSGEBERS VON 1853
Als der Herausgeber die Vorbereitung der nachfolgenden Erzählung begann, nahm er nicht an, dass sie den Umfang dieses Bandes erreichen würde. Um jedoch alle Tatsachen darzustellen, die ihm mitgeteilt wurden, erschien es notwendig, sie auf ihre gegenwärtige Länge auszudehnen.
Viele der Aussagen auf den folgenden Seiten werden von reichhaltigen Beweisen untermauert – andere beruhen allein auf Solomons Behauptungen. Dass er sich strikt an die Wahrheit gehalten hat, davon ist zumindest der Herausgeber, der die Gelegenheit hatte, irgendwelche Widersprüche oder Unzulänglichkeiten in seinen Aussagen zu entdecken, fest überzeugt. Er hat ausnahmslos dieselbe Geschichte wiederholt, ohne bei der geringsten Einzelheit abzuweichen, und hat gleichfalls sorgfältig das Manuskript durchgesehen, und Änderungen diktiert, wann auch immer die unbedeutendste Ungenauigkeit zu finden war.
Es war Solomons Glück, dass er während seiner Gefangenschaft verschiedenen Herren gehörte. Die Behandlung, die ihm in den „Kiefernwäldern“ zuteil wurde, zeigt, dass es unter den Sklavenhaltern Personen von Menschlichkeit wie auch von Grausamkeit gibt. Von einigen spricht er mit Gefühlen der Dankbarkeit – anderen im Geist der Bitterkeit. Man kann glauben, dass der nachfolgende Bericht seiner Erlebnisse am Bayou Boeuf ein stimmiges Bild der Sklaverei in all ihrem Licht und Schatten zeigt, wie sie an diesem Ort zur Zeit existiert. Frei, wie er meint, von jeder Voreingenommenheit und jedem Vorurteil, war es das einzige Ziel des Herausgebers, eine wahrheitsgetreue Geschichte von Solomon Northups Leben zu erzählen, wie er sie von seinen Lippen erfuhr.
Er hofft, dass er beim Erreichen dieses Zieles Erfolg hatte, ungeachtet der unzähligen Fehler in Stil und Ausdrucksweise, die man hierin finden mag.
DAVID WILSON.
WHITEHALL, New York, Mai 1853.
KAPITEL I.
EINLEITUNG – HERKUNFT – DIE FAMILIE NORTHUP – GEBURT UND ELTERN – MINTUS NORTHUP – EHE MIT ANNE HAMPTON – GUTE VORSÄTZE – DER CHAMPLAIN-KANAL – REISE MIT DEM FLOSS NACH KANADA – LANDWIRTSCHAFT – DIE GEIGE – KOCHKUNST – UMZUG NACH SARATOGA – PARKER UND PERRY – SKLAVEN – UND SKLAVEREI – DIE KINDER – DER BEGINN DES LEIDS.
Nachdem ich als freier Mann geboren wurde, und über dreißig Jahre lang den Segen der Freiheit in einem freien Staat genossen habe – und nachdem ich am Ende dieser Zeit entführt und in die Sklaverei verkauft wurde, in der ich verblieb, bis ich glücklicherweise im Januar des Jahres 1853 gerettet wurde, nach einer Gefangenschaft von zwölf Jahren – wurde mir nahe gelegt, dass ein Bericht über mein Schicksal und mein Leben für die Öffentlichkeit nicht uninteressant wäre.
Seit meiner Rückkehr in die Freiheit ist mir das wachsende Interesse in den Nördlichen Staaten hinsichtlich des Themas der Sklaverei nicht entgangen. Erfundene Geschichten, in denen vorgeblich ihre Eigenheiten in ihren angenehmeren ebenso wie in ihren abstoßenderen Aspekten dargestellt werden, wurden in einem nie da gewesenen Ausmaß in Umlauf gebracht und haben, so wie ich es verstehe, eine fruchtbare Thematik für Stellungnahmen und Diskussionen geschaffen.
Ich kann von der Sklaverei nur insoweit berichten, wie sie sich meinen eigenen Beobachtungen gezeigt hat – nur insoweit ich sie an meiner eigenen Person gekannt und erfahren habe. Es ist mein Ziel, die Tatsachen freimütig und wahrheitsgemäß darzulegen: die Geschichte meines Lebens ohne Übertreibungen wiederzugeben, und es anderen zu überlassen festzustellen, ob selbst die Seiten erdichteter Werke das Bild eines grausameren Unrechtes oder einer strengeren Knechtschaft zu zeichnen vermögen.
So weit ich mich zurückerinnern vermag, waren die Vorfahren auf meiner väterlichen Seite Sklaven in Rhode Island. Sie gehörten einer Familie mit dem Namen Northup, aus der sich einer, der in den Staat New York zog, in Hoosick im County Rensselaer niederließ. Er hatte Mintus Northup, meinen Vater, dorthin mitgebracht. Nach dem Tode dieses Gentlemans, was sich vor etwa fünfzig Jahren zugetragen haben muss, wurde mein Vater ein freier Mann, gemäß einer Anweisung in dessen Testament.
Henry B. Northup, Esquire, aus Sandy Hill, ein angesehener Rechtsanwalt und der Mann, in dessen Schuld ich dank der Vorsehung für meine gegenwärtige Freiheit stehe, und auch für meine Rückkehr in die Gesellschaft meiner Frau und meiner Kinder, ist ein Verwandter jener Familie, in deren Diensten meine Vorväter solchermaßen standen, und von der sie ihren Namen ableiteten, den ich auch trage. Dieser Tatsache mag das anhaltende Interesse zuzuschreiben sein, welches er zu meinen Gunsten aufbrachte.
Einige Zeit nach seiner Befreiung zog mein Vater in die Stadt Minerva in Essex County, New York, wo ich im Juli des Jahres 1808 geboren wurde. Wie lange er dort blieb, kann ich nicht genau bestimmen. Von dort zog er nach Granville, im County Washington, in die Nähe eines Ortes, den man Slyborough nennt, wo er einige Jahre auf der Farm von Clark Northup arbeitete, ebenfalls ein Verwandter seines alten Herren; von dort zog er auf die Farm der Aldens in der Moss Street, ein kleines Stück nördlich des Dorfes Sandy Hill; und von dort auf die Farm, die nun Russel Pratt gehört, an der Straße von Fort Edward nach Argyle gelegen, wo er wohnen blieb bis zu seinem Tode, der sich am zweiundzwanzigsten Tage des Novembers 1829 zutrug. Er hinterließ eine Witwe und zwei Kinder – mich und Joseph, einen älteren Bruder. Letzterer lebt immer noch im County Oswego, nahe der Stadt selbigen Namens; meine Mutter starb während der Zeit meiner Gefangenschaft.
Auch wenn er als Sklave geboren wurde und unter den Benachteiligungen litt, denen meine unglückliche Rasse unterworfen ist, war mein Vater ein Mann, dem man für seinen Fleiß und seine Rechtschaffenheit Respekt zollte, wie viele, die noch leben und sich noch an ihn erinnern, bereitwillig aussagen werden. Sein ganzes Leben verbrachte er mit friedlicher Betätigung in der Landwirtschaft, suchte nie Beschäftigung in jenen eher niederen Arbeiten, welche insbesondere den Kindern Afrikas zugewiesen werden. Abgesehen davon, dass er uns eine Erziehung angedeihen ließ, die über das hinausging, was üblicherweise Kindern in unserer Stellung zugestanden wurde, erhielt er durch seinen Fleiß und seine Sparsamkeit einen ausreichenden Besitzstandsnachweis, um ihm das Wahlrecht einzuräumen (Anm. d. Übers.: Im Bundesstaat New York war das Wahlrecht zu jener Zeit abhängig vom Vermögen des Bürgers, wurde aber auch Farbigen zugestanden). Er war es gewohnt, mit uns über sein früheres Leben zu sprechen; und gleichwohl er jederzeit die wärmsten Gefühle der Gewogenheit, ja sogar der Zuneigung für die Familie hegte, in deren Haus er ein Leibeigener war, begriff er nichtsdestoweniger jenes System der Sklaverei, und hing bekümmert seinen Gedanken hinsichtlich der Erniedrigung unserer Rasse nach. Er war bemüht, unseren Geist mit seinen Ansichten über gute Sitten zu füllen, und uns zu lehren, Vertrauen und Zuversicht Ihm zu schenken, der die bescheidensten ebenso wie die höchsten seiner Geschöpfe schätzt. Wie oft seit jener Zeit ist mir die Erinnerung an seine väterlichen Ratschläge in den Sinn gekommen, während ich in einer Sklavenhütte in den fernen und unzuträglichen Gegenden Louisianas lag, an den unverdienten Verletzungen litt, die mir von einem unmenschlichen Herrn zugefügt wurden, und mich nur noch nach dem Grab sehnte, das ihn schon bedeckte, um mich vor der Peitsche des Unterdrückers abzuschirmen. Auf dem Friedhof von Sandy Hill markiert ein schlichter Stein die Stelle, wo er ruht, nachdem er würdig die Pflichten erfüllt hatte, die zu der niederen Sphäre gehören, welche zu beschreiten ihm Gott bestimmte.
Bis zu jener Zeit war ich hauptsächlich bei meinem Vater mit den Arbeiten auf der Farm beschäftigt. Die mir zugestandenen freien Stunden verbrachte ich im Allgemeinen entweder bei meinen Büchern oder mit dem Spiel auf der Geige – eine Unterhaltung, welche die vorherrschende Leidenschaft meiner Jugend war. Sie war auch seither die Quelle des Trostes, bot den einfachen Wesen Vergnügen, mit denen ich mein Los teilte und lenkte meine eigenen Gedanken viele Stunden lang von der schmerzhaften Betrachtung meines Schicksals ab.
Am Weihnachtstag des Jahres 1829 heiratete ich Anne Hampton, ein farbiges Mädchen, welches damals in der Nähe unseres Hauses lebte. Die Eheschließung fand in Fort Edward statt, durch Timothy Eddy, Esquire, einen Ratsherrn jener Stadt, und heute noch ein bekannter Bürger des Ortes. Sie hatte lange Zeit in Sandy Hill bei Mr. Baird gewohnt, dem Eigentümer der Eagle Tavern, und auch in der Familie von Reverend Alexander Proudfit aus Salem. Dieser Gentleman hatte an letzterem Ort viele Jahre lang der presbyterianischen Gesellschaft vorgestanden, und war weithin für seine Gelehrtheit und Frömmigkeit bekannt. Anne hält immer noch die außerordentliche Güte und die hervorragenden Ratschläge jenes guten Mannes in dankbarer Erinnerung. Sie kann nicht die genaue Linie ihrer Abstammung bestimmen, doch das Blut dreier Rassen vermischt sich in ihren Adern. Es ist schwer zu sagen, ob Rot, Weiß oder Schwarz vorherrschend ist. Die Verbindung von ihnen allen in ihrer Herkunft jedoch hat ihr einen einzigartigen, aber gefälligen Ausdruck verliehen, so wie er nur selten zu sehen ist. Man kann sie nicht eindeutig als Quadroon (Anm. d. Übers.: jemand, der zu einem Viertel schwarzer Abstammung ist) einordnen, auch wenn sie diesen irgendwie ähnelt, eine Klasse übrigens, wie ich vergessen habe zu erwähnen, der meine Mutter angehörte.
Ich hatte gerade die Minderjährigkeit hinter mich gebracht, nachdem ich das Alter von einundzwanzig im vorigen Juli erreichte. Dem Rat und der Unterstützung meines Vaters beraubt, mit einer Frau, für deren Unterhalt ich verantwortlich war, stellte ich mich auf ein Leben des Fleißes ein; und ungeachtet des Hindernisses der Hautfarbe und in dem Bewusstsein meines niederen Status, hing ich angenehmen Träumen künftiger guter Zeiten nach, wenn der Besitz einer bescheidenen Behausung mit einigen umliegenden Äckern meine Mühen belohnen sollten und mir die Mittel zu Glück und Bequemlichkeit brächten.
Von der Zeit meiner Eheschließung bis zu diesem Tage ist die Liebe, die ich meiner Frau entgegenbringe, ehrlich und unvermindert; und nur diejenigen, welche die glühende Zärtlichkeit verspürt haben, die ein Vater seinem Nachwuchs entgegenbringt, können meine Zuneigung für die geliebten Kinder ermessen, die uns seither geboren wurden. So viel halte ich für angemessen und notwendig zu sagen, damit diejenigen, welche diese Seiten lesen, die Schmerzlichkeit jener Leiden verstehen können, die zu ertragen ich verurteilt war.
Unmittelbar nach unserer Eheschließung begannen wir unseren eigenen Haushalt zu führen, in dem alten gelben Gebäude, welches damals am südlichen Rand des Dorfes Fort Edward stand, und das seitdem in ein modernes Anwesen umgebaut worden ist, in jüngster Zeit bewohnt von Captain Lathrop. Man kennt es als Fort House. In diesem Gebäude wurde zeitweilig nach der Gründung des Countys Gericht gehalten. Es wurde ebenfalls im Jahr 1777 von Burgoyne (Anm. d. Übers.: John Burgoyne war ein britischer General im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg) bewohnt, da es nahe dem alten Fort am linken Ufer des Hudson River lag.
Während des Winters war ich mit anderen beschäftigt, den Champlain-Kanal zu reparieren, an dem Teilstück, dessen Inspektor William Van Nortwick war. David McEachron besaß die unmittelbare Verantwortung für die Männer, mit denen ich arbeitete. Als der Kanal dann im Frühling eröffnet wurde, konnte ich von meinem ersparten Lohn ein Paar Pferde kaufen, und andere Dinge, die im Binnenschiffergewerbe notwendig waren.
Nachdem ich einige tüchtige Hände zu meiner Unterstützung angeworben hatte, schloss ich einen Vertrag über den Transport großer Flöße Bauholz vom Champlainsee nach Troy ab. Dyer Beckwith und ein Mr. Bartemy aus Whitehall begleiteten mich auf mehreren Fahrten – ein Wissen, dass mich anschließend befähigte, einem würdigen Herrn einen profitablen Dienst zu erweisen und die einfältigen Holzfäller an den Ufern des Bayou Boeuf zu erstaunen.
Bei einer meiner Reisen den Champlainsee hinab war ich veranlasst, Kanada einen Besuch abzustatten. Ich begab mich nach Montreal und besuchte dort die Kathedrale und andere Sehenswürdigkeiten der Stadt, von wo ich meinen Abstecher nach Kingston und in andere Städte fortsetzte, und dabei Kenntnisse über die Örtlichkeiten erwarb, die mir ebenfalls später noch dienlich waren, wie es gegen Ende dieser Erzählung deutlich werden wird.
Nachdem ich meinen Vertrag am Kanal zu meiner und der Zufriedenheit meines Auftraggebers erfüllt hatte und nicht untätig bleiben wollte, nun, da die Schiffbarkeit des Kanals wieder eingestellt worden war, schloss ich einen weiteren Vertrag mit Medad Gunn ab, um eine große Menge Holz zu schlagen. Mit dieser Arbeit war ich während des Winters der Jahre 1831-32 beschäftigt.
Mit der Rückkehr des Frühlings fassten Anne und ich das Projekt ins Auge, eine Farm in der Nachbarschaft zu übernehmen. Ich war seit frühester Kindheit an landwirtschaftliche Arbeiten gewohnt, und es war eine Beschäftigung, die meinen Vorlieben entgegenkam. Dementsprechend trat ich in eine Übereinkunft betreffs eines Teils der ehemaligen Alden-Farm ein, auf der mein Vater früher gelebt hatte. Mit einer Kuh, einem Schwein, einem Joch vorzüglicher Ochsen, die ich kürzlich von Lewis Brown in Hartford erworben hatte, und weiterem persönlichen Besitz und Habe zogen wir in unser neues Heim in Kingsbury. In diesem Jahr pflanzte ich fünfundzwanzig Morgen Getreide an, säte große Felder mit Hafer aus, und nahm die Landwirtschaft in so großem Maßstab auf, wie es dem äußersten Rahmen meiner Mittel entsprach. Anne kümmerte sich voll Sorgfalt um die Angelegenheiten des Hauses, während ich angestrengt auf dem Feld schuftete.
An diesem Ort lebten wir bis zum Jahre 1834. In der Winterzeit hatte ich viele Einladungen erhalten, auf der Geige zu spielen. Wann auch immer sich die jungen Leute zum Tanz versammelten, war ich fast unausweichlich zur Stelle. In allen umliegenden Dörfern war mein Fiedelspiel offenkundig. Anne hatte gleichsam während ihres langen Aufenthalts in der Eagle Tavern eine gewisse Berühmtheit als Köchin errungen. Während der Gerichtswochen und bei öffentlichen Veranstaltungen wurde sie für einen hohen Lohn in der Küche von Sherrill’s Coffee House angestellt.
Wir kehrten nach der Verrichtung dieser Dienste immer mit Geld in unseren Taschen zurück; so dass wir uns bald durch Fiedelspiel, Kochen und Landwirtschaft im Besitz von einigem Wohlstand fanden und tatsächlich ein glückliches und erfolgreiches Leben führten. Nun, wahrhaftig wäre es so für uns gewesen, wären wir auf der Farm bei Kingsbury geblieben; doch die Zeit kam, da der nächste Schritt hin zu dem grausamen Schicksal unternommen wurde, das mich erwartete.
Im März 1834 zogen wir nach Saratoga Springs.
Wir bewohnten ein Haus, welches Daniel O’Brien gehörte, auf der Nordseite der Washington Street. Zu jener Zeit führte Isaac Taylor eine große Pension, bekannt als Washington Hall, am nördlichen Ende des Broadways. Er beschäftigte mich als Droschkenfahrer, und in dieser Funktion arbeitete ich zwei Jahre für ihn. Nach jener Zeit wurde ich gewöhnlich, ebenso wie Anne, während der Saison im United States Hotel beschäftigt, und anderen Gasthäusern jenes Ortes. In der Wintersaison verließ ich mich auf mein Geigenspiel, auch wenn ich während des Baus der Troy- und Saratoga-Eisenbahn dort viele Tage harter Arbeit zubrachte.
In Saratoga besaß ich die Gewohnheit, Artikel, die meine Familie benötigte, in den Geschäften von Mr. Cephas Parker und Mr. William Perry einzukaufen, Gentlemen denen gegenüber ich aufgrund vieler freundlicher Gesten Gefühle größter Hochachtung entgegenbrachte. Aus diesem Grunde bewirkte ich zwölf Jahre später, dass an sie der Brief, der weiter hinten angeführt ist, gerichtet wurde, welcher in der Hand von Mr. Northup das Mittel zu meiner glücklichen Befreiung war.
Während ich im United States Hotel weilte, traf ich regelmäßig Sklaven, die ihre Herren aus dem Süden begleitet hatten. Sie waren immer ordentlich angezogen und anständig versorgt, führten scheinbar ein lockeres Leben, das sie nur mit wenigen seiner gewöhnlichen Sorgen bekümmern konnte. Viele Male ließen sie sich mit mir auf Unterhaltungen über die Sklaverei ein. Ich entdeckte, dass sie fast einstimmig ein geheimes Verlangen nach Freiheit hegten. Einige von ihnen brachten ein inständiges Bestreben zu fliehen zum Ausdruck, und berieten sich mit mir über die beste Methode, dieses umzusetzen. Die Furcht vor der Strafe jedoch, die, wie sie wussten, ihre erneute Gefangennahme und Rückkehr begleiten würde, erwies sich in allen Fällen als ausreichend, um sie von dem Versuch abzuhalten. Nachdem ich mein ganzes Leben die freie Luft des Nordens geatmet habe, und in dem Bewusstsein, dass ich dieselben Gefühle und Neigungen verspürte, die einen Platz im Herzen des weißen Mannes finden – mehr noch, in dem Bewusstsein eine Intelligenz zu besitzen, die zumindest der einiger Männer mit einer helleren Haut gleichkam – war ich zu unverständig, vielleicht auch zu unabhängig, um zu verstehen, wie jemand zufrieden sein konnte, in der erbärmlichen Lage eines Sklaven zu leben. Ich konnte nicht die Gerechtigkeit dieses Gesetzes oder jener Religion verstehen, die das Prinzip der Sklaverei aufrechterhält oder anerkennt; und nicht ein einziges Mal, wie ich stolz bemerken darf, versäumte ich einem, der zu mir kam, den Rat zu geben, auf seine Gelegenheit zu lauern und die Freiheit zu ergreifen.
Ich wohnte weiterhin bei Saratoga bis zum Frühjahr des Jahres 1841. Die schmeichlerischen Erwartungen, die uns sieben Jahre zuvor verführt hatten, unser ruhiges Farmhaus am Ostufer des Hudson River zu verlassen, hatten sich nicht erfüllt. Die Gesellschaft und die Bekanntschaften an jenem weltbekannten Kurort waren nicht dafür geschaffen, die einfachen Gewohnheiten von Fleiß und Sparsamkeit zu erhalten, an die ich gewöhnt war, sondern im Gegenteil sie mit anderen zu ersetzen, die zu Trägheit und Verschwendung neigten.
Zu dieser Zeit waren wir die Eltern dreier Kinder – Elizabeth, Margaret und Alonzo. Elizabeth, die älteste, war in ihrem zehnten Lebensjahr; Margaret war zwei Jahre jünger, und der kleine Alonzo hatte gerade erst seinen fünften Geburtstag hinter sich gebracht. Sie erfüllten unser Haus mit Freude. Ihre jungen Stimmen waren Musik in unseren Ohren. So manches Luftschloss bauten ihre Mutter und ich für die unschuldigen Kleinen. Wenn ich nicht bei der Arbeit war, spazierte ich immer mit ihnen in ihren feinsten Kleidern durch die Straßen und Alleen Saratogas. Ihre Gegenwart war mein Wohlgefallen; und ich drückte sie mit einer ebenso warmen und zärtlichen Liebe an meinen Busen, wie wenn ihre dunkle Haut so weiß wie Schnee gewesen wäre.
Bis hierher bietet die Geschichte meines Lebens nichts in irgendeiner Weise Ungewöhnliches – nichts außer den gewöhnlichen Hoffnungen und der Liebe und den Arbeiten eines unbedeutenden farbigen Mannes auf seinem bescheidenen Weg durch die Welt. Doch nun hatte ich einen Wendepunkt in meinem Dasein erreicht – die Schwelle des unaussprechlichen Unrechts erreicht, und der Trauer und der Verzweiflung. Nun hatte ich mich dem Schatten in der Wolke genähert, hin zu der dichten Dunkelheit, von der ich bald verschluckt werden sollte, um von da an vor den Augen meiner ganzen Familie verborgen zu sein, und ausgesperrt aus dem süßen Licht der Freiheit, viele beschwerliche Jahre lang.
KAPITEL II.
DIE ZWEI FREMDEN – DIE ZIRKUSGESELLSCHAFT – ABREISE VON SARATOGA – BAUCHREDNERKUNST UND TASCHENSPIELERTRICKS – REISE NACH NEW YORK – EIN FREIENNACHWEIS – BROWN UND HAMILTON – DIE EILE DEN ZIRKUS ZU ERREICHEN – ANKUNFT IN WASHINGTON – DIE BESTATTUNG VON HARRISON – PLÖTZLICHE KRANKHEIT – DIE QUAL DES DURSTES – DAS ZURÜCKWEICHENDE LICHT – BEWUSSTLOSIGKEIT – KETTEN UND DUNKELHEIT.
Eines Morgens, gegen Ende März des Jahres 1841, spazierte ich, da zu der Zeit keine besonderen Geschäfte meine Aufmerksamkeit erforderten, im Ort Saratoga Springs umher und überlegte so bei mir, wo ich eine momentane Beschäftigung erhalten könnte, bis die Saison begänne. Anne war, wie es ihrer Gepflogenheit entsprach, nach Sandy Hill gegangen, eine Entfernung von etwa zwanzig Meilen, um die Verantwortung für die Küche in Sherrill’s Coffee House zu übernehmen, während das Gericht dort tagte. Elizabeth hatte sie, so glaube ich, begleitet. Margaret und Alonzo waren bei ihrer Tante in Saratoga.
An der Ecke Congress Street und Broadway nahe der Taverne, die damals und, da mir nicht das Gegenteil bekannt wäre, immer noch von Mr. Moon geführt wird, begegneten mir zwei Gentlemen von respektablem Erscheinungsbild, die mir beide völlig unbekannt waren. Ich habe die schwache Erinnerung, dass sie mir von einem meiner Bekannten vorgestellt wurden, mit der Bemerkung, ich wäre ein erfahrener Geigenspieler, doch von wem, habe ich mich vergebens versucht zu erinnern.
Auf jeden Fall begannen sie sofort eine Unterhaltung über das Thema, und stellten viele Fragen, die auf meine Fertigkeit in dieser Hinsicht abzielten. Da meine Antworten allem Anschein nach zufriedenstellend waren, schlugen sie vor, meine Dienste für eine kurze Zeit in Anspruch zu nehmen, wobei sie gleichzeitig konstatierten, ich wäre genau die Person, die ihr Geschäft benötige. Ihre Namen, die sie mir anschließend nannten, waren Merrill Brown und Abram Hamilton, obwohl ich starke Gründe habe anzuzweifeln, dass dies ihre wahren Namen waren. Der Erstere war ein Mann von augenscheinlich vierzig Jahren, ein wenig klein geraten und dicklich, mit einer Miene, die auf Gerissenheit und Intelligenz hindeutete. Er trug einen schwarzen Gehrock und einen schwarzen Hut, und sagte, er wohne entweder in Rochester oder in Syracuse. Der Letztere war ein junger Mann von heller Hautfarbe und lichten Augen und war, so meine ich, nicht älter als fünfundzwanzig. Er war groß und schlank, gekleidet in einen gelblichbraunen Mantel, mit einem glänzenden Hut und einer Weste in einem eleganten Muster. Seine ganze Kleidung entsprach der neuesten Mode. Sein Auftreten war ein wenig weibisch, aber einnehmend, und er trug eine lockere Miene, die zeigte, dass er in der Welt herumgekommen war. Sie hatten eine Verbindung, wie sie mir mitteilten, mit einer Zirkusgesellschaft, die damals in Washington weilte; dass sie auf ihrem Weg dorthin wären, um sich ihr wieder anzuschließen, nachdem sie diese eine kurze Weile verlassen hatten, um einen Abstecher nach Norden zu machen, denn sie hatten das Land sehen wollen und zahlten für ihre Ausgaben mit Hilfe gelegentlicher Darbietungen. Ebenso merkten sie an, dass sie auf große Schwierigkeiten gestoßen wären, musikalische Unterstützung für ihre Auftritte zu finden, und dass sie, wenn ich sie bis nach New York begleiten würde, mir einen Dollar für jeden Tag in ihren Diensten zahlen würden, und zusätzlich drei Dollar für jeden Abend, an dem ich zu ihren Auftritten spielte, neben einer ausreichenden Prämie, um die Kosten meiner Rückkehr von New York nach Saratoga zu decken.
Ich nahm sofort ihr verführerisches Angebot an, gleichsam wegen dem Lohn, den es versprach, wie auch einem Verlangen, die Metropole zu sehen. Sie waren bestrebt, sofort aufzubrechen. Da ich glaubte, meine Abwesenheit wäre nur kurz, hielt ich es nicht für notwendig, Anne zu schreiben, wohin ich ging; tatsächlich nahm ich sogar an, meine Rückkehr wäre vielleicht ebenso früh wie die ihre. Daher nahm ich Leinenzeug zum Wechseln und meine Geige und war bereit zum Aufbruch. Die Kutsche wurde vorgefahren – eine mit Dachbespannung, gezogen von einem Paar edler Brauner, was insgesamt für ein elegantes Erscheinungsbild sorgte. Ihr Gepäck, das aus drei Koffern bestand, wurde auf dem Rahmen befestigt, und nachdem ich den Sitz des Lenkers bestieg, während sie hinten ihre Plätze einnahmen, fuhr ich auf der Straße nach Albany aus Saratoga heraus, beschwingt von meiner neuen Stellung und so glücklich wie ich es jemals war, an jedem beliebigen Tag meines ganzen Lebens.
Wir kamen durch Ballston, schlugen den Weg über die Kammstraße ein, wie man sie nennt, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, und folgten ihr geradewegs nach Albany. Wir erreichten diese Stadt vor der Dunkelheit, und hielten an einem Hotel südlich des Museums. In dieser Nacht hatte ich die Gelegenheit, einen ihrer Auftritte zu verfolgen – der einzige in der ganzen Zeit, in der ich bei ihnen war. Hamilton stellte sich an die Tür; ich bildete das Orchester, während Brown für die Unterhaltung sorgte. Sie bestand aus dem Werfen von Bällen, Tanzen auf dem Seil, dem Backen von Pfannkuchen in einem Hut, dem Quieken unsichtbarer Schweine und ähnlichen Bauchredner- und Taschenspielerstücken. Das Publikum war außergewöhnlich dünn besetzt, dazu nicht vom erlesensten Charakter, und Hamilton berichtete von den Einnahmen als eine „armselige Ansammlung leerer Büchsen.“
Früh am nächsten Morgen setzten wir unsere Reise fort. Der Refrain ihrer Unterhaltung drückte nun die Sorge aus, den Zirkus ohne Verzögerung zu erreichen. Sie hasteten voran, ohne erneut für eine Vorführung anzuhalten, und zu gegebener Zeit erreichten wir New York, wo wir eine Unterkunft in einem Haus auf der Westseite der Stadt nahmen, in einer Straße, die vom Broadway zum Fluss verlief. Ich nahm an, meine Reise wäre zu Ende und erwartete in einem, höchstens zwei Tagen wieder bei meinen Freunden und meiner Familie in Saratoga zu sein. Brown und Hamilton jedoch begannen mich zu bedrängen, mit ihnen weiter nach Washington zu kommen. Sie behaupteten, dass sich der Zirkus unmittelbar nach ihrer Ankunft, nun da die Sommersaison nahte, auf den Weg nach Norden machen würde. Sie versprachen mir eine Anstellung und einen hohen Lohn, wenn ich sie begleiten würde. Sie ergingen sich weitschweifig über die Vorzüge, in deren Genuss ich kommen würde, und sie gaben derart schmeichelhafte Erklärungen ab, dass ich schließlich zu dem Schluss kam, ihr Angebot anzunehmen.
Am nächsten Morgen schlugen sie vor, dass es besser wäre, da wir nun einen Sklavenstaat betreten würden, wenn wir vor dem Verlassen New Yorks einen Freiennachweis beschaffen würden. Die Idee schien mir klug zu sein, auch wenn ich glaube, dass sie mir kaum in den Sinn gekommen wäre, hätten sie es nicht vorgeschlagen. Wir machten uns sofort auf den Weg, zum Zollhaus, so wie ich verstand. Sie beeideten bestimmte Tatsachen, die bewiesen, dass ich ein freier Mann war. Ein Schriftstück wurde aufgesetzt und uns mit der Anweisung ausgehändigt, es zum Verwaltungsbüro zu bringen. Dies taten wir, und nachdem der Verwaltungsbeamte etwas darauf hinzugefügt hatte, wofür ihm sechs Schilling bezahlt wurden, kehrten wir zum Zollhaus zurück. Wir gingen noch einige weitere Formalitäten durch, bevor wir fertig waren, und dann, nachdem ich dem Zollbeamten zwei Dollar gezahlt hatte, steckte ich die Papiere in meine Tasche und machte mich mit meinen zwei Freunden auf den Weg zu unserem Hotel. Ich gestehe, zu der Zeit dachte ich, dass die Papiere kaum die Kosten ihrer Anfertigung wert seien – mir drängte sich niemals auch nur im Entferntesten die Ahnung einer Gefahr für meine persönliche Sicherheit auf. Der Beamte, zu dem wir geschickt wurden, machte, wie ich mich erinnere, eine Bemerkung in einem großen Buch, das, wie ich annehme, immer noch in dem Büro liegt. Ein Verweis auf die Eintragungen von Ende März oder dem ersten April des Jahres 1841 wird zweifelsfrei die Ungläubigen zufrieden stellen, zumindest soweit es diesen speziellen Vorgang betrifft.
Mit dem Nachweis der Freiheit in meinem Besitz nahmen wir am Tag nach unserer Ankunft in New York die Fähre nach Jersey City und schlugen den Weg nach Philadelphia ein. Hier blieben wir für eine Nacht und setzten unsere Reise nach Baltimore früh am nächsten Morgen fort. Zu gegebener Zeit kamen wir in letzterer Stadt an und übernachteten in einem Hotel nahe dem Eisenbahndepot, dass entweder von einem Mr. Rathbone geführt wurde, oder aber Rathbone House genannt wurde. Auf dem ganzen Weg von New York schien ihre Sorge, den Zirkus zu erreichen, immer eindringlicher zu werden. Wir ließen die Kutsche in Baltimore zurück und reisten im Eisenbahnwaggon weiter nach Washington, wo wir gerade bei Einbruch der Nacht eintrafen, am Vorabend der Bestattung von General Harrison (Anm. d. Übers.: William Henry Harrison war der neunte Präsident der Vereinigten Staaten), und übernachteten in Gadsby’s Hotel auf der Pennsylvania Avenue.
Nach dem Abendessen riefen sie mich in ihr Zimmer und zahlten mir dreiundvierzig Dollar, eine Summe, die meinen Lohn übertraf. Sie sagten, jener Akt der Großzügigkeit sei der Tatsache geschuldet, dass sie während unserer Reise von Saratoga nicht so oft aufgetreten seien, wie sie mich hatten erwarten lassen. Darüber hinaus, so berichteten sie mir, war es die Absicht der Zirkusgesellschaft gewesen, Washington am nächsten Morgen zu verlassen, doch aufgrund der Bestattung hatte sie beschlossen, einen weiteren Tag zu bleiben. Sie waren damals, so wie auch von unserer ersten Begegnung an, äußerst freundlich. Sie ließen keine Gelegenheit aus, mich im Tonfall der Billigung anzusprechen; während ich andererseits sicherlich von ihnen höchst eingenommen war. Ich schenkte ihnen meine Zuversicht ohne Vorbehalt, und hätte ihnen beinahe unbeschränkt vertraut. Ihre beständige Unterhaltung mit mir und ihr Verhalten mir gegenüber – ihre Voraussicht hinsichtlich des Freiennachweises, ebenso wie hundert andere kleine Taten, die man nicht unbedingt wiedergeben muss – all dass deutete darauf hin, dass es wirkliche Freunde waren, die ehrlich um mein Wohlergehen beflissen waren. Ich weiß es nicht, doch sie waren es. Ich weiß es nicht, doch sie waren an dieser großen Niedertracht unschuldig, derer ich sie nun als überführt erachte. Ob sie nun in mein Unglück verwickelt waren – raffinierte und unmenschliche Ungeheuer in der Gestalt von Menschen – mich vorsätzlich von Heim und Familie fortlockten, und meiner Freiheit, des Goldes wegen – diejenigen, welche diese Seiten lesen, werden dieselben Mittel besitzen, dies zu bestimmen wie ich selbst. Wenn sie unschuldig waren, so muss mein plötzliches Verschwinden wahrhaftig unerklärlich gewesen sein; aber wenn ich mir im Geiste all die begleitenden Umstände überlege, kann ich es mir niemals erlauben, ihnen gegenüber so nachsichtig zu sein.
Als ich von ihnen das Geld erhalten hatte, welches sie im Überfluss zu besitzen schienen, rieten sie mir, in dieser Nacht nicht auf die Straße zu gehen, insofern ich mit den Gebräuchen der Stadt nicht vertraut war. Nachdem ich versprach, ihren Rat im Sinn zu behalten, verließ ich beide zusammen, und bald darauf wurde mir von einem farbigen Diener eine Schlafkammer im rückwärtigen Teil des Hotels im Erdgeschoß zugewiesen. Ich legte mich zur Ruhe nieder, dachte an Heim und Frau, und die Kinder, und die weite Entfernung, die zwischen uns lag, bis ich in Schlaf verfiel. Doch kein guter Engel des Erbarmens kam an mein Bett und forderte mich auf zu fliehen – keine Stimme der Gnade warnte mich im Traum vor den Prüfungen, die mir gerade bevorstanden.
Am nächsten Tag gab es einen großen Festzug in Washington. Das Donnern von Kanonen und das Läuten der Glocken füllten die Luft, während viele Häuser mit Trauerfloren verschleiert waren, und die Straßen schwarz waren vor Menschen. Als der Tag voranschritt, trat die Prozession in Erscheinung, kam langsam die Avenue herab, Kutsche auf Kutsche in langer Abfolge, während Tausende und Abertausende zu Fuß nachfolgten – alle sich zum Klang melancholischer Musik bewegend. Sie trugen den Leichnam von Harrison zu Grabe.
Ab dem frühen Morgen war ich immer in der Gesellschaft von Brown und Hamilton. Sie waren die einzigen Personen, die ich in Washington kannte. Wir standen zusammen, als der Trauerzug vorbeimarschierte. Ich erinnere mich deutlich, wie Fensterscheiben zerbrachen und klirrend zu Boden fielen, nach jedem Donnern der Kanone, die auf dem Friedhof abgefeuert wurde. Wir begaben uns zum Capitol und spazierten einige Zeit auf dem Gelände umher. Am Nachmittag gingen sie zum Haus des Präsidenten, und während all der Zeit behielten sie mich in ihrer Nähe und zeigten mir verschiedene Sehenswürdigkeiten. Bisher hatte ich noch nichts von dem Zirkus gesehen. Tatsächlich hatte ich inmitten der Aufregungen des Tages nur wenige Gedanken an ihn verschwendet, wenn überhaupt.
Meine Freunde betraten mehrere Male während des Nachmittags Trinklokale und bestellten Schnaps. Sie besaßen jedoch keinesfalls die Angewohnheit, diesem übermäßig zu frönen, soweit ich sie kannte. Bei diesen Gelegenheiten schenkten sie, nachdem sie sich selbst bedient hatten, ein Glas ein und gaben es mir. Ich wurde nicht betrunken, wie man vielleicht aus dem, was sich anschließend zutrug, folgern könnte. Gegen Abend, und kurz nachdem ich eines dieser Getränke zu mir genommen hatte, begann ich einige höchst unangenehme Empfindungen durchzumachen. Ich fühlte mich äußerst unwohl. Mein Kopf begann zu schmerzen – ein tauber, schwerer Schmerz, unsagbar unangenehm. Beim Abendessen war ich ohne Appetit; der Anblick und der Geruch des Essens lösten bei mir Übelkeit aus. Ungefähr zur Dämmerung führte mich derselbe Diener in den Raum, den ich auch die vorige Nacht belegt hatte. Brown und Hamilton rieten mir, zu Bett zu gehen, bedauerten mich freundlich und brachten die Hoffnung zum Ausdruck, dass es mir am Morgen wieder besser gehen würde. Nachdem ich mich nur von Mantel und Stiefeln entledigt hatte, warf ich mich auf das Bett. Es war mir unmöglich zu schlafen. Der Schmerz in meinem Kopf wurde immer stärker, bis er fast unerträglich war. In kürzester Zeit wurde ich durstig. Meine Lippen waren ausgetrocknet. Ich konnte an nichts anderes denken als Wasser – an Seen und fließende Ströme, an Bäche, an denen ich mich gebückt hatte, um zu trinken, und an den tropfenden Eimer, der sich mit seinem kühlen und überlaufenden Nektar vom Grunde des Brunnens erhebt. Gegen Mitternacht, soweit ich es beurteilen kann, erhob ich mich, unfähig länger noch einen solch eindringlichen Durst zu ertragen. Ich war ein Fremder in diesem Haus und kannte die Zimmer nicht. Soweit ich erkennen konnte, war niemand mehr auf den Beinen. Aufs Geratewohl herumtastend, ich weiß nicht mehr woher eigentlich, fand ich zumindest den Weg zu einer Küche im Keller. Zwei oder drei farbige Diener waren dort unterwegs, von denen mir einer, eine Frau, zwei Gläser Wasser gab. Das verschaffte mir eine kurzfristige Linderung, doch als ich wieder mein Zimmer erreicht hatte, war dasselbe brennende Verlangen zu trinken, derselbe quälende Durst zurückgekehrt. Er war noch peinigender als zuvor, ebenso wie der ungezügelte Schmerz in meinem Kopf, wenn dies überhaupt möglich war. Ich war in schlimmer Not – litt entsetzliche Schmerzen! Ich schien an der Schwelle zum Irrsinn zu stehen! Die Erinnerung an jene Nacht furchtbaren Leids wird mich bis ins Grab verfolgen.
Nachdem eine Stunde oder auch mehr seit meiner Rückkehr aus der Küche vergangen war, wurde mir bewusst, dass jemand mein Zimmer betrat. Es schienen mehrere zu sein – ein Durcheinander von Stimmen – aber wie viele, oder wer sie waren, kann ich nicht sagen. Ob Brown und Hamilton dabei waren, ist eine reine Annahme. Mit ziemlicher Sicherheit erinnere ich mich nur, dass mir gesagt wurde, es wäre notwendig zu einem Arzt zu gehen, um eine Medizin verschrieben zu bekommen, und dass ich, nachdem ich meine Stiefel angezogen hatte, ohne Mantel und Hut, ihnen durch eine lange Passage oder Gasse auf die offene Straße folgte. Sie zweigte im rechten Winkel von der Pennsylvania Avenue ab. Auf der gegenüberliegenden Seite brannte in einem Fenster ein Licht. Ich hatte den Eindruck, dass drei Personen bei mir waren, doch letzten Endes schien alles unbestimmt und vage, und wie die Erinnerung an einen schmerzhaften Traum. Wie ich auf jenes Licht zuging, welches, wie ich mir vorstellte, im Fenster eines Arztes leuchtete, und das scheinbar vor mir zurückwich, ist die letzte flimmernde Erinnerung, die ich mir noch ins Gedächtnis rufen kann. Von diesem Augenblick an war ich besinnungslos. Wie lange ich mich in jenem Zustand befand – ob nur in dieser Nacht, oder viele Tage und Nächte – weiß ich nicht; aber als mein Bewusstsein zurückkehrte, war ich allein, in völliger Dunkelheit und in Ketten.
Der Schmerz in meinem Kopf hatte ein gewisses Maß nachgelassen, doch ich war sehr schwach und kraftlos. Ich saß auf einer niedrigen Pritsche aus groben Brettern, ohne Mantel oder Hut. Ich trug Handschellen. Um meine Knöchel befand sich auch ein Paar schwerer Fesseln. Ein Ende der Kette war an einem großen Ring auf dem Boden befestigt, das andere an den Fesseln um meine Knöchel. Ich versuchte vergeblich aufzustehen. Nachdem ich aus einer derart schmerzhaften Trance erwacht war, dauerte es einige Zeit, bis ich wieder meine Gedanken sammeln konnte. Wo war ich? Was hatten diese Ketten zu bedeuten? Wo waren Brown und Hamilton? Was hatte ich getan, um in solch einem Kerker gefangen zu sein? Ich konnte es nicht verstehen. Es gab eine Lücke über einen unbestimmten Zeitraum vor meinem Erwachen an diesem einsamen Ort, deren Ereignisse mir selbst bei äußerster Anstrengung meines Gedächtnisses nicht einfallen wollten. Ich lauschte angestrengt nach einem Signal oder Geräusch von Leben, aber nichts durchdrang die bedrückende Stille, außer dem Klirren meiner Ketten, wann immer ich mich auch zufällig bewegte. Ich sagte etwas, doch der Klang meiner Stimme erschreckte mich. Ich betastete meine Taschen, soweit es die Schellen erlaubten – tatsächlich weit genug, um sicher zu sein, dass ich nicht nur meiner Freiheit beraubt worden war, sondern auch mein Geld und mein Freiennachweis verschwunden waren! Dann begann sich in meinem Verstand zunächst düster und verwirrt der Gedanke zu bilden, dass ich entführt worden war. Aber das, so dachte ich, wäre unglaublich. Es musste eine Art Missverständnis gegeben haben – einen unglücklichen Fehler. Es konnte doch nicht sein, dass ein freier Bürger New Yorks, der niemandem ein Unrecht zugefügt noch irgendein Gesetz gebrochen hatte, derart unmenschlich behandelt wurde. Je länger ich jedoch meine Lage überdachte, desto sicherer wurde ich mir in meinem Verdacht. Es war wahrlich ein trostloser Gedanke. Ich spürte, dass bei Menschen in ihrer Gefühllosigkeit kein Vertrauen und keine Gnade zu finden war; und so empfahl ich mich dem Gott der Geknechteten, beugte meinen Kopf auf meine zusammengeketteten Hände und weinte höchst bitterlich.
KAPITEL III.
SCHMERZHAFTE ÜBERLEGUNGEN – JAMES H. BURCH – WILLIAMS’ SKLAVENPFERCH IN WASHINGTON – DER LAKAI RADBURN – ICH BEHARRE AUF MEINER FREIHEIT – DER ZORN DES HÄNDLERS – DAS PADDEL UND DIE NEUNSCHWÄNZIGE KATZE – DIE ZÜCHTIGUNG – NEUE BEKANNTE – RAY, WILLIAMS UND RANDALL – ANKUNFT DER KLEINEN EMILY UND IHRER MUTTER IM PFERCH – MÜTTERLICHER KUMMER – DIE GESCHICHTE ELIZAS.
Etwa drei Stunden vergingen, während derer ich auf der niedrigen Pritsche sitzen blieb, in schmerzhafte Überlegungen versunken. Schließlich vernahm ich das Krähen eines Hahnes, und bald darauf drang ein fernes, polterndes Geräusch an meine Ohren, wie von Kutschen, welche durch die Straßen eilten, und ich wusste, dass es Tag war. Jedoch fiel nicht ein einziger Lichtstrahl in mein Gefängnis. Schließlich vernahm ich Schritte direkt über mir, als ob dort jemand hin und her schritt. Es kam mir der Gedanke, dass ich mich in einem unterirdischen Raum befände, und der feuchte, schimmlige Geruch des Ortes bestätigte meinen Verdacht. Der Lärm über mir dauerte mindestens eine Stunde an, als ich schließlich Schritte von draußen nahen hörte. Ein Schlüssel klapperte im Schloss – eine massive Tür schwang in ihren Angeln auf, ließ eine Lichtflut herein und zwei Männer traten ein und standen vor mir. Einer von ihnen war ein großer, kräftiger Mann, von vielleicht vierzig Jahren, mit dunklem, kastanienbraunem Haar, ein wenig mit Grau durchsetzt. Sein Gesicht war voll, sein Teint gerötet, seine Züge waren grob und derb, und drückten nur Grausamkeit und Arglist aus. Er war ungefähr fünf Fuß und zehn Zoll groß, von fülliger Statur, und man gestatte mir ohne Vorurteil zu sagen, dass er ein Mann war, dessen ganze Erscheinung bösartig und abstoßend war. Sein Name war James H. Burch, wie ich später herausfand – ein wohlbekannter Sklavenhändler in Washington; und damals oder zumindest bis vor kurzem als Geschäftspartner verbunden mit Theophilus Freeman aus New Orleans. Die Person, welche ihn begleitete, war ein einfacher Lakai namens Ebenezer Radburn, der nur als Gefangenenwärter fungierte. Beide Männer leben immer noch in Washington, oder taten es zur Zeit meiner Rückkehr aus der Sklaverei durch diese Stadt im letzten Januar.
Das Licht, welches durch die offene Tür fiel, befähigte mich, den Raum zu betrachten, in dem ich festgehalten wurde. Er maß etwa zwölf Fuß auf jeder Seite – die Wände aus stabilem Mauerwerk. Der Boden bestand aus schweren Holzbohlen. Es gab ein kleines Fenster, von dicken, gekreuzten Eisenstangen versperrt und einer äußeren Fensterlade, die sicher befestigt war.
Eine eisenbeschlagene Tür führte in eine benachbarte Zelle oder ein Kellergewölbe, das völlig ohne Fenster oder eine andere Quelle von Tageslicht war. Die Einrichtung des Raumes, in dem ich mich befand, bestand aus der hölzernen Pritsche, auf der ich saß, und einem altmodischen, verdreckten Kastenofen, und abgesehen davon gab es in keiner der Zellen weder Bett noch Decke noch sonst irgendetwas anderes. Die Tür, durch die Burch und Radburn eingetreten waren, führte durch eine kleine Passage und eine Treppenflucht hinauf in einen Hof, der von einer zehn oder zwölf Fuß hohen Ziegelmauer umgeben war, unmittelbar an der Rückseite eines Gebäudes gelegen, das ebenso breit wie der Hof war. Der Hof erstreckte sich hinter dem Haus auf einer Länge von etwa dreißig Fuß. In einem Teil der Mauer war eine mit Eisen verstärkte Tür, die in einen schmalen, überdachten Gang führte, welcher an der einen Seite des Hauses vorbei zur Straße verlief. Das Verhängnis des farbigen Mannes, hinter dem sich die Tür aus jenem schmalen Gang schloss, war besiegelt. Die Mauerkrone trug eine Seite eines Daches, welches nach innen hin aufstieg und so eine Art offenen Schuppen bildete. Unter dem Dach verlief ringsum eine Art Dachboden, wo Sklaven, wenn sie denn wollten, bei Nacht schlafen oder bei unbarmherzigem Wetter Zuflucht vor dem Sturm suchen konnten. In vielerlei Hinsicht sah er wie die Scheune eines Farmers, außer dass er so konstruiert war, dass die Außenwelt niemals das menschliche Vieh sehen konnte, welches hier hindurchgetrieben wurde.
Das Gebäude, zu dem der Hof gehörte, war zwei Stockwerke hoch, und lag mit der Vorderseite an einer der öffentlichen Straßen Washingtons. Seine Außenseite gab nur den Anschein eines ruhigen Privatwohnsitzes wieder. Ein Fremder, der es ansah, hätte sich niemals seinen scheußlichen Nutzen träumen lassen. So seltsam es auch scheinen mag, deutlich in Sichtweise ebendiesen Hauses, von seiner gebieterischen Höhe auf es herabblickend, lag das Capitol. So konnten sich die Stimmen der patriotischen Repräsentanten, die von Freiheit und Gleichheit prahlten und das Klirren der Ketten jener armen Sklaven beinahe vermischen. Ein Sklavenpferch, im Schatten des Capitols selbst!
Solchermaßen ist die korrekte Beschreibung von Williams’ Sklavenpferch in Washington wie er im Jahr 1841 aussah, von einem der Keller aus, in denen ich mich so unerklärlich wiederfand.
„Nun, mein Junge, wie fühlst du dich jetzt?“, sagte Burch, als er durch die offene Tür trat. Ich antwortete, dass ich krank sei, und erkundigte mich nach dem Grund meiner Gefangenschaft. Er entgegnete, dass ich sein Sklave sei – dass er mich gekauft hätte, und dass er mich nach New Orleans schicken wolle. Ich brachte laut und deutlich zur Geltung, dass ich ein freier Mann sei – ein Einwohner von Saratoga, wo ich eine Frau und Kinder hatte, die ebenfalls frei wären, und dass mein Name Northup sei. Ich beschwerte mich bitterlich über die ungewohnte Behandlung, die mir zuteil geworden war und drohte, dass ich bei meiner Befreiung Genugtuung für das erlittene Unrecht verlangen würde. Er stritt ab, dass ich ein freier Mann sei, und erklärte mit einem einfühlsamen Fluch, dass ich aus Georgia käme. Wieder und wieder brachte ich vor, dass ich niemandes Sklave sei, und bestand darauf, dass er mir sofort die Ketten abnähme. Er war bemüht, mich zum Schweigen zu bringen, als fürchte er, meine Stimme könne gehört werden. Doch ich wollte nicht schweigen und prangerte die Urheber meiner Gefangenschaft, wer immer sie auch sein mochten, als durchtriebene Verbrecher an. Nachdem er feststellte, dass er mich nicht zum Schweigen bringen konnte, flüchtete er sich in einen gewaltigen Gefühlsausbruch. Mit lästerlichen Flüchen nannte er mich einen rabenschwarzen Lügner, einen Entflohenen aus Georgia, und belegte mich mit allen möglichen anderen profanen und vulgären Schimpfnamen, die sich eine höchst unanständige Phantasie ausdenken kann.
Während der ganzen Zeit stand Radburn schweigend neben ihm. Seine Aufgabe war es, diesen menschlichen oder vielmehr unmenschlichen Stallbetrieb zu überwachen, Sklaven entgegenzunehmen, zu füttern und sie auszupeitschen, für den Lohn von zwei Schilling pro Kopf und Tag. Burch wandte sich zu ihm um und befahl, das Paddel und die neunschwänzige Katze hereinzubringen. Er verschwand und kehrte nach wenigen Augenblicken mit diesen Folterinstrumenten zurück. Das Paddel, wie man es im Jargon der Sklavenzüchtigung nennt, oder zumindest das Exemplar, mit dem ich das erste Mal die Bekanntschaft machte, und von dem ich nun spreche, war ein Brett aus Hartholz, achtzehn oder zwanzig Zoll lang, in der Form eines altmodischen Puddingschlägers oder auch eines gewöhnlichen Ruders. Der flache Teil, der vom Umfang etwa so groß wie zwei offene Hände war, besaß an zahlreichen Stellen Löcher von einem kleinen Bohrer. Die Katze war ein dickes Tau mit vielen Strängen – die Stränge trennten sich und waren an jedem ihrer Enden mit einem Knoten versehen.
Sowie diese respekteinflößenden Peitschen erschienen, wurde ich von den beiden gepackt und grob meiner Kleidung beraubt. Meine Füße waren, wie ich bereits erklärte, am Boden befestigt. Nachdem er mich mit dem Gesicht nach unten auf die Pritsche gezogen hatte, stellte Radburn seinen schweren Fuß auf die Fesseln zwischen meinen Handgelenken, womit er sie schmerzhaft auf dem Boden hielt. Burch begann mich daraufhin mit dem Paddel zu schlagen. Hieb auf Hieb ging auf meinen nackten Leib hinab. Als sein unnachgiebiger Arm ermüdete, hielt er inne und fragte, ob ich immer noch darauf bestünde, ein freier Mann zu sein. Ich bestand darauf, und dann wurden die Schläge erneuert, schneller und energischer, wenn dies überhaupt möglich war, als zuvor. Immer wenn er ermüdete, wiederholte er dieselbe Frage, und setzte nach dem Erhalt der gleichen Antwort sein grausames Werk fort. Die ganze Zeit gab jener fleischgewordene Dämon die teuflischsten Flüche von sich. Schließlich brach das Paddel und er hielt nur noch den nutzlosen Griff in seiner Hand. Immer noch wollte ich nicht nachgeben. All seine Hiebe konnten meinen Lippen nicht die schändliche Lüge entlocken, ich sei ein Sklave. Den Griff des zerbrochenen Paddels zornig auf den Boden werfend, ergriff er das Seil. Dies war weitaus schmerzhafter als das andere. Ich strampelte mit all meiner Macht, doch es war umsonst. Ich betete um Gnade, doch mein Gebet wurde nur mit Verwünschungen und Striemen beantwortet. Ich glaubte, ich müsse unter den Peitschenhieben des verfluchten Rohlings sterben. Selbst jetzt noch geht mir eine Gänsehaut bis auf die Knochen, wenn ich mich an diese Szene erinnere. Mein ganzer Leib stand in Flammen. Mein Leiden kann ich mit nichts anderem als den brennenden Qualen der Hölle vergleichen!
Schließlich bewahrte ich auf seine wiederholten Fragen mein Schweigen. Ich gab ihm keine Antwort. Tatsächlich war ich auch kaum noch in der Lage zu sprechen. Immer noch bearbeitete er mit der Peitsche ohne Unterlass meinen armen Leib, bis es schien, als würde mir das blutige Fleisch bei jedem Hieb vom Leib gezogen. Ein Mann mit auch nur einem Körnchen Erbarmen in seiner Seele hätte keinen Hund so grausam geprügelt. Schließlich sagte Radburn, dass es nutzlos wäre, mich weiter zu peitschen – dass ich schon wund genug sei. Daraufhin ließ Burch von mir ab und sagte mit einem mahnenden Schütteln seiner Faust vor meinem Gesicht, die Worte durch seine fest zusammengepressten Zähne zischend, dass, wenn ich jemals noch einmal wagen würde zu behaupten, ich hätte ein Recht auf Freiheit, dass ich entführt worden wäre oder irgendetwas anderes in dieser Art, die Züchtigung, die ich gerade erhalten hätte, nichts sei im Vergleich zu dem, was dann folgen würde. Er schwor, dass er mich entweder unterwerfen oder umbringen würde. Mit diesen tröstlichen Worten wurden die Fesseln von meinen Handgelenken genommen, doch meine Füße blieben am Ring befestigt; der Laden an dem kleinen vergitterten Fenster, der geöffnet worden war, wurde wieder geschlossen, und nachdem sie hinausgingen und die große Tür hinter sich schlossen, war ich wie zuvor wieder allein in der Dunkelheit.
Nach einer Stunde, vielleicht zwei, sprang mir das Herz in die Kehle, als der Schlüssel erneut im Schloss klapperte. Ich, der ich so allein gewesen war, und der sich so inbrünstig danach gesehnt hatte, jemanden zu sehen, gleichgültig wen, erschauerte nun bei dem Gedanken, dass sich ein Mensch näherte. Ein menschliches Gesicht war furchterregend für mich, besonders ein weißes. Radburn trat ein, und brachte auf einem Blechteller ein Stück verschrumpeltes gebratenes Schwein, eine Scheibe Brot und einen Becher Wasser. Er fragte mich, wie ich mich fühlte, und merkte an, ich hätte eine ziemlich heftige Tracht Prügel bekommen. Er machte mir Vorhaltungen bezüglich der Schicklichkeit, auf meiner Freiheit zu beharren. In einer recht gönnerhaften und vertraulichen Manier gab er mir den Rat, dass je weniger ich zu diesem Thema sagte, desto besser es für mich wäre. Der Mann versuchte offenkundig freundlich zu erscheinen – ob ihn nun der Anblick meines erbarmungswürdigen Zustands anrührte oder mit der Absicht, jede weitere Bekundung meiner Rechte auf meiner Seite verstummen zu lassen, darüber ist es jetzt nicht nötig, zu spekulieren. Er schloss die Fesseln an meinen Fußgelenken auf, öffnete die Läden des kleinen Fensters und ging, mich wieder alleine zurücklassend.