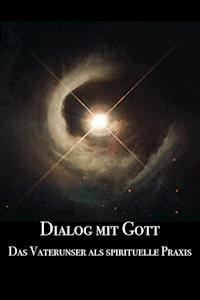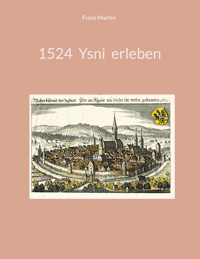
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Autor hat ein besonderes Talent, den Leser die klösterliche Welt im mittelalterlichen Ysni hautnah miterleben zu lassen. Es ist, als ob er am Klosterleben, an Besuchen anderer Abteien, wie St. Gallen, und Kutschfahrten ins Allgäu selbst teilnimmt. Der historische Roman versprüht eine große Lebendigkeit, ist spannend geschrieben, fasziniert und unterhält. Der Klosterzögling Konrad erlebt auch die Stadt in all ihren Facetten; sei es der Tuchhandel der Ysnier Kaufleute; der Jakobimarkt verbunden mit dem nahen Rossmarkt; die Münzwerkstatt, die Einladung zum Gastmahl beim Patrizier Buffler, der traditionellen Zunftschoppen, eine Visite bei einem Lehensbauern sowie die beginnende Reformation und der Bauernaufstand. Als ein begnadeter Erzähler kann der Autor mit seiner Diktion begeistern. Seine Kenntnisse und Einblicke in Politik und (Kirchen-) Geschichte beruhen auf gründlichen Quellenstudien. Ein fesselndes Buch, das man, mit großem Gewinn, gerne liest! Dr. Harald Pfeiffer, Heidelberg
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Gewidmet meinen Eltern als ein Dankeschön für eine Kindheit, die mich zeitlebens trägt.
Heimat
„Die strengste Auslegung des Wortes Heimat ist für mich, dass Heimat eine Zeit ist. Ich sage: Heimat ist das, was man nicht mehr hat. Heimat ist Kindheit, und später, wenn man sich aus den Gegenden der Kindheit entfernt hat, dann hat man diese Heimat nicht mehr, beziehungsweise man hat sie dann im Kopf oder in der Seele. Aber es gibt nicht mehr diese Art von umgrenzter Sicherheit.
Heimat ist nicht Nostalgie, dieses Wort würde ich nie verwenden, da würde ich schon lieber von Heimweh sprechen.“
Martin Walser: Auszug aus einem Interview zu seinem 85. Geburtstag in der Rhein-Neckar-Zeitung vom 24. März 2012 anl. einer Lesung von Martin Walser aus seinen Tagebüchern im Germanistischen Seminar an der Universität Heidelberg mit anschließender Podiumsdiskussion Heimweh ist die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies. Foto: Martin Walser, Franz Martin, 2012, privat
1
1 Eine Zufallsbegegnung mit André Heller in seinem exotischen Garten ANIMA bei Marrakesch im Oktober 2018
Stadtansicht nach Merian vor dem Brand
1631
Bildnachweis: Stadtarchiv Isny im Allgäu
Inhaltsverzeichnis
Heinrich von Ysni
Benedikt – der Ordensgründer
Novizen Feier - Albert von Hohenstein geb. 1508
Stadt Ysni von 1042 – 1524
Von der Gründung des Klosters 1042 – 1122
Bibliothek – Skriptorium
Klosterhistorie von 1122 – 1524
Jakobimarkt in Ysni
Tuchhandel in Ysni
Rund ums Rathaus am Jakobimarkt
Gastmahl bei Bufflers - Auftakt
Gastmahl bei Bufflers – Hauptgang
Der Morgen danach
Besuch in der Münzwerkstatt
Auf dem Weg zum Zunftschoppen
Stadtplan
Zunftschoppen im Roten Ochsen
Zwischen Zunftschoppen undKomplet
Rossmarkt – Sattler – Marstall – Prädikantenbibliothek…
Abt – Marstall Spital Heilig Geist – Skriptorium
Von Ysni nach Bregenz zum Kloster Mehrerau
Zu Gast im Kloster St. Gallen
Fürstabt Franz von Gaisberg vom Kloster St. Gallen
Kapitelsaal – Klosterhof – Bauernaufstand
Überlandfahrt
Bauernaufstand und Vorabend der Reformation
Bauernkrieg und Beginn der Reformation in Ysni
Quo vadis – Konrad
Nachwort – zur Person
Ein Dankeschön
Bücherliste
Abbildungen
Horen – Stundengebete der Mönche
Kapitel II
Benedikt – der Ordensgründer
„Liebe Mitbrüder im Herrn,
heute am 11. Juli 1524 feiern wir wie jedes Jahr das Fest des hl. Benedikt, dem Gründer unseres Ordens. Lasst mich heute an diesem herrlichen Tag an das Leben unseres Vorgängers im Herrn erinnern.
Benedikt wurde um 480 in dem Dorf Nursia in Umbrien22 nördlich von Rom als Zwilling mit seiner Schwester Scholastika geboren. Er stammt aus der Familie eines reichen Landbesitzers und wurde schon als Knabe nach Rom zur Ausbildung geschickt, wo er auch studierte. Zu dieser Zeit war Rom bereits dem sittlichen Verfall preisgegeben, die Kaiserresidenz unter Konstantin dem Großen nach Byzanz ins oströmische Reich verlegt.
Zurück zu unserem Ordensgründer. Benedikt war von seinen Mitstudenten enttäuscht, die Elite der Grundbesitzer, Staatsbeamten und Militärs lebte dank der hohen Steuereinnahmen aus den Provinzen im Überfluss: Völlerei, Müßiggang und Wohllust prägten den Alltag. Für den jungen Benedikt war diese Art zu leben unerträglich. Er schloss sich einer asketischen Gemeinschaft in den Sabiner Bergen in der Nähe von Rom an und lebte dort als Einsiedler mit Gleichgesinnten zusammen. Dann suchte er die völlige Einsamkeit und lebte zurückgezogen drei Jahre lang in einer Höhle bei Subiaco im Aniotal östlich von Rom.
Täglich ließ ihm der Mönch Romanus aus einem benachbarten Kloster an einem Seil ein Stück Brot herab, eine Glocke am Seil gab dazu das Zeichen. Benedikts Ruf als Eremit wuchs, viele Menschen kamen, um ihn zu sehen und um seinen Rat zu erfahren. Die Mönche vom benachbarten Ort Vicovaro luden ihn ein, besprachen sich mit ihm und wählten ihn zum Abt ihrer Gemeinschaft. Benedikt versuchte das Leben in diesem Kloster neu zu gestalten, musste jedoch feststellen, dass die Mönche sich seinen Vorstellungen widersetzten und ihn sogar vergiften wollten. In diesem Zusammenhang darf ich an unseren ersten Abt Manegold erinnern, der von einem unserer Brüder im Jahre 1100 durch einen Dolchstoß direkt ins Herz ermordet wurde. Diese Tat mag uns alle zu denken geben und uns in dem Bestreben stärken, keine Missgunst in unseren Herzen zu tragen und Hass zu säen. Nur vier Jahre bekleidete er dieses hohe und verantwortungsvolle Amt.
Nach dem böswilligen Anschlag auf sein Leben kehrte Benedikt in das Tal von Subiaco zurück und gründete das Kloster San Clemente sowie zwölf kleinere Klöster in der Umgegend. Er war von den Regeln des spätantiken Eremitentums inspiriert, insbesondere von den Gemeinschaften des Pachomios aus Ägypten und von Basilius von Caesarea, der die Mönchsregeln der Ostkirche auf den Säulen Gehorsam, Gebet und Arbeit aufbaute.
Mit einigen seiner Mitbrüder zog Benedikt um das Jahr 529 aus Subiaco fort und gründete auf einem Berg über Casinum, einer ehemaligen römischen Befestigungsanlage, das Kloster Montecassino. Hier verfasste er die "Regula Benedicti", die Grundlage und Maßstab auch für unser Leben hier in der Abtei Ysni sind.
Benedikt formulierte seine Regeln aus den Erfahrungen der ersten christlichen Mönche und ihr kennt alle unser Grundverständnis: „Ora et labora.“ Das Gotteslob und die tägliche Arbeit sind gleichgewichtig, hinzu kommt der Gehorsam dem jeweiligen Abt gegenüber. Dies ist das Fundament unseres Zusammenlebens. Auch wenn euch die Ordensregeln alle bekannt und wir bestrebt sind, im Sinne unseres Ordensgründers zu handeln, schadet es nie, sich immer wieder an unseren Ursprung zu erinnern.
Als das Steppenvolk der Hunnen um 375 n. Chr. ins heutige Frankenreich eindrang, setzte eine große Völkerwanderung ein, welche die Stämme in ganz Europa durcheinanderwirbelte. Goten, Wandalen, Langobarden, Burgunder und andere Völker wichen den kriegerischen Reitern aus und drangen bis nach Sizilien, Spanien und Griechenland vor. Im Zuge der Wirren dieser nomadenhaften Völkerverschiebungen wurde mit Julius Nepos, der letzte Kaiser des antiken römischen Reiches gestürzt, der Ostgote Odoaker ernannte sich zum König von Italien und durch seinen Nachfolger Theoderich der Große von Ravenna erlebte die römische Kultur der Spätantike eine neue Blüte. Theoderich war jedoch nicht nur der Anführer seiner Goten, sondern wurde zugleich auch als Haupt des weströmischen Reiches und Stellvertreter des oströmischen Kaisers in Konstantinopel anerkannt.
Der oströmische Kaiser Justinian I. vom Bosporus nutzte die Querelen der Nachfolger des Theoderichs und es gelang ihm um 540 weite Teile des alten Imperium Romanum – so das gesamte Italien und Teile Nordafrikas – zurückzugewinnen.
Und damit sind wir in der Zeit unseres Ordensgründers, des hl. Benedikt23, an dem die ungestümen Germanen, ein Komplott ehemaliger Stämme in Mitteleuropa und im südlichen Skandinavien, sicherlich nicht spurlos vorübergegangen sind. Für Benedikt von Nursia war schon sehr früh wichtig, dass seine Brüdergemeinschaft an einem festen Ort ansässig ist. In Zeiten des Umbruchs, der politischen und kulturellen Umwälzungen waren den Fratres ein beständiger Ort von Bedeutung, an dem sie Gott loben und preisen und ihrer täglichen Arbeit zum Lebensunterhalt nachgehen konnten. Der Verzicht auf persönliches Eigentum entbindet uns dem Streben nach Reichtum, über den der einzelne verfügen kann. Dies macht uns frei, und unser Denken ist auf Gott und unsere Gemeinschaft gerichtet.
Das Schweigegebot soll uns darin unterstützen, eine innere Ruhe zu finden, damit wir uns auf eine Beziehung mit Gott, unserem Schöpfer, einlassen können. Auch wenn wir hie und da das Bedürfnis haben, uns anderen mitzuteilen, müssen wir alle ernsthaft an uns arbeiten, das konsequente Schweigen einzuhalten. Wenn wir das schaffen, beweisen wir unsere Stärke, die auch eine Form der Askese ist. Mir als Abt bleibt es vorbehalten, euch im Gespräch zuzuhören, wenn ihr Bitten und euere Sorgen an mich herantragt. Es gilt auch für mich, daraus zu lernen und für die Einheit unseres Konvents zu sorgen. Das strikte Schweigegebot gilt für uns Patres zwischen Vesper und Komplet und bis zum Morgen des Folgetages sowie im Kreuzgang, dem Oratorium, dem Skriptorium und dem Refektorium einzuhalten. Einen großen Gemeinschaftsschlafsaal haben wir schon seit längerem nicht mehr. Im ehemaligen Dormitorium, der große Raum unter dem Dach, legen jetzt unsere Getreidevorräte. Jeder von euch verfügt über eine eigene Zelle mit Schlafgelegenheit sowie einem Pult, einem Gebetsstuhl und einem Kruzifix, in welcher er seine Ruhe finden und das Gespräch mit Gott suchen kann.
Unsere Laienbrüder sind von diesem strengen Schweigegebot ausgenommen, da sie tagsüber ihrer körperlichen Arbeit in Landwirtschaft und Handwerk nachgehen und den Anweisungen unseres Cellerars Pater Franziskus Folge zu leisten haben. Wenn ihr euch von eueren Sünden, Verfehlungen und Anfeindungen reinwaschen müsst, steht euch Pater Prior zur Seite. Er wird euch das Sakrament der Beichte spenden.
Ich darf nun das Wort an unseren Bibliothekar Bruder Ansgar übergeben. Er hat sich ausgiebig mit der Zeit befasst, als unsere Gegend erstmals besiedelt wurde und wird euch einiges zu berichten haben.“
„Hochwürdigster Abt24, danke dass ihr mir das Wort übergeben habt, ich möchte das Rad der Geschichte gerne viele Jahrhunderte zurückdrehen und euch Mitbrüdern einen Einblick in die Historie dieses Landstrichs geben.
Gestattet mir einen weiten Blick zurück in die Vergangenheit dieses paradiesischen Fleckchens um Ysni. Diese herrliche Gegend mit den fruchtbaren Äckern, die im Sommer mit blauem Flachs übersät sind, die Wiesen saftig grün gedeihen, die Wälder Nahrung und Unterschlupf für das Wild gewähren und die Bäche reich an Fischen sind. Schon im Jahre 15 v. Chr. war diese Landschaft in Folge der Siege der römischen Feldherrn Drusus und Tiberius über die nördlichen Alpenvölker ins Imperium Romanum einverleibt. Das eroberte Land wurde in zwei Provinzen geteilt, von welchen der südliche Teil den Name Raetia prima und der nördliche Teil, in welchem sich auch die Gegend um Ysni befindet, den Namen Raetia secunda25 oder Vindelicia erhielt. Bereits der griechische Geograph Strabo, der über diese Gegenden wohl unterrichtet gewesen zu sein scheint, nennt zwei dieser Stämme nämlich die Brigantier gegen Bregenz hin und die Estionen östlich von Campodunum, dem heutigen Kempten. Sonach liegt Ysni genau zwischen diesen beiden Punkten. Wer diese Vindelicier, so wurden die Bewohner unseres Landstriches genannt, genau waren, ob ein germanisches oder keltisches Volk, weiß uns niemand mit Bestimmtheit zu sagen. Schwerlich waren sie rein deutsch, auch hier mochte das keltische Element das vorherrschende gewesen sein. Die Alten schildern sie uns als ein grausames Räubervolk, das früher den angrenzenden Heleviten, Germanen und Bojern sehr gefährlich war. Ihr Land ist eine raue, schneereiche Hochebene mit vielen Hügeln, so wird berichtet. Die Erzeugnisse der Viehzucht führen zu Käse im Überfluss und die Produkte der Tannenwälder wie Harz, Pech und Kienholz sind ihre Handelsartikel. Wer wird nicht bei solchen Ausführungen namentlich diesen Teil Oberschwabens, unser raues, aber gras- und holzreiches Allgäu erkennen? Unter römischer Herrschaft legte das Volk schnell seine wilden Sitten ab und fügte sich in die von den neuen Herrschern gebotenen Formen.
In unserem Weinkeller steht im hinteren Gewölbe eine römische Wegesäule, auf der eingraviert ist, dass im Jahre 202 nach Christi Geburt unter dem Kaiser Septimus Severus unter anderem auch die Haupttrasse, die von Kempten westwärts führte, eine Wiederherstellung erhalten hat. Die Stelle, wo diese Wegsäule stand, befand sich zwischen Nellenbruck und Wengen, nach der Maßeinheit des alten Roms elftausend Schritte von Kempten, dem ehemaligen Campodunum entfernt und anderthalb Wegstunden von Ysni. Wer sich die steinerne Wegsäule bei Kerzenlicht genau anschaut, wird erstaunt feststellen, dass die drittletzte Zeile der Inschrift mit einem Meisel entfernt wurde. Wie wir wissen, enthielt die ausgetilgte Zeile den Namen Septimius Geta, dessen Erwähnung Caracalla von allen öffentlichen Monumenten im damaligen römischen Reich entfernen ließ. Was war wohl der Grund für eine solche unverständliche Tat?
Caracalla war der nur elf Monate ältere Bruder von Geta. Ihr Vater, Kaiser Septimius Severus, sah seine beiden Söhne als Mitregenten vor und bereitete sie in jungen Jahren auf dieses Amt vor, doch die Brüder lebten in ständiger Rivalität. Der eine wollte den anderen an Geschicklichkeit, Wissen und Ehrgeiz übertreffen. Es entwickelte sich ein Hassgefühl, das ungeahnte Ausmaße erreichen sollte.
Der Kaiser nahm seine beiden Buben mit auf seinen zweiten Feldzug gegen die Parther, die im Gebiet östlich von Kleinasien, Mesopotamien, angrenzend an das Kaspische Meer bis zum Persischen Golf lebten. Die römischen Soldaten kämpften erfolgreich und die Kaiserfamilie blieb noch einige Zeit im Orient, reiste dann nach Ägypten weiter und kehrte erst 2 Jahre später nach Rom zurück. Doch die Feindschaft zwischen den beiden Brüdern blieb bestehen, auch wenn der Kaiser eine Goldmünze prägen ließ, auf der seine Frau Gemahlin und die zwei Kinder in voller Eintracht zu erkennen sind.
Caracalla war der Erstgeborene, fühlte sich Geta überlegen und im Alter von nur neun Jahren wurde ihm der Namen Marc Aurel Antonius verbunden mit dem Titel Caesar zuerkannt und damit konnte er sich in direkter Nachfolge des Kaisergeschlechtes der Antonine sehen. Die Inschrift auf unserer Wegsäule im Weinkeller unseres Klosters ist ein Stein gehauener Beweis dafür.
Wie ging die Geschichte in Rom weiter? Kaiser Septimius Severus ernannte seine beiden jugendlichen Söhne kurzerhand zu Konsuln und bekleidete sie mit dem höchsten Amt, welches das Römische Reich zu vergeben hatte. Zwietracht und Streit setzten sich mit den Beiden fort, sodass der Kaiser entschied, sie im Jahre 208 auf den Feldzug nach Britannien mitzunehmen. Im Jahre 209 erhielt Geta ebenfalls die Würde eines Augustus, war hiermit seinem Bruder gleichgestellt und so bestanden die Voraussetzungen für eine gemeinsame Herrschaft.
Die Kämpfe um den nördlichen Teil der britischen Insel zogen sich dahin. Der Kaiser erkrankte an Gicht, fühlte sich als Feldherr dieser Aufgabe nicht mehr gewachsen und betraute seinen Sohn Caracalla mit der alleinigen Heeresführung. Geta übernahm die zivile Kontrolle der eroberten Gebiete.
Nach dem Tod des Vaters, des Kaisers Septimius Severus, im Frühjahr 201 im Norden Britanniens übernahmen beide Söhne die Herrschaft im römischen Reich, schlossen Frieden mit den Kaledoniern und Mäaten aus dem heutigen Schottland und zogen als Kaiser getrennt nach Rom zurück.
Der Ausbruch der Streitigkeiten ließ nicht lange auf sich warten. Eine eindeutige Regelung über die Aufgabenteilung und Zuständigkeiten mit den entsprechenden Befugnissen war nicht gegeben, sodass es zu einem Kampf zwischen den ungleichen Brüdern kommen musste, wer letztendlich die Herrschaft über das römische Reich ausübte, um einen Bürgerkrieg und eine Spaltung des Imperium Romanum zu verhindern.
Es war wohl im Dezember 211, als Caracalla geschickt seinen jüngeren Bruder in den kaiserlichen Palast in einen Hinterhalt lockte. Auf sein Drängen hin lud Julia Domna ihre beiden Söhne auf den Palatin zu einem Versöhnungsgespräch ein. Nach den Schilderungen des zeitgenössischen Geschichtsschreibers Cassius Dio hatte Caracalla Mörder bestellt, die seinen Bruder in den Armen der Mutter töteten.
Caracalla war mit seinen nun 23 Jahren am Ziel. Er herrscht alleine über das römische Reich. Am Tag nach der Tat rechtfertigte er vor dem Senat in einer Rede sein Tun, indem er behauptete, selbst nur einem Anschlag seines Bruders Geta zuvorgekommen zu sein. Er verhängte über Geta die Damnatio memoriae, d.h. die Auslöschung seines Andenkens und ließ an allen öffentlichen Denkmälern und Schriftstücken dessen Namen tilgen. Sogar die Münzen, auf denen das Porträt seines Bruders abgebildet war, ließ er einschmelzen. Diese Anweisung setzte er streng und gründlich durch, was an der Wegsäule auf dem Weg nach Kempten – ungefähr 1.000 km von Rom entfernt - unschwer zu erkennen ist.
In was für einer Welt, liebe Mitbrüder, lebten unsere Vorfahren? Wir dürfen uns nicht wundern. Unsere biblischen Eltern hatten alles, was sie zum Leben brauchten. Der Garten Eden voller Bäume und Früchte hielt alles Wünschenswerte für sie bereit, die Tafel war immer reichlich gedeckt, der Wein sprudelte aus den Fässern. Es genügt -, wenn ich es Euch andeute, was geschah: der Sündenfall – die Lust, Grenzen zu überschreiten gegen den erklärten Willen des Allmächtigen zu handeln, zu essen vom Baum der Erkenntnis. Das Ergebnis: seitdem sind wir verdammt, das Gute von dem Bösen unterscheiden zu müssen. Die Folgen wiegen schwer, wir versündigen uns tagtäglich, erforschen unser Gewissen und tragen letztendlich die Last der Buße. Mit diesem Trauma hat sich außer dem Menschen kein anderes Lebewesen zu beschäftigen.
Im Buch Genesis, der Schöpfungsgeschichte 4, 1-24 geht es weiter mit den Brüdern Kain und Abel. Da hören wir von dieser abscheulichen Tat, bereits in der zweiten Generation der biblischen Menschwerdung. Es fällt uns schwer, dieses barbarische Handeln zu verstehen. Deshalb müssen wir uns vorsehen, dass sich ein Hassgefühl unter uns Brüdern nicht ausbreiten darf. Wir müssen uns üben in dem täglichen Respekt dem anderen gegenüber und uns getragen fühlen von der allmächtigen Liebe Gottes.
Nun zurück zu den „alten“ Römern und unserer Klostergeschichte:
Neben der gefundenen Wegesäule unter Kaiser Septimius Severus ist uns ein zweites Denkmal aus der Klosterchronik bekannt, wenn auch der Stein nicht mehr auffindbar ist. Es handelt sich um ein Devotionsdenkmal, das bestimmte Städte im Vindelicae, dem Gebiet zwischen Bodensee und Donau, anno 145 nach Christi Geburt dem Kaiser Antonius Pius errichteten. Es sollte einem Kaiser gedenken, der den Limes in unserem Bereich weiter nach Norden verlegte und über 23 Jahre Herrscher des römischen Reiches gewesen ist.
In einer Gegend, durch welche über Jahrhunderte römische Heerscharen durchzogen und zur Sicherung26 ihrer Macht Grenzwälle und Kastelle errichteten, ist es nicht verwunderlich, dass sich neben den Mauerresten auch Tongefäße und Münzen finden lassen. Bei der Bettmauer, unweit unseres Klosters in Richtung Adelegg vor dem Flüßlein Argen gelegen, befindet sich ein ehemaliges römisches Kastell. Spuren eines Walls und eines zweiten Grabens sind auf dem angrenzenden Ackerland teilweise noch sichtbar, größtenteils im Laufe der Jahrhunderte aber eingeebnet. Die Einfahrt in die Wehranlage auf der Nordwestseite lässt sich noch deutlich erkennen. Das Plateau bildet ein Dreieck. Vom Mauerwerk ist bis auf die Grundmauern nichts mehr zu sehen. Auf der Nordseite mit sandigem Untergrund liegen römische Ziegel und Tonscherben mit dem Boden vermischt. Hier stand ein wichtiger Befestigungsposten mit verschiedenen Abteilungen der dritten Legion und der ihr zugeordneten Reitergeschwader, deren Hauptaufgabe war, den Donau-Iller-Limes und hier den Abschnitt von Kempten bis Bregenz zu überwachen. Bei Bedarf konnten von hier aus auch größere Truppenverbände zu gefährdeten Punkten in Marsch gesetzt werden. Des Weiteren kontrollierten die römischen Legionäre von hier aus mit ihren Reiterstaffeln – wir gehen von ungefähr 200 Mann27 aus, die in fünf hölzernen Baracken untergebracht waren - die Straßenverbindungen und Flussübergänge in der näheren Umgegend. Ob sich ein römischer Tempel und zwar ein Isistempel im Kastell befunden hat, können wir aufgrund des benachbarten Ysni und aus dem Namen Bettmauer schließen, etwas Genaueres wissen wir jedoch nicht. Interessant ist dabei, dass im Staatskalender des Kaisers Theodosius anno 380 n.Chr. genau die Befestigungsanlage Vemania aufgeführt ist, dessen Name wir mit dem Römerkastell an der Bettmauer verbinden. Als Entfernung werden 15 Millien des Itinerar, also der Wegstrecke von Kempten zu Kastell angegeben. Diese Entfernung entspricht in etwa sechs Wegstunden zu Fuß.
Neben Mauerresten und Tonscherben fand man im römischen Kastell auch Münzen und Schmuck. So schloss im Jahre 1490 unser geehrter Abt Georg mit zwei Ratsherren als Vertreter der Stadt Ysni einen Vertrag, in welchem das Kloster sich ausdrücklich das Recht vorbehält, auf diesem Platz nach Kostbarkeiten, goldenen und silbernen Gefäßen graben zu dürfen. Das Ergebnis ließ sich sehen. Der Schatzfund besteht unter anderem aus 157 Münzen, die ursprünglich in einem Leinenbeutel verwahrt wurden. Darunter fand sich in einem Holzkästchen reicher Frauenschmuck wie goldene Halsketten, Arm-, Ohr- und Fingerringe. Als ehemalige Besitzer der Gegenstände kommen aufgrund ihres Wertes am ehesten ein hoher Offizier beziehungsweise der Kommandant des Lagers und dessen Frau in Frage, die bevorzugt in einem Haus aus Stein in dem Kastell wohnten. Besonders erwähnenswert sind eine Goldmünze des Kaisers Diokletian, verschiedene Silbermünzen, darunter eine mit dem Bild des Kaisers Maxentius aus dem Jahr 306 mit der Inschrift: Conservator urbis suis – der Erhalter seiner Stadt. Aus dem gefundenen Schatz sticht ein goldener Ring mit einem geschnittenen Stein hervor, ein Onyx mit einem schönen Intaglio, einer Sphinx auf einem Felsen und den vor ihr stehenden Ödipus, wie er ihr Rätsel löst.
Im 3. und 4. Jahrhundert war nicht nur unsere Gegend durch Raubzüge der Germanen bedroht. Die Bewohner des Kastells Vemania28 versteckten ihr Hab und Gut mit dem Ziel, dieses vor den ungezügelten Horden jenseits des Limes zu schützen. Dies gelang nur bedingt, denn im Jahre 305 nach Christi Geburt wurde bei einem Überfall von Germanen das gesamte Kastell zerstört.
Die frühesten Bewohner unserer Gegend gehörten zu den Vindelicis, einem keltischen Stamm, der sich vom westlichen Bodensee bis an den Inn erstreckte. Vorstellungen der Kelten von ihren Gottheiten sind uns nicht bekannt. Es gibt keine schriftlichen Überlieferungen im Vergleich zu den „alten“ Römern, den Griechen, dem jüdischen Volk oder den ägyptischen Pharaonen. Wir wissen wenig über ihre Mythen, ihren Glauben, ihre Lebensgewohnheiten und Sitten.
Über Gaius Julius Cäsar wissen wir dagegen wesentlich mehr. Der eine oder andere von Euch erinnert sich an das vierte Buch von „De bello Gallico“, worin Cäsar berichtet, dass er es ablehnt den beiden germanischen Stämmen der Usipeter und Tenkterer im römisch besetzten Gallien ein Siedlungsgebiet anzubieten, nachdem der tapferste germanische Stamm der Sueben diese über den Rhein vertrieben hat. Es kam zur Schlacht, in welcher die beiden Germanenstämme mit Frau und Kindern vernichtend geschlagen wurden. Um seine Macht gegenüber den Sueben – sprich Schwaben - zu demonstrieren ließ Cäsar von seinen Soldaten innerhalb von 10 Tagen eine Brücke über den Rhein bauen, betrat das Land der Germanen in der Absicht diese zu unterwerfen. Zu einer Kampfhandlung mit den Sueben kam es jedoch nicht. Diese hatten ihre Dörfer verlassen und sich ins Hinterland zurückgezogen. Aus Rache ließ Cäsar die Dörfer niederbrennen.
Schließlich zieht er mit seinem Heer weiter den Rhein entlang in Richtung Norden an den Main, die Lahn und Sieg zu den Ubiern und verspricht dem römisch gesonnen germanischen Stamm den Schutz vor den Sueben. Bereits nach 18 Tagen in Germanien zieht sich Cäsar mit seinen Soldaten nach Gallien zurück und lässt die Brücke über den Rhein abreißen.
Kaum sind ein paar Jahrzehnte vergangen, sollte es anders kommen. Bei der Eroberung des Voralpenraumes um 15 vor Christi Geburt unter dem Kaiser Augustus hatten die römischen Heere leichtes Spiel. Obwohl die keltischen Stämme die römischen Legionäre an Körpergröße, Wildheit und Reitkunst übertrafen, gingen sie aus den Kämpfen nicht siegreich hervor. Die römischen Soldaten verfügten über Speere, welche die Schilde der keltischen Kämpfer durchbohren konnten. So waren unsere Vorfahren dem Imperium Romanum schnell einverleibt, übernehmen deren Kultur und erleben den Höhepunkt der Ausdehnung des römischen Reiches.
Mit dem Einsetzen der kriegerischen Überfälle germanischer Stämme in die Provinzen des Römischen Reiches nördlich der Alpen ab dem Beginn des 3. Jahrhunderts n. Chr. verdrängen östlich des Rheins und südlich der Donau germanische Einflüsse mehr und mehr die gallo-römische Kultur. Der Fall des Limes um 260 n. Chr. und die Rücknahme der römischen Verteidigungslinie gegenüber den eindringenden Alemannen an den Rhein gilt dabei als magische Grenze, an der die hochentwickelte römische Kultur am Oberrhein und nördlich des Bodensees in Schutt und Asche sank. Durch die nachfolgende weitgehende Übertragung der Verteidigung der nördlichen Reichsgrenze des Imperiums an germanische Söldner geht noch vor dem Ende des weströmischen Reiches 476 n. Chr. die römische Kultur weitgehend in der Kultur der von Norden heranrückenden Germanenstämme auf. Es gibt wenige Zeugnisse aus der Römerzeit, die über unsere Gegend berichten, und so müssen wir uns auf ein paar Nachweise beschränken, die jedoch genügend darüber verraten, wie unsere Vorfahren vor 1.500 Jahren hier gelebt haben, und es bleibt uns unvoreingenommen, die eine oder andere waghalsige Geschichte auszudenken.
Spätestens zu Beginn des 5. Jahrhunderts mit der endgültigen Einnahme der römischen Provinz Pannonien, dem heutigen Westungarn, durch die Hunnen werden die letzten Überreste der römischen Besatzungszeit, des einst blühenden Imperium Romanum, ausgelöscht. Während sich bisher eine, wenn auch sehr unvollkommene Zivilisation und die Anfänge des Christentums über das Land verbreitet haben mochten, so drängen jetzt die rohen Schwärme der Alemannen oder Schwaben und mit ihnen eine neue Barbarei in unsere Gegend herein, in welche erst Jahrhunderte später wieder einiges historisches Licht fällt.
Der ganze Bezirk gehörte nun zum Herzogtum Alemannien und kam somit nach Aufhebung der herzoglichen Würde unter die Gewalt der fränkischen Kammerboten. Den St. Galler Urkunden verdanken wir auch hier die meisten Nachrichten, aus denen wir die Gaue, in welcher unser Bezirk eingeteilt war, mit einiger Sicherheit erschließen können. Sie waren der Nibelgau und der Argengau. Das Nähere über den ersteren, seinen Namen, Ausdehnung usw. muss der Beschreibung der Leutkircher, die ihm hauptsächlich angehörten, vorbehalten bleiben. Dort werden auch die Grafen desselben angeführt werden, soweit sie vom Jahr 766 an bis ins zehnte Jahrhundert zu unserer Kenntnis gekommen sind.
Zum Argengau gehörte neben Ysni die Orte Wangen, Hatzenweiler, Schwarzenbach, Niederwangen und Ratzenhofen. Sehr häufig waren die Argengau-Grafen zugleich auch Grafen des Linzgaus, ein Gebiet von der Schussen bis Überlingen. Südlich stießen diese beiden Gaue an den gebirgigen Gau der Voralpen, der Alpgau genannt, der das jetzige obrige Allgäu29 abdeckt. Nach dem Aufhören der Gauverfassung im 11. Jahrhundert, als aus den Gauen dynastische Besitzungen der Grafen waren, hat sich der Name Allgäu unserer Gegend durchgesetzt. Wir finden unten in Eglofs um die Mitte des 13. Jahrhunderts einen Beweis der Herrschaft, dass sie zur „Grafschaft im Albegaw“ gehörte. Im Jahr 1306 wird in einer Verkaufurkunde von Isny, Chronik der Truchsess 1,51, Isny als in Algowe gelegen, genannt. Unseres Wissens ist dies das früheste Vorkommen der Form Algau anstatt Alpgau. Gegenwärtig begreift man im Sprachgebrauch das Allgäu mit der Gegend um Wangen, Isny, Leutkirch und Wurzach.
Als erbliche Dynasten an der Stelle der Gaugrafen finden wir im 11. Jahrhundert im Besitze dieser Gegend die Welfen, die stammverwandten Grafen von Buchhorn30 und Bregenz, später die Welfen allein, mit Ausnahme der Dynastie oder Grafschaft Trauchburg und der im Argengau gelegenen einzelnen Bezirke in Niederwangen usw., welche den Grafen von Veringen gehörten. In Mitten der Welfischen Güter lagen die des Klosters St. Gallen, welche sehr bedeutend waren und sich vom Bodensee bis nach Leutkirch31 hinzogen und ganze Orte, z.B. Wangen selbst und mehrere feste Burgen, z.B. Neuravensburg, Praßberg, Leupolz, Ratzenried, Zeil in sich begriffen. Die Welfen übten darüber die Schirmvogtei.
Anfang des siebten Jahrhunderts beginnt die Ausbreitung des Christentums im Bodenseeraum durch den Iren Kolumban und seinem Schüler Gallus. Erst unter fränkischer Herrschaft gewann das Christentum im Allgäu festen Boden, da Karl der Große das Christentum zur ausschließend herrschenden Religion seines Reiches erklärte. Den Hauptanteil der Verbreitung der Lehre von Jesus Christus waren besonders die Klöster, welche meistens nach der Ordensregel des heiligen Benedikts von Nursia eingerichtet wurden. Die älteste Kirche der Umgegend soll die zu Rohrdorf sein, in welche selbst Ysni eingepfarrt war, bis es ein eigenes Gotteshaus durch die Grafschaft der Veringer erhielt. Und dies bedeutet der Ursprung unserer Benediktinerabtei.
Nun, lassen wir es gut sein mit unseren Reminiszenzen und Gedanken und uns getreu ans Werk gehen mit der Aufforderung unseres Ordensgründers, dem hl. Benedikt, ora et labora!“
Burg Alt-Trauchburg
Caspar Obach, (1807-1868), Gouache, Fürstlich Waldburg-Zeilsche Gesamtarchiv, Zeil, Wikipedia commons
22 Benedikt von Nursia, Rijksmuseum, Wikipedia commons
23 Giovanni Bellini, Benedikt von Nursia und der Evangelist Markus, Santa Maria Gloriosa, Venedig, Wikipedia commons
24 Abt Philipp von Stain 1501 – 1532, Wikipedia commons
25 Anton R. Vinzenz, Chronik der Stadt Isny im Allgäu und Umgegend vom Jahr 200 bis 1854 nach Christi Geburt. Strehle, Isny 1854.
26 Beschreibung des Königreichs Württemberg, 15. Heft, Oberamt Wangen, Prof. August Pauly, Mitglied des königlich statistisch-topographischen Bureau, 1841
27 Daniela Kah, Isny Marketing, 2018, Eine Reise durch die Stadtgeschichte, S. 22
28 Römerkastell, Vemania, Modell, Städt. Museum Isny
29 Karte des Allgäus, Wikipedia commons
30 das heutige Friedrichshafen
31 Beschreibung des Königreichs Württemberg, a.a.O., S. 103
Kapitel III
Novizenfeier – Albert von Hohenstein –
Das Konvent der Klostergemeinschaft hat sich nach dem gemeinsamen Frühstück im Kapitelsaal versammelt, Abt Philipp von Stain erhebt sich und beginnt:
„Liebe Brüder im Herrn, heute feiern wir ein großes Fest. Der Postulant Albert von Hohenstein wird nach der Terz das Versprechen vor Gott und unserem Konvent abgeben, dass er den nächsten Schritt zu unserer monastischen Lebensweise vollziehen wird. Lieber Novizenmeister Pater Remigius, berichte uns in aller Offenheit, ob wir dem Wunsch Albert von Hohensteins aufgrund seiner Lebenseinstellung, seiner Worte und Werke hier in unserem Kloster entsprechen können.“
„Kommt einer neu und will das klösterliche Leben beginnen, werde ihm der Eintritt nicht leicht gewährt“, sagt unser Regelbuch im Punkt 58. Lieber Albert von Hohenstein, noch trägst du einen adeligen Namen, bist inzwischen über sechs32 Monate bei uns im Konvent und hast dich in unseren Tagesablauf eingelebt. Du hast die Pflichten, welche dir zur Vorbereitung unseres täglichen Gottesdienstes aufgetragen wurden, angenommen und bist ein Teil unserer Gemeinschaft geworden. Du hast dich den Prüfungen, die dir auferlegt wurden, gestellt und den Versuchungen widerstanden. Du hast versprochen, beharrlich im Tun und im Denken zu bleiben und hast die Regeln unseres Ordensgründers des hl. Benedikt von Anfang bis Ende gelesen und verinnerlicht. Du hast dich entschieden, dieses Gesetz unserer Gemeinschaft zu achten und bist in unser Klosterleben eingetreten, obwohl du über die ganze Zeit die Möglichkeit hattest, deine Freiheit zu suchen.
Du bist den Anordnungen unseres hochwürdigsten Abtes Philipp von Stain gefolgt, hast deinen Dienst an unserer Pforte und am Altar mit viel Aufmerksamkeit und stets zuvorkommend geleistet. Du hast dich an unser Schweigegebot nach der Komplet gehalten und dich nie ohne Erlaubnis unseres Abtes aus dem Klosterbereich entfernt.