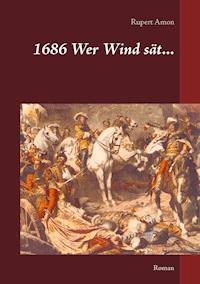Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1683. Die zweite Türkenbelagerung Wiens. Hauptmann Philipp von Lamberg-Sprinzenstein stemmt sich mit seinen Männern gegen den drohenden Untergang. Die Türken, unter ihrem Großwesir Kara Mustafa Pascha, tauchen vorm Ende des auslaufenden Friedensvertrages mit den Habsburgern vor der Osthauptstadt des Habsburger Reiches auf und wollen den sogenannten „goldenen Apfel“ pflücken, wie Wien von den Osmanen genannt wurde. Der Kaiser flüchtet nach Passau. Das Kommando in Wien übernimmt Graf Ernst Rüdiger von Starhemberg. Die Osmanen umschließen die Stadt am 15. Juli völlig. 20.000 Verteidiger gegen 200.000 Angreifer. Die Osmanen graben sich durch das Glacis in Richtung der Basteien, angeführt von ihrem schrecklichen Anführer, dem Janitscharen Bey Ahmed Pascha. Während der Belagerung wird Philipp von Lamberg verwundet und lernt Marie Luise von Thürheim kennen, die Tochter eines Arztes im Bürgerspital. Zwischen den Gräuel des Krieges und der Liebe zu Marie hin- und hergerissen muss Philipp seine Abenteuer bestehen. Immer an seiner Seite sein neapolitanischer Freund, Alessandro Stradella. Türkische Mineure untergraben Tag und Nacht die Wiener Verteidigungsstellungen. Zur selben Zeit stellen die deutschen Fürsten in größter Eile eine Armee zusammen. Der Papst konnte den König von Polen und den römisch deutschen Kaiser zu einem Bündnis gegen die verhassten Heiden überreden. Philip von Lamberg kämpft an allen Fronten. Die Türken versuchen unterdessen die Stadt auszuhungern und von jeglicher Nachricht abzuschneiden. Die Kuriere Wiens enden meist mit dem Kopf auf einem Holzspieß. Einer von Philips Männern, Leutnant Gregorowitz, begibt sich verkleidet auf den gefährlichen Weg zu Herzog Karl von Lothringen. Immer näher rücken die Türken. Die Stollen der Türken laufen bereits unter der Stadtmauer. Die Verteidiger, ohnedies mehr tot als lebendig, sammeln ihre letzten Kräfte. Nach 62 Tagen der Belagerung tauchen die Verbündeten der Christen auf dem Kahlenberg auf. Es ist der 12. September. Die Osmanen sind überrascht, die Tataren flüchten. Die Schlacht dauerte den ganzen Tag. Philipp und Alessandro beteiligen sich an einem letzten Ausfall gegen die Janitscharen. Eine riesige Mine wurde unter der Stadtmauer gelegt, detoniert diese, wäre der Weg für die Türken in die Stadt frei. Wien wird in letzter Sekunde befreit. Der Großwesir flüchtet nach Belgrad und wird dort vom Henker des Sultans stranguliert. Doch die Türken halten noch immer Ungarn und die nächste Schlacht wird kommen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 984
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Die Wichtigsten Personen
1683: Der letzte Widerstand
31.März 1683 - Vatikan
1. Juli 1683
07. Juli 1683
11.07.1683 - Hainburg
14. Juli 1683
14. Juli 1683
14. Juli.1683 - Wiener Hofburg
15. Juli 1683
16. Juli 1683
17. Juli 1683
18. Juli 1683
19. Juli 1683
20. Juli 1683
23. Juli 1683
25. Juli 1683
26. Juli 1683
28. Juli 1683
30. Juli 1683
31. Juli 1683
1. August 1683
2. August 1683
3. August 1683
4. August 1683
6. August 1683
7. und 8. August 1683
9. August 1683
10. August 1683
11. August 1683
12. August 1683
13. August 1683
14. August 1683
15. August 1683
18. August 1683
20. August 1683
22. August 1683
24. August 1683
25. August 1683
29. August 1683
4. September 1683
9. September 1683
11. September 1683
12. September 1683
15. September 1683
Ende September 1683 - Schloss Hartheim bei Eferding
25. Dezember 1683 - Belgrad
DIE WICHTIGSTEN PERSONEN
Die Verteidiger von Wien
PHILIPP VON LAMBERG-SPRINZENSTEIN, Hauptmann der kaiserlichen Dragoner
ALESSANDRO STRADELLA, Leutnant der kaiserlichen Dragoner und Philipps bester Freund
MICHAEL GREGOROWITZ, Leutnant der kaiserlichen Dragoner und Kurier der Wiener
FRANZ MAYER, Leutnant der kaiserlichen Dragoner
GREGOR TREGLER, Major 3. Infanterie Regiment
GEORG FRIEDRICH KRIECHBAUM, Leutnant 54. Infanterie Regiment
KARL FRANZ VON LOTHRINGEN, Graf von Rosnay, Fürst von Commercy, Regimentsführer der kaiserliche Dragoner
GEORG RIMPLER, Oberstleutnant und Festungsbaumeister
JOHANN ANDREAS VON LIEBENBERG, Bürgermeister der Stadt Wien
HEKTOR WINTER, Major 22. Dragonerkompanie
ERNST RÜDIGER VON STARHEMBERG, Militärkommandant der Stadt Wien
GUIDO VON STARHEMBERG, Vetter und Adjutant des Militärkommandanten
Uvm.
MARIE LUISE VON THÜRHEIM, Tochter von Franz und Angebetete von Philipp von Lamberg
FRANZ VON THÜRHEIM, Vater von Marie und Medicus in der Stadt Wien
JOSEFINE, Wirtin im Wirtshaus zur Reblaus und Alessandros Geliebte
BERNHARD UND MAGDA, Bedienstete und Freunde von Philipp von Lamberg
LEOPOLD KARL VON KOLLONITZ, Bischof von Wiener Neustadt
Entsatzheer
KARL VON LOTHRINGEN, Heerführer von Kaiser Leopold I.
JOHANN III. SOBIESKI, König von Polen
MAX EMANUEL VON BAYERN, Kurfürst von Bayern
LUDWIG WILHELM VON BADEN - BADEN, Markgraf
MAXIMILIAN ORTNER, Leutnant der kaiserlichen Kürassiere unter Karl von Lothringen
EUGEN VON SAVOYEN, Prinz und Vetter von Ludwig Wilhelm von Baden – Baden
Uvm.
Die Osmanen
KARA MUSTAFA PASCHA, Großwesir und Heerführer der Osmanen
AHMED PASCHA, Anführer der osmanischen Elitetruppe der Janitscharen
KARA MEHMED PASCHA, General vor der Burgbastei
WESIRS ABAZA SARI HÜSEYIN PASCHA, Beylerbeyi von Damaskus
ACHMED BEY, ehemaliger Kapuziner Mönch und jetziger Anführer der Pioniere
HIZIR PASCHA, Beylerbeyi von Bosnien
SÜLEYMAN PASCHA, General der Artillerie
ALI AGA, Hofschatzmeister
MEHMED IV, Sultan der Osmanen
IBRAHIM PASCHA, Beylerbeyi von Ofen (Buda, Stadtteil von Budapest)
Uvm.
1683
Der letzte Widerstand
Dies, werte Freunde, ist meine Geschichte. Geschrieben mit Blut und Tränen, in dunklen Zeiten voller Leid und Schmerz. Und doch auch eine Geschichte gefüllt mit Liebe und Güte, Freundschaft und Mut.
Mein Name ist Philipp von Lamberg-Sprinzenstein, Hauptmann im Dragonerregiment des Fürsten von Commercy, Grafen von Rosnay.
Ich wurde geboren im Jahre des Herrn 1658 an einem wunderschönen Maitag. Das Licht der Welt erblickte ich auf Schloss Sprinzenstein, in der Nähe vom Ort Sarleinsbach, unserem Familiensitz im Land ob der Enns. Ich bin der zweite Sohn des Reichsgrafen von und zu Lamberg-Sprinzenstein und somit zum Militärdienst auserkoren. Ich habe meine Kindheit überlebt, was, bei Gott, nicht selbstverständlich war. Ich habe meine geliebte Mutter in jungen Jahren verloren, der Allmächtige sei ihrer unsterblichen Seele gnädig, und wurde von meiner Stiefmutter erzogen. Sie tat ihr Bestes, so viel sei zu sagen.
Mein Vater erwarb für mich ein Offizierspatent und so schlug ich eine militärische Kariere ein. Ich habe die ersten Schlachten als Leutnant überlebt, was ebenso beachtlich, weil keinesfalls selbstverständlich, war.
Nun, im Jahre des Herrn 1683 diente ich im Range eines Hauptmanns und befand mich auf einer Mission, weit weg von meinem Regiment und meiner Kompanie. Ich wurde zusammen mit meinem Freund, Leutnant Alessandro Stradella, mit einer Geheimmission betraut. Den Feind aufspüren, das war unser Auftrag. Nun, wo fängt man an, wenn dieser Feind der Türke ist? Ich denke, hier, in Belgrad, waren wir genau richtig.
Von dem Mauervorsprung auf dem ich stand war die Aussicht auf die Stadt geradezu berauschend und die Vorfreude auf mein bevorstehendes Abenteuer lies mein Blut in Wallung geraten. Nur noch einen weiteren Vorsprung erklimmen und meine süße Belohnung war mir gewiss. Ich tastete mich an der Mauer voran und ergriff mit meiner rechten Hand die Balkonbrüstung. Ganz langsam zog ich mich hoch und lies mich über das Geländer auf den weißen Marmorfußboden gleiten. Nichts rührte sich im Garten, die Vögel zwitscherten wie bisher und keine Wache war zu sehen. Langsam bewegte ich mich in Richtung des Gemachs. Der Saray war schlechter gesichert als ich dachte. Manchmal belohnt einen das Leben, dachte ich. Wenn man mich hier finden würde, würde man mich bestimmt ganz langsam töten, und Köpfen wäre für mich, einen Ungläubigen, bestimmt noch eine zu milde Strafe. Was das betrifft kennen die Osmanen keine Gnade. „Surrayer“, flüsterte ich, „Geliebte, wo bist Du?“. Ich dachte an den Tag, als ich sie zum ersten Mal erblickte. Vor der Moschee ging sie an mir vorbei. Es war ein herrlicher Frühlingstag und die Luft roch nach Lorbeer und Rosmarin. Anmutig, mit hoch erhobenem Haupt, schritt sie an mir vorbei. Dabei drehte sie den Kopf ganz leicht in meine Richtung. Oder hatte sie mir den Kopf verdreht? Wer will das schon noch so genau wissen. Was ich aber noch weiß, ist, dass sie einen grünen Seidenkaftan trug und Ihre Kurven zeichneten sich deutlich darunter ab. Sie musterte mich neugierig und Ihre katzenhaften, smaragdgrünen Augen lächelten mich unter langen, schwarzen Wimpern an. Und was für Haare! Schwarz wie Ebenholz, eine wahre orientalische Schönheit, wie aus einem Traum. Die Konkubine des Emirs war einfach atemberaubend. Was für ein Weib! Auch wenn vieles verhüllt war und ich deswegen nicht alles von ihr sah, füllte diese Grazie mein Herz mit Verlangen. Ich musste sie haben, koste es, was es wolle.
Ich traf sie von da an öfter, tat als wäre dieses Aufeinandertreffen rein zufällig, doch immer war ich auf der Suche nach ihr, und mir kam es sogar vor, dass sie von unserer ersten Begegnung an, auch häufiger spazieren ging, auf der Suche nach mir. Ich beobachtete dieses anmutige Wesen heimlich, doch immer wenn sie meiner gewahr wurde, war ihr Gang noch graziler, ihre Blicke noch sinnlicher.
Ich fing an, ihr Liebesgedichte zu schreiben und steckte sie ihr heimlich zu. Gedichte voller Schmerz und Sehnsucht, Leidenschaft und Erfüllung. Ich ersann Ablenkungsmanöver für ihre Begleiter. Nicht selten machte sich Alessandro für mich zum Narren. Unsere Wege kreuzten sich ständig und immer war es eben ein Gedicht oder eine wohlriechende Blume, was den Weg, unbemerkt von ihren Begleiter in die zarte Hand des wunderschönen Mädchens fand. Dabei versuchte ich jedes Mal, sie kurz zu berühren. Ihr Blick wurde immer schmachtender, ihr Lächeln immer betörender und siehe da, eines Abends schickte sie mir ihren Diener mit einer Nachricht. Auch dieses Mal fand er mich an unserem Lieblingsplatz, beim Marmor Brunnen vor dem Gebetshaus. Der hoch gewachsene Maure lies die Nachricht seiner Herrin einfach im Vorbeigehen unbemerkt in meinen Schoß fallen und setzte seinen Weg weiter fort. Begierig las ich ihre Nachricht:
„Komm am dritten Tag bei Sonnenuntergang zu meinem Balkon mein Liebster, er wird für Dich geöffnet sein! Sei vorsichtig, mein Herz, ich warte voll Sehnsucht!“
Der dritte Tag, sagte sie, der dritte Tag. Und ich hoffte, ich hatte mich nicht getäuscht und sie meinte diesen wunderschönen Tag. Wenn nicht, würde ich wohl früher als erhofft meinem Schöpfer begegnen.
Nun, hier stand ich also auf ihrem Balkon und die letzten Sonnenstrahlen durchfluteten das riesige Zimmer und beleuchteten allerlei Kostbarkeiten. Der Emir musste ein Mann von gewaltigem Reichtum sein. Überall an den Wänden hingen kostbare Wandteppiche, Skulpturen aller Herren Länder schmückten Edelholzkästchen und ein edles Gemälde mit größtenteils halb bekleideten Frauen zierte die Decke. Die Luft roch nach Rosenblätter und Sandelholz. Langsam durchquerte ich den Raum, ständig bedacht, kein Geräusch zu machen. Im Zentrum des Raumes standen einladende Diwane, doch waren diese leer. Als ich fast den ganzen Raum durchquert hatte, fiel mein Blick auf ein weiteres riesiges Gemälde, welches direkt gegenüber dem Balkon an der Wand angebracht war. Ein alter fetter Osmane mit riesigem, weißem Turban starrte herrschaftlich dem Besucher entgegen. Ringe schmückten seine wulstigen Finger und ein Dolch in einer rubinbesetzten Scheide steckte in seinem Gürtel. „Selim Mustafa“, dachte ich bei mir, „es wird mir eine Ehre sein, deine Konkubine zu beglücken und so adrett wie Du aussiehst“, dachte ich, „gehe ich davon aus, dass es nicht nur mein Vergnügen sein wird.“ Unter dem strafenden Blick des Paschas schlich ich weiter durch die prächtigen Räumlichkeiten.
An einem Durchgang hingen dicke, rote Vorhänge mit goldenen Kordeln verknotet. Ich spähte ganz vorsichtig in den Raum dahinter und was ich sah, war der Himmel auf Erden. Ein Himmelbett, riesengroß, ein Traum in weiß! Überall waren weiße Kissen, weißer Chiffon oder weiße Seide. Vor dem Bett aber stand ein Waschzuber aus Elfenbein und darin saß anmutig Surrayer. Rasch sah ich mich im Zimmer um, aber außer ihr war niemand zu sehen. Rosenblätter schwammen in ihrem Badewasser und manche klebten auch auf ihrer samtenen, olivfarbenen Haut.
Mich hielt es nicht mehr im Durchgang, langsam, damit ich meine Herzdame nicht erschreckte, ging ich auf sie zu. Sie blickte auf und lächelte mich wohlwollend an. Dann, als ich kurz vor ihr stand, erhob sie sich anmutig aus ihrem Badewasser. Ein kleiner Rinnsaal lief zwischen ihren runden, perfekten Brüsten über Ihren flachen Bauch zu ihrer leicht beharrten Scham. „Ich fürchtete schon, Du würdest nicht kommen,“ hauchte sie mit betörendem Augenaufschlag. Ihr Schmollmund lies einen Anflug von Traurigkeit erkennen. Dann lächelte sie und ihre Augen strahlten. „Doch jetzt bist hier bei mir“.
„Nichts hätte mich vom Kommen abhalten können, meine Prinzessin. Keine Macht dieser Erde“ erwiderte ich, und war mir der Zweideutigkeit sehr wohl bewusst. Ihre grünen Katzenaugen richteten sich auf die Wölbung meines Kaftans unterhalb meines Gürtels. „Hast du eine Waffe in mein Gemach mitgebracht, mein Liebster“, schnurrte sie neckisch. Meine Stiefel hatte ich schon abgestreift als sie mir, offenbar mit geübter Hand, den Gürtel öffnete. Gürtel und Dolch glitten zu Boden. Mit einer einzigen geschickten Bewegung zog ich mir meine Oberbekleidung über den Kopf und streifte sie ab. Nackt, wie Gott mich schuf, stand ich nun vor ihr. Sie stieg aus der Wanne und drückte sich an mich. Ihre Lippen berührten die meinen und wir küssten uns lange und leidenschaftlich. Ihre schwarzen Locken streichelten meine Wangen während wir uns küssten und ich wünschte dieser Moment würde ewig andauern. Meine Hände glitten über ihren Rücken und fanden ihren Po. Mit der rechten Hand streichelte ich weiterhin ihre runden Backen, die linke aber, wanderte zu ihrer üppigen Brust. Sie stöhnte leise vor Vergnügen. Ihre rechte Hand umfasste kurz entschlossen mein erregiertes Glied und sie fing langsam an, mich zu streicheln. Wahnsinnig vor Verlangen hob ich sie hoch und trug sie zu ihrem Bett. Ihr Duft nach Rosen war so betörend, dass ich fürchtete, mir würden die Sinne schwinden. Dies hier musste wahrlich der Himmel sein! Ich legte sie sanft, mit dem Rücken voran, auf das Bett. Sie war leicht wie eine Feder. Ihre wohlgeformten Beine gingen auseinander und ich sah ihre Scham. Ich kniete mich vor ihr nieder und küsste sie dort zärtlich. Die Lust durchfuhr ihren Körper und Surrayer bäumte sich unter meinen Liebkosungen auf. Sie stöhnte immer lauter, und als ich dachte, sie hielte es nicht mehr länger aus, und würde uns durch ihr Stöhnen verraten, legte ich mich auf sie und versiegelte mit meinem Mund ihre Lippen. Sie reckte mir ihr Becken entgegen und ich drang sanft in sie ein. Ein Schauer lief durch Ihren Körper. „Ja, nimm´ mich mein Liebster“, hauchte sie in mein Ohr, „ich bin ganz die Deine.“ Ich genoss Ihre Wärme und Ihre Enge und küsste abwechselnd ihre vollen, sinnlichen Lippen und Ihre prallen Brüste. Wenn unsere Lippen nicht aneinander gepresst waren, biss sie verzückt in ein Kissen um ihr Stöhnen zu unterdrücken. Ich erhöhte das Tempo, versuchte so tief wie möglich in sie einzudringen. Dann ließ ich mir wieder Zeit nur um gleich darauf das Tempo für meine Geliebte überraschend das Tempo wieder zu erhöhen. Surrayer stöhnte immer heftiger bis ihr ganzer Körper zu zucken begann, sie presste ihr Becken gegen das meine und grub ihre Fingernägel in meine Pobacken. Das vormals klare Weiß ihrer Augen wurde milchig und ihr Blick trübte sich vor Verzückung. Sie öffnete leicht ihren vollkommenen Mund und seufzte vor Wonne. Auch ich bog meinen Oberkörper nach hinten und explodierte in ihr. Grelle Blitze tanzten vor meinen Augen und ich küsste sie zärtlich auf den Mund bis ich wieder klar denken konnte.
Als wir wieder ein wenig zu Atem kamen, schmiegte sie sich an mich. Zärtlich streichelte sie meine Brust. Ich spürte ihren Atem an meinem Hals. „Du bist ein junger Gott“, flüsterte sie. „Zumindest siehst Du so aus.“ „Nein“, widersprach sie sich selbst, „es ist nicht nur dein Aussehen, auch was und wie du es tust ist göttlich.“ Sie lächelte zufrieden.
Ich kann nicht verhehlen, dass es mir immer schon leicht fiel Frauen zu beeindrucken. Mit meinen fünfundzwanzig Jahren, einer Statur wie eine griechische Statue, bis auf das Gemächt versteht sich, da ist meines bedeutend üppiger, und einer Größe von sechs Fuß war ich bestimmt nicht die hässlichste Erscheinung auf Gottes Erde. Die körperlichen Anstrengungen im Leben eines Soldaten trugen dazu bei, dass sich meine Muskeln sichtlich wohl geformt hatten. Auch konnte ich es bis jetzt verhindern, mich im Kriege grob körperlich zu entstellen. Was eher am Glück lag und nicht an den mangelnden Gelegenheiten. Meine braunen Haare fallen mir bis zu den Schultern und ich wusste, dass meine blauen Augen auch zu überzeugen wissen. Auch meine wohlgeformte Nase und mein sinnlicher Mund kommen bei den meisten Frauen gut an. Kurz um, es war mir bewusst, wie ich auf die holde Weiblichkeit wirkte und ich nutzte meist dieses Wissen.
Surrayer seufzte und stützte sich auf ihre Ellenbogen auf. Das Seidenlaken, bedeckte nur die Hälfte Ihres Körpers und ich betrachtete ihre wohlgeformten Beine. „Warum kannst Du nicht der Emir sein“, fragte sie mit gespielter Entrüstung. Eine Zornesfalte erschien auf ihrer ansonsten makellosen Stirn. Ihr Schmollmund sah entzückend aus. „Dann könnten wir immer zusammen sein und ich wäre deine Hauptfrau“, ereiferte sie sich.
„Ja, der Emir“, sagte ich. „Wo ist er und warum konnte ich Dich heute ungestört besuchen?“
Ihr gespielter Ernst war verflogen und sie lächelte mich wieder an.
„Den habe ich fortgeschickt, und er wird auch so bald nicht zurückkommen. Dem Eunuchen habe ich gesagt, er solle mir das Bad einlassen und sich dann für heute zurückziehen. Habe ich das gut gemacht?“ Wieder dieser Schmollmund. „Du bist eine Göttin“, sagte ich. „Wie aus einer griechischen Sage. Wunderschön und offensichtlich auch verschlagen.“ Sie biss mich zärtlich in die Schulter. „Zur Strafe für die Verschlagenheit“, sagte sie. „Diese Bestrafung gefällt mir“, erwiderte ich. Sie lächelte. „Wo ist er hin?“ fragte ich sie erneut. „Ich meine nur, damit ich weiß, wie lange wir noch für uns haben?“ „Er ist dem Großwesir entgegen geritten und wird tagelang fort sein. Wir haben also noch ein wenig Zeit, Liebster.“
Dem Großwesir entgegen, dachte ich. Was führt den Großwesir nach Belgrad? Meine Gedanken überschlugen sich. Konnte dies die Information sein, die uns einen Vorteil verschaffte, aus dem Gemach des Emirs? Ich versuchte noch einmal mein Glück. „Kommt er alleine, auf eine Kurzvisite, oder ist er gar mit dem Emir verwandt?“ „Was Du alles wissen willst, mein Geliebter. Nein, Selim Mustafa ist nicht mit ihm verwandt, und der Großwesir kommt mit vielen Männern, über 100.000 Mann habe ich gehört. Mein Herr ist für deren Verpflegung verantwortlich, und war anhand der hohen Kosten in letzter Zeit ziemlich mürrisch. Aber Schluss jetzt, mein Liebster, spar dir deinen Atem auf für Besseres! Zufällig fällt mir da gerade was ein.“ Zärtlich küsste sie meinen Hals und wanderte zielstrebig herauf zu meinen Lippen. Während sie mich küsste, wanderte ihre rechte Hand zwischen meine Beine. „So wie Du stramm stehst, könnte ich fast vermuten, du seiest Soldat!“ Ihr Kopf verschwand aus meinem Gesichtsfeld und Surrayer´s Lippen fanden, was sie suchten. Kurz darauf durchfluteten wohltuende Schauer meinen Körper. Das war knapp, dachte ich, kurz bevor ich an nichts mehr denken konnte.
Es war schon spät, als ich zu den Pferden zurückkam. Alessandro hatte mich beim Durchgang in den Innenhof, wo wir unsere Pferde angebunden hatten, an sich vorbei gehen lassen. Jetzt kam er zurück und steckte beim Gehen seinen Dolch wieder in die Scheide.
„Niemand ist dir gefolgt“, sagte er. „Was hast Du herausgefunden?“ Neugierig musterte er mein Gesicht. „Zweierlei, mein Freund!“ sagte ich. „Orientalische Frauen sind den unseren in mancher Hinsicht überlegen.“ Ich musste dabei grinsen und machte eine Pause. „Und weiter“, sagte Alessandro. „Was war das zweite?“. Dann polterte Alessandro los: „Immer du mit deinen Frauengeschichten, ich meine, ich kann hier den ganzen Tag auf dich warten und was machst du? Du gibst mir Ratschläge über Frauen! Mir, einem direkten Nachfahren von Eros, dem römischen Liebesgott! Das ist fast, als glaubtest Du, eine Taube könnte einem Adler das Fliegen beibringen!“ Jetzt musste ich lachen, und auch Alessandro konnte sich nicht mehr zurückhalten. „Spaß beiseite“, sagte er. „Was hast Du sonst noch herausgefunden?“ „Sie kommen Alessandro“, sagte ich. „Es hat begonnen! Kara Mustafa Pascha ist auf dem Weg, zumindest nach Belgrad, und mit ihm 100.000 Mann.“ „Aber ob sie nach Wien kommen hast Du nicht erfahren, oder?“ Hoffnung breitete sich auf seinem Gesicht aus.
„Nein, mein Freund, das wusste sie nicht.“ „ Er könnte auch nach Ungarn wollen, wer weiß, vielleicht haben wir soviel Glück.“ „Ich befürchte aber, Kara Mustafa Pascha, der Großwesir der Türken wird im Sommer mit seinem Heer vor Wien stehen. So wird es in meinem Bericht stehen“, sagte ich. „Und, wir müssen uns darauf vorbereiten!“ Alessandro nickte. „Wahrscheinlich hast Du Recht“, sagte er. „Lass uns reiten, wir müssen den Herzog informieren, und es ist ein weiter Weg nach Raab!“ „Ja, du hast Recht“, sagte ich. „Wir müssen aufbrechen! Schade, eigentlich. Ich fing gerade an, Belgrad, seine Einwohner und die vortreffliche sogar liebevolle Gastfreundschaft der Osmanen zu genießen.“
31.März 1683 - Vatikan
Papst Innozenz XI. hatte nicht viel geschlafen. Zu viel hing vom Ausgang des heutigen Tages ab. Die Bedrohung aus dem Osten hatte Gestalt angenommen. Die Osmanen rüsten sich zum Kampf. Seinen tüchtigen serbischen Spitzeln war es zu verdanken, diesen Umstand überhaupt zu bemerken. Aber die christliche Welt schlief. Schlimmer noch, die großen christlichen Herrscher zerfleischen sich gegenseitig. Seit Jahren versuchte er nun Frankreich und das Haus Habsburg zum Frieden zu bewegen damit diese beiden christlichen Herrscher gemeinsam gegen die verhassten Türken ins Feld ziehen. Es war seiner Heiligkeit bis heute nicht gelungen. Im Gegenteil, Frankreich schickte Pioniere und Berater zu diesem Heiden, dem türkischen Sultan Mehmet IV., der Geißel der Christenheit. Alles um sich das Vorrecht des Handels mit Indien zu sichern. Und als wäre dies nicht Frevel genug, macht Ludwig der XIV. der Kirche auch noch ihre Abgaben streitig.
Aber heute war der Tag an dem sich das Blatt wenden würde, an dem dich das Schicksal der Christenheit entscheiden würde, dies würde sein Tag werden. Er blickte aus dem Fenster seiner Gemächer auf den Vorplatz. Kutschen waren vorgefahren und der Papst erkannte vertraute Gesichter. Ein Lächeln breitete sich in seinem Gesicht aus, als er Pater Marco und den Nuntius von Wien, Kardinal Buonvisi, aus einer Kutsche steigen sah. Seine getreuen Mitstreiter, dachte er bei sich. Ohne sie wäre das Komplott zum Scheitern verurteilt. Auf der Kutsche gleich dahinter erkannte er das Wappen der Habsburger, den roten Löwen. Also war Kaiser Leopold ebenfalls angekommen.
Hufgeklapper erfüllte den Innenhof und eine dritte prächtige Kutsche, von acht Schimmeln gezogen, kam in sein Blickfeld. „König Johann Sobieski“, flüsterte er. Auch er hielt sein Versprechen und machte die weite Reise. Es klopfte an seiner mit christlichen Ornamenten verzierten Tür. „Herein!“ rief er. Die Tür ging auf und der Kämmerer betrat seine Gemächer. „Die Hoheiten sind erschienen, Eure Heiligkeit.“ Der Papst nickte ihm kurz zu und schritt andächtig in Richtung Treppe. Dies wird wahrlich sein Tag und der Tag seines Herren, Jesus Christus!
Das Kaminfeuer brannte behaglich im großen Konferenzsaal. Das Eichenholz knackte und verströmte einen angenehmen Duft. Der Tag war noch nicht weit vorangeschritten, und die Wärme des offenen Feuers machte die Temperatur im Raum erträglich. Pater d´Aviano war von der Pracht dieses Raumes begeistert. Große Gemälde hingen an den Wänden. „Tintoretto“, las er auf einem Bild und es stellte unzweifelhaft das letzte Abendmahl dar. Auf einem anderen sah man die Kreuzigung Jesu, in einer solchen Echtheit, dass es den Geistlichen beinahe zu Tränen rührte.
Überall brannten Kandelaber. Dicke, farbenprächtige Teppiche aus dem Orient waren auf dem Steinboden ausgelegt. Fünf Männer waren an einer festlich gedeckten Tafel versammelt. Papst Innozenz XI., Kaiser Leopold von Österreich, König Sobieski von Polen und deren Berater Pater Marco d’Aviano und der Nuntius von Wien, Kardinal Francesce Buonvisi. Niemand sonst war bei dieser Beratung erwünscht.
Innozenz der XI. ergriff als erster das Wort. „Willkommen im Vatikan, Ihre Majestäten! Danke, dass Sie diese beschwerliche Reise auf sich genommen haben. Ich verspreche, es wird Ihr Schaden nicht sein.“
Kaiser Leopold blickte zu seinem Berater Pater Marco. Nur wegen seines Freundes war er hier. Hoffentlich macht sich diese Reise auch bezahlt! Denn eigentlich dürfte er gar nicht aus Wien weg sein. Zuviel passierte gerade an seinem Hof. Die Ungarn paktierten mit dem Feind, den französischen Froschfressern war ohnehin nicht zu trauen und die unsäglichen Heiden bereiteten ihm auch Kopfzerbrechen. Hoffentlich hatte der Papst gute Neuigkeiten! Kaiser Leopold I. konnte jedenfalls in seiner misslichen Lage welche gebrauchen.
„Bevor ich anfange,“ sagte der Papst, „muss ich um absolutes Stillschweigen ersuchen. Nur so, wird dieses Vorhaben gelingen.“ Er sah jedem seiner Gäste tief in die Augen und sprach nach einer kurzen Pause weiter. „Meine Spione haben Nachrichten abgefangen, aus denen zweifelsfrei hervorgeht, dass ein Angriff der Osmanen in Europa noch in diesem Jahr bevorsteht!“ Auch nach diesen Worten schwieg der Papst theatralisch, wodurch sich das eben Gesagte, dramatisch verstärkte. „Ihre beiden Reiche könnten die Ziele sein. Jedes für sich, versteht sich, welches wissen wir nicht genau. Was ich aber weiß, ist, dass Ihre beiden Reiche, alleine für sich, scheitern werden. Scheitern und untergehen. Für immer einverleibt ins Reich der Osmanen“
König Johann Sobieski lachte laut auf. “Nicht, solange ich König bin, werden diese stinkenden Antichristen mein Reich bekommen! Dies gelobe ich, solange ich lebe. Für Gott und für mein Vaterland.“
„Ich weiß, dass ihr tapfer seid, mein König, aber wie ich schon sagte, jeder für sich alleine wird untergehen und mit ihm sein Haus. Alleine seid ihr dem Feind nicht gewachsen. Ihr braucht ein starkes Bündnis, und hier und heute ist die Gelegenheit günstig, dieses Bündnis unerkannt von Euren Feinden miteinander zu schließen. Zwei große, christliche Herrscher verbunden in einem Defensivpakt.“ Der Papst machte wieder eine Pause und beobachtete die beiden Herrscher.
Sobieski starrte auf seine Hände, als wollte er wissen zu was sie fähig waren, während Leopold an einem Glas Wein nippte und aussah, als hätte er seine Entscheidung bereits getroffen. Kaiser Leopold ergriff auch als erster das Wort. “Eure Heiligkeit, ich danke Euch für diese Gelegenheit und schwöre bei der Heiligen Jungfrau, dass ich Polen und König Sobieski zu Hilfe kommen werde, sobald dieser von den Türken angegriffen wird. Als Zeichen, dass es mir ernst ist, werde ich ein Schriftstück aufsetzen lassen, in welchem wir uns gegenseitige Unterstützung zusagen werden. Dies werde ich mit meinem Siegel unterfertigen.“ Feierlich blickte er zu Pater Marco, der dem Habsburger Kaiser ermunternd zunickte. Genau so, hatten sie es im Vorfeld besprochen, dachte der Priester. Diese Allianz war der Wunsch Gottes, und egal wo der Türke zuschlug, werden die Erzengel an der Seite der gläubigen Christen kämpfen. Diese Allianz war stark genug, um den Feinden des einzig wahren Glaubens zu trotzen. Und er, Pater Marco d’Aviano, würde die christliche Koalition unterstützen, und im Fall der Fälle, allen jenen Trost spenden, welche ihn benötigen.
„Es ist bereits vollbracht“, sagte der Papst. “Ich habe mir erlaubt einen Vertrag aufsetzen zu lassen und habe diesen mit dem päpstlichen Siegel versehen. Dies ist sein Inhalt wie mit ihren Hoheiten besprochen.“ Unter den Augen der gekrönten Häupter entrollte er das Pergamentschriftstück. Mit feierlicher Stimme las Papst Innozenz den Vertrag vor:
1. Der Heilige Römische Kaiser soll jährlich während des Türkenkrieges 60.000 Mann und die Krone Polens 40.000 Mann stellen.
2. Wenn der König von Polen selbst am Krieg teilnimmt, übernimmt er die Führung der Truppen.
3. Gegenseitiger Beistand bei der Belagerung von Krakau oder Wien.
4. Beide Seiten sollen christliche Verbündete suchen und diese in die Allianz einladen.
5. Der Kaiser zahlt an die polnische Krone 200.000 Reichstaler.
6. Alle Steuern (300.000 Reichstaler) der venezianischen Kirchen in der Lombardei werden für ein Jahr als Sold der polnischen Soldaten für den Türkenkrieg verwendet.
7. Der Kaiser übernimmt alle Schulden der Polen gegenüber Schweden aus dem letzten schwedischen Krieg und verzichtet auf alle Schulden gegenüber Österreich.
8. Kein Allianzpartner macht ohne Einverständnis des anderen Waffenstillstand oder Frieden mit den Türken.
9. Seine kaiserliche Majestät und die Krone Polens schwören einen heiligen Eid auf diesen Vertrag.
10. Von beiden Seiten sollen kriegskundige Ratgeber abgestellt werden, die der anderen Seite die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Heeres übermitteln.
11. Eroberte Gebiete in Ungarn gehören seiner kaiserlichen Majestät, eroberte Gebiete in der Walachei und der Ukraine gehören Polen.
12. Diese Allianz geht auch an die Erben und Nachfolger des Römischen Kaisers über.
Als er fertig gesprochen hatte, sah er in die Runde. „Von immenser Wichtigkeit ist auch, dass dieses Treffen und der Inhalt unserer Unterredung geheim bleiben müssen, solange bis unsere Stunde gekommen ist“, erklärte der Papst ernst. „Die Geheimhaltung ist unsere stärkste Waffe.“ Wieder blickte seine Heiligkeit durch die Runde. Alle nickten, und Schweigen breitete sich in diesem so prunkvollen Raum aus bis der König von Polen das Wort ergriff.
Entschlossen blickte er dem Habsburger Kaiser ins Antlitz. “So sei es! Auf Gedeih und Verderb verbündet!“ sprach Jan Sobieski, dann lachte er lauthals, und sein Lachen hallte von den Wänden des Saales durch den ganzen Palast.
Papst Innozenz war mit sich zufrieden. Er und seine Vertrauten hatten dies alles, mit Gottes Hilfe, möglich gemacht.
Dies war die Stunde seines Herren, die Stunde seines Gottes, des einzig wahren Gottes. Jetzt würde es für die Heiden nicht mehr so einfach sein, christliches Kernland mit Ihrem Glauben zu besudeln.
Dies war die Stunde Null, der Anfang vom Ende des Osmanischen Vormarsches, dessen war er sich sicher. Weitere Verhandlungen mit den Fürsten aus Bayern, aus Sachsen und aus Franken würden folgen.
Es wird zwar ein hübsches Sümmchen kosten, aber was sind schon alle Reichtümer dieser Welt gegen die Liebe des Allmächtigen. Nur billiger Tand. Die Christenheit hatte genug gelitten unter den Osmanen. Von nun an wird das Christentum über die Heiden triumphieren, das schwor er im stillen Gebet bei allen Heiligen.
1. Juli 1683
Herzog Karl V. von Lothringen konnte es kaum glauben. Fast minütlich trafen in Raab Boten aus den Grenzfestungen ein, um über Kapitulationen oder Niederlagen zu berichten. Die Festungen Tata, Neutra, Vezprem und Papa haben sich einer riesigen osmanischen Übermacht ergeben. Das konnte doch nicht wahr sein. Er selbst war mit seinem Heer auf dem Weg zur Festung Neuheusl um die mit den Türken verbündeten, aufständischen Ungarn unter Fürst Emmerich Thököly das Fürchten zu lehren. Falls sich seine Späher nicht irrten, und das taten sie nie, kam dort hinter den Hügelkämmen eine Vorhut von 40.000 Mann Tatarenkavallerie und Janitscharen auf Raab zugeritten. Eine Vorhut! Herzog Karl von Lothringen grunzte. Wie viele Männer mochte der Sultan dieses Mal schicken? Er musste unbedingt sein Heer retten und den Kaiser alarmieren. „Palffy, wo stecken sie?“ Der Herzog drehte sich schnell im Kreis und blickte sich um. Der erst neunzehnjährige Adjutant des Generalissimus, des obersten Generals des Kaisers, beeilte sich, in seinem Blickfeld zu erscheinen. „Lassen Sie nicht absatteln, Palffy, wir müssen sogleich weiter. Die Infanterieeinheiten lassen Sie sogleich umdrehen und im Laufschritt Richtung Wien marschieren. Sagen Sie das General von Sachsen-Lauenburg!“ Palffy kehrte sogleich wieder um, um den soeben erteilten Befehl auszuführen. „Halt, ich bin noch nicht fertig! Sagen Sie dem General, er solle zwei Kompanien Musketiere zur Verstärkung zurücklassen und die eintreffenden versprengten Truppen sollen auch die Garnison verstärken, und schicken sie mir unseren schnellsten Reiter. Ich muss eine Depesche nach Wien schicken.
Haben sie alles, mein Junge?“ Der Generalissimo fühlte sich schrecklich alt, sein Kreuz schmerzte und sein schwerer Kürass drückte an seinen Schultern, oder war es nur die schwere Last, die man ihm als Oberbefehlshaber des kaiserlichen Heeres auferlegt hatte? Er wusste es nicht, aber er dachte, dass fünfzig Jahre ihn durchaus berechtigten, einen Jungspund großväterlich zu behandeln.
Was soll das Grübeln, dachte er bei sich. Denken hat mich nicht zu dem gemacht was ich heute bin. Ein Soldat muss handeln. „Wer befehligt die Garnison?“ fragte er im Gehen seinen zweiten Adjutanten, Graf von Mercy. „Ich weiß es nicht, mon General“, antwortete dieser. „Nun, ist mir eigentlich auch völlig egal, Graf! Instruieren Sie ihn! Er muss Widerstand leisten bis zum letzten Mann. Wir brauchen die Zeit um den Kaiser in Sicherheit zu bringen!“
„Mach ich sogleich, Herzog“, bemühte sich Claudius Florimund Graf von Mercy zu erwidern, aber der Herzog hörte ihn nicht mehr und ging schnurstracks zu seinem Pferd. Sie waren schnell, dass musste er ihnen lassen. Er hatte gehofft, die Grenzfestungen würden länger standhalten. Nun, das konnte er jetzt getrost vergessen. Warum etwas nachtrauern, was man nicht mehr ändern kann? Wichtiger war, in Erfahrung zu bringen, wie stark der Feind wirklich war und wie weit das Hauptheer von der Vorhut entfernt war. Er musste auf Nachricht hoffen. Als er sich in den Sattel erhob waren von Palffy und von Mercy ebenfalls bei Ihren Pferden erschienen. Mercy auch erst siebzehn Jahre alt und Palffy schwangen sich trotz des schweren Rüstzeugs in den Sattel als wären sie nackt und ritten zu einem Dorffest. Nackt und Dorffest! Gott helfe mir! Was habe ich nur für unkeusche Gedanken, dachte der General. „Befehl ausgeführt, Herr General!“ meldeten die zwei Jünglinge. „Palffy, reiten Sie zu ihrem Onkel dem Grafen und sagen Sie ihm er soll mit der Vorhut abrücken. Dann reiten sie zu Generalfeldwachmeister Rabatta und spornen Sie ihn zur Eile an. Den Markgrafen zu Baden überlasse ich Ihnen, Mercy. Ich habe momentan keine Lust auf Gezeter und ewige Diskussionen, wie ich mein Heer führen soll. Und wo ist Graf Julius von Sachsen-Lauenburg? Wir müssen uns beeilen!“ „Ich bin direkt hinter Ihnen, mein General.“ Herzog Karl fuhr herum und sah in das grinsende Gesicht seines langjährigen Freundes. Dieser lächelte ihm zu und winkte ihm lässig mit der linken Hand. „Meine Kürassiere sind bereit zum Aufbruch, Herzog Carolus.“ „Gott sei’s gepriesen, mon ami, auf Sie ist immer Verlass!“ Graf Julius, welcher nur ein paar Jahre jünger war als der Generalissimo zog freundlich seine Zischägge, eine halbkugelförmige Helmglocke mit langem Nackenschirm vom Kopf und verneigte sich im Sattel. „Danke! Sehr freundlich von Ihnen, meine Bemühungen anzuerkennen. Da freut man sich gleich wieder mehr auf diesen, wie ich annehme, wilden Ritt?“ „So ist es, mein Freund, lassen Sie uns unsere alten Knochen in Bewegung bringen“, erwiderte Herzog Karl schelmisch. „Es gilt, ein Heer nach Wien zu führen, bevor es zu spät ist.“ Beide Männer lachten, als sie ihren Pferden die Sporen gaben und das Heer bewegte sich Richtung Wien, der Hauptstadt des Ostreiches.
07. Juli 1683
Irgendetwas stimmte nicht. Oberst, Prinz Julius von Savoyen, war mit einem flauen Gefühl im Magen erwacht. Seit Tagen marschierte das Heer Richtung Wien. Die Nacht hatte er hier im Schloss Petronell, 40 Kilometer östlich von Wien verbracht. Die Soldaten kampierten auf dem freien Feld und jetzt am Morgen glitzerten ihre Brustharnische, Helme und Lanzen in der aufgehenden Sonne. Es würde wieder ein heißer, beschwerlicher Tag werden, dachte er. Das Schloss gehörte dem Reichsgrafen von Abensperg-Traun eines Adelsgeschlechts welches zu den so genannten Apostelgeschlechtern des Österreichischen Adels gehörten. Diese Familien gehörten schon unter den Babenbergern zum Hochadel. Nun, dies mag zwar für viele unbedeutend klingen, für ihn aber, selbst aus einem alten Hochadelsgeschlecht war dies von höchstem Interesse. Seine Blutlinie ließ sich bis 1003 nach Christus auf den Grafen von Salmourenc zurückführen, was, wie er zugeben musste, nicht solange war, wie bei den Grafen von Abensperg-Traun. Bis 976 nach Christus waren deren Wurzeln nach zu vollziehen. Beeindruckender Stammbaum, wie Julius von Savoyen fand. Der Prinz fühlte sich ein wenig unpässlich, wusste aber nicht genau warum. Er hatte schlecht geträumt. Jesus hatte zu ihm gesprochen, ganz freundlich, aber in Französisch, wie er erst später bemerkte. Er wusste nicht genau was Gottes Sohn zu ihm sagte, zumindest konnte er sich nicht mehr daran erinnern, wie eben meistens nach Träumen. Er wusste nur, dass der Herr plötzlich eine Dornenkrone auf hatte und Blut rann in dicken Rinnsalen von seinem Haupt. Seine Augen blickten dennoch sanft und drückten kein Leid aus. Was mochte das bedeuten? Er war verwirrt. Er musste nach dem Feldfrühstück mit seinem Freund Prinz Karl von Aremberg sprechen, dieser würde ihn mit seinem heiteren Gemüt schon auf andere Gedanken bringen. Ein Lächeln huschte über sein Gesicht. Karl, der gute Kerl, ist bestimmt schon bei einer Magd und versucht sein Glück. Von Aremberg war ein Bild von einem Mann und hatte stets Glück bei den Weibsbildern. Und auf dem Schlachtfeld gab es keinen besseren Kämpfer. Dies war auch der Grund warum sie meistens zusammen ritten, denn auch der Prinz von Savoyen hatte das Kriegshandwerk erlernt und wusste zu kämpfen.
An seiner Tür klopfte es. „Herein!“ rief er. „Nur herein!“ Ein Diener brachte ihm heißes Wasser und Seife. Er scheuchte ihn unfreundlich hinaus und drehte sich flugs zum Zuber. Das Wasser dampfte noch und er ergriff die rosenfarbene Seife. Er roch dran und seufzte innig.
Französische Seife aus Marseille, dachte er, was für ein erlesener Geschmack. Sie duftete nach Wildrosen und schmeichelte seiner Nase. Auch auf die Gefahr hin, dass es ihn für Seuchen und Krankheiten anfälliger machte, mochte er es, sich mit Seife zu waschen, egal mit welcher. Es musste nicht diese hochwertige Art sein, es durfte auch Kernseife sein. Hauptsache er brachte den Pferdegeruch von der Haut. Er seifte sich schnell das Gesicht ein und holte sein Rasiermesser aus seinem Beutel, dann nahm er seinen kleinen goldumrandeten Taschenspiegel und hielt ihn so, dass er sich beim Rasieren gut sehen konnte. Mit dem ersten Versuch schnitt er sich in die Wange und vor Schreck ließ er den Spiegel fallen. Der Spiegel fiel auf harten Stein und das Glas zersprang in tausend Stücke.
„Merde! Auch das noch“, fluchte er. „Sieben Jahre Pech!“ Doch er sollte sich täuschen.
Das Heer hatte sich wieder in Bewegung gesetzt und marschierte westlich in Richtung Regelsbrunn, immer der Donau entlang. Sie hatten ein kleines Stück des Weges hinter sich gebracht, als Reiter der Nachhut plötzlich neben dem Generalstab auftauchten. Einer der Dragoner bremste seinen Schimmel und salutierte zackig. „Melde gehorsamst, General, feindliche Kavallerie an unserer linken Flanke, nur mehr wenige Orte entfernt.“ „Soldat“, blaffte der Herzog von Lothringen, „geht das genauer?“ „Jawohl, Herr General!“, beeilte sich der Kavallerist zu sagen. „Wenn das Hauptheer dieses Tempo beibehält, holen sie uns in einer Stunde ein. Nur Tatarenkavallerie, Herr General, nur schnelle Einheiten“, bemühte er sich zu erklären.
„Das weiß ich selber mein Junge“, blaffte der General, „dass wir Kanonen und Infanterie Einheiten mitführen, macht uns sehr langsam. Wie viele sind es Soldat? Eine halbwegs genaue Schätzung wenn ich bitten darf.“ Der General wirkte beunruhigt. „Ein wenig plötzlich jetzt guter Mann.“ „So viele, Herr General, dass man sie nicht zählen kann. Soweit das Auge reicht Kavallerie. Tausende, nein Zehntausende, ein Meer von Reitern, Herr General“, der Soldat schwitzte unter dem schweren Helm. „Sicher mehr als doppelt so viele wie unsere Heeresstärke.“ Er schluckte und wagte es nicht dem Generalissimo in die Augen zu sehen. „Gut gemacht, Soldat“, sagte dieser plötzlich.
„Wie heißen sie?“ „Steiner, Herr General. Richard Steiner, mein General“, der Dragoner schaute jetzt neugierig, in Erwartung was da kommen mag. „Palffy“, blaffte der General. „Dieser Mann soll sich nachher bei Ihnen melden, wir befördern ihn zum Leutnant. Abtreten Soldat! Kommen Sie am Abend zu meinem Adjutanten, er wird sich um alles kümmern.“ Der Dragoner lächelte. Er und ein Offizier! Das konnte er sich noch gar nicht vorstellen. Glücklich salutierte er und ritt von dannen. Karl von Lothringen blickte sich um. General Julius von Sachsen-Lauenburg war an seiner Seite und Generalfeldwachmeister Rabatta hatte auch das Gespräch mitgehört. Nur der Markgraf von Baden war bei der Nachhut und momentan nicht in seiner Nähe.
Herzog Karl von Lothringen richtete sich im Sattel auf und spähte über den Tross seines Heeres. Und da sah er ihn auch schon. Ein roter Fleck unter blauen Uniformen. So stach er förmlich aus den Reihen hervor. Der „rote Ludwig“, so nannten ihn alle. Ein vortrefflicher Soldat, aber ein ebenso streitbarer wie tüchtiger Offizier. „Mercy, holen Sie von Baden zu uns. Wir halten Kriegsrat. Flott jetzt!“ Mercy nickte und gab seinem Pferd die Sporen. Sie sind schon so nahe, dachte der Feldherr. „Wir müssen sie aufhalten meine Herren“, sagte er zu seinen Generälen. „Jede Stunde zählt und deswegen sollten wir ihnen den Schneid abkaufen.“ Er lächelte. Rabatta und von Sachsen-Lauenburg nickten auch grinsend. „Ich denke, auch wir sollten sie stellen“, sagte Graf Rabatta. „Sie rechnen jetzt nicht mit einem Kampf. Sie müssen glauben, wir ziehen uns in die Stadt zurück.“
„Ganz recht“, bestätigte von Sachsen Lauenburg. „Lasst uns mal sehen, was sie auf der Pfanne haben“, wieder lachte er. In diesem Moment preschte Markgraf Ludwig von Baden heran. „Wohlan meine Herren“, sagte er. „Welch ein schöner Tag für einen Kampf. Haben wir uns schon für eine Schlacht entschieden?“ Der Graf lächelte die Generäle verschmitzt an. „Ein kleines Scharmützel hebt den Blutdruck, Euer Gnaden“, sagte man mir. Er blickte Herzog Karl direkt ins Gesicht. „Wie recht ihr habt von Baden! Mir scheint es auch angebracht, den Heiden das Tor zur Hölle zu zeigen, finden sie nicht auch meine Herren?“ „Jawohl, Generalissimo!“ schallte es im Chor.
„Lassen wir ein paar Köpfe rollen“, antwortete Graf Rabatta.
Die Lage war perfekt für einen Hinterhalt. Im Norden die Donau, im Süden ein Waldstück. Die Tataren mussten an den Kaiserlichen vorbei, wollten sie nach Wien. Herzog Karl von Lothringen stellte die Infanterie in die Mitte der Schlachtlinie. Fünftausend Musketiere bildeten eine Phalanx aus tödlichem Feuer. Die Flinten der kaiserlichen Truppen waren den Osmanischen an Reichweite überlegen. Diese Flinten konnten den Tod auf zweihundert Meter Entfernung bringen, wohingegen die osmanischen Musketen nicht einmal auf achtzig Meter mit Sicherheit trafen. In diesem Kampf aber ging es nicht um Musketen, dieser Kampf wurde zu Pferde ausgetragen. Den linken Flügel führte der Markgraf zu Baden gestützt auf sein Kürassier-Regiment und weiteren Kavallerie-Einheiten, gesamt über siebentausend Reiter. Graf von Palffy, der Onkel des jungen Adjutanten, und von Mercy verstärkten seine Truppen. Auf der rechten Seite am Rande des Waldes erwartete Karl von Lothringen seinen Feind unterstützt von den Generälen von Sachsen-Lauenburg und von Rabatta. Auch auf dieser Seite konnten die Generäle siebentausend Berittene in den Kampf führen. „Nicht vergessen, meine Herren, wir können sie nicht schlagen. Wir wollen sie nur zwingen, langsamer vorzurücken. Wir brauchen Zeit“, dies erläuterte der Herzog seinem anwesenden Stab. „Sagen Sie es ihren Offizieren.
Keine Verfolgung! Nur einen heftigen Angriff und wenn sie abziehen, rücken wir weiter vor nach Wien. Keine Kanonen! Das würde zu lange dauern.“ Alle nickten und Befehle wurden weitergeleitet. Jetzt hieß es warten und das war manchmal das Schlimmste. Zeit, über das Leben nachzudenken, und wie lange man es wohl noch genießen konnte. Genau diesen Gedanken hing auch Oberst Prinz von Savoyen nach, während man allerorts auf den Feind wartete. Er saß lässig in seinem Sattel und gestikulierte wild an seinem Kopf herum. „Ich schwöre Ihnen Karl“, er hatte eine Dornenkrone auf und sprach Französisch. „Deswegen muss Gott noch lange kein Franzose sein“, sagte Karl und legte seine Stirn in Falten. „Prinz von Aremberg, das heißt nur, dass Gott wie Sie und ich mehrere Sprachen spricht. Darunter natürlich Französisch, wie jeder zivilisierte Mensch.“
„Aber“, sagte der Prinz von Savoyen, „was sollte mir der Traum sagen? Ich habe ein schlechtes Gefühl.“ Bekümmert blickte er zum Horizont. „Denken Sie doch an den Spiegel“, sagte von Aremberg.
„Sieben Jahre Unglück! Also, was sollte Ihnen dann heute schon passieren?“ „Sie haben Recht Karl“, seine Miene hellte sich auf.
„Dafür muss man doch leben, oder etwa nicht?“ Prinz von Aremberg nickte. „Haben Sie Ihre Pistolen überprüft? Sind sie geladen? Ist das Pulver trocken, ihr Säbel geschärft?“ „Alles überprüft“, sagte der Prinz von Savoyen. „Von mir aus können diese Heiden kommen.“
Und das taten diese auch.
Herzog Karl von Lothringen hatte Dragoner ausgeschickt um die Tataren aufzuspüren und dann anzulocken. Die Dragoner waren eine leichte Kavallerie, sozusagen eine berittene Aufklärungstruppe. Sie trugen keine schweren Rüstungen, und waren dadurch viel leichter, als die schwer gepanzerten Kürassiere. Meistens war ihr einziger Schutz ein so genannter Lederkoller, ein Lederwams mit oder ohne Ärmel.
Dieser Verzicht wirkte sich natürlich in der Beweglichkeit und Schnelligkeit aus. Die Dragoner waren trotzdem schwer bewaffnet.
Säbel, Karabiner und zwei Pistolen gehörten zur Grundausstattung.
Eine Staubwolke machte sich in der Ferne bemerkbar. Ganz eindeutig das Tatarenheer, dachte der Generalissimo, gleich war es soweit.
Adrenalin floss durch seine Adern und die Vorfreude auf die Schlacht machte ihn ruhiger. So, so dachte er. Keine Kreuzschmerzen mehr, keine Schulterblessuren, alles wie weggeblasen. „Sagen Sie den Männern, sie sollen tief zielen“, forderte er seine Offiziere auf. „Los jetzt!“ Die Generäle ritten zu ihren Reihen und gaben die Befehle weiter.
In diesem Moment sprengten kaiserliche Dragoner in vollem Galopp über die fünfhundert Meter voraus liegende Hügelkuppe. Sie waren noch keine hundertfünfzig Meter von der Kuppe entfernt, als im wilden Haufen die tatarische Vorhut auftauchte. Wilde Reiter mit hohen Turbanen und langen Bärten auf kleinen strubbeligen Pferden wogten über den Hügel. Ihr Kriegsgeschrei wurde nur vom Donnern der Hufe übertönt. Auch sie waren in vollem Galopp und sich ihres Sieges bis dahin wohl völlig sicher gewesen. Viele hatten ihre Krummsäbel gezogen und schwenken sie kreisförmig über ihren Köpfen. Einige hatten ihre Spieße angelegt und versuchten die Eskadron Dragoner einzuholen. Aber die hundertfünfzig kaiserlichen Soldaten hatten einen anderen Auftrag. Auf ihren größeren, schnelleren und ausgeruhten Pferden war es den Dragonern ein Leichtes, sich von den Tataren fernzuhalten. Viel zu spät erkannten die Tataren, dass sie in einen Hinterhalt geführt wurden und da sie nicht abschwenken konnten, verringerten sie ihr Tempo und suchten nach einem Ausweg. In diesem Moment eröffneten die Kaiserlichen das Feuer und trotz der noch beträchtlichen Distanz von hundertachtzig bis zweihundert Meter lichteten sich die vorderen Reihen der Tataren. Pferde knickten mitten im Lauf ein und begruben ihre Reiter unter sich. Die Schmerzensschreie der Verwundeten mischten sich mit dem lauten Trommeln der Pferdehufe und dem Krachen der Musketen. Das Sterben hatte also begonnen. Die kaiserliche Kavallerie wartete nicht darauf, dass sich der Feind wieder formieren konnte, sondern ging sogleich in den Angriff über. Oberst Prinz Ludwig Julius von Savoyen lies zum Angriff blasen und er und sein Freund, Prinz Karl von Aremberg, ritten an der Spitze seiner Savoyen Dragoner, mitten in die Flanke der feindlichen Reiter. Flinten krachten, Pistolen wurden abgefeuert und es erhob sich der klirrende Lärm aufeinander prallender schwerer Säbel über das Schlachtfeld.
Die Tataren hatten sich wieder erholt und nun bewiesen sie, wie behände sie ihre Pferde zu führen vermochten. Ein Tatarenreiter mit einem mächtigen geschwungenen Oberlippenbart trieb gerade eben einem Dragoner seine Lanze in die Seite und stieß ihn so vom Pferd. Männer fochten zu Pferde und auch am Boden, Blut spritzte aus offenen Wunden, Gliedmaßen lagen abgeschlagen auf der Erde.
Sterbende Männer schrien im wahrsten Sinne wie am Spies. Pferde machten ihre letzten Schnauber und mitten unter seinen Männern kämpfte Prinz Ludwig Julius um sein Leben. Seine Dragoner wurden von den gepanzerten Kürassieren getrennt und er war gerade dabei sie wieder in Formation zu bringen, als eine weitere Tataren Reiterschar über die Hangkuppe brandete. Der Prinz hatte seine Pistolen schon leer geschossen und nahm jetzt seinen Karabiner zur Hand. „Folgt mir, Savoyer, mir nach“, rief er seinen Soldaten zu. Im vollen Galopp ritt er den Neuankömmlingen entgegen. In etwa hundert seiner Reiter folgten ihm und die meisten zogen ihre Degen und Säbel während sie ihren Schlachtruf ausstießen. An der Spitze der Tatarenschar aber hatten die Reiter die Gefahr bereits erkannt und brachten ihrerseits ihre Flinten in Anschlag. Der Prinz, auf Schussweite herangekommen, betätigte den Abzug und einer der Steppenreiter griff sich an die Brust und fiel rücklings aus dem Sattel. Der Prinz steckte seinen Karabiner zurück in den Holster und zog seinen schweren Säbel. In diesem Moment feuerten die Tataren. Des Prinzen Pferd brach über seine Vorderbeine weg und knickte, schwer getroffen, nach vorne. Dann überschlug es sich und blieb zitternd liegen. Die Augen vor Schreck geweitet lag das Vollblutpferd auf der Seite und blutete aus vielen Wunden. Blutiger Speichel tropfte aus dem Maul des Schlachtrosses und es würde nicht mehr lange dauern bis der Tod endlich das Tier erlösen würde. Der Prinz aber war noch nicht tot. Als seine treue Stute zusammenbrach, schaffte er es nicht mehr, die Füße aus den Steigbügeln zu bekommen. Das Pferd fiel auf ihn und zerschmetterte dem Prinzen nahezu alle Knochen. Aus seinen Lungen kamen rasselnde Geräusche und kleine Rinnsale hellen Blutes bildeten sich auf seinem aufgeschürften Haupt. „Zu mir“, keuchte er, „zu mir.“ Blut schwappte aus seinem Mund. Ein Tatare, der auch vom Pferd gestürzt war, aber mehr Glück hatte, wollte dem Prinzen den Garaus machen.
Er zog sein Krummschwert und holte aus, um dem verwundeten Adeligen den Kopf ab zu schlagen. Doch in diesem Moment krachte ein Schuss. Des Tataren Blick wirkte kurz überrascht, doch gleich darauf machte sich auf seiner Stirn ein roter Fleck bemerkbar und wurde immer größer. Sein Auge brach und er fiel um. Der osmanische Krieger war tot bevor er auf dem Boden aufschlug. Karl von Aremberg steckte die Pistole zurück in das Holster und schwang sich vom Pferd. Das Pferd benutzte er als Deckung für sich und seinen am Boden liegenden Freund. Er erkannte sofort, dass er alleine den Prinzen von Savoyen nicht befreien würde können, dazu war das, auf dem zerschmetterten Körper seines Kameraden liegende Pferd zu schwer. Er nahm seinen Karabiner aus dem Holster seines Sattels, fest entschlossen seinen Freund zu verteidigen, koste es was es wolle.
Rings umher kämpften die Soldaten und er nutzte die kurze Gelegenheit seinen Freund näher in Augenschein zu nehmen. Seine Beine sah man überhaupt nicht und der Rücken des Pferdes lag auf dem Brustkorb des Prinzen von Savoyen. Dessen braunes Haar war mit Blut verklebt und Karl von Aremberg musste an die seltsame Geschichte denken welche ihm sein Freund des Morgens erzählt hatte. Prinz Ludwig kam wieder zu sich und erkannte seinen Freund. „Lass mich liegen“, stammelte er. „Du kannst mich nicht retten.“ „Ich werde Hilfe holen, mon ami“, entgegnete Karl von Aremberg. Er war ins Französische gewechselt, weil auch der Prinz ihn in dieser Sprache angesprochen hatte. „Halten Sie durch! Ich bin gleich zurück.“ Der Oberst hatte seine Augen wieder geschlossen. Von Aremberg bestieg wieder sein Pferd und gab ihm die Sporen. Rund um ihn gab es dichte Scharmützel. Er schoss einen Feind mit seinem Karabiner vom Pferd steckte die Flinte wieder in den Holster und zog seinen Pallasch. Er würde sich zu seiner Linie durchkämpfen und Hilfe holen oder sterben. Letzteres geschah. Als er sich durch eine Phalanx Tataren durchschlug und schon fast glaubte, es geschafft zu haben, holte ihn eine Lanze vom Pferd. Der Tatarenkrieger war bereits ohne Pferd und erwischte den Prinzen von der Seite. Der Prinz von Aremberg war im Gedanken gewesen und hatte seinen Gegner nicht bemerkt. Die Sorge um seinen Freund machte ihn unaufmerksam. Die Lanze bohrte sich durch die Seite in sein Herz, es blieb ihm nicht einmal mehr die Zeit, ein Gebet zu sprechen, denn er war auf die Stelle tot. Das Gefecht aber gewannen die kaiserlichen Truppen und als sich die Tataren zurückzogen, ließen sie zweihundert tote Krieger zurück. Die Kaiserlichen verloren nur sechzig Mann.
Als die Verwundeten geborgen wurden, fand man auch Oberst Prinz Ludwig Julius von Savoyen. Er lebte noch und man brachte ihn zurück nach Wien. Dort aber verstarb er ein paar Tage später an seinen zahlreichen Verletzungen.
Herzog Karl von Lothringen war von seinem Rappen abgestiegen. Seine Ordonanz rieb sein erschöpftes Pferd trocken. „Holen Sie mein Ersatzpferd, Palffy! Aber ein bisschen plötzlich! Wer weiß, wie viel Zeit uns noch bleibt.“ Sein Blick schweifte über das Schlachtfeld, Krähen ließen sich auf den Kadavern nieder und pickten krächzend Fleisch aus den toten Körpern. Das ist die schreckliche Fratze des Krieges, dachte der General und der Tod war allgegenwärtig. Aber für Gott und den Kaiser lässt sich vieles ertragen und heute hatten sie gesiegt. Kein großer Sieg. Nicht für die Geschichtsbücher und schon gar kein entscheidender Sieg, aber ein Sieg. Die Osmanen hatten jetzt seit einiger Zeit die erste Niederlage hinnehmen müssen und so würden sie jetzt erkennen, dass noch ein bedeutender Gegner zwischen ihnen und Wien, bereit zur blutigen Auseinandersetzung, auf sie wartet. Das würde ihren Vormarsch verlangsamen, und er, Karl von Lothringen, wusste, dies konnte zwischen Sieg und Niederlage entscheiden. Er hatte in seiner Depesche an den Kaiser, seiner Majestät empfohlen, sofort Wien in Richtung Passau zu verlassen.
Dieses Szenario hatten sie mehrmals durchgesprochen und der Kaiser wusste, dass er seiner Stadt am besten dienen konnte, wenn er selbst in Sicherheit war. In Passau würde er sich, mit Hilfe des Papstes, um die Verstärkungen kümmern. Wie viele kommen würden, war leider ungewiss, aber wichtig war, dass sie schnell anrücken mussten.
Zurückkehrende Kundschafter haben über eine beachtliche Heeresstärke des Feindes berichtet. Annähernd zweihunderttausend Osmanen drängten Richtung der Reichshauptstadt und er, der Generallisimo, wusste nur zu gut, dass weder er mit seinen Soldaten noch die Stadt Wien lange standhalten konnte. Wien war keine moderne Festung voller Soldaten, Wien war eine Weltstadt, war die kaiserliche Residenzstadt! Voller Kirchen und Theater und modernen Häusern. Sicherlich hatte man nach der letzten Türkenbelagerung Vorkehrungen getroffen, aber ob das reichen würde? Er befürchtete nicht. Zweihunderttausend Osmanen, dachte er wieder, der Teufel hat die Höllenpforte geöffnet. Wie sollte er eine solche Streitmacht besiegen? Dieser enorme Vorteil an Männern ließ sich nicht mit besseren Musketen tilgen, auch nicht mit organisierten Soldaten. Nicht einmal mit besseren Geschützen. Was sollte er tun, fragte er sich. Die Garnison in Wien verstärken. Zwei Drittel seiner Männer sind Kavalleristen, auch wenn einige im Festungskampf und im Kampf zu Fuß ausgebildet sind, so waren die meisten jedenfalls Reiter.
Ausweichen und sich bedeckt halten? Späher ausschicken und auf den richtigen Zeitpunkt warten? Störfeuer und Nadelstiche setzen? Er wusste es nicht. Eine Feldschlacht aber würde er nicht wagen, dazu war die Übermacht zu groß. Wenn es aber so weit war, und er war sich sicher, dass seine Zeit kommen würde, dann würde er der Hammer sein und die Osmanen der Ambos, und seine Schläge würden diese Heiden nie mehr vergessen. Er gestattete sich ein Lächeln. „Wie viele Verluste meine Herren?“ Und das Lächeln war schlagartig verschwunden. „Gibt mir jemand Auskunft?“ Er wandte sich an seine Generäle und Ordonanzen. „Ich habe nicht den ganzen Vormittag Zeit“, er schnaubte. „Sechzig Mann, Herzog Carolus“, von Rabatta senkte seinen Blick. Wir haben sechzig Mann verloren und ein Dutzend Verletzte. Zwei davon werden die nächsten Tage höchstwahrscheinlich nicht überstehen. Er hielt seinen Helm mit beiden Händen und sah betreten zu Boden. „Prinz von Aremberg ist unter den Toten, mein Fürst, und Prinz Ludwig Julius von Savoyen ist schwer verletzt. Der Feldarzt gibt ihm nur mehr wenige Stunden. Ich ließ ihn sofort nach Wien bringen, vielleicht kann man dort wenigstens zur Linderung seiner Schmerzen beitragen.“ Er schwieg verlegen. „Ein schwarzer Tag“, erwiderte der Herzog.“Wahrlich ein schwarzer Tag.“ Er bekreuzigte sich. „Ich kenne beide Familien sehr gut. Eine harte Bürde, welche diesen hochwohlgeborenen Christenmenschen vom Herrn auferlegt wurde.“ Der Herzog von Lothringen bekreuzigte sich rasch. „Wir aber müssen weiter meine Herren! Wir dürfen jetzt nicht verweilen oder gar zaudern. Das Schicksal der Christenheit wird vor Wien entschieden. Also auf jetzt, lassen sie uns reiten!“ Mit diesen Worten bestieg er sein frisches Pferd und drehte sich im Sattel noch einmal zu seinen Männern um. „Es wird nicht ohne Opfer gehen, meine Herren, doch wir werden siegen, denn Gott ist mit uns.“ Dann gab er seinem Pferd die Sporen und ritt Richtung Wien. Der Kampf hatte also begonnen.
11.07.1683 - Hainburg
Ahmed Pascha starrte auf die brennende Stadt. Niemand konnte sich seinen Janitscharen widersetzen. Jene, die es versuchen, finden den Tod. Drei Tage lang hatte er mit seinem Janitscharenkorps und Tatarenreitern Hainburg belagert. Drei verlorene Tage. Vierzigtausend Mann gegen eine Stadtgarnison, der Sieg war vorhersehbar. Langsam bewegte er sein Pferd durch die Vorstadt in Richtung seines Zeltplatzes. Seine Leibwachen folgten ihm in einigem Abstand. Die Strasse war rutschig vom vielen Blut. Ein Schwerttag lag hinter ihm und jetzt am Abend war das Schlachten beendet. Er, Ahmed Pascha, hatte den Ungläubigen Milde versprochen würden sie ihm die Stadt ohne Gegenwehr übergeben. Der christliche Oberbefehlshaber hatte seine Kapitulationsaufforderung zurückgewiesen und sich auf seinen Gott berufen. Sein Herr, Jesus Christus, verbiete ihm mit Ihm, Ahmed Pascha, zu verhandeln. Armer Narr, dachte Ahmed Pascha, nur Allahs Kinder besitzen offensichtlich genug Weisheit um zu wissen, wann man geschlagen ist. Er hätte seine Feinde zwar trotzdem nicht verschont, alleine sie wären schneller gestorben. Sein Blick schwenkte über die unzähligen Kreuze am Straßenrand. Auf jedes hatte man einen Christen genagelt, wie Jesus Christus. Passend, dachte er. Dies würde diese Ungläubigen jedenfalls lehren, seine Angebote nicht abzulehnen. Den Oberbefehlshaber aber hatte er nicht gekreuzigt. Graf von Irgendwo zu Irgendwas. Was nutzen Titel, wenn man seinen Tod vor Augen hat? Wahrlich ein armer Narr. Verzweifelt schrie er um Gnade als der Henker ihm den Pfahl durch das Rektum trieben. Gar nicht wie ein vornehmer Adeliger. Im Tod sind alle Menschen gleich, dachte der Janitscharen-Aga.
Frauen und Kinder aber hatte er verschont. Nicht, weil er ein Heiliger war, sondern aus purer Berechnung. Die Kinder würde er nach Istanbul transportieren lassen. Die Knabenlese war unter den Janitscharen seit Jahrhunderten Brauch. Die Besten von Ihnen würden in Istanbul vierzehn Jahre lang in allen Belangen ausgebildet.
Sprachen, Kunst und der Umgang mit Waffen aller Art. Danach werden sie als Aga, als Hauptleute, in den Janitscharenkorps ihren Dienst aufnehmen. Die anderen, nicht Auserwählten, werden Frondienst in den Grenzgebieten von Anatolien und Rumelien verrichten und dabei die türkische Sprache und Lebensweise erlernen. Anschließend, nach vier bis sieben Jahren, werden sie nach Istanbul zurück gebracht um alle möglichen niederen Dienste zu verrichten. Diese Jungen würden immer „acemi oglanlar - fremde Jungen“ bleiben. Die Mädchen werden versklavt, so einfach ist das.
Er aber, Ahmed Pascha, war einst einer der Auserwählten, er hatte es zum Korpsführer der Janitscharen geschafft und sein Aufstieg würde weiter gehen. Zuerst dieser Feldzug und dann wer weiß? Kara Mustafa Pascha ist verweichlicht, unvorsichtig und ein eitler Pfau. Vielleicht kommt meine Chance. Schon bald marschieren wir auf Wien, und in einem Feldzug weiß man nie was passiert. Allah ist groß, dachte Ahmed Pascha. Aus diesen Gedanken riss ihn eine vertraute Stimme.
Er hatte gar nicht bemerkt, dass er schon bei seinem Zelt angekommen war. Der Anführer seiner Leibwache holte ihn in die Gegenwart zurück. „Herr, wir haben Euch, wie ihr befohlen habt, die Beute in euer Hauptzelt bringen lassen.“ Ehrerbietend senkte er sein Haupt und machte ein paar Schritte zurück. Ahmed Pascha glitt vom Pferd und seine Diener nahmen ihm seinen Krummsäbel ab und reichten ihm eine Bronzeschüssel mit Wasser. Ahmed Pascha wusch sich kurz Hände und Gesicht und trocknete sich ab. Sein langer buschiger Bart reichte ihm bis zur Brust und war jetzt nass geworden Mit einem Baumwolltuch rubbelte er ihn jetzt trocken. Kurz erhaschte er ein Bild von sich in einem eisernen Rundschild. Seine mächtigen Arme und seine kräftige Brust kamen durch eine Verzerrung noch mehr zum Vorschein. Seine Gestalt erinnerte an einen Bären und dessen Kraft strahlte er auch aus. In seinem Blick aber lauerte der Tod.
Ahmed Pascha betrat sein geräumiges Zelt. Einer seiner Diener verneigte sich und begrüßte dann überschwänglich seinen Herren. Ein paar kleine Truhen mit Juwelen und Münzen standen in seinem Zelt.
Nun, auch das würde sich in Wien ändern. Wien war eine Hauptstadt des Deutschen Reiches und nicht ein Drecksloch wie diese jämmerliche Stadt. Wie auch immer, dachte er, der Weg zum goldenen Apfel war jetzt jedenfalls frei. Allah sei Dank. Prüfend glitt sein Blick über die Juwelen. Das meiste waren Kirchenschätze, Kreuze mit Juwelenbesatz, Ordensschmuck, und so weiter. Auch ein paar Golddukaten waren darunter. Wie überall, bereicherte sich die Kirche, und wie überall, wo er bis jetzt der Christenheit begegnete, waren deren unmittelbaren Diener, die, die sich am meisten bereicherten. Priester! Er spuckte auf den Boden. Alle Ungeziefer, die sofort ausgerottet werden müssen. Ihm stand der Sinn jetzt aber nicht nach solchen Schätzen und so ging er weiter in Richtung seines Schlafbereichs. Leises Schluchzen wies ihm den Weg. Vor seinem Schlafgemach standen aufgereiht drei Mädchen. Alle waren noch jung, noch keine älter als sechzehn Jahre, und alle drei hatten blonde, lange Haare. Ihre Kleidung hing in Fetzen und Russ klebte an ihnen. Doch konnte man dennoch erahnen, wie hübsch sie waren. Zwei der Mädchen weinten leise, die Dritte aber starrte geistesabwesend vor sich hin. „Wurden sie von jemanden angerührt?“ fragte er seinen Hauptmann. Der Hauptmann verneigte sich vor ihm und verneinte entschieden. „Ich hätte jeden auspeitschen lassen, mein Herr, hätte es jemand gewagt.“ Zufrieden betrachtete Ahmed Pascha die Frauen. Blond, jung, schlank und vollbusig, so wollte er sie am liebsten. „Wo ist mein Eunuch?“, wollte er von seinem Diener wissen. „Er setzt gerade heißes Wasser auf, Erhabener“, antwortete dieser. „Lass ihn holen! Er soll die Weiber baden und sie mir dann in mein Gemach bringen, alle drei zusammen. Nun fort mit dir, beeil dich, bevor ich dir Beine mache!“ Der Diener rannte schnellstmöglich aus dem Zelt.
Voller Vorfreude betrat Ahmed Pascha sein Schlafgemach. Dicke Teppiche waren ausgelegt und weiche Kissen schmückten seine Schlafstelle. Als er sich ausgezogen hatte, ergriff er seine Reitgerte, welche in einer Ecke bereit stand. Der Ledergriff lag gut in seiner Hand. Er konnte wahrlich zusehen, wie sehr sich seine Erregung steigerte. Dieser Tag würde doch noch ein schönes Ende nehmen, so viel wusste er, Allahu Akbar, Allah ist groß.