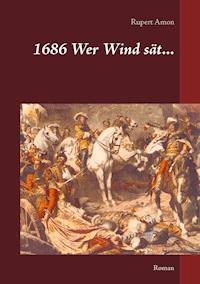
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
1686, drei Jahre ist es her, dass Philipp von Lamberg-Sprinzenstein Wien gegen die Osmanen verteidigte. Nun, ruft der Habsburger Kaiser erneut zur Schlacht. Im Herzen Ungarns zieht der römisch deutsche Kaiser ein Heer zusammen um die alte Hauptstadt von Ungarn aus den Klauen der Türken zu befreien. Ofen, das heutige Budapest ist das Ziel. Philipp von Lamberg führt die Lamberg Dragoner in die Schlacht. Doch der weise Osmanen Pascha Abdurrahman verteidigt gekonnt die Stadt. Werden die kaiserlichen Soldaten scheitern, unter großen Verlusten, wie sie es schon 1684 taten? Während Philipp versucht mit seinen Kameraden Ofen den Osmanen zu entreißen, begibt sich seine wunderschöne Frau Marie nach Steyr. Die Heilkunst hat es der jungen Frau angetan. In der Stadt des Eisens trifft sie auf Albruna, eine Heilerin. Die beiden jungen Frauen freunden sich an. Doch ist Albruna was sie zu sein scheint? Oder hat sie ein düsteres Geheimnis? Heilerin oder Hexe? Der Tod lauert in Steyr und in Ofen auf Marie und Philipp. Werden die beiden sich wiedersehen oder enden ihre Leben in Asche und Rauch?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 665
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mit wackerem Herzen gingst Du voran.
Wo immer Du auch bist, wir werden Dir dereinst folgen!
Ruhe in Frieden!
DIE WICHTIGSTEN PERSONEN
Die Belagerer von Ofen:
PHILIPP VON LAMBERG-SPRINZENSTEIN, Anführer der Lamberg-Dragoner
ALESSANDRO STRADELLA, Major der Lamberg-Dragoner und Philipps bester Freund
JOHANN GEORG VON HERBERSTEIN, Major der Lamberg-Dragoner
WOJCIECH HOLINKA, Leutnant der Lamberg-Dragoner
GREGOR TREGLER, Major der Lamberg-Dragoner
PRINZ EUGEN VON SAVOYEN, Anführer der Savoyer-Dragoner
KARL FRANZ VON LOTHRINGEN, Graf von Rosnay, Fürst von
Commercy,
Regimentsführer der
kaiserlichen Dragoner
LUIGI FERDINANDO MARSIGLI, Oberst im kaiserlichen Heer und Schöngeist
FRANCESCO LANFREDUCCI, Malteserritter und Vetter von Alessandro Stradella
GEORG BENEDICT VON OGILVY, Oberstleutnant der Infanterie
BEATRIX HIERONYMA DE LORRAINE, Schwester von Karl Franz von Lothringen
MARIA ELISABETH DE COMMERCY, Schwester von Karl Franz von Lothringen
Uvm.
Steyr:
MARIE LUISE VON LAMBERG-SPRINZENSTEIN, Frau von Philipp von Lamberg
FRANZ VON THÜRHEIM, Vater von Marie und Medicus
ALBRUNA, reisende Heilerin
KARL, Beschützer und Geliebter von Albruna
ABT RUPRECHT VON AMFELDT, Abt von Gleink
HAUPTMANN KRAMER, Hauptmann der Stadtwache von Steyr
THEODOR TRAKL, Apotheker und Geliebter von Albruna
Die Osmanen
ABDURRAHMAN PASCHA, Stadthalter von Ofen
KILIC ARSLAN, Hauptmann der Osmanen
MARA, Hauptfrau des Paschas
SINAN SAMIL KAHRAMAN, Oberbefehlshaber der Stadtwache
SULEIMAN PASCHA, Großwesir der Osmanen
Uvm.
Das große Wappen deren von Lamberg
1686 Wer Wind sät …
Ein sanfter, warmer Wind aus Westen wehte ihm durchs lockige Haar während er die Klinge seines Rapiers prüfte. Sie war scharf, wie gewöhnlich, und wie es sich für das Werkzeug eines Soldaten geziemte. Zufrieden steckte er das Rapier zurück in die Scheide und zog nun auch seinen Dolch. Wieder prüfte er rasch die Klinge und stellte fest, dass auch diese scharf war, bereit für das heutige Tagwerk. Die großen, alten, immergrünen Zypressen am Rande der kleinen Ortschaft neigten ihre Wipfel sanft im Wind und die klaren blauen Augen des in braunem Leder gekleideten Kriegers beobachteten jede Bewegung der ehrwürdigen Bäume. Dann prüften diese durchdringenden Augen den Stand der Sonne. Diese brannte unbarmherzig vom Himmel und die Menschen in diesem adretten Dorf suchten Schutz vor der Hitze im Schatten der zahlreichen Türme. Aber nicht alle. Einige hatten sich mitten am Dorfplatz von San Gimignano versammelt und nahmen auch diese brütende Hitze in Kauf, nur um diesem Schauspiel beizuwohnen. Der dunkelhaarige Soldat mit der schwarzen, langen Mähne richtete nun seine stahlblauen Augen auf seinen Kontrahenten.
„Alora“, sagte er laut, „Du Schurke hast also die Tochter des
Weinhändlers geschändet!“
Es war keine Frage sondern eine Feststellung.
„Und danach hast Du dieses arme, unschuldige, wunderschöne Wesen im Weiher ertränkt. Gut, wer ist schon wirklich unschuldig? Aber, wunderschön, wie ein Engel, so war
Mariella, bei Gott.“
Der derart angesprochene Mann war riesengroß, mit einem harten Gesicht und Händen, so groß, wie die Deckel eines 50 Liter Weinfasses. Muskelbepackt, mit dem Genick eines Stieres ausgestattet, starrte der Grobian seinem Kontrahenten direkt ins Gesicht. Seine Lippen zusammengepresst zu einem schmalen Strich. Sein fleckiger Lederwamst war abgetragen, doch auch seine Waffen schienen gut in Schuss zu sein. Sein von Narben entstelltes Gesicht verzog sich zu einer Grimasse als der Mann sprach:
„Sie war eine Hexe“, knurrte er. „Eine verdammte Hexe! Das dreckige Luder wollte lüsterne Spiele mit mir treiben. Der
Teufel wohnte in ihr.“ Ein Raunen ging durch die Menschenmenge, welche einen Kreis gebildet hatte. Einige Zuseher bekreuzigten sich rasch.
Der Hüne drehte sich im Kreis und grinste die Dorfbewohner hämisch an.
„Sie fluchte gotteslästerlich während ich sie nahm, sie war
besessen.“
„Schande über Dich, Du Lügner!“ schrie eine ältere Frau. „Du hast uns unsere Tochter genommen.“
Sie schluchzte auf und warf sich auf die Knie während sie an ihren Kleidern zerrte. Sofort traten andere Frauen hinzu und nahmen die Unglückliche in die Arme.
„Die Hexe ging von selbst ins Wasser“, krächzte der Gigant.
„War auch besser so für dieses vermaledeite Weib.“ Grinsend spuckte der Hüne nun zu Boden.
„Deine Fingerabdrücke sind auf Mariellas wunderschönem Hals. Niemand sonst hier hat so große Hände.“
Diese Worte kamen von dem großen Mann mit den schwarzen Haaren, der sich hinhockte, ein wenig Staub vom Boden aufnahm, und diesen zu Boden rieseln ließ. Er drehte dem narbengesichtigen Hünen dabei den Rücken zu.
„Du leugnest also abermals vor Gott deine Tat?“, fragte er ganz ruhig und drehte sich dabei nicht um.
Am Dorfplatz war es jetzt ganz ruhig, nur das vereinzelte Meckern der Ziegen war in der Ferne zu vernehmen.
„Ich habe nichts getan, was Gott nicht wollte.“, antwortete der Hüne rau und sein schütteres Haar schwang nach hinten, als er herausfordernd Rapier und Dolch zog.
„Ein Gottesurteil also“, sagte der Mann mit den schwarzen, langen Haaren laut in die Menge und zupfte an seinem adretten Spitzbart. „So sei es.“, sprach er nun laut und drehte sich zu seinem Gegner um. Dabei zog der offensichtliche Krieger flink Degen und Dolch.
„Bist Du eigentlich gläubig?“, fragte er dann, während er mit festem Schritt auf seinen Gegner zuging und sein Schwert singend durch die Luft sausen ließ. „Denn ich zähle bis sieben und falls du noch etwas zu beichten hast, mach es jetzt, denn wenn ich fertig gezählt habe, bist Du tot. Vor all den Menschen hier, mach es. Dort drüben ist sogar ein Priester anwesend.“
Der gut aussehende Mann zeigte mit dem Dolch auf den Pater von San Gimignano.
„Dieser hört Dir zu. Nicht wahr, Pater? Doch rede schnell.
Denn die Acht wirst du nicht mehr hören.“
Der Hüne mit dem Narbengesicht warf sich zornig, mit wildem Gebrüll auf seinen Gegner. Er schwang den Degen recht geschickt, doch sein flinker Gegner wich ihm behände zur Seite aus.
„Eins!“ Der Soldat mit den langen, schwarzen Haaren lächelte.
„Fang an zu beichten, Stronzo, sonst ist es zu spät. Hast Du Mariella getötet? Gott verzeiht vielleicht. Alora, ich aber nicht.
Zwei!“
Der Hüne hatte nun zu tun, die geschickten Hiebe des Soldaten abzublocken. Doch noch schaffte er es. Schweiß trat auf seine Stirn und seine Atmung beschleunigte sich. Der Soldat mit der schwarzen Mähne wich einer harten Attacke des vermeintlichen Mörders nach hinten aus, so schnell, dass dieser nach vorne taumelte von der Kraft seines eigenen Angriffs aus dem Gleichgewicht gebracht. Die Menge hielt den Atem an.
„Sie war eine Hexe.“, keuchte der Mann mit dem Narbengesicht.
„Drei!“, sagte der Soldat. „Und vier und fünf. Mir ist zu heiß für dieses Geplänkel. Und Dein Gestank verpestet meine Atemluft.“
Blitzschnelle Hiebe sausten auf den Hünen nieder und ritzten ihm den linken Arm und die rechte Wange auf. Geschockt versuchte der Hüne sich auf seinen Widersacher zu werfen, taumelte aber wieder ins Leere. Der gut gekleidete Recke stellte seinem Gegner ein Bein und dieser stürzte zu Boden.
Der Handschutz des Rapiers knallte wuchtig auf die Nase des Narbengesichts und diese brach mit einem lauten Knacken.
Blut schoss aus der verbogenen Nase und tropfte zu Boden.
„Sechs! Gestehe vor Gott, und Du wirst möglicherweise ins Paradies eingehen. Doch mach es gleich, denn sterben wirst Du bald. Musste Mariella leiden, das arme Kind? Sag es, oder warst Du wenigstens im Tod barmherzig? Ging es schnell, als Du sie würgtest?“
Der Hüne wischte sich das Blut von der Nase als er sich nun zu seiner vollen Größe aufrichtete. Dann spuckte er zu Boden.
„Dafür stirbst Du, Bastardo!“, schrie er und setzte abermals zum Angriff an. Seine Klinge fuhr wieder nur ins Leere, so schnell war sein Gegner. Der narbengesichtige Mann torkelte nach vorne weg. Dann drehte er sich schwerfällig um. Blut färbte seinen Wamst rot. Sein Gegner hatte ihm den Bauch aufgeschnitten bei seiner missglückten Attacke. Jetzt drehte der ganz in schwarzes Leder gekleidete Recke ihm den Rücken zu und wischte seine Klinge an einem groben Tuch sauber. Auch das Tuch war jetzt blutig. Die Menge jubelte.
Der gutaussehende Recke verbeugte sich galant.
„Mein Blut“, dachte der Hüne, „wie konnte das passieren?“
Dann warf der flinke Soldat das Tuch fort, drehte sich aber noch immer nicht um.
„Sieben!“, sagte der Soldat. „Zeit für Dich zu gehen. Die Hölle wartet. Rede jetzt, oder schweige für immer.“
„Sie war eine Hure und Hexe und sie hatte den Tod verdient!“ Der narbengesichtige Hüne schrie diesen Satz, als er den Soldaten attackierte. Die Klinge des Säbels war auf das Herz seines Kontrahenten gerichtet und sauste singend heran. Noch immer drehte sich der offensichtliche Soldat nicht um. Die Menge seufzte auf. Sie sahen förmlich das Unheil kommen.
Doch die Klinge des schweren Säbels traf abermals nicht. Sie streifte nicht einmal das schwarze Lederwamst des flinken Mannes. Sie fuhr einfach nur ins Leere. Der Hüne mit dem Narbengesicht aber blieb wie angewurzelt stehen und seine Augen sahen in die Ferne. Zu den Weinbergen auf den Hügeln, und zu dem kleinen Weiher am Fuße des Dorfes.
Auch sah er die zahlreichen Türme, welche sich über der Stadt erhoben. Doch ob er diese Schönheit noch aufnehmen konnte, sei zu bezweifeln. Der Blick des Hünen brach. Das letzte was er im Diesseits wahrnahm war, dass der Mann mit den schwarzen langen Haaren hinter ihm auftauchte. Irgendetwas zupfte an seinem Genick. Und dann nur noch Schwärze. Der gutaussehende Recke reinigte abermals mit dem groben Tuch seinen Dolch, welchen er soeben aus dem Genick des Hünen gezogen hatte.
„Acht“, flüsterte er, während die Menge jubelte. Mit der Stiefelspitze trat er noch einmal gegen den Kopf des am Boden liegenden Gegners, doch dieser rührte sich nicht mehr.
Das Blut schwoll stetig, mitten auf dem Hauptplatz, zu einem kleinen See an. Das Gottesurteil war vollstreckt. Die Bürger von San Gimignano umringten ihn nun und schlugen ihm dankbar und bewundernd auf die Schultern.
Was für eine Schande, dachte der gutaussehende Krieger.
Mariella, getötet von diesem Schwachkopf. Warum gerade diese wunderschöne Frau? Erinnerungen an seine Jugend und an die intimen Stunden mit diesem wunderschönen Mädchen kamen hoch. Warum konnte er nicht früher hier sein? Weil er auf Nachricht hoffte in Florenz und ihm gesagt wurde, dass diese Depesche hierher in die Toskana zu seiner Tante geschickt wurde. Und als er ankam, war Mariella bereits tot.
Geschändet und getötet von einem Ungeheuer. Doch die Depesche war immer noch nicht eingetroffen. Hufgeklapper erhob sich über das aufgebrachte Gezeter der Menschenmenge. Ein Reiter kam in Sicht und trabte gemächlich auf die Bürger zu. Der Kreis um die ausblutende Leiche öffnete sich und der Reiter hielt sein Pferd vor dem am Boden liegenden Körper an.
„Ist das Capitano Stradella?“, fragte der schnauzbärtige Mann, irgendetwas kauend, und zeigte lässig auf den blutigen Leichnam.
„Nein, ich bin Capitano Stradella. Capitano Alessandro Stradella“, sagte der schwarzhaarige Mann und beendete die Reinigung seines Dolches. Seine blauen Augen taxierten den Reiter.
„Eine Depesche für Sie, Capitano, aus Linz, von einem Oberst von Lamberg“, sprach er weiter und reichte dem Soldaten den Umschlag.
Dieser lächelte, als er die Depesche entgegennahm und den Dolch zurück in die Scheide steckte. Endlich wieder Abenteuer, dachte der gutaussehende Soldat und verließ vergnügt den Platz. Noch während er ging, öffnete Alessandro Stradella das Schreiben und fing an zu lesen. Die Brüder würden wieder zusammen reiten. Das war nun Gewissheit.
Doch vorher führte ihn sein Weg noch nach Pisa. Seine Nonna hatte ihn darum gebeten. Und seiner Großmutter konnte er nichts abschlagen.
Der hagere Mann bewegte sich leise, fast lautlos. Sein Gesicht war nahezu zur Gänze mit einer Kappe bedeckt, von der Art wie die Waidmänner sie zu tragen pflegten. Sein Gewand war aus feinstem Leder gearbeitet, weich und doch widerstandsfähig. Er trug die kostbare, mit zahlreichen Ornamenten verzierte Flinte in der rechten Hand und es machte den Anschein als wiege diese nicht mehr als eine Daunenfeder. Der Mann war das Gewicht der schweren Waffe gewohnt, typisch für einen Soldaten, und doch war die Haltung des Mannes anders. Erhaben, fast majestätisch, hatte er den Kopf gehoben und spähte durchs Dickicht. Vor ihm erhellte die Frühlingssonne den Wald auf einer Lichtung und die Sonnenstrahlen tanzten auf einem kristallklaren, gewundenen, schmalen Bach. Singvögel zwitscherten fröhlich in den Baumkronen und wurden nur von Zeit zu Zeit unterbrochen vom langgezogenen und hart gerollten „krrrääh“ des Tannenhähers, welcher hier im Umkreis, wahrscheinlich in der Nähe der Haselnusssträucher, sein Nest haben musste. Es war als wäre die Welt mit sich im Reinen, nicht aus den Angeln gerissen und in Asche und Staub erstickt, in Blut und Tränen ertränkt, so wie es tatsächlich in den letzten Jahren der Fall war. Trotz der Wärme des Tages fröstelte es den Mann. Er schloss die Augen und musste sich an einem Baum festhalten.
Lichtblitze zuckten durch seine Erinnerung. Granaten explodierten, Menschen schrien auf vor Schmerz, als ihnen die Gliedmaßen vom Körper gerissen wurden. Seine Gedanken, seine schrecklichen Erinnerungen kehrten für einen Moment zurück und keuchend fiel der Mann auf seine Knie. Er atmete jetzt schwer und rang nach Luft. Instinktiv legte er sich auf den Rücken. Der Mann öffnete jetzt die Augen und blickte durch die vielen Blätter zum Himmel. Sonnenstrahlen wärmten sein Gesicht und langsam beruhigte er sich wieder.
Er kannte diese Anfälle und konnte mittlerweile ganz gut damit umgehen. Seine Atmung wurde flacher und er entspannte sich sichtlich. Seine Brust hob und senkte sich nun regelmäßig und Ruhe war wieder eingekehrt im Dietacher Holz, wie dieser Wald bei den Einheimischen genannt wurde.
Der Wanderer richtete sich auf und ging langsam zum Bach.
Seine Kehle war trocken, seine hässliche Narbe am Kopf schmerzte. Er kniete sich nieder am Rande des Baches und trank das reine, klare Wasser. Die Lebensgeister kamen zurück und just in dem Moment als er sich wieder aufrichten wollte, fand er, was er suchte. Er drückte sanft einen Farn zur Seite und da war sie, die Spur, die sein Herz höher schlagen ließ. Im dunklen, feuchten Waldboden am Rande des Baches war die Fährte nicht zu übersehen. Er hatte sie also wiedergefunden und ein Lächeln huschte über sein Gesicht. Rasch prüfte er, ob sein Dolch noch am Gurt an seinem Rücken hing, ob sein Pulver noch trocken war. Dann erhob der Mann sich flink um der Fährte zu folgen. Die Spur war nun deutlich zu erkennen und er konnte ihr ohne Schwierigkeiten folgen. Den Bach entlang durch Haselnusssträucher und wilde Farne. Immer lauter wurde nun das Geräusch von aufprallendem Wasser.
Hier musste also irgendwo ein Wasserfall sein, dachte der Mann. Er bewegte sich schnell aber lautlos durch das jetzt hohe Gras und die saftig grünen Farne. Kurz darauf blieb er geduckt stehen, denn er befand sich am Rande eines prächtigen Weihers. Vor seinen Augen schoss ein Wasserfall über fast senkrechte Kalkformationen in den verzauberten Weiher. Das Wasser war dort glasklar und der Wanderer konnte die Regenbogenforellen von weitem sehen. In den aufspritzenden Wassertropfen spiegelte sich die Frühlingssonne in allen Farben und ein kleiner Regenbogen erhob sich über der Gischt. Kein von Menschen verursachter Laut durchbrach den Klang der Natur. Die Blicke des Mannes streiften über die schöne, saftige Wiese am Weiher und fand nun endlich das Ziel seiner Jagd. Ein seltenes, weißes Reh wanderte gemütlich zum Wasserfall ohne sich um zu sehen.
Das Tier hatte seine Witterung noch nicht aufgenommen und war sich daher der Gefahr nicht bewusst. Dem Wanderer stockte der Atem, so ein schönes Tier hatte er bis jetzt in seinem Leben noch nicht erblickt. Das Reh schlenderte langsam zum Wasserfall und verschwand schnurstracks hinter dem Vorhang aus Wasser. Der Mann stutzte. Er traute seinen Augen nicht. Dann sprang er auf und beeilte sich dem Tier zu folgen. Behände schwang er sich über nasse Felsen und schnellen Schrittes begab er sich auf die Wiese am Fuße des Wasserfalls. Doch noch bevor er den Weiher erreicht hatte, blieb er wie angewurzelt stehen. Aus der Wasserwand vor ihm erschien eine Hand und kurz darauf eine zierliche Frauengestalt. Mit nichts am Körper, nackt wie Gott, oder wer auch immer, sie schuf, durchschritt das blonde Mädchen den feuchten Vorhang und stieg anmutig in den verzauberten Weiher. Ihr Kopf drehte sich langsam in seine Richtung und ihre stahlblauen Augen fixierten den Wanderer.
Wo hatte er diese Frau schon einmal gesehen, fragte sich der Mann. Woher kannte er diese anmutige Schönheit? Das Mädchen kannte keine Scheu und langsam durchwatete das schöne Geschöpf das kniehohe Wasser, den Blick immer noch auf den Eindringling gerichtet. Ihre vollen Brüste hoben und senkten sich und ihre Brustwarzen richteten sich langsam auf.
Wasser tropfte von ihren blonden Haaren, sammelte sich am Hals und lief dann über die Brüste zu ihrem flachen Bauch.
Jetzt lachte das Mädchen vergnügt, während sie sich die Haare aus dem Gesicht strich. Immer näher kam sie dem Mann und immer noch lachte sie. Eine Gestaltenwandlerin, dachte der Mann entsetzt und seine Hand fuhr an seinen Rücken, zu seinem Dolch. Mitten in der Bewegung hielt er inne.
Verlangen durchströmte seinen Körper. Das junge Mädchen war zu schön und immer noch lachte sie. Die blonde Schönheit formte ihre feingliedrigen Hände zu einem Gefäß, schöpfte Wasser und trank langsam. Noch immer fixierte sie den Ankömmling lächelnd. Sie benetzte ihre nackten Schultern und ihre Scham. Immer noch lächelte das Mädchen ihren Besucher an. Im Unterholz rund um den Weiher erhoben sich nun Geräusche. Äste knackten, Blätter raschelten und helles Kichern durchdrang den Wald. Satyrn und Nymphen erschienen aus dem Unterholz und verbeugten sich tief vor dem Wesen im Wasser. Auch diese waren nackt und noch ehe
der Mann sich‘s versah, wälzten sich die unheimlichen Wesen auf der Wiese vor dem Weiher in eindeutiger sinnlicher Umklammerung.
Der Mann war vor Schreck wie gelähmt. Seine Blicke wanderten über die nackten Körper auf der Lichtung welche sich in allen möglichen oder unmöglichen Stellungen vereinten. Die Satyre stöhnten, die Nymphen keuchten und ließen ihrer Lust freien Lauf. Was für ein Frevel, dachte der Wanderer und doch konnte er seinen Blick nicht von dem Treiben nehmen. Vorsicht, dachte er, wo war das Mädchen?
Ruckartig drehte er seinen Körper zum Weiher, doch das blonde Mädchen stand ruhig, auf Armlänge von ihm entfernt, vor ihm. Der Schreck fuhr ihm in die Glieder. Das wunderschöne Geschöpf hatte seinen Dolch in der Hand und sah den Mann über die Klinge hinweg ernst an. Er erstarrte und konnte sich nicht rühren. Das Mädchen warf den Dolch zu Boden, so, dass sich die Klinge in die Erde bohrte, dann öffnete sie mit ihren zarten Händen seinen Gürtel. Hohe, spitze Schreie der Lust erfüllten die Lichtung. Lustvolles Stöhnen mischte sich mit dem Rauschen des Wasserfalls doch der Mann nahm nur die eine wahr. Langsam glitt seine Hose zu Boden, seine Flinte nahm sie ihm sanft aus der Hand. Sie umrundete seinen Körper und ihre warmen, weichen Hände öffneten seinen Lederwamst während sie hinter ihm stehen blieb. Sein Hut fiel zu Boden und nun stand sie wieder vor ihm. Sie beobachtete ihn wie ein Raubtier. Dabei befeuchtete ihre Zunge ihre vollen, roten Lippen. Sanft drückte sie den Wanderer zu Boden. Er ließ es geschehen. Sie entfernte seine Stiefel und seine Strümpfe, zum Schluss sein Hemd. Jetzt lag er nackt im Gras. Noch immer konnte er sich nicht rühren. Vor ihm stehend, beäugte sie ihn aufmerksam. Auch er versuchte, alles in sich auf zu nehmen. Ihre vollen, roten Lippen, ihre schwarzen, langen Wimpern, ihre kleine, leicht spitze Nase.
Die schwarzen Wimpern passten nicht zu ihren langen, blonden Locken, doch dieses Mädchen war ein Kunstwerk, wunderschön, nicht von dieser Welt. Doch von welcher Welt dann, durchfuhr es die Gedanken des Wanderers. Die junge Frau hatte noch immer kein Wort gesprochen. Jetzt kniete sie sich vor ihm nieder. Ihre prallen, wohlgeformten Brüste berührten seine Knie, dann sein aufgerichtetes Gemächt, als das wunderschöne Wesen kniend seinen Körper erkundete.
Sanft, fast vorsichtig, strich sie mit ihren Fingern über die Narbe über seinem linken Ohr. Zärtlich streichelte sie jetzt seine Wange und blickte ihm tief in die Augen. Blau, so blau, dachte er nur. Ist sie eine Göttin? Nein, durchzuckte ein Gedanke sein Gehirn. Blasphemie! Es gibt keinen Gott außer dem einen. Das hier kann nicht sein. Diana, dachte er erneut und sein kurzes Aufbäumen war wie weggewischt. Die Göttin der Jagd? Er schloss die Augen. Vielleicht war sie dann weg, doch wollte er das? Weiche Hände berührten seinen Körper.
Erst seine Wange, dann seinen Hals, seine Brust, seinen Bauch. Oh, nein, dachte er bei der nächsten Berührung. Eine Hand umschloss sein Gemächt und streichelte ihn sanft. Er ließ sie gewähren, weiterhin mit geschlossenen Augen. Sein Glied pulsierte und es verlangte den Mann nach mehr. Ihre Bewegungen mit der Hand wurden nun heftiger und die pure Lust breitete sich in seinen Lenden aus. Er musste die Augen öffnen und was er sah war dem Himmel sehr nah. Das blonde Mädchen lächelte und schob sich sanft auf ihn. Geschickt führte sie sein Glied ein und saß nun rittlings auf ihm. Ihre Brüste baumelten über seinem Mund und ihre Brustwarzen streiften rhythmisch seine Lippen. Erst ganz langsam, doch dann immer schneller kreiste sie ihr Becken. Spitze Schreie der Lust drangen aus ihrer Kehle. Das waren die ersten Laute welche er von diesem wunderschönen Wesen vernahm. Immer heftiger wurden ihre Bewegungen, seine Hände umfassten ihre vollen Brüste und liebkosten diese. Sie beugte sich nach hinten und presste ihr Becken an seinen Körper. Er war so tief in ihr, Wonne durchflutete ihn und mit einem Schrei der Lust explodierte er in ihr. Grelle Blitze erschienen vor seinen geschlossenen Augenlidern, sein Körper verkrampfte sich und ein ihm bis dato unbekanntes Glücksgefühl durchströmte seinen Körper.
Er hatte die Augen geschlossen, doch jetzt hatte sich alles verändert. Ihm war kalt, es fröstelte ihn. Flüssigkeit rann aus seiner Nase. Er riss die Augen auf und Entsetzen machte sich in ihm breit. Er lag in seinem Bett in der Abtei von Gleink.
Blut rann aus seiner Nase, sein Nachtgewand war zerfetzt, sein Laken feucht von seinem Samen. Das Fenster zu seinem Gemach war offen. Die Kreaturen der Nacht heulten seinen Namen. Wolf und Eule waren vor seinem Fenster und schienen ihn auszulachen. Hexerei, dachte der junge Abt erschrocken und blickte an sich herab. Abt Ruprecht von Amfeldt betete zu seinem Gott. Bei allen Heiligen, beim heiligen Berthold und beim Apostel Andreas, steht mir bei.
Hexen und Dämonen treiben ihr Unwesen und sogar hier in den geweihten Hallen war man vor ihnen nicht sicher. Sein Herz klopfte wie wild, sein Kopf schmerzte und seine rosafarbene Narbe über dem linken Ohr pulsierte. Hexen und Dämonen hatten ihn heimgesucht und seinen Samen geraubt, das konnte Abt Ruprecht an seinem Laken sehen. Sie hatten seine Sinne benebelt und ihm Streiche gespielt, nur so konnten sie an seinen Mannessaft herankommen. Er bekreuzigte sich zügig dreimal und stieg aus seinem Bett. Das werdet ihr mir büßen, dachte er, während er sein Nachthemd ablegte. Er warf das besudelte Kleidungsstück in eine Ecke und stellte sich nackt vor das offene Fenster. Der Vollmond beleuchtete den Stiftshof als Abt Ruprecht von Amfeldt die Fäuste zum Himmel hob. Die Muskeln an seinem von Narben gezeichneten Körper spannten sich als er im Stillen für sich einen Schwur ablegte. Ob Inkubi oder Sukkubi oder sonst irgendein Dämon, ich werde Euch und eure Malefizer finden und dann Gnade Euch Gott. Denn niemand wird Euch vor meiner Rache retten.
Kommandos wurden gebrüllt und hallten von den Häusern wieder. Säbel traf auf Säbel, Rapier auf Pallasch. Das Trommeln der Hufe und das Krachen der Musketen ergänzten den höllischen Lärm der Schlacht. Nur war dies keine Schlacht. Die Männer des Regiments Lamberg unterzogen sich meinem Drill. Ich stand unter dem Vordach meines Zeltes und beobachtete die Ausbildung meiner Männer ganz genau.
Was sie jetzt lernten, würde ihnen ihr Leben retten, so viel wusste ich. Kaiser Leopold höchst selbst hatte mir, dem Freiherrn Philipp von Lamberg–Sprinzenstein, die Erlaubnis erteilt dieses Regiment Dragoner aufzustellen. Für einen Teil der Kosten der Ausbildung kam der Kaiser auf, für den Rest bezahlte ich. Dafür war es mein Privileg, ein Regiment zu führen, welches den Namen meines Hauses führte. Die Lamberg-Dragoner, dachte ich, was für eine Ehre. Doch die Lamberg-Dragoner waren noch nicht einsatzbereit, hatten sich am Feld der Ehre noch nicht bewiesen, den Reigen mit Gevatter Tod noch nie getanzt. Das Regiment, meine ich, nicht die einzelnen Männer. Über ein Jahr ist es nun her, dass ich die Erlaubnis erteilt bekam. Im November 1684 gleich nach der unrühmlichen Beendigung der Belagerung der Festung Ofen. Ich war nicht zugegen, doch viele meiner Kameraden waren dabei, und was sie erlebten, wusste mittlerweile jedes Kind. Alles fing gut an. Die kaiserlichen Truppen waren nach der Verteidigung Wiens und der Vernichtung des türkischen Heeres 1683 voller Tatendrang. Schon im Jahr darauf beschloss der Generalstab mit dem Segen des Kaisers den nächsten türkischen Dorn im Fleische der Habsburger zu entfernen, und dieser Dorn war Ofen, die Hauptstadt des ehemaligen ungarischen Königs. Malerisch gelegen, zwischen grünen Hügeln an der blauen Donau. Die Stadt direkt am Fluss. Die Burg auf einem Hügel daneben, gut beschützt von dicken Mauern und zahlreichen Rondells und Türmen. Seit nunmehr über 150 Jahren war diese wunderschöne Stadt in der Hand der Türken. Doch nun war die Zeit gekommen, dachte man, die Türken hatten ihre Stärke verloren, ihre lange Jahre währende Dominanz am Schlachtfeld vor Wien eingebüßt.
Nachdem das Heer unter der bewährten Führung von Herzog Karl von Lothringen am 13. Juni die Donau überquerte, rückte man zügig vorerst auf die türkische Festung Gran vor. Am 16.
Juni wurde dieses von Türken stark verteidigte Bollwerk überraschend schnell im Sturm genommen. Die starken Festungsmauern halfen nichts, denn die kaiserlichen Truppen zerschossen mit ihren Geschützen das Haupttor und drangen dann heldenmutig in die Festung ein. Nur wenigen Osmanen gelang es, sich in das Schloss auf den Felsen oberhalb der Stadt zurück zu ziehen, doch auch diese kapitulierten nach nur eineinhalb Tagen. Gott war auf unserer Seite, dachte man sogleich, nichts würde also unser Heer aufhalten können. Und so war es auch. Das Schlachtenglück blieb den Kaiserlichen weiter hold. Maximilian Lorenz von Starhemberg traf am 27.
Juni auf ein kleines, türkisches Heer von knapp 17.000 Mann, und obwohl die Türken gut verschanzt waren, fegten die Truppen des Kaisers wie ein Orkan über diesen Gegner und besiegten die Osmanen ohne große Verluste. Doch von nun an sollte sich das Schlachtenglück wenden. Nemesis selbst strafte unsere Selbstüberschätzung und das Unglück des kaiserlichen Heeres begann. Im Juni noch erreichten unsere tapferen Krieger zwar Ofen, rückten noch in den vorgelagerten Ort Pest ein und schlugen ihr Quartier auf. Auch der heldenhafte Ernst Rüdiger von Starhemberg, mein General und Kampfgefährte bei der Verteidigung Wiens, war auf Wunsch des Kaisers herbei geeilt und übernahm das Kommando. Doch es half alles nichts. Die Angriffe unserer Soldaten wurden blutig zurückgeschlagen. Die Artillerie des Feindes forderte hohen Blutzoll unter unseren Mannen, die Osmanen kämpften tapfer und ohne Gnade. Das Sterben hatte begonnen. Monatelange Kämpfe voller Grauen und Entsetzen mündeten im September 1684 in einer Katastrophe. Das Entsatzheer der Türken traf vor Ofen ein und obwohl schon sehr geschwächt, gelang es den kaiserlichen Soldaten noch dieses Heer der Ungläubigen abzuwehren. Zu diesem Zeitpunkt war der Verteidiger Wiens, der Schild der Christenheit, mein Waffengefährte und General, Ernst Rüdiger von Starhemberg, bereits schwer erkrankt und vom Kaiser persönlich vom Schlachtfeld zurück beordert worden. Im Oktober entschied dann der Generalstab die Belagerung abzubrechen, da das ungünstige Wetter das seine dazu tat. Das Fazit dieses Feldzugs war schrecklich. 23.000
Mann des kaiserlichen Heeres, nahezu die Hälfte also, war gefallen oder an der Ruhr oder an diversen Fieberepidemien krepiert. Wie gesagt, ich war nicht vor Ort, doch litt ich zu Hause mit, mit meinen ehemaligen Kameraden. Der Ruf des Kaisers ließ nicht lange auf sich warten. Man erinnerte sich bei Hof an mich, meine Taten bei der Verteidigung Wiens waren also nicht vergessen im Generalstab. Ein gewisser Offizier, ein Prinz, hatte seine Finger im Spiel, wie es schien, denn mein Freund und Waffenbruder, Karl Franz von Lothringen, Fürst von Commercy, Graf von Rosnay besuchte mich auf Schloss Neuhaus und brachte mir persönlich das Schreiben meines Kaisers mit der Erlaubnis ein Regiment aufzustellen. Das geschah im November 1684, und nun war ich hier, am Fuße meines Schlosses Neuhaus an der Donau, am eigens gebauten Truppenübungsplatz und die Lamberg-Dragoner exerzierten und übten sich im Kriegshandwerk. 726 Mann strömten über den Platz, hauend, stechend, schießend, zu Fuß und zu Pferde.
Teils alte Kameraden aus der Zeit der Wiener Türkenbelagerung, teils frische Männer aus der Musterung. 24 Offiziere, 56 Unteroffiziere, 8 Ärzte oder Feldschere, 8 Fahnenschmiede, 16 Tombeaurs und 600 Gemeine tummelten sich am Exerzierplatz. Dazu fast mein ganzer Stab. Fast mein ganzer Stab, denn Major Alessandro Stradella war noch nicht zugegen, ich rechnete aber ständig mit seinem Erscheinen.
Mein neapolitanischer Freund, nein, mein Bruder, war vor Monaten nach Italien abgereist um eine private Angelegenheit zu klären, versprach mir aber zurück zu kehren, und bis jetzt hatte er immer seine Versprechen gehalten. Fast eineinhalb Jahre Drill hatten aus den meisten meiner Männer gute Kämpfer gemacht, doch würde sich erst in der ersten Schlacht erweisen, aus welchem Holz sie geschnitzt waren. Das Holz vieler dieser Soldaten kannte ich bereits, bei einigen aber, würde erst das Abschaben der Rinde die Holzart preisgeben.
Eine Gruppe Reiter galoppierte vor meinen Augen auf Attrappen zu, welche mit Piken ausgestattet waren. Zwar wurden die gegnerischen Pikeniere immer weniger, doch musste man als Reiter höllisch aufpassen, sollten mit der Pike geübte Männer deine Gegner sein. Der Major führte seine Gruppe Reiter gewandt und geschickt in einem Halbkreis, sprengte mit seinen Männern auf die Attrappen im vollen Galopp zu nur um sein Pferd, in ausreichender Entfernung zur gefährlichen Waffe des Feindes, abrupt abzubremsen. Das Pferd des Majors grub die Hinterläufe in den weichen Boden und reduzierte augenblicklich seine Geschwindigkeit auf ein Minimum. Der Major feuerte seine zwei Pistolen rasch auf die Attrappen ab und war fertig just in dem Moment in dem sein Pferd einen Bogen zurück machte und rasch wieder Tempo in die entgegengesetzte Richtung aufnahm. Die anderen Reiter machten es ihren Anführern in einer Gruppe nach und das Krachen der Pistolen erfüllte den Platz. Nicht jeder hatte die Grazie und das Geschick ihres Anführers, doch die meisten konnten dieses Manöver mittlerweile sehr effizient durchführen. Dieses Kavalleriemanöver wurde eine
„Caracolla“ genannt. Vom spanischen Wort, Caracol, die Schnecke, abgeleitet. Man ritt auf den Gegner zu und feuerte erst aus sicherer Distanz vor den Piken der Feinde seine Schusswaffen ab, zog sich dann noch einmal zurück, sammelte sich und erst danach griff man mit gezogenem Pallasch oder Säbel die Fußtruppen erneut an. So reduzierte man vorerst die feindlichen Truppen ohne viele Verluste und verschaffte sich dadurch einen zahlenmäßigen Vorteil für den Nahkampf. Bei Gegnern mit Musketen allerdings war diese Taktik nicht ratsam. Ein ruhig stehender Musketier oder Arkebusier schießt dich einfach vom Pferd wenn du ihm, durch das Abbremsen des Pferdes, Zeit dazu lässt. Zielstrebig und unerschrocken, im vollen Galopp durch die gegnerischen Reihen. Links und rechts fürchterliche Hiebe austeilend, war bei Gegnern mit Schusswaffen ratsamer. Auch beim Angriff auf Pikeniere gingen die Meinungen der Fachleute auseinander. Viele, wie der berühmte General des Dreißigjährigen Krieges, Gottfried Heinrich zu Pappenheim, verabscheuten diese Taktik und stuften sie als feige ein. Seine Pappenheimer also griffen auch Pikeniere stets im vollen Galopp an, koste es, was es wolle.
Nun, für mich zählten meine Männer. Jeden, den ich durch eine kluge Entscheidung meinerseits retten konnte, würde ich retten. Diese Männer waren nicht nur ein Stück Fleisch, diese Männer waren meine Waffenbrüder. Ich würde keines ihrer Leben vergeuden. Der Major ritt mit seinen Mannen an mir vorbei und hob grüßend seinen Arm.
„Guten Tag, Oberst von Lamberg!“, rief der junge Mann vergnügt. „Konnten meine Männer überzeugen?“, fragte er wohl wissend, dass diese Darbietung Lob verlangte.
Major Johann Georg von Herberstein war mittlerweile einer meiner liebsten Freunde. Schneidig, stattlich, und stets zum Plaudern aufgelegt mit einer fröhlichen, ungezwungenen Art, machte der Offizier es jedermann leicht, ihn gern zu haben. Im Gefecht allerdings, konnte er sein Pferd auf einer Münze wenden und seine Hand war unter härtesten Bedingungen so ruhig, dass er auf hundert Schritte kaum sein Ziel verfehlte.
Auch Degen und Rapier beherrschte er ganz passabel. Ein Soldat also, vom Scheitel bis zur Sohle. Der Graf war mit sechsundzwanzig Jahren nur ein wenig jünger als ich und unsere Familien kannten sich schon lange.
„Hervorragend, Herr Major“, sagte ich, „wie ich es von Euch gewohnt bin, eben,“ ergänzte ich. „Aber umsonst habt ihr ja nicht diese Offiziersstelle erhalten, mein lieber Freund, ich stelle nur die Besten ein.“ Graf von Herberstein lächelte und trabte winkend an mir vorbei. Dann stimmte er ein Lied an und seine Männer stimmten mit ein. Ich wendete mich schmunzelnd wieder den anderen Übungen zu. Das Fechten hatte meine Aufmerksamkeit erregt. Ich hatte nur für diese Übungen türkische Krummsäbel, sogenannte Scimitare, anfertigen lassen. Denn der Kampf gegen die Türken war auch ein Kampf gegen diese Krummsäbel. Die Osmanen waren Meister dieser Waffen und diese Waffen, wie ich aus meiner Erfahrung auf dem Wiener Schlachtfeld sehr wohl wusste, hatten ihre Tücken. Ich beobachtete einen Trainingskampf.
Einer meiner neuen Unteroffiziere versuchte beim Kampf mit einem seiner Soldaten den Krummsäbel zu gebrauchen, schaffte es aber nicht richtig. Natürlich flogen die Funken.
Natürlich hieben die Männer mit all ihrer Kraft aufeinander ein, doch Kraft war nicht alles. Ich verspürte große Lust einzuschreiten. Die beiden Männer waren gut geschützt und schenkten sich auch in diesem Trainingskampf nichts.
Schweiß rann ihnen vor Anstrengung aus allen Poren, und trotzdem wurden die Schwerthiebe weiterhin mit voller Wucht geführt. Hart prallten die Klingen aufeinander. Scimitar auf Rapier. Doch etwas fehlte mir und so ging ich dazwischen. Ich hatte mich langsam den Kämpfenden unbemerkt genähert und mich zu den zusehenden Kameraden gestellt.
„Haltet ein“, sagte ich nun.
Die Männer ließen voneinander ab und gingen auf Abstand.
Dann verbeugten sie sich tief.
„Herr Oberst“, stammelten sie fast gleichzeitig und getrauten sich nicht aufzublicken. Immer noch empfand ich Stolz, diese Männer in den Farben meines Hauses zu sehen. Ich hatte blaue Waffenröcke und schwarze Mäntel schneidern lassen, dazu rote Hosen und schwarze Kavalleriestiefel. Eine schwarze Feldkappe vollendete die Montur. Natürlich auch Helme und Lederkoller, aber diese wurden nur in der Schlacht getragen.
„Überlass‘ mir kurz Deinen Scimitar“, sagte ich zu meinem
kräftigen Unteroffizier, „ich will euch etwas zeigen, was sehr wahrscheinlich für euch wichtig sein könnte.“ Ich lächelte meine Männer an.
„Obacht“, sagte ich, „ich zeige euch jetzt wie die Türken diese Waffe handhaben.“ Ich stellte mich gegenüber meinem Kontrahenten auf und winkte ihn zu mir.
„Greif mich an“, forderte ich den Gemeinen auf. „Angriff!“,
rief ich, „jetzt!“ Der junge Soldat zögerte ein wenig, denn ich war überhaupt nicht geschützt. Nur mit einem Hemd bekleidet, winkte ich ihn abermals zu mir.
„Keine Sorge“, ermutigte ich den Mann, „mir geschieht schon nichts.“
Der junge, kräftige Soldat umfasste nun sein Rapier entschlossener und ging selbstbewusst auf mich zu. Wenn er es so haben will, dann werde ich halt kurz mit diesem Aristokratenwindbeutel meinen Spaß haben, stand in seinen Augen geschrieben.
„Greif an“, ermutigte ich ihn abermals und winkte ihn zu mir.
„Du wirst mich nicht einmal ritzen.“
Der Soldat war jetzt vom Ehrgeiz gepackt. Rund um unseren Kampfplatz war es nun ruhig geworden. Überall am Platz stellten die Soldaten ihre Übungen ein und warteten gespannt was nun geschehen würde. Der Soldat hatte jetzt Mut gefasst und machte sich zum Angriff bereit. Er verlagerte sein Gewicht auf seinen rechten Fuß und ich sah seine Schulter zucken. Die linke Hand hatte er über den Kopf erhoben, die Spitze des Rapiers zielte auf meine Brust, doch hatte er die Schwerthand noch abgewinkelt. Langsam schob er sich auf mich zu, Schritt für Schritt, Zehenspitze für Zehenspitze. Ich aber stellte mich breitbeinig hin, das Krummschwert mit dem Rücken an meine Schulter gelehnt und wartete geduldig ab.
Natürlich wusste ich, dass sein Rapier bedeutend länger war als mein Scimitar, aber es war mir einerlei. Denn ich kannte den Vorteil meiner gebogenen Waffe aus vielen Kämpfen um Leben und Tod. Kannte mein Angreifer ihn auch? Nun, das würde sich gleich herausstellen, dachte ich. Der junge Soldat nahm nun seine Kappe vom Kopf und blonde Locken kamen zum Vorschein. Er schwitzte und war angespannt, doch er ließ sich zu einer Attacke verleiten. Der Rapier sauste auf meine Brust zu, doch es kostete mich keine Mühe, die Waffe abzuwehren. Ich schlug sie gelangweilt zur Seite. Ich reizte den Jüngling weiter und tat, als müsste ich gähnen. Die Menge lachte und der blonde Soldat attackierte ein weiteres Mal.
Doch das wollte ich auch bewirken. Es war für meine Männer überlebenswichtig die Gefährlichkeit dieser, meiner Waffe, zu erkennen. Und meine Aufgabe war es, diese Gefährlichkeit nun anschaulich für jedermann zu demonstrieren. Mein junger Gegner, jetzt vom Ehrgeiz gepackt, machte nun den Fehler sich zu sehr an mich heran zu wagen. Sein Reichweitenvorteil war nun nicht mehr gegeben. Seine lange, gerade Klinge stieß auf meine Brust zu. Doch ich wich nicht aus, sondern trat noch einen Schritt auf meinen Gegner zu, blockte mit der Rückseite meiner Klinge seinen Schlag und drückte seine Klinge nach außen. Dann drehte ich mit einer flinken Bewegung meines Handgelenks die Klinge so, dass nun die Spitze meines Krummsäbels auf das Herz meines Gegners zeigte. Mit der linken Hand drückte ich meine Klinge gegen die seine und stabilisierte nun meinen angedeuteten Todesstoß. Mit der Schwerthand stieß ich meine Klinge gegen die Brust meines Gegners.
„Schlafe süß, mein Freund, der Tod nimmt Dich mit auf seinen Schwingen.“, sagte ich, und ich lächelte, während meinem Gegner, ob der Plötzlichkeit meiner Attacke, das Gesicht erstarrte.
Ich klopfte aufmunternd meinem Gegner auf die Schulter und winkte den Unteroffizier zu mir während ich zu meinen Soldaten sprach.
„So kämpfen unsere Feinde“, sagte ich, „und das meistens leider ziemlich erfolgreich. Die Scheide bitte“, sagte ich zu meinem Unteroffizier und zeigte auf besagten Gegenstand.
Er reichte sie mir geschwind. Ich hielt die stabile Schwerthülle über meinen Kopf.
„Außerdem benutzen sie weiters ihre Scheiden für den Kampf. Seht her, ich werde es euch zeigen. Achtet auf die gebogenen Klingen. Unsere Feinde werden versuchen, an eure Hälse zu gelangen, an eure Arme und Beine und mit einer einzigen runden Bewegung“, ich machte eine Schnittbewegung,
„trennen sie eure Arme ab, oder öffnen eure Adern und Arterien. Ihr zwei, kommt her!“, befahl ich zwei Dragonern.
„Greift mich an“, befahl ich und hielt in einer Hand die Schwertscheide in der anderen Hand den Scimitar. Die Männer taten wie ihnen geheißen und ich zeigte meinen Soldaten wie ich den einen Angriff mit der Schwertscheide blockte und den anderen mit dem Krummsäbel. Dann attackierte ich und schlug dem einen Gegner die massive Scheide gegen den Hals während ich dem anderen Gegner hinter meinem Rücken mit dem Krummsäbel die freiliegende Niere filetierte. Natürlich nur, wenn dies ein Ernstfall gewesen wäre. So deutete ich dies nur an. Die Männer staunten. Meine Gegner rissen erschrocken ihre Augen auf.
„Grüße an unseren Schöpfer!“, rief ich den verdutzten Soldaten zu, gab meine Waffe dem Unteroffizier wieder zurück und lächelte verschmitzt in die Menge. „Eure Kameraden wären jetzt tot“, sagte ich und verbeugte mich tief.
„So kämpft der Türke, seid auf alles vorbereitet!“.
Meine Männer klatschten und jubelten mir zu und ich genoss es. Der Schweiß stand auch mir auf der Stirn, doch ich fühlte mich gut. Ein Spieß, ein bulliger Unteroffizier, ergriff nun das Wort und scheuchte die Männer wieder zurück an ihre Plätze.
Dann drehte er sich mir zu und zwinkerte. Auf Feldwebel Josef Müller war wie immer Verlass. Major von Herberstein reichte mir lachend ein Tuch und ich wischte mir den Schweiß von der Stirn.
„Hervorragende Darbietung, Philipp“, sagte von Herberstein
anerkennend. „Ich habe aufmerksam zugesehen und ich hoffe, ich habe einiges gelernt“, sagte der junge Graf stirnrunzelnd.
„Das hoffe ich auch“, sagte ich. „Meine Anstrengungen sollten sich doch wohl lohnen“, wieder lachten wir.
„Vielleicht könnten wir das ja wiederholen“, sagte der Major,
„mit mir als Gegner?“.
Ich mochte den Grafen wahrlich, aber für heute hatte ich genug.
„Morgen, Johann Georg, morgen, ich verspreche es“, antwortete ich keuchend. „Ich muss erst mal verschnaufen“, verabschiedete ich mich und ging zurück zum Zelt des Stabes.
„Gregor!“, rief ich im Gehen.
Major Gregor Tregler drehte sich um. Die schwarze Augenklappe machte sein ansonsten vornehmes Gesicht verwegener. Er verlor sein Auge als wir gemeinsam Wien verteidigten. Genauer gesagt war es unter anderem dem Major zu verdanken, dass die Stadt zu guter Letzt nicht unterging.
Sein Auge war der Preis, den er bezahlen musste. Das alles war nun schon fast drei Jahre her und mein Freund strotzte vor Tatendrang. Er blickte vom Kartentisch auf und beobachtete mich.
„Was kann ich für dich tun, Philipp?“
Er grinste mich an.
„Ich könnte auch ein paar Kniffe vorführen, mit dem Langbogen zum Beispiel, wäre dir damit geholfen?“
„Um Gottes Willen“, antwortete ich, „lass es, mein Freund.
Mit prähistorischen Waffen wollen wir unsere Männer nicht mehr ablenken.“ Wir grinsten beide.
„Nein, mein Freund, wann können wir aufbrechen, wäre meine Frage?“
Ich war froh, dass dieser außergewöhnliche Offizier nicht nur mein Freund war sondern auch in meine Dienste gewechselt war. Er bekleidete nun in meinem Regiment den Rang eines Majors und war einer meiner Berater. Eigentlich führte er mein Regiment, wenn man es genau nahm, denn ich hatte mich um viele Dinge zu kümmern in den letzten eineinhalb Jahren und war nicht oft zugegen.
Nach meiner Rückkehr aus Wien und meiner damit verbundenen glücklichen Vermählung mit meinem Goldschatz, Marie Luise von Thürheim, musste ich meine Güter und Besitztümer sichten und ordnen. Dafür war eine Menge Zeit von Nöten, denn nicht weniger als ein Dutzend Schlösser und Burgen samt dazu gehörigem Land, Dörfern und Gütern nannte ich nun mein Eigen. Dazu mehrere Häuser und Stadtpalais in Wien, Passau, München, Prag und Graz.
Um alles musste ich mich kümmern und ich musste schnell feststellen, dass ich Unterstützung brauchte. Die besorgte ich mir in Person meines betagten Oheims, Freiherr Wenzel von Sprinzenstein, seines Zeichens studierter Jurist an den Universitäten Prag und Florenz und somit wie geschaffen für meine Aufgabe. Mein Oheim half gerne, einerseits war ich sein Lieblingsneffe und andererseits bot diese Aufgabe ein wenig Abwechslung in seinem ansonsten eintönigen Leben.
Auch, dass er dadurch Abstand von meiner Tante bekam, kam ihm, so denke ich jedenfalls, auch nicht ungelegen. Ich vertraute ihm wie mir selbst und konnte mich nach einigen Monaten der Reisen und der Besichtigungen meiner Güter, wieder mehr um mein Regiment kümmern. Meine geliebte Gemahlin stand mir bei allen Reisen zur Seite, denn unsere Liebe war so frisch wie der Morgentau und wir begehrten einander wie am ersten Tage. Jetzt aber stand mein Aufbruch ins Heerlager des Kaisers bevor und ich fürchtete schon den Abschied.
Alessandro war in dieser Zeit abgereist in seine Heimat und bis heute nicht zurückgekehrt. Ich verstand ihn ja, nur darauf zu warten, dass ich für ihn und unseren Zeitvertreib Zeit hatte, ermüdete ihn. Er ging fort und kam nicht mehr zurück. Einmal ein Brief aus Neapel, einmal aus Florenz, das war alles, was ich von ihm hörte. Doch sein Platz im Regiment blieb frei, und ich wartete auf seine Rückkehr, denn er ist mein Bruder und Freund. Ich hatte ihm geschrieben, zu einer Verwandten nach Florenz, noch hoffte ich auf seine Rückkehr.
„Wir haben alle Waffenübungen abgehalten und sind mit dem Drill fast fertig. Ende des Monats müssen wir uns mit dem Regiment in Wien einfinden. Das Ziel ist noch nicht klar. Aber ich denke, dass wir nach Stuhlweissenburg marschieren werden.“ Gregor Tregler blickte von der Karte auf.
„Alles andere macht für mich keinen Sinn. Oder aber…“ Er unterbrach seinen Satz. Ich nickte ihm zu, als Aufforderung seinen Satz zu vollenden.
„Oder aber, es geht nach Ofen, ins Herz des Feindes. Wieder einmal. An den Platz, an dem sich das Schicksal Ungarns entscheiden könnte. Der Hauptstadt der ungarischen Könige.“ Major Tregler sah mich ernst an.
„Nein“, sagte er dann und schüttelte energisch seine braune Mähne. „Zu gewagt für unseren sanftmütigen Kaiser.“
„Wer weiß“, sagte ich, „man munkelt sein Berater, der Bischof, und seine Priester sagen dem Kaiser was auf dem Schlachtfeld zu tun sei, und diese sind getrieben vom Hass auf die Türken. Und Ofen in Gottes Hand? Schönes Zeichen für die gesamte Christenheit, oder etwa nicht? Gott will es so“, ich ahmte beim letzten Satz eine predigende Stimme nach.
„Ja, aber ziemlich gewagt“, antwortete Major Tregler. „Sollten wir scheitern und unser Heer untergehen, könnten die Türken wieder bis Wien vorrücken. Dies gilt es zu bedenken. Nichts ist gewiss im Laufe einer Schlacht. Fortuna ist eine unberechenbare Schlampe, das zeigt uns die Geschichte.“ Gregor Tregler lachte.
„Stuhlweissenburg, also“, sagte ich.
Gregor Tregler nickte.
„Überall lauert der Tod.“
„Heute Tarock?“, fragte er dann. „In der Schenke „Zum alten
Flötzer“ gegen Abend?“, Gregor Tregler grinste. „Ich habe Frau und Kinder zu ernähren. Ich brauche also Dein Gold. Du hast mir für diesen Offiziersposten so viel abgeknöpft, ich brauche Gelegenheit, es mir zurück zu verdienen.“
„Umsonst ist der Tod“, sagte ich, „und was würden andere nicht dafür geben, für mich und den Kaiser ihre Haut zu riskieren? Ruhm und Ehre sind seltene Blumen und man pflückt sie meist auf dem Schlachtfeld. Ich gebe Dir die Gelegenheit für nur ein wenig Deines Reichtums.“ Wir lachten beide und reichten uns die Hand zum Abschied.
Dann sprang ich auf mein Pferd und ritt Richtung Schloss Neuhaus. Marie würde dort sein und ich war voller Vorfreude und begierig darauf meine Frau, meinen Himmel auf Erden, meinen Engel, zu sehen. Viel Zeit blieb uns nicht mehr.
Vor mir tauchte nach kurzem Ritt mein neues Zuhause auf.
Schloss Neuhaus an der Donau hatten wir beide, Marie Luise und ich, zu unserer neuen Heimat auserkoren. Gründe dafür gab es viele. Zum einen war es die Nähe zu Maries Vater.
Franz von Thürheim residierte die meiste Zeit im Schloss Hartheim, was keine zwanzig Meilen von Neuhaus entfernt lag und so rasch erreichbar war für mein Weib. Der zweite Grund war die gute Lage, nördlich der Donau, direkt oberhalb der Ortschaft Untermühl thronte das Schloss auf einem Hügel an der Einmündung des Flusses Große Mühl in die Donau. Vom wunderbaren, fünfeckigen Turm hatte man einen schönen Überblick über das Donautal, von der Donauschleife bei Oxlan über Aschach und den Falkenberg. Am Anfang, in grauer Vorzeit, stand hier einst eine Burg und das Land wurde dem Passauer Bistum zugerechnet. Die Burg hatte viele Besitzer, unter anderem die Grafen von Schaunberg.
Die Grafen von Schaunberg wollten aber zu viel, vor allem nach Unabhängigkeit und eigenem Land stand ihnen der Sinn und so lehnten sie sich gegen die Obrigkeit auf. Nun, diese Obrigkeit waren die Habsburger und diese machten keine lange Federlese. Herzog Albrecht ging mit seinem Heer gegen den Grafen von Schaunberg vor. Das Resultat war die zehn Jahre andauernde Schaunberger Fehde bei der sich die Habsburger schlussendlich durchsetzten. Die Grafen von Schaunberg mussten letztlich die Lehenshoheit der Habsburger anerkennen. Doch Schloss Neuhaus konnte nicht erobert werden und die Schaunberger Grafen konnten noch einige Zeit gewisse Vorrechte behaupten. Aus dieser Zeit stammen offensichtlich auch die Wasserspeier am großen Turm. Irgendwann kam dann die Burg in den Besitz meiner Vorväter. 1536 zuerst als Pfand und dann 1591 als freies Eigen. 1650, nach den Bauernkriegen, begann der große Umbau von der Burg zum wohnlichen Schloss und den Sprinzenstein wurde die hohe Gerichtsbarkeit zuerkannt. Nun, jetzt baut meine Gemahlin um, und ich fürchte es bleibt kein Stein auf dem anderen. Ein neues Wohnhaus, ein Sommergebäude mit Festräumen und Säulengängen voller Licht und Wärme. Ein barockes Kleinod eben, nicht mehr aber auch nicht weniger. Marie Luise lässt auch die südlichen und östlichen Wehranlagen abtragen, sie brauche Platz für ihre Gartenanlagen. Gemüse und Heilkräuter werden angepflanzt und überhaupt, diese Maßnahmen stärken den Schlosscharakter, pflegt sie immer zu sagen. Und mein geliebtes Weib hatte, wie stets, recht. Ich war froh, dass ich den vierzig Meter hohen Turm behalten durfte. Denn auch dieser war ihr anfangs ein Dorn im Auge. Zu viel Schatten, sagte sie, und auf meinen Einwand, dass die Türken vor unseren Toren stünden, reagierte sie nur mit einem aufgesetzten Lachen, dabei stemmte sie ihre zierlichen Arme an die Hüften. Die stehen in Ungarn, sagte sie, nicht einmal bei der Belagerung Wiens sind sie bis hierhergekommen, also lass uns vernünftig reden. Mir blieb nichts anderes über als zu einer List zu greifen. Ich ließ das Turmzimmer herrichten und ausstaffieren mit feinster Seide und Brokat. Weiche Kissen und Polster wurden vorbereitet und als alles, so wie ich es mir vorstellte, vorbereitet war, verband ich Marie Luise eines Nachts mit einem Seidentuch die Augen, trug sie nach oben auf den Turm und bettete sie in weichen Kissen. Dann zündete ich die Kerzen an und bat sie noch ein wenig still zu halten.
Auf mein Zeichen mit einer Fackel, entzündeten meine Männer auf kleinen Booten auf der Donau ihre Laternen. Der Anblick war wunderschön. Ich führte Marie zum Fenster und entfernte sanft das Seidentuch über ihren Augen. Sie seufzte angetan und wir liebten uns die ganze Nacht im Turmzimmer.
Als der Morgen graute, verließen wir den Turm und ich zeigte Marie noch die fünf außergewöhnlichen Wasserspeier. Einer von ihnen war einem menschlichen Hinterteil nachempfunden und zeigte direkt nach Wien. Die Grafen von Schaunberg waren 1559 mit Graf Wolfgang von Schaunberg ausgestorben, aber was sie von den Habsburgern hielten, war immer noch am Wasserspeier für jedermann gut ersichtlich. Ich behielt meinen Turm, Marie Luise bekam dennoch was sie wollte. Jetzt wo wir uns vereinbart hatten, war vieles leichter zu bewerkstelligen. Ich ließ vorgezogene Basteien anlegen, ganz so wie es im modernen Festungsbau üblich war. Dazu ließ ich noch breite Burggräben ausheben und zwei weitere Batterietürme entstanden. Ich wollte nichts dem Zufall überlassen und auf gut Glück angewiesen sein. Ja, die Türken waren momentan in Ungarn, aber ich wusste nur zu gut, dass sich das schnell wieder ändern könnte. Wie sagte Gregor Tregler, Fortuna ist eine unberechenbare Schlampe. Ich musste lächeln. Jetzt musste jedenfalls der Feind, wer immer es sein würde, diese Hindernisse überwinden, bevor sie das Schloss betreten konnten.
Marie Luise bekniete mich vor kurzem dem Bau einer Schlosskapelle zuzustimmen, aber ich sagte ihr, dass diese noch warten müsse, weil unsere Sicherheit bevor ging. Sie zog so einen süßen Schmollmund, dass ich ihr abermals nichts abschlagen konnte, und ich gab mein Versprechen mich sofort nach dem Bau der Wehranlagen, um dieses Vorhaben zu kümmern.
Langsam kam ich meinem Ziel näher. Der Wald rings um mich lichtete sich und gab den Blick auf das Schloss frei.
Überall waren Baugerüste zu sehen und fleißiges Volk machte sich allerorts nützlich. Eine saftige, große Wiese lag zwischen Wald und Schlosstor. Mit der Absicht angelegt, einen möglichen Feind schon von weitem zu entdecken und diesem dann keine Gelegenheit zur Deckung zu geben, sollte er sich zum Angriff entschließen. Jetzt aber gab es keinen Feind und Kühe grasten in aller Ruhe auf dem saftigen Grün. Der breite Weg war unbeschattet und die Mittagssonne brannte auf meinen behelmten Kopf. Eine Allee wäre hier von Vorteil, dachte ich. Vielleicht Hainbuchen? Der Eisenbaum, eines Soldaten würdig, härter als Eiche. Ja, das gefiel mir und während ich den Weg zum Haupttor entlang ritt, nahm ich mir vor auch dieses Vorhaben alsbald umzusetzen.
„Winde des Frühlings, erheitern die Luft, Nun ist‘s Zeit, zu zerreißen den Kragen.“
Der Mann im bunten Seidenrock hielt kurz inne um die Zuseher noch mehr in seinen Bann zu ziehen. Dann strich er durch seinen prächtigen, vollen, silberfarbenen Bart, bevor er mit samtener Stimme weitersprach:
„Im Paradies ist Wein und Liebchen alle Nacht, Ein Mensch hat uns die Kunde ja gebracht.“
Das anwesende, auserlesene Publikum klatschte ausgelassen, wohl hatte es das Wortspiel verstanden. Ein Mensch, was mit dem Wort Adam zu übersetzen war, was aber auch zugleich der erste Mensch war. Ein vortreffliches Wortspiel also.
Abdurrahman Pascha, der Großstatthalter von Ofen, Wesir und Fürst, nickte seinem Kapellmeister zu und gleich darauf erhob sich das blecherne Spiel der Zurna über den abebbenden Applaus der Gäste. Auch mehrere Trommeln stimmten in die rhythmische Melodie mit ein und des Statthalters Gäste wiegten sich vergnügt im Takt der Melodie. Der allseits beliebte Abdi Pascha, wie ihn die Türken nannten, beobachtete mit gutmütigen, klaren, blauen Augen den jetzt einsetzenden Tanz. Wie gern wäre er noch einmal jung, dachte der greise Fürst während er den jungen Männern und Frauen beim Tanz zusah. Der Saft des Lebens sprudelte in ihnen, berauschte sie, machte sie unsterblich. Das dachte der Pascha von Ofen auch selbst einmal von sich. Doch unsterblich, das wusste er nun, war er nicht. Aber schwer zu töten, das jedenfalls war er, das traf auf Abdi Pascha zu. Seit geraumer Zeit wandelte er, der Pascha von Ofen, nun auf Allahs weiter Welt und Abdi Pascha wusste, dass er Allah dankbar sein musste für solch ein langes Leben, in diesen rauen und kalten Zeiten, und das war er auch.
Dankbar und liebenswert zu jenen, die dies verdienten, aber auch hart und unnachgiebig zu jenen, die seinen Zorn herausforderten. Und darum, so dachte der weise alte Mann jedenfalls, war ihm auch dieser unvorhersehbare Aufstieg im osmanischen Reich ermöglicht worden. Vor so vielen Jahren, dachte er, nahm sein Weg seinen Anfang und nun war er fast zu Ende. Abdi Pascha klatschte in die Hände im Takt der Musik und dachte weiter über sein Leben nach, das nun zu einem Großteil in der Vergangenheit lag. Die Muße der alten Leute, dachte er lächelnd. Wie lange war es her, siebzig Jahre oder gar achtzig? Als junger Mann kehrte er seiner Heimat den Rücken und machte sich auf, die Welt zu entdecken. Er wurde anders genannt, damals in einer anderen Welt, zu einer anderen Zeit. Dann bekam er seinen richtigen Namen, Abdurrahman, Diener des Barmherzigen, und dieser Name gefiel ihm und er passte auch zu ihm. Der Barmherzige,
„Rahman“ einer der 99 Namen Allahs, und „Abd“ was übersetzt so viel wie Diener oder Sklave hieß. Abdi Pascha war beides, sein ganzes bisheriges Leben. So kannte man ihn im Reich und im gesamten Orient. Und diesen hatte er bereist, hatte die überwältigende Schönheit der Wüsten Ägyptens kennengelernt, die farbenprächtigen Bazare Bagdads durchstreift und die großen Schiffe der algerischen Korsaren bestiegen. War als Oberkommandierender der Janitscharen auf Kreta und in Podolien gewesen und hatte nie einen Kampf verloren. War Beylerbeyi von Ägypten in der Zeit der großen Revolte, von Bagdad als es von den Safawiden bedroht wurde.
Auch nach Bosnien hatte der Sultan ihn entsandt. Überall diente er seinem Herrn vortrefflich. Mit Feuer und Schwert aber auch mit sanfter Hand, überall so, wie es von Nöten war.
Niemals ungerecht und immer treu. Dann ein hohes Amt im Sultans Palast, der hohen Pforte, mit aller Pracht und Ansehen des Hofes gesegnet. Danach vor zwei Jahren, 1684, das erste Mal Beylerbeyi von Ofen. Kurz darauf, 1685, in der Zeit höchster Bedrohung durch die Christen, Oberbefehlshaber von Ungarn, aber noch im selben Jahr als Beylerbeyi nach Aleppo geschickt. Ausgemustert und vergessen? Mit nichten. Vor ein paar Monaten ereilte ihn der Ruf des Sultans im fernen Aleppo. Noch einmal nach Ofen sollte er, um Allahs Willen.
Denn hier in Ungarn brauchte das Reich, nach der verlorenen Schlacht um Wien, einen erfahrenen Krieger, einen demütigen Diener Allahs um das drohende Unheil in Ungarn noch abzuwenden. Und so war Abdurrahman Pascha wieder gekommen, hierher nach Ofen, in die Hauptstadt der alten ungarischen Könige, in die Stadt an der blauen Donau, eingefasst von Hügeln mit satten, grünen Wiesen und Wäldern, beherrscht von einer starken Burg mit dicken Mauern, welche nur von prächtigen Moscheen überragt wurde.
Und hier, dass wusste Abdi Pascha, würde er sterben und seinen Frieden finden.
Die Musik war nun fordernd und wild und steuerte auf ihren Höhepunkt zu. Die luftigen Räume des Saales, nur mit ein paar Säulen eingegrenzt, ließen die Töne in den Frühlingshimmel entweichen und Abdurrahman Pascha wusste, dass auch sein Volk in der Stadt sich an ihnen erfreuen konnte. Viele würden die Musik hören und ihre Herzen würden mit Freude erfüllt sein. Nicht nur auf dem Schlachtfeld konnte ein Mann sich auszeichnen. Nein, auch im Gesang, in der Poesie, in der Kalligraphie, in der Architektur und in vielen weiteren schönen Künsten konnte ein Mann zu Ruhm und Ehre gelangen. Beim Töpfern, Weben und in der Kunst des Goldschmiedens, in allen Handwerken gab es wahre Meister. Aber natürlich auch in der Kunst des Krieges.
Abdurrahman Pascha wurde abrupt aus seinen Gedanken gerissen.
Seine blauen Augen nahmen schnelle Bewegungen am Rande der Menge wahr. Eine in robustes Leder gekleidete Gestalt näherte sich seinem Thron. Stattlich, kräftig, aber auch flink, wie eine große Raubkatze, bahnte sich der junge Mann seinen Weg durch die Menge. Er lächelte nicht. Sein rasiertes, kantiges Gesicht war ohne Regung. Die schwarzen Haare wehten im Wind als der Mann sich rasch näherte. Abdi Pascha erhob sich von seinem Thron und ging dem Mann entgegen.
Dabei nickte er dem Kapellmeister zu, und dieser verstand.
Die Musiker spielten weiter während die beiden Männer wortlos Schulter an Schulter in einem Seitengang verschwanden. Meister des Kriegshandwerks, wahrlich du hast einen Namen, dachte Abdi Pascha und betrachtete den jungen Krieger an seiner Seite. Wenn sein treuer Gefährte und Hauptmann seiner Leibwache, Kilic Arslan, seine Aufführung störte, so musste das etwas zu bedeuten haben. Die Christen waren offensichtlich wieder einmal auf dem Vormarsch. Das Spiel hatte also begonnen, dachte Abdi Pascha. Ein Spiel? War es das? Fragte der greise Statthalter von Ofen sich. Ja, für ihn, Abdi Pascha, dem erfahrenen, alten Mann, war es ein Spiel.
Ein grausames Spiel, das er schon oft gespielt hatte. Und der Einsatz, das wusste der Fürst von Ofen, war das Leben Vieler.
„Setz dich, mein Freund, was gibt es zu berichten?“
Der alte Mann hatte den jungen Krieger in einen Nebenraum geführt. Die Musik im Saal hatte nun aufgehört und ein weiterer Dichter trug seine Verse vor. Nur gedämpft drangen seine Worte zu den beiden Männern.
„Unsere Spione berichten von massiven Truppenbewegungen rund um Wien, mein Wesir. Tausende Soldaten sind auf ihrem Weg. Sie kommen dieses Mal aus allen deutschen Ländern.
Viele Protestanten sind darunter. Die freien Ungarn formieren sich auch. Auch sie ziehen nach Wien. Alle Christen formieren sich unter dem Habsburger.“ Kilic Arslan musterte seinen weisen Anführer, doch dieser lächelte nur. Die gütigen, blauen Augen des Statthalters von Ofen blitzten erfreut.
„Viel Feind, viel Ehr, oder etwa nicht! Nur, was ist des Habsburgers Ziel? Stuhlweißenburg? Fünfkirchen?
Ruppertsburg oder Szegedin und dann weiter nach Peterwardein?“
Der Pascha von Ofen machte eine kurze Pause.
„Nein“, sagte er dann, und wieder lächelte der greise Fürst.
„Der Kaiser kommt zu uns, hierher nach Ofen. Er wird sich das holen wollen, was nach seiner Meinung, ihm schon lange zusteht, und was ihm, dem Habsburger, schon so viele Leben seiner Soldaten gekostet hat. Nun, wir haben diese Giauren schon vor zwei Jahren gelehrt, was es bedeutet, ihre dreckigen Hände nach Ofen auszustrecken. Wir haben sie ihnen abgehackt und nach Hause geschickt. So wird es ihnen auch
jetzt wieder ergehen.“ Wieder lächelte der Wesir und Pascha von Ofen. Beide Männer schwiegen und die Worte des Dichters im Saal fanden auch den Weg in die Ohren der beiden Männer.
„Bist Du vernünftig, so erforsch' Dein eig'nes Wesen, Lob‘ den, der mit sich selbst zuerst bekannt gewesen;
Wenn Du Dein Herz nicht and'rem Gotte hingegeben, So wird im Feld der Liebe stets Dein Name leben.“
„Die Kuffär werden zu Tausenden sterben, sollten sie es wagen, unsere Stadt zu betreten.“ Kilic Arslans Stimme hatte die Stille im Raum durchbrochen.
„Meine Männer werden ihre Pflicht erfüllen und ihre Taten wird man im ganzen Reich besingen.“ Der junge Mann war aufgesprungen und starrte entschlossen gen Westen, seine dunklen Augen flackerten wild vor Leidenschaft.
„Kilic Arslan. Der Säbel und der Löwe.“, sagte der Statthalter von Ofen freundlich. „Was für ein ungewöhnlicher Name.
Wurde er Dir ehrenhalber gegeben, Kilic, meine ich?“
„Ja, mein Fürst. Vor langer Zeit, in einem anderen Land. Doch jetzt bin ich der Säbel Allahs. Und ich werde wüten unter unseren Feinden wie noch nie ein Mensch zuvor gewütet hat.
Zur Ehre Allahs.“ Abdurrahman Pascha nickte zustimmend und lachte laut auf.
„Aber vorher, mein Freund, wirst du mich verlassen und ich werde einen anderen statt Deiner zum Hauptmann meiner Leibwache machen.“ Kilic Arslan erstarrte.
„Warum Herr, was habe ich getan, dass Ihr mich nicht mehr haben wollt?“





























