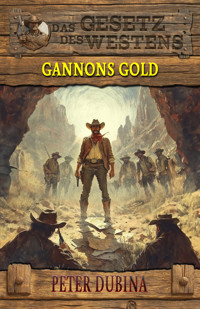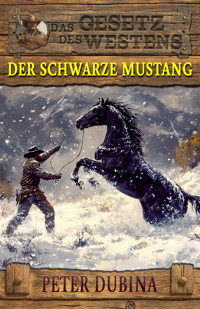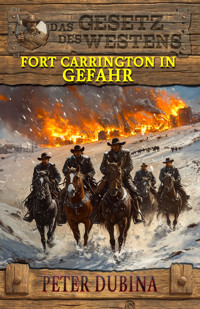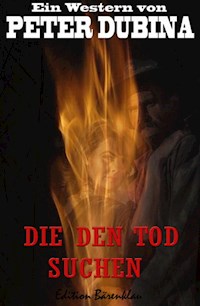5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EK-2 Publishing
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Drei Western für zwei! Willkommen im Wilden Westen, wo Mut, Verrat und Gerechtigkeit auf dem Spiel stehen. Dieses Bundle vereint drei packende Romane der Erfolgsreihe „Das Gesetz des Westens“ – in einem Buch!
Schwarzer Falke: Fort Sill steht vor dem Ausbruch eines Krieges: Comanchen und Kiowas rebellieren, und der Hass zwischen den Fronten wächst. Ben Drago, selbst ein Halb-Kiowa, soll Frieden vermitteln, doch ein grausames Massaker durch Büffeljäger entfacht die Flammen des Konflikts. Während der Schwarze Falke, Anführer der Kiowas, zum Krieg aufruft, muss Drago entscheiden, wo seine Loyalität liegt.
Eine Falle für Shannon: Joe Shannon gerät auf dem Weg zum Viehkauf in einen tödlichen Strudel aus Gewalt, Verrat und Verfolgung. Gemeinsam mit einem Hilfs-Marshal soll er einen gefangenen Mörder lebend nach Elmo bringen – verfolgt von dessen Bande und begleitet von einem rätselhaften Kopfgeldjäger. Doch nicht nur draußen lauert die Gefahr – auch innerhalb der Gruppe droht alles zu zerbrechen.
Spuren der Rache: Tom Walker überquert heimlich den Rio Grande, um einen Mord zu rächen. Doch schon bald wird er verfolgt – von skrupellosen Killern und dunklen Geheimnissen. In der Hitze des Grenzlands spitzt sich alles zu einem explosiven Showdown zu.
Über die Reihe „Das Gesetz des Westens“ Erleben Sie regelmäßig knallharte Abenteuer aus dem Wilden Westen – von legendären Western-Autoren wie Alfred Wallon, Peter Dubina, John Gray und vielen mehr. EK-2 Publishing bringt mit dieser Reihe das Flair von Pulverdampf, rauen Siedlern und einsamen Revolverhelden direkt zu Ihnen nach Hause.
Laden Sie den Colt, satteln Sie auf – und sichern Sie sich drei explosive Western in nur einem Band! Hinweis: Dieses Bundle enthält Neuauflagen gleichnamiger Romane.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Peter Dubina
3 Western in 1Schwarzer Falke
Drei Romane der historischen Western-Reihe „Das Gesetz des Westens“
Schwarzer Falke
Eine Falle für Shannon
Spuren der Rache
EK-2 Publishing
Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!
Liebe Leser, liebe Leserinnen,
zunächst möchten wir uns herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie dieses Buch erworben haben. Wir sind ein Familienunternehmen aus Duisburg und jeder einzelne unserer Leser liegt uns am Herzen!
Mit unserem Verlag EK-2 Publishing möchten wir militärgeschichtliche und historische Themen sichtbarer machen und Leserinnen und Leser begeistern.
Vor allem aber möchten wir, dass jedes unserer Bücher Ihnen ein einzigartiges und erfreuliches Leseerlebnis bietet. Haben Sie Anmerkungen oder Kritik? Lassen Sie uns gerne wissen, was Ihnen besonders gefallen hat oder wo Sie sich Verbesserungen wünschen. Welche Bücher würden Sie gerne in unserem Katalog entdecken? Ihre Rückmeldung ist wertvoll für uns und unsere Autoren.
Schreiben Sie uns: [email protected]
Nun wünschen wir Ihnen ein angenehmes Leseerlebnis!
Ihr Team von EK-2 Publishing,
Ihr Verlag zum Anfassen
Schwarzer Falke
von Peter Dubina
Ben Drago hatte die Rauchfahne über dem nördlichen Horizont schon vor einer Stunde gesehen – Bussarde, die mit schwerfälligen Flügelschlägen dorthin flogen, hatten ihn darauf hingewiesen. Der einsame Reiter war keine Sekunde im Zweifel gewesen: Rauch und Bussarde, das bedeutete in den Wüstengebieten von Nord-Texas immer dasselbe – Tod.
Drago war ein hochgewachsener Mann. Wenn er aufrecht stand, maß er sechs Fuß und zwei Zoll. Er trug ein bunt gesticktes, mit Fransen verziertes Lederhemd, an den Schenkeln von der Sonne gebleichte Levis-Hosen und Mokassins, deren hohe Schäfte unter den Knien von Lederriemen gehalten wurden. Tief an seiner rechten Hüfte war ein Armeecolt mit Holzgriff festgeschnallt. An der linken Seite trug er ein Bowie-Messer mit Beingriff in einer Büffellederscheide.
Seit er die Rauchfahne am fernen Horizont gesehen hatte, hielt er seine Henry Rifle in der linken Armbeuge, den rechten Zeigefinger in den Abzugsbügel gehakt.
Doch das eigentlich Bemerkenswerte an Ben Dragos Erscheinung war sein Gesicht, das von einem staubbedeckten schwarzen Texanerhut mit breitem Rand und flacher Krone beschattet wurde. Es war das Gesicht eines Indianers, scharf geschnitten, kühn und stolz wie das eines Falken, aber mit einem Zug von Bitterkeit und Einsamkeit um die Mundwinkel. Das schwarze Haar trug er schulterlang.
Sein schwarz-weiß gescheckter Pinto blickte mit bösen Augen, die erkennen ließen, wie verwegen, bockbeinig und niederträchtig er zu sein vermochte.
Ben Drago zügelte den Hengst am Rand eines um diese Jahreszeit ausgetrockneten Flussbettes. Vor dem Comanchen-Zeltdorf in der Niederung war nur wenig übriggeblieben. Einige der Bisonhaut-Tipis brannten noch, von anderen standen nur noch die Stangengerüste. Die Luft war von stinkenden Rauchschwaden erfüllt.
Ben Drago stieß dem Hengst die stumpfen Hacken seiner Mokassins in die Weichen und ritt in das Flussbett hinunter. Überall zwischen den verkohlenden Tipis lagen tote Indianer: Männer, Frauen, sogar Kinder.
Ein halbnackter Krieger lag – von Kugeln durchsiebt unter seinem zusammengeschossenen Pferd. Seine starre Rechte umklammerte noch einen Winchester-Karabiner, das Schild an seinem linken Arm bedeckte das Gesicht des Toten. Nur wenige Schritte entfernt lag ein anderer Comanche mit einer furchtbaren Säbelwunde zwischen den Schulterblättern. Aber auch er musste bis zuletzt erbittert gekämpft haben, denn neben seiner ausgestreckten Hand lag ein mit Pulverschleim bedeckter alter Perkussionscolt, Ben Drago spürte Bitterkeit in sich aufsteigen, als er an einer Squaw vorbeiritt, die noch im Tod ihr Kind an sich drückte. Beide waren von Kugeln niedergestreckt worden. Mitten in dem zerstörten Zeltdorf zügelte Ben Drago sein Pferd und schwang sich aus dem Sattel. Er stieg über einen gefallenen Comanchenkrieger weg, ging ein paar Schritte weit und sah sich um. Aber nirgendwo war ein Zeichen von Leben zu entdecken. Nur die Bussarde kreisten lauernd und geduldig wie der Tod über den Rauchwolken, als warteten sie darauf, dass der einsame Reiter sie wieder mit ihrer schrecklichen Beute allein ließ.
An vielen Orten hatte sich Ben Drago schon solch ein Anblick geboten, und immer war ihm, wenn er schließlich weiter geritten war, zumute gewesen, als habe er ein Stück von sich selbst sterbend zurückgelassen. Es war das Erbe seiner indianischen Mutter, das ihn so empfinden ließ. Ben Drago war ein Kämpfer und auf seine Weise ein Revolvermann, aber er hasste das blutige Sterben und die sinnlose Vernichtung, wie der erbarmungslose Krieg zwischen Weißen und Indianern sie mit sich brachte.
Er stieß mit dem Fuß gegen eine am Boden liegende zerbrochene Lanze, an deren Schaft im heißen Wüstenwind Adlerfedern zitterten. Diese zerschellte Comanchenlanze wirkte auf Ben Drago wie ein Symbol für den Kampf, den das Volk seiner Mutter längst verloren hatte, auch wenn es sich da und dort noch erbittert gegen die Weißen zur Wehr setzte.
Mitten in seine bitteren Gedanken hinein peitschte ein Schuss, und er hörte das dumpfe Geräusch, mit dem die Kugel ihr Ziel traf. Er fuhr herum, riss blitzschnell den Ladehebel der Henry nach unten, und eine Patrone fuhr mit metallischem Klicken in den Lauf. Doch sein Zeigefinger, erstarrte am Abzugshahn.
Nur fünf Schritte von ihm entfernt lag der Comanche, über den er vor einer Minute hinweg gestiegen war, weil er ihn für tot gehalten hatte, auf den Knien. Mit beiden Händen hielt er einen Colt auf Ben Drago gerichtet, der Revolverlauf schwankte hin und her. In der nackten, mit weißem Lehm beschmierten Brust des Indianers saß ein Ausschussloch, wie eine Kugel es hinterlässt, wenn sie den Körper eines Menschen durchschlägt. Die Hände mit dem Colt sanken herab, der Comanche fiel vornüber aufs Gesicht.
Ben Drago hob seinen Blick von dem Toten. Am Rand der gegenüberliegenden Uferböschung hielt ein Reiter, der ein Packpferd am Zügel führte. Er ließ die Winchester, mit der er geschossen hatte, sinken, lud die Waffe durch und stieß sie in den Sattelschuh. Dann spornte er sein Pferd an und ritt im Schritt den Abhang hinunter.
Wie ein Bussard saß er im Sattel. Er war hochgewachsen und hager und vom Hut bis zu den kniehohen Maultierrohr-Stiefeln in schwarzes Leder gekleidet. Man merkte ihm an, dass er einen langen, harten Ritt hinter sich hatte, denn er war staubbedeckt. Seine Rockschöße waren nach hinten geschlagen und ließen zwei silberne Colts mit weißen Elfenbeingriffen sehen, die in tief geschnallten schwarzledernen Halftern steckten. Die Art, wie der Mann seine Waffen trug, verriet Ben Drago, dass er einem Revolvermann gegenüberstand.
Das Gesicht des Fremden war fast dreieckig, mit stark hervortretenden Backenknochen, und erinnerte Ben Drago an das eines Wolfes – ein Eindruck, der noch durch die schräg geschnittenen bernsteingelben Augen verstärkt wurde. Sein Pferd war ein Rapphengst mit wilden Augen, langem Schweif und herrlicher Mähne. Sattel und Zaumzeug bestanden aus schwarzem, silberbeschlagenem Leder. Das zweite Pferd war ein erschöpfter Brauner mit schweißbedeckten Flanken, der eine mit einer Decke verhüllte Last über dem Sattel trug. Die Decke war voll Fliegen.
»Wenn ich den Finger eine Sekunde später um den Abzugshahn gekrümmt hätte, hätten Sie jetzt ein Kugelloch zwischen den Schultern«, sagte der Fremde. »Übrigens: Mein Name ist Siringo, Charles Siringo.«
Ben Drago hatte diesen Namen schon mehrmals nennen hören. Siringo war ein Kopfgeldjäger und hatte in Texas, Neumexiko und Arizona einen legendären Ruf als Revolvermann.
»Waren Sie Zeuge des Massakers?«, fragte Ben Drago.
»Nein.«
»Was suchen Sie dann hier?«
»Nichts. Was ich suchte, habe ich schon gefunden«, erwiderte er und deutete mit einer Kopfbewegung auf die verhüllte Last im Sattel des Braunen. Ben Drago hob den Rand der Decke mit dem Gewehrlauf hoch und sah, dass darunter ein Toter auf dem Pferderücken festgebunden war. »Auf seinem Steckbrief steht: tot oder lebend«, fuhr der Kopfgeldjäger fort. »Er ist fünfhundert Dollar wert.«
Siringo hatte ihm das Leben gerettet, doch plötzlich empfand Ben Drago Widerwillen, ja, Hass gegen diesen Mann, der völlig ungerührt inmitten von Tod und Verwüstung von dem Geld sprach, das er fürs Töten erhielt. Drago kehrte zu seinem Pferd zurück, schob die Henry Rifle in den Sattelschuh und saß auf.
»Wenn Sie nicht blaue Augen hätten, würde ich sie für einen Indianer halten«, sagte Siringo. »Arbeiten Sie als Kundschafter für die Armee? Nein«, beantwortete er seine Frage selbst, als sein Blick auf Dragos tief geschnallten Colt mit dem abgewetzten Holzgriff fiel. »Nein, Sie tragen Ihre Waffe wie ein Revolvermann. Wie ist Ihr Name?«
»Man nennt mich Ben Drago. «
»Ben Drago – das Kiowa-Halbblut?« Ein Funke sprang in Siringos Augen auf. »Ich habe schon von Ihnen gehört. Wenn Sie auch auf dem Weg nach Fort Sill sind, sollten wir zusammen reiten.«
»Ich weiß, dass ich in Ihrer Schuld stehe. Vielleicht ergibt sich einmal die Gelegenheit, unsere Rechnung zu begleichen«, entgegnete Ben Drago. »Trotzdem möchte ich allein von hier weg reiten.
»Es ist wohl das Indianerblut in Ihren Adern, das Ihnen beim Anblick der toten Comanchen zusetzt«, sagte Siringo. Seine Stimme klang jetzt höhnisch und herausfordernd. Ben Drago hatte ihn abgewiesen, als er ihm anbot, an seiner Seite zu reiten. Das allein genügte, um Feindschaft zwischen ihnen zu entfachen. Revolvermänner, denen die meisten Menschen ohnehin mit Hass, Verachtung oder Angst begegneten, hatten einen leicht verletzlichen Stolz.
»Ich habe in meinem Leben schon viele Männer sterben sehen – und einige davon habe ich selbst getötet«, erwiderte Ben Drago und legte die Rechte auf den Holzgriff seines Armeecolts. »Aber ich habe noch nie einen Menschen für Geld umgebracht, ich habe das Töten nicht zu meinem Geschäft gemacht. Das ist der Unterschied zwischen uns, Siringo. Deshalb lässt mich der Tod unschuldiger Frauen und Kinder nicht unberührt, während er Ihnen völlig gleichgültig zu sein scheint.«
Das Gesicht des Kopfgeldjägers erstarrte.
»Ich hätte wohl doch eine Sekunde länger warten sollen, bevor ich eine Patrone verschwendete, um Ihr Leben zu retten«, sagte er.
Ben Drago griff mit der linken Hand in die Tasche, zog einen Silberdollar hervor und warf ihn vor Siringo in den Staub.
»Das ist für die Patrone«, entgegnete er.
»Sie schätzen Ihr Leben verdammt niedrig ein«, sagte der Kopfgeldjäger. »Mag sein, es ist billig zu haben.«
Seine Rechte hing noch immer mit gekrümmten Fingern über dem Elfenbeingriff des silbernen Colts. Er schien versucht, den Kampf zu wagen.
Doch in diesem Augenblick ertönte Hufschlag. Ben Drago warf einen schnellen Blick nach links und sah US-Kavallerie aus den Rauchwolken der brennenden Tipis auftauchen. Die Soldaten näherten sich in Zweierreihen, zwischen sich führten sie Indianer, die mit auf den Rücken gefesselten Händen auf den ungesattelten Rücken ihrer scheckigen Pferde saßen. Der Offizier – ein junger Lieutenant mit rötlichem Dragonerschnurrbart – galoppierte, gefolgt von Hornist und Fahnenträger, auf Ben Drago und Siringo zu.
»Lieutenant Parke Stobo, G-Kompanie des 10. US-Kavallerieregiments«, sagte er. »Wenn Sie keine Armeeangehörigen sind, sollten Sie dieses Gebiet auf dem schnellsten Weg verlassen. Hier kommt es überall zu Gefechten zwischen Truppen und aufständischen Comanchen und Kiowas.«
Ben Drago zog einen sorgfältig zusammengefalteten Brief aus der Tasche und reichte ihn dem Lieutenant, der ihn las, zurückgab und militärisch grüßte.
»Meine Kompanie befindet sich nach einem Kampf auf dem Rückweg nach Fort Sill«, fuhr er fort. »Wenn Sie wollen, können Sie sich uns anschließen. Und Sie, Sir?«, wandte er sich an Siringo, der sich in den Sattel hatte zurücksinken lassen.
»Ich bin ebenfalls auf dem Weg nach Fort Sill«, antwortete der Kopfgeldjäger. »Ich brauche eine schriftliche Bestätigung des Provost Marshals.«
Ben Drago folgte den vorbeireitenden gefangenen Comanchen mit seinem Blick. Der erste in der Reihe war ein junger Krieger mit einer schwarzen Falkenfeder im Haar. Ebenso wie den nachfolgenden Gefangenen waren ihm die Hände auf den Rücken gefesselt. Eins aber unterschied ihn von den anderen: Er trug einen alten spanischen Brustpanzer. Er saß erschöpft auf seinem Pferd. Sein Kopf hing vornüber, das Kinn lag auf dem blanken Eisen. Doch als habe er Ben Dragos Blick gespürt, hob er die Stirn – und im Vorbeireiten trafen sich die Blicke der beiden Männer. Ein jähes Erkennen durchzuckte Ben Drago.
»Wie sind diese Comanchen in Gefangenschaft geraten, Lieutenant?«, fragte er.
»Beim Angriff auf das Zeltdorf ist eine Anzahl Krieger entkommen«, antwortete der Offizier. »Wir haben sie verfolgt. In einem weiteren Gefecht wurden die meisten getötet, der Rest gefangengenommen. Wir schaffen sie nach Fort Sill, wo sie vor ein Militärgericht gestellt werden.«
»Sie hätten dem Henker die Arbeit abnehmen können, wenn Sie sie an Ort und Stelle erschossen hätten«, warf Siringo ein.
Diese Worte trafen Ben Drago wie ein Schlag ins Gesicht. Doch er ließ sich nichts anmerken, als er sich an den Lieutenant wandte: »Ich möchte mit dem Gefangenen reden, der diesen alten Eisenpanzer trägt.«
»Ich habe nichts dagegen. Aber nehmen Sie sich vor ihm in Acht. Er ist einer der Anführer des Aufstandes. Er weiß, dass ihm der Galgen droht und würde wahrscheinlich alles tun, um eine Waffe in die Hand zu kriegen und kämpfend zu sterben.«
Ben Drago saß ab und schlang die Zügel seines Pinto-Hengstes um eine halbverkohlte Zeltstange, dann ging er zu den Gefangenen hinüber, die unter scharfer Bewachung standen. Der Comanche im Brustharnisch hob den Blick, als Ben Drago neben seinem Pferd stehenblieb.
»Erkennst du mich wieder, Schwarzer Falke?«, fragte Ben Drago. »Vor ein paar Wintern haben wir zusammen Büffel gejagt. Was ist geschehen, dass wieder Blut fließt zwischen deinem Volk und den Weißen?«
Er brach ab, denn der Comanche hatte ihm ins Gesicht gespuckt. »Haben die weißen Soldaten dich gerufen, damit du ihnen hilfst, mein Volk zu vernichten?«, erwiderte der Gefangene.
Ben Drago wischte sich das Gesicht mit dem Handrücken ab.
»Wir waren Freunde – und wir sind es noch immer. Worte, die im Zorn gesprochen werden, muss man vergessen können. Warum willst du mir nicht sagen, was geschehen ist, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben?«
»Das ist geschehen«, antwortete der Indianer und deutete mit einer Kopfbewegung auf das zerstörte Zeltdorf. »Das und noch Schlimmeres. Hungernde alte Leute, sterbende kleine Kinder, ein Volk ohne alle Hoffnung – das ist es, was geschah.«
»Schwarzer Falke, dein Volk kann den Kampf gegen die Weißen nicht gewinnen.«
»Das wissen wir, Ben Drago. Aber es gibt eine Grenze für das, was Menschen ertragen können. Es ist besser, kämpfend zu sterben, als zu verhungern. Du, der du die Sache der Weißen zu deiner eigenen gemacht hast, kannst nicht verstehen, was mein Volk empfindet. Du gehörst nicht zu uns. Du hast weißes und rotes Blut in deinem Herzen, aber die Stimme des weißen Blutes klingt stärker in dir.«
»Ich bin nicht dein Feind«, sagte Ben Drago. »Meine Mutter war eine Kiowa, und in meinem Herzen bin ich mehr ein Kiowa als ein Weißer. Colonel Grierson, der Kommandant von Fort Sill, hat mich gerufen, damit ich ihm helfe, den Kämpfen zwischen der Armee und den Comanchen und Kiowas ein Ende zu bereiten.«
Weiter gelangte er nicht. In dem Augenblick, in dem der Comanche sich vom Pferderücken herab auf ihn warf, durchzuckte Ben Drago die Erkenntnis, dass er vergessen hatte, auf die Hände des Gefangenen zu achten. Irgendwie war es dem Indianer gelungen, seine Fesseln so weit zu lockern, dass er sich mit einem letzten, verzweifelten Ruck hatte befreien können. Beide Männer stürzten zu Boden.
Ben Drago fühlte, wie der Comanche ihm mit der Rechten den Colt aus dem Halfter riss. Er konnte das Handgelenk seines Gegners gerade noch in dem Moment packen, in dem der Schwarze Falke die Revolvermündung auf Ben Dragos Stirn richtete und abdrücken konnte.
In dieser Sekunde erreichte ein Sergeant, der sich bei dem plötzlichen Angriff des Indianers auf Ben Drago aus dem Sattel geschwungen und seine Waffe gezogen hatte, die beiden Kämpfenden und schlug den Schwarzen Falken mit dem stählernen Coltlauf nieder. Der Comanche erschlaffte, rollte von Ben Drago herunter und blieb regungslos liegen.
Ben Drago richtete sich auf den Knien auf, nahm dem Indianer den Armeecolt aus der schlaffen Hand, schob die Waffe in das tief geschnallte Halfter, hob seinen Hut auf, kam auf die Füße und schlug sich mit der Hutkrempe den Staub von den Kleidern.
Zwei farbige Kavalleristen saßen ab, wälzten den Besinnungslosen aufs Gesicht und banden ihm die Arme auf den Rücken. Als sie ihn auf die Füße stellten, war er wieder bei sich und warf Ben Drago einen Blick voll tödlichen Hasses zu, bevor ihn die Soldaten zu seinem Pferd schleppten und hinaufhoben.
»Sie kennen diesen Indianer?«, fragte der Lieutenant, der ebenfalls den Colt gezogen hatte und ihn nun wieder in das Armeehalfter schob. Ben Drago war zu seinem Pinto zurückgekehrt und hatte sich in den Sattel geschwungen. Er nickte.
»Was hat diese neuen Kämpfe zwischen der Armee und den Comanchen ausgelöst, Lieutenant?«, wollte er wissen. »Seit zwei Jahren ist in diesem Teil von Texas nicht mehr gekämpft worden. Die Indianer lebten in der Reservation und verließen sie nur, um südlich des Red River Büffel zu jagen – ein Recht, das ihnen der mit der Regierung in Washington geschlossene Friedensvertrag ausdrücklich zugesteht.«
»Es sind blutige Unruhen im Indianerterritorium ausgebrochen, und schließlich haben mehrere Banden von Comanchen und Kiowas unter Black Horse und dem Schwarzen Falken die Reservation verlassen. Die 10. Kavallerie hat den Befehl erhalten, die aufständischen Indianer in die Reservation zurückzutreiben.«
»Es sieht eher so aus, als lautete Ihr Befehl, jeden Indianer – sei es Mann, Frau oder Kind – südlich des Red River zu töten«, sagte Ben Drago mit einem Blick auf das zerstörte Zeltdorf.
»Sie würden anders reden, wenn Sie die Blutspur gesehen hätten, die die Indianer durch Nord-Texas ziehen«, entgegnete der junge Lieutenant mit unverkennbarer Feindseligkeit. »Nachts wird der Weg, den die aufständischen Banden nehmen, von Feuerschein und tagsüber von Rauchsäulen gezeichnet. Sie überfallen Postkutschen, Büffeljägerlager und kleine Siedlungen und töten jeden Weißen, der ihnen in die Hände fällt.«
Der Lieutenant setzte seinem Pferd die Sporen an und ritt zu seiner wartenden Abteilung. Der Hornist und der Standartenträger folgten ihm. Nur Siringo blieb zurück. Er stützte sich mit beiden Händen auf das Sattelhorn und musterte Ben Drago mit einem abschätzenden Blick.
»Wer überleben will, Ben Drago, muss sich auf die Seite des Siegers schlagen. Die Indianer können den Kampf nicht gewinnen«, sagte er. »Ich gebe Ihnen einen guten Rat: Vergessen Sie das Kiowa-Blut in Ihren Adern. Nehmen Sie keine Indianersquaw, sondern eine weiße Frau zum Weib. Dann wird man Ihren Kindern nicht mehr ansehen, dass sie noch zu einem Viertel Indianer sind.«
Ben Dragos Hand fuhr zum Griff des Colts. Aber ebenso schnell, wie sein Zorn aufgeflammt war, erlosch er auch wieder. Er hatte in seinem wilden, kampferfüllten Leben gelernt, Männer und ihre Worte richtig einzuschätzen – ein Umstand, der ihm mehr als einmal das Leben gerettet hatte – und sein Gefühl sagte ihm, dass Siringo ihn nicht abermals beleidigen und herausfordern wollte. Seine Worte entsprangen der einfachen Überlebensstrategie eines Revolvermannes.
Der Kopfgeldjäger zog seinen Rapphengst herum und ritt, das Lasttier mit seiner schrecklichen Bürde mit sich führend, zu den Soldaten hinüber.
*
Es war früher Abend, die Sonne war schon untergegangen, und die lichtblauen Schatten der fernen Hügel griffen wie Finger weit über die Ebene, als die Kavallerie-Abteilung mit Ben Drago, Siringo und den gefangenen Comanchen Fort Sill erreichte. Das Fort, der stärkste Armeeposten im Indianerterritorium, lag auf einer Anhöhe über dem Cache Creek. Es bestand aus einer Unzahl von Offiziersquartieren, Mannschaftsbaracken, Ställen, Stabs- und anderen Gebäuden. Die Palisaden, die Fort Sill früher umgeben hatten, waren niedergelegt worden, um mehr Raum zu schaffen. Von den wuchtigen Eckbastionen war nur die südöstliche stehengeblieben, von der aus man das Flusstal überblicken konnte.
Neben der Batterie Vierundzwanzigpfünder-Perrot-Kanonen auf dem Paradeplatz trennte sich Ben Drago von der G-Kompanie und ritt unter dem am Fahnenmast flatternden Sternenbanner hindurch zum Hauptquartier. Niemand achtete auf ihn, denn im Fort herrschte reges Leben und Treiben. Vor dem Hauptquartier hielt ein halbes Dutzend Comanchen auf scheckigen Pferden. Einer von ihnen hatte ein reiterloses Tier am Zügel.
Drago schwang sich aus dem Sattel und schlang die Zügel seines Pintos um das Haltegeländer vor dem Hauptquartier. Doch als er die Stufen zur Veranda hinaufsteigen wollte, stellte sich ihm ein Sergeant in den Weg.
»Wohin wollen Sie?«, fragte er.
»Colonel Grierson erwartet mich«, antwortete Ben Drago-
Doch der Sergeant gab den Weg nicht frei. Drago wollte keinen Streit. Er griff in die Tasche und zog den zusammengefalteten Brief hervor, wegen dem er den langen Ritt unternommen hatte.
»Geben Sie das dem Colonel, dann weiß er, wer ihn sprechen will«, sagte er. Der Sergeant öffnete den Brief und begann zu lesen.
»Ich sagte, Sie sollten dieses Schreiben Colonel Grierson geben. Aber ich habe nichts davon erwähnt, dass der Inhalt des Briefes Sie etwas angeht.« Ein Unterton von Zorn schwang in Dragos Stimme mit,
»Du siehst trotz deiner blauen Augen wie ein Indianer aus«, entgegnete der Sergeant und schob herausfordernd das Kinn vor. »Und von einem verdammten Indianer lasse ich mir nichts vorschreiben. Von deiner Sorte habe ich mehr zur Hölle geschickt als ich Finger an den Händen habe. Und es wird gleich einer mehr sein, wenn du dein unverschämtes Mundwerk nicht hältst, du Bastard.«
Ben Drago fühlte, wie ihm das Blut ins Gesicht schoss. Unwillkürlich fuhr seine Hand zum Messer. Der Sergeant sah die Bewegung und griff nach dem Armeecolt an seiner Seite.
In diesem Augenblick wurde die Tür des Hauptquartiers von innen aufgestoßen, und ein Comanche trat, gefolgt von einem Lieutenant und zwei Soldaten, heraus. Er war alt, hatte ein bronzefarbenes, von Falten zerfurchtes Gesicht und eisgraues Haar.
Er trug ein rotes Hemd, einen langen, breiten Lendenschurz und die typischen Comanchenhosen mit breit überlappenden Säumen.
Als er Drago sah, blieb er stehen, und sein düsteres Gesicht hellte sich auf. Dann trat er auf ihn zu und legte ihm beide Hände auf die Schultern.
»Mein Freund«, sagte er, »was führt dich hierher? Bist du erschienen, um den Niedergang meines Volkes mit anzusehen?«
»Ich bin hier, um euch zu helfen, wenn meine Kraft dazu ausreicht, Sanaco«, erwiderte Drago.
Der alte Indianer trat einen Schritt zurück. »Wir verhungern in der Reservation«, sagte er. Seine Worte klangen nicht wie eine Anklage, nur wie eine bittere Feststellung. »Wir haben nicht genug zu essen, unsere Kinder und alten Leute sterben an Schwäche. Unsere Krieger stehlen sich heimlich fort, um Büffel zu jagen. Aber sobald sie die Reservationsgrenzen überschreiten, werden sie in Kämpfe mit den Soldaten verwickelt. Ich habe Colonel Grierson gebeten, uns zu helfen. Doch meine Worte haben nur seine Ohren, aber nicht sein Herz erreicht. Ich fürchte, die Sonne meines Volkes geht für immer unter.«
»Ich habe die Spuren der Kämpfe auf dem Weg hierher gesehen. Und ich habe deinen Sohn gesehen, den Schwarzen Falken«, sagte Ben Drago.
Einen Augenblick herrschte Schweigen, dann fragte der alte Mann mit mühsam beherrschter Stimme: »Ist er -tot?«
»Nein«, antwortete Drago. »Geh zum Wachhaus. Dort findest du ihn. Ich muss mit Colonel Grierson sprechen. Danach komme ich in dein Tipi.«
Das Gesicht des Comanchen nahm einen Ausdruck von Erleichterung an. Er nickte. »Ja, sprich mit dem Colonel. Du bist ein halber Weißer und siehst und verstehst doch die Not meines Volkes.«
»Drago? Sind Sie Ben Drago?«, fragte eine Männerstimme. Drago drehte sich um. Auf der Schwelle zum Hauptquartier stand ein bärtiger Offizier mit dem Rangabzeichen
eines Colonels. Ohne erst zu fragen, wusste Drago, dass dieser Mann Grierson war.
»Sie haben mich rufen lassen, Colonel. Hier bin ich«, entgegnete er. Grierson winkte ihm, zu folgen. Drago legte Sanaco flüchtig eine Hand auf die Schulter, dann betrat er das Hauptquartier. Er schloss die Tür hinter sich und blieb abwartend stehen.
Grierson musterte ihn. »Wissen Sie, warum ich Sie angeschrieben habe, Drago?«, fragte er.
»Sie haben Schwierigkeiten mit den Comanchen und Kiowas.«
»Ja. Sie sind ein Halbblut, und man sagt, Sie hätten einen guten Einfluss auf die Indianer. Mir wurde berichtet, dass Sie schon verschiedentlich als Kundschafter für die Armee gearbeitet hätten – neben Ihrem eigentlichen Geschäft als Revolvermann.«
»Was wollen Sie von mir, Colonel?«, fragte Ben Drago in ungeduldigem Ton. »Sie haben mich doch wohl nicht gerufen, um mit mir über die Art und Weise zu reden, wie ich mein Geld verdiene.«
»Nein. Umso weniger, als bei der Arbeit, die ich Ihnen zu bieten habe, kein Revolverlohn herausspringt, höchstens der Sold eines Armeekundschafters«, sagte Grierson, fuhr aber – als er Dragos ablehnenden Gesichtsausdruck bemerkte – rasch fort: »Wenn Ihnen jedoch daran liegt, ein schlimmeres Blutvergießen zu verhindern, dann sollten Sie mein Angebot nicht ausschlagen, ohne darüber nachgedacht zu haben.«
»Sagen Sie, was Sie zu sagen haben, Colonel.«
»In letzter Zeit sind in der Reservation immer wieder Unruhen ausgebrochen. Ich gebe zu, es entstanden Schwierigkeiten, die Indianer ausreichend mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Aber die Schuld daran trifft nicht die Armee, sondern das dem Innenministerium unterstellte Indianerbüro in Washington. Ich habe sogar schon auf eigene Faust versucht, Rinder für die Indianer zu kaufen. Doch das ist nicht so einfach, denn das Innenministerium wacht eifersüchtig über seine Rechte. Zu viele Geschäftsinteressen aller möglichen Leute laufen im Indianerbüro zusammen. Der einzige Erfolg meiner Bemühungen bestand darin, dass ich vom Kriegsministerium den Befehl erhielt, die Grenzen des Indianerterritoriums – im Süden bildet der Red River die Grenze – abzuriegeln, damit keine aufständischen Comanchen- und Kiowabanden mehr die Reservation verlassen können.«
»Das verstehe ich nicht«, sagte Drago. »Warum lässt man die Indianer nicht auf Büffeljagd gehen, wenn die Regierung ihnen nicht genug Rindfleisch liefern kann, um sie am Leben zu erhalten?«
»Der Grund ist einleuchtend – vielleicht nicht für einen Revolvermann, der obendrein noch eine Hälfte Kiowa-Blut in den Adern hat, aber doch für einen korrupten Politiker: Die Comanchen und Kiowas hungern in seiner Reservation. Wenn wir sie aber über den Red River ins Büffelland reiten lassen, stoßen sie dort auf weiße Büffeljäger, die die Bisons ihrer Felle wegen zu Hunderttausenden berauben. Das facht den Hass der Comanchen und Kiowas bis zur Weißglut an. Sie attackieren die Büffeljäger – und da sie in der Überzahl und mit Winchester-Gewehren bewaffnet sind, metzeln sie die Weißen in vielen Fällen nieder.«
»Colonel«, unterbrach Drago, Grierson, zog sich einen Stuhl heran, ließ sich rittlings darauf nieder, verschränkte die Arme auf der Stuhllehne und legte das Kinn darauf, »ich habe auf dem Ritt nach Fort Sill ein von der Kavallerie überfallenes Comanchenlager gesehen, in Fetzen geschossene Männer, Frauen und Kinder. Wenn ich an ihren Anblick denke, wundert es mich nicht, dass sich die Indianer der Armee nicht ergeben wollen.«
Grierson trat an den aus Feldsteinen gemauerten Kamin, nahm sich eine Zigarre, biss das Ende ab und spuckte es in die kalte Asche auf der Feuerstelle.
»Wir befinden uns im Krieg, Drago«, erwiderte er. »Sie wissen, dass das Schicksal der Besiegten zu allen Zeiten bitter war. Das ist nicht erst seit heute so. Die Indianer müssen sich damit abfinden, dass ihre überlieferte Lebensweise zum Untergang verurteilt ist. Wir bemühen uns, sie zu sesshaften Ackerbauern und Viehzüchtern zu erziehen, aber sie sträuben sich dagegen.«
»Die Comanchen sind seit Jahrhunderten ein Krieger- und Reitervolk, Colonel. Es ist ihnen unmöglich, ihre Lebensart von einem Tag zum anderen zu ändern – vor allem dann, wenn sie in der Reservation ungerecht behandelt und außerhalb des Indianerterritoriums von Ihren Soldaten zusammengeschossen werden.«
»Ich möchte die Kämpfe beenden und weiteres Blutvergießen verhindern. Black Horse befindet sich mit achtzig bis hundert Kriegern noch immer außerhalb der Reservation und verheert Texas. Finden Sie ihn, Drago, und bewegen Sie ihn dazu, sich zu ergeben.«
»Damit Sie ihn vor ein Militärgericht stellen und aufhängen lassen können?«
»Es geschieht selten genug, dass ein aufständischer Indianer am Galgen stirbt, Drago. In den meisten Fällen wird eine verhängte Todesstrafe in lebenslange Verbannung umgewandelt.«
»In einem Gefängnis hinzusiechen und jahrelang auf den Tod als einzige Rettung vor der Verzweiflung zu hoffen, ist für einen Indianer ebenso schlimm, wie gehenkt zu werden.«
Grierson zeigte Anzeichen von zorniger Ungeduld.
»Wenn ich Ihre Hilfe nicht so dringend brauchen würde, Drago, würde ich mit Vergnügen zu Ihnen sagen: Scheren Sie sich zum Teufel! Aber Sie sind wahrscheinlich der einzige Mann, der den Comanchenaufstand beenden kann, ohne dass noch viele weitere Menschen sterben müssen. Wollen Sie also den Auftrag übernehmen oder nicht?«
»Zu mir ist noch niemand gekommen, der mir für einen solchen Höllenjob nicht mehr geboten hätte, als Sie es tun, Colonel«, erwiderte Ben Drago. »Wenn ich trotzdem annehme, dann der Indianer wegen. Behalten Sie Ihr Geld, und kaufen Sie sich dafür eine neue Zigarre.«
»Heißt das, Sie übernehmen den Auftrag?«
Ben Drago war schon an der Tür. Auf der Schwelle drehte er sich noch einmal um. »Ich werde es mir überlegen. Morgen erfahren Sie, wie ich mich entschieden habe.«
*
Als Ben Drago sein Pferd vor der Handelsniederlassung außerhalb des Forts anbinden wollte, hörte er ein Geräusch hinter sich und drehte sich um. Eine junge Frau, fast noch ein Mädchen, war aus der Tür getreten. Sie trug eine Bluse aus nachtblauem Baumwollsamt, einen weiten roten Rock und Mokassins, hatte ein hübsches Gesicht mit dunklen Augen und langes, offen über den Rücken fallendes schwarzes Haar. Wäre ihre Hautfarbe nicht sehr hell gewesen, hätte Ben Drago geglaubt, eine Squaw vor sich zu haben.
»Wenn Sie meinen Vater sprechen wollen – der ist nicht hier«, sagte sie.
»Ich suche nach einer Unterkunft«, entgegnete Drago und griff an die Hutkrempe. »Ich dachte, hier gäbe es vielleicht ein freies Bett.«
Sie musterte ihn.
»Nein«, sagte sie dann, »aber wir haben eine Kammer neben dem Stall. Sie dient zur Aufbewahrung von Saatgut und Getreide, und es gibt dort Ratten… «
»Ich bin nicht empfindlich«, unterbrach Drago sie mit einem Lächeln. »Ich habe meine Decke schon mit Klapperschlangen geteilt.«
Jetzt lächelte die junge Frau ebenfalls.
»Dann will ich Ihnen die Kammer zeigen. Über den Preis können Sie mit meinem Väter verhandeln, er verlangt gewöhnlich einen Dollar für die Nacht, Mister… «
»Drago, Ben Drago.«
»Ich bin Gwyneth Shaugnessy.«
Shaugnessy war ein irischer Name, doch er passte nicht zu diesem Mädchen. Sie sah aus, als hätte sie Indianerblut in den Adern.
Drago führte sein Pferd zum Stall und band es dort an. Die Kammer war so klein wie eine Gefängniszelle, aber ein, zwei Nächte konnte ein Mann es darin schon aushalten, und länger würde Drago nicht in Fort Sill bleiben. Er ging hinaus und löste die Verschnürung zweier in Büffelhaut gewickelter Bündel, die hinter dem Sattel festgebunden waren.
»Soll ich Ihnen helfen?«, fragte Gwyneth Shaugnessy.
Doch Ben Drago hielt ihre Hand fest, als sie nach einem der Bündel greifen wollte.
»Das darf keine Frau berühren, ich werde es selbst tragen«, sagte er. Sie sah ihn merkwürdig an.
»Ich kenne nur ein Ding, dessen Berührung durch eine Frau verboten ist: den Kriegsschild eines Prärie-Indianers«, erwiderte sie. »Aber das wissen nur die wenigsten Weißen.«
»Ich habe eine Hälfte Kiowa-Blut.«
Drago trug die beiden Bündel in die Kammer. Das eine enthielt einen Kriegsschild mit dem Donnervogelsymbol in weißer, roter und schwarzer Farbe. In dem zweiten Bündel verwahrte er einen Bogen aus Wacholderholz und Büffelhörnern, einen Pumafeilköcher voll Pfeilen mit Truthahnfedern und Feuersteinspitzen, einen Tomahawk und eine indianische Pfeife mit langem, federgeschmücktem Rohr. Das war alles, was Ben Drago an sein Leben bei den Kiowas erinnerte, wo er in einem Tipi mitten auf der sturmumtosten Prärie geboren und aufgewachsen war, wo er den Büffel gejagt und gegen die Feinde der Kiowas gekämpft hatte.
Für ihn waren es Heiligtümer, und nach dem Glauben der Prärie-Indianer hätte er es niemals zugelassen, dass eine Frau den Kriegsschild berührte, denn nach indianischen Vorstellungen verlor ein Schild dadurch seine magischen Eigenschaften und vermochte seinen Träger nicht mehr zu schützen.
Drago war ein berufsmäßiger Revolverkämpfer, aber in seinem Herzen war er immer noch ein Kiowa-Krieger.
»Ich hätte es mir beim ersten Blick in Ihr Gesicht denken können«, sagte Gwyneth Shaugnessy, als Ben Drago wieder aus der Kammer trat und die Tür hinter sich verriegelte. »Ich selbst habe auch Indianerblut, aber das darf ich nicht laut aussprechen, denn mein Vater betrachtet es als eine Schande.«
»Denken Sie ebenso?«, fragte Drago.
Das Mädchen warf den Kopf in den Nacken und erwiderte seinen Blick mit einem gewissen Stolz.
»Ich schäme mich dessen nicht«, antwortete sie. »Meine Mutter war eine schöne und gute Frau, aber sie geriet in die Gefangenschaft der Comanchen. Mein Vater kaufte sie einem Indianer für zwei Winchester-Gewehre und ein Fass Whisky ab. Er tat es, weil sie schön war. Später hat er sich ihrer geschämt – und jetzt schämt er sich für mich, weil ich die Tochter eines Comanchen bin. Er ist nicht mein wirklicher Vater. Ich bin nur seine Stieftochter. Wenn er könnte, würde er mich vor der Welt verstecken.«
»Die Weißen denken mit dem Kopf und nicht mit dem Herzen. Der Kopf ist der Sitz der Scham, das Herz der Sitz der Liebe«, sagte Ben Drago. Er schwang sich in den Sattel. »In welche Richtung muss ich reiten, um Sanacos Zeltdorf zu erreichen?«
»Sanaco?«, fragte sie.
»Ja. Ich habe mit ihm zu reden. Sein Sohn wird im Wachhaus gefangen gehalten. Ich glaube, Sanaco fürchtet, dass man den Schwarzen Falken aufhängen wird.«
Sie starrte ihn an, als habe er sie ins Gesicht geschlagen. Mühsam beherrschtes Entsetzen sprach plötzlich aus ihren Augen.
Ihr Verhalten überraschte Drago.
»Kennen Sie ihn?«, fragte er und ahnte die Antwort schon, bevor das Mädchen den Mund abermals auftun konnte. Ihre Hand klammerte sich an die Mähne des Pintos, als suche sie nach einem Halt. Ihr Kopf und ihre Schultern sanken herab.
»Ja, ich kenne ihn«, erwiderte sie kaum hörbar. »Er hat meinem Vater zwanzig Pferde für mich geboten, denn er will mich zur Squaw.«
*
Mit der Hand am Griff seines Colts und aufmerksamen Blicken nach allen Seiten ritt Drago durch das Comanchenlager. Es war Nacht. Vor einem Tipi waren zwei Lanzen in den Boden gerammt. An der einen hing ein Schild in einer bemalten Lederhülle, an der anderen eine Fellhaube mit Büffelhörnern, das Häuptlingszeichen der Comanchen.
Ben Drago saß ab, schlang die Zügel seines Pferdes um eine der Lanzen, zog die Henry Rifle aus dem Sattelschuh, denn er hatte das bestimmte Gefühl, die Waffe nicht außerhalb des Zeltes lassen zu dürfen, hob den Vorhang vor dem Eingang des Tipis in die Höhe und betrat das Zelt. Der Indianerraum wurde von einer Flamme, die aus der Asche einer Feuerstelle züngelte, notdürftig erhellt.
»Yata-he, Sanaco«, sagte Ben Drago, führte die rechte Hand ans Herz und vollführte mit ihr dann eine waagerechte Bewegung in Schulterhöhe.
»Yata-he, Ben Drago«, erwiderte der weißhaarige, alte Comanche, der auf einer zusammengefalteten Decke vor dem Feuer saß. »Du bist willkommen in meinem Tipi.«
Drago nahm den Hut ab, hockte sich Sanaco gegenüber mit gekreuzten Beinen hin und legte die Henry Rifle quer über seine Knie. Außer ihnen war niemand im Zelt.
»Welche Nachricht bringst du mir?«, fragte der Indianer.
»Colonel Grierson will, dass ich Black Horse und seine Bande suche, um sie zur Übergabe zu bewegen«, antwortete Drago. »Weißt du, wo sich die Aufständischen verbergen?«
»Wenn Menschen gejagt werden, sind sie unstet wie der Wind. Sie fliehen von einem Versteck zum anderen.«
»Sanaco, du musst mir helfen«, sagte Ben Drago eindringlich. »Das ist vielleicht die letzte Chance, deinem Volk eine neue blutige Niederlage im Kampf gegen die Soldaten zu ersparen.«
»Was werden die Weißen mit meinem Sohn tun?«, fragte der alte Comanche.
»Man wird ihn nicht hängen, aber vielleicht wird er verbannt werden.«
Sanaco ließ ein Stöhnen hören. »Nimmt man einem Comanchen die Freiheit, nimmt man ihm das Leben. Er kann das Gewicht von Eisenketten nicht ertragen«, sagte er. »Ben Drago, mein Sohn ist der Anführer der Büffelschilder. Er wird eher den Tod suchen, als sich mit Gefangenschaft und Verbannung abzufinden.«
»Hilf mir, Black Horse und seine Bande zu finden«, drängte Drago hartnäckig. »Wenn er sich ergibt, kann das Schlimmste vielleicht vermieden werden.«
»Black Horse wird nicht in die Reservation zurückkehren, bevor sich die Zustände hier nicht gebessert haben.«
»Ich will wenigstens mit ihm reden und tun, was ich kann, um die Lebensumstände deines Volkes erträglicher werden zu lassen, Sanaco. Aber vorher muss der Aufstand beendet werden. Die Comanchen müssen aufhören zu rauben, zu töten und zu brennen. Ich weiß, dass man euch Unrecht zugefügt hat. Doch manchmal muss ein Volk sich fremder Gewalt beugen, wenn es überleben will. Das muss ich Black Horse erklären.«
»Vielleicht wird er dich gar nicht anhören, sondern gleich töten. In seinen Augen bist du ein Weißer, und er kämpft gegen die Weißen.«
Ben Drago starrte in die verdämmernde Glut des Feuers. Rauch stieg aus der Asche auf.
»Ich weiß, dass man den Weißen nicht trauen kann«, sagte er. »Trotzdem muss dein Volk lernen, mit ihnen zu leben, oder es wird der Tag kommen, an dem der letzte Indianer
vom Angesicht der Erde verschwindet. Sanaco, wo finde ich Black Horse?«
»Irgendwo zwischen dem Red River und dem Fluss der Zwei Berge.«
Ben Drago erhob sich und setzte seinen Hut auf.
»Was weißt du von einem Mädchen im Fort, für das dein Sohn ihrem Vater zwanzig Pferde geboten hat?«, fragte er, schon am Eingang des Hopis.
Auch der alte Comanche war aufgestanden. Jetzt huschte ein Schatten über sein zerfurchtes Gesicht.
»Ihr Vater hat abgelehnt, weil er das Mädchen keinem Indianer geben will, obwohl sie selbst Comanchen-Blut in den Adern hat«, erwiderte er. »Aber ein Indianer gilt den Weißen weniger als ein Hund.«
Als Drago gebückt durch den niedrigen Zelteingang hinaustrat, hörte er das metallische Klicken, mit dem mehrere Winchester-Karabiner durchgeladen wurden. Als er den Blick hob, sah er sich von einem Halbkreis schussbereiter Gewehrmündungen umgeben. Er richtete sich auf und trat zur Seite, um den Weg für Sanaco freizugeben.
Im tanzenden Flammenschein eines Lagerfeuers umstanden ihn ein, zwei Dutzend Comanchen. Er wusste gleich, dass es Krieger der Büffelschilde waren. Die schwarzen Augen der Indianer ließen ihn nicht los. Sie hielten die Winchester-Karabiner im Hüftanschlag, die Finger um die Abzugshähne gekrümmt. Ben Drago hielt seine Hände ganz ruhig, um keinem der Krieger einen Grund zu geben, ihn niederzuschießen. Da er den Hass der Comanchen auf alle Weißen – und die, die sie für Weiße hielten – kannte, ahnte er, dass er nur einen Fingerdruck vom Tod entfernt war.
Sanaco sah sich um.
»Lasst ihn gehen!«, sagte er dann. »Er ist ein Freund unseres Volkes. Soll man von den Comanchen behaupten können, dass niemand seines Lebens sicher ist, der ihr Lager in friedlicher Absicht betritt?«
*
Es ging schon auf Mitternacht zu, als Ben Drago das Fort erreichte. Als er am Wachhaus vorbeiritt – einem niedrigen Gebäude mit dicken Lehmziegelwände und eisenbeschlagenen Holztüren, die mit kleinen, vergitterten Luken versehen waren, damit die Gefangenen nicht in ihren Zellen erstickten, wenn die Sonne tagsüber das Wachhaus wie einen Backofen erhitzte – hörte er leises, eindringliches Stimmengemurmel und glaubte, vor einer der verriegelten Zellentüren eine schlanke Frauengestalt in rotem Rock zu erkennen. Doch als er sich noch einmal im Sattel umdrehte, war die Stelle leer.
Vor der Handelsstation saß er ab und führte den Pinto in den Stall. Er nahm ihm den Sattel, die Satteltaschen, das Zaumzeug und den Scabbard mit der Henry Rifle ab und trug alles in die Kammer.
Das Gespräch mit Sanaco hatte einen bitteren Geschmack bei ihm hinterlassen. Es würde gut sein, den mit ein oder zwei Whiskys hinunterzuspülen. Ben Drago verließ die Kammer, verriegelte sorgfältig die Tür und ging zudem Lehmziegelhaus hinüber.
Auf der Schwelle blieb er stehen und sah sich um. Der Raum war teils wie ein Handelsladen, teils wie ein Saloon eingerichtet. Ein langer Eichenholztisch ersetzte die Theke. Dahinter stand ein Regal mit Flaschen und Gläsern an der Wand. Außerdem gab es noch zwei, drei runde Holztische in diesem Teil des Raumes. An einem pokerten drei Männer, und einer von ihnen war Siringo. Der Revolvermann hob den Blick, als Drago eintrat, senkte ihn aber gleich wieder auf sein Blatt.
Die beiden anderen Spieler waren offensichtlich Büffeljäger. Sie waren unrasiert und trugen abgerissene, schmutzige Kleidung. Der rechts von Siringo saß, hatte eine fransenverzierte Lederjacke mit einem Wolfsfellkragen an, die mit Bisonblut und Bisonfett befleckt war. Aber jeder von ihnen hatte einen Armeecolt mit Holzgriff umgeschnallt und trug ein Bowiemesser in einer Lederscheide an einem Riemen um den Hals. Sharps Rifles lehnten neben ihnen, schwere, langläufige 52er Gewehre mit Fallblockverschluss und Klappvisier, die einen Büffel noch auf fünfhundert Schritt mit einem einzigen Schuss von den Beinen reißen konnten.
Ein weiterer Mann – ebenfalls ein Büffeljäger – lehnte an dem Tisch, der als Theke diente. Er hatte ein hageres, pferdeähnliches Gesicht mit eng zusammenstehenden Augen und trug zwei Colts in den Halftern überkreuzgeschnallter Revolvergürtel. Er war sichtlich betrunken.
»Viertausendfünfhundert Büffel habe ich allein im letzten Winter geschossen«, erklärte er dem Mann hinter der Theke mit dem selbstgefälligen, streitsüchtigen Lachen, das Betrunkenen eigen ist. »Die Felle haben beim Verkauf fast zwölftausend Dollar gebracht. Wir haben die Prärie mit Büffelkadavern übersät zurückgelassen. Das war in doppelter Hinsicht ein gutes Geschäft: Wir haben nicht nur viel Geld verdient, wir haben auch mitgeholfen, diese verdammten Indianer auszuhungern. General Sheridan hat vorgeschlagen, alle Büffeljäger mit einer Medaille auszuzeichnen, die auf der einen Seite einen toten Bison, auf der anderen einen fliehenden Indianer zeigt. Wir befreien das Land von dieser roten Pest, indem wir ihnen die Büffel wegschießen und sie so dem Hungertod ausliefern.«
»Whisky!«, sagte Ben Drago, der am anderen Ende des langen Eichenholztisches, so weit wie möglich von dem Betrunkenen entfernt, stehengeblieben war, zu dem Mann hinter der Theke, der kupferrotes Haar und blassblaue Augen hatte.
»Sind Sie der Mann, dem meine Tochter die Kammer neben dem Pferdestall zugewiesen hat?«, fragte der, nachdem er Ben Drago gemustert hatte. Nach seinen Worten zu urteilen, musste er der Indianerhändler Shaugnessy sein. Drago hatte einen sechsten Sinn für Ärger und drohende Gefahren – und er ahnte, dass ihm eins von beiden bevorstand.
»Und wenn es so wäre?«
»Ich will keinen Indianer unter meinem Dach haben«, erwiderte der Händler. »Satteln Sie Ihr Pferd, und reiten Sie weiter. Ich will Sie hier nicht mehr sehen, wenn der Tag anbricht.«
Ben Drago fühlte, wie ihm das Blut ins Gesicht stieg. Das geschah manchmal, wenn sein leicht verwundbarer Stolz verletzt wurde. Aber er bezwang sich.
»Ich habe einen Whisky verlangt«, entgegnete er. Beim Klang seiner Stimme, der zur Vorsicht riet, presste der Händler wütend die Lippen aufeinander, aber er stellte ein Glas und eine Flasche vor Ben Drago auf die Theke.
»He du!«, sagte der Büffeljäger zu ihm. »Das ist ein verdammt gutes Gewehr.« Er stellte seine Whiskyflasche weg und schlug mit der Hand auf den Kolben der Sharps Rifle, die vor ihm auf der Theke lag. »Damit habe ich einmal einen Indianer auf eineinhalb Meilen Entfernung vom Pferd geschossen. Für jeden roten Bastard, den ich abgeknallt habe, schnitt ich eine Kerbe in den Kolben.«
Drago warf einen Blick auf das Gewehr und zählte zwölf Kerben.
Er goss sich einen Whisky ein. Äußerlich bot er ein Bild vollkommener Ruhe. Nur wer ihn sehr gut kannte, hätte an der starren Reglosigkeit seines Gesichts ablesen können, was er in diesem Augenblick dachte, fühlte und empfand. Sanacos Worte fielen ihm wieder ein: Ein Indianer gilt den Weißen weniger als ein Hund. Langsam trank er seinen Whisky aus, aber die Schärfe des Alkohols vermochte nicht, den bitteren Geschmack des Zorns aus seinem Mund zu vertreiben.
»Dir haben sie wohl die Zunge abgeschnitten, weil du nicht antwortest«, sagte der Büffeljäger zu Ben Drago. Er leerte sein Glas, stellte es auf die Theke, warf ein paar Silbermünzen daneben, griff mit der Rechten nach seiner Sharps Rifle, mit der Linken nach der halb geleerten Whiskeyflasche und ging mit unsicheren Schritten auf die Tür zu. »Um das Fort treiben sich immer ein paar Indianersquaws herum, die ihr Lager für einen Silberdollar sogar mit dem Teufel teilen würden.«
»Wenn sie es tun«, sagte Ben Drago, »dann nur, weil sie Nahrung für ihre Kinder herbeischaffen müssen. Der Hunger treibt sie dazu, ihre Liebe an betrunkene Dreckskerle wie dich zu verkaufen.«
»Verdammt, das ist unmöglich!«, unterbrach eine zornige Stimme seine düsteren Gedanken. »Ich habe das Herz-As vorhin abgelegt. Wie kommt es jetzt in Ihren Straight Flush?«
Ben Drago drehte sich jetzt nach dem Tisch um, an dem die drei Pokerspieler saßen. Mitten auf dem Tisch lag eine Menge Geld. Fünf-, sechshundert Dollar, schätzte Ben Drago. Weitere Banknoten- und Silbermünzenstapel waren vor den drei Männern aufgetürmt – das meiste davon vor Siringo. Das Licht der tiefhängenden Petroleumlampe fiel direkt auf die Spieler.
»Wollen Sie behaupten, ich spiele falsch?«, fragte der Kopfgeldjäger kalt. Er musterte den Büffeljäger in der Lederjacke mit dem Wolfsfellkragen mit unbewegtem Gesicht. Seine Hände lagen auf der Tischkante, nur eine Spanne von den Colts entfernt. »Wenn Sie nicht verlieren können, sollten Sie sich nicht an einen Pokertisch setzen. Ich hatte es gar nicht nötig, zu betrügen. In meinem ganzen Leben bin ich noch nicht zwei so schlechten Spielern begegnet wie euch. Schluckt den Verlust und haut ab!«
»Ich hatte Sie die ganze Zeit über im Verdacht, zu betrügen«, sagte der Büffeljäger hitzig. »Aber verdammt will ich sein, wenn ich mir von einem hergelaufenen Revolvermann und Kartenhai die Taschen leeren lasse.«
»Nur zu, wenn Sie außer Ihrem Geld auch noch Ihr Leben verlieren wollen«, erwiderte Siringo. »Sie stehen schon mit einem Bein in der Hölle. Sie brauchen das andere nur noch nachzuziehen.«
»Du verfluchter…« Der Büffeljäger sprang auf. Polternd stürzte sein Stuhl um. Seine Hand fuhr zum Colt. Auch der Mann neben ihm griff zur Waffe. Aber Siringo war schneller. Nie zuvor hatte Ben Drago einen Mann so schnell ziehen sehen. Die silbernen Colts schienen Siringos Händen aus den Halftern heraus entgegen zu springen. Mit einer einzigen, flirrenden Bewegung huschten die Revolverläufe aus dem Leder und spien zwei rote Flammenzungen aus. Das Krachen der Schüsse ließ die Lehmziegelmauern erzittern.
Der Büffeljäger in der Lederjacke reckte sich hoch auf. Der Colt fiel ihm aus der Hand. Wie ein gefällter Baum stürzte er vornüber, prallte gegen den Tisch und riss ihn im Fallen um. Die Whiskeyflasche und die Gläser zersprangen auf dem Lehmboden in Scherben. Spielkarten und Dollarnoten flatterten nach allen Seiten.
Die Kugel aus dem Colt des zweiten Mannes blieb in der Tischplatte stecken. Siringos Blei war ihm in die Seite gefahren und hatte ihn halb um die eigene Achse gewirbelt. Als er den Revolverlauf abermals auf den Kopfgeldjäger richten wollte, krümmte dieser beide Finger um die Abzugshähne seiner silbernen Colts. Der Büffeljäger fiel auf die Knie. Sein zweiter Schuss ging in den Boden. Dann fiel er mit einem Seufzer aufs Gesicht.
In diesem Augenblick hörte Ben Drago ein Geräusch von der Tür her. Schnell wandte er den Kopf. Er sah den dritten Büffeljäger auf der Schwelle stehen, die Sharps Rifle auf Siringo gerichtet, der ihm den Rücken zuwandte. Der rechte Zeigefinger des Mannes zog bereits den Abzugshahn nach hinten.
Ben Dragos Hand zuckte zum Griff des Armeecolts. Er schoss einen Sekundenbruchteil schneller, bevor der Büffeljäger den Schuss aus seiner Sharps lösen konnte. Der Mann zuckte zusammen, als ihm das heiße Blei in die Brust fuhr. Dennoch drückte er ab. Die Sharps Rifle dröhnte, aber der Gewehrlauf war schon aus der Richtung geraten. Die Kugel schlug nur ein faustgroßes Loch in die Lehmziegelmauer. Der Büffeljäger sank mit verzerrtem Gesicht gegen den Türrahmen, rutschte an ihm herunter zu Boden, fiel zur Seite und blieb mit dem Gesicht nach unten liegen.
Siringo war herumgefahren, als der Schuss hinter ihm fiel. Doch als er sah, was geschehen war, wirbelte er die silbernen Colts an den Abzugsbügeln um die Zeigefinger und ließ sie in die Halfter gleiten.
»Leben um Leben«, sagte er zu Ben Drago. »Jetzt haben Sie Ihre Schuld beglichen.«
»Daran war mir gelegen«, erwiderte Drago und schob den Colt ins Leder. Dann ging er und hob die drei Sharps Rifles der Büffeljäger auf. Eine nach der anderen schmetterte er gegen die Wand, dass die Schäfte splitternd zerbrachen und die Kolben davonflogen.
»Ob Sie es wollen, oder nicht: Jede Ihrer Handlungsweise verrät Ihr indianisches Blut«, sagte Siringo, der ihm zugesehen hatte. »Sie haben eben ein paar von den Gewehren zerschlagen, mit denen die Büffel abgeschlachtet werden. Aber es gibt noch ein paar hundert andere – und die werden weiter schießen, bis der letzte Büffel von der Prärie verschwunden ist.«
Bevor Ben Drago zu einer Erwiderung ansetzen konnte, wurde die Tür aufgestoßen, und ein Sergeant, dem vier Kavalleristen mit Springfield-Armeekarabinern in den Händen folgten, trat über die Schwelle. Der Sergeant blickte von Siringo zu Drago und wieder auf den Kopfgeldjäger. Er schob den Armeecolt ins Halfter.
»Was, zum Teufel, ist hier geschehen?«, wollte er wissen.
Siringo hob mit einem abschätzigen Lächeln die Schultern.
»Es hat einen Streit beim Pokern gegeben, Sergeant«, erwiderte er. »Der Händler«, er deutete auf Shaugnessy, der sich in seiner Rolle als Zeuge offensichtlich nicht sehr wohl fühlte, »kann bezeugen, dass die Büffeljäger als erste zum Colt gegriffen haben. Aber keine Angst: Diese Burschen haben genug Geld in den Taschen, um selbst ihr Begräbnis zu bezahlen. Der Armee werden dadurch keine Kosten entstehen.«
*
Etwa eine halbe Stunde später verließen Ben Drago und Siringo das Office des Provost-Marshals, der die Polizeigewalt innerhalb des Forts ausübte. Shaugnessy hatte als Zeuge ausgesagt, und dem Marshal war nichts anderes übriggeblieben, als die beiden Männer freizulassen. Er hatte ihnen aber auferlegt, Fort Sill bis zum Mittag des folgenden Tages zu verlassen. Sollten sie aber bis dahin noch innerhalb der Grenzen des Militärpostens angetroffen werden, mussten sie mit einer Gefängnisstrafe von dreißig Tagen rechnen.
»Ich möchte einen Whisky für Sie ausgeben«, sagte Siringo, während sie den Paradeplatz überquerten.
»Sie schätzen den Wert Ihres Lebens verdammt gering ein«, antwortete Ben Drago. Das waren fast die gleichen Worte, die der Kopfgeldjäger zu ihm gesagt hatte, nachdem er ihm in dem zerstörten Comanchenlager das Leben gerettet hatte. Siringo lächelte wie ein Wölf, der seine Zähne zeigt.
»Es darf auch eine ganze Flasche sein. Oder zwei.«
»Danke«, sagte Ben Drago, »aber ich habe genug für heute. Im Übrigen wissen Sie doch: Der Verkauf von Whisky an Indianer ist verboten.«
»Sie sind nur zu einer Hälfte ein Kiowa. Aber seit wir uns zum ersten Mal begegneten, habe ich mich gefragt, wie ein Halbindianer zum Revolvermann werden konnte.«
»Vielleicht haben Sie recht«, meinte Siringo. »Aber Sie sind ein guter Mann und verdammt schnell mit dem Colt, soviel weiß ich jetzt. Sollten wir uns noch einmal begegnen, stehen wir hoffentlich auf derselben Seite – sonst wird einer von uns sterben müssen. Und ich würde Sie ungern töten.«
Nachdenklich kehrte Ben Drago zur Handelsstation zurück. Als er sich dem Lehmziegelhaus näherte, hörte er die Stimmen eines Mannes und einer Frau. Es waren Shaugnessy und seine Stieftochter, zwischen denen ein heftiger Streit im Gange zu sein schien.
»… du hast immer nur Verachtung für die Indianer übrig gehabt und sie jedes Mal, wenn du mit ihnen gehandelt hast, zu deinem Vorteil betrogen«, hörte Drago Gwyneth rufen. »Du hast an ihnen gehandelt wie an meiner Mutter. Für sie hast du dich geschämt, aber für dein Bett schien sie dir gut genug. Du hast sogar zwei Winchester-Gewehre und ein Fass Whiskey für sie gegeben. Doch als du ihrer überdrüssig warst, hast du ihr so lange deine Verachtung gezeigt, bis sie vor Scham darüber, dass sie ein Kind von einem Comanchen hatte, ihrem Leben mit einer Kugel ein Ende setzte.«
»Ich habe nicht verdient, dass du so zu mir sprichst«, entgegnete Shaugnessys Stimme. »Habe ich mich nicht immer um dich gekümmert und versucht, dir den rechten Weg zu weisen? Ich wollte doch nur, dass du dich von den Indianern fern hältst. Du solltest als eine Weiße aufwachsen …«
»Du wirst dich damit abfinden müssen, dass ich einen Comanchen liebe«, unterbrach ihn Gwyneth. »Ich werde in meinem Leben keinem anderen Mann angehören als ihm.«
Eine Weile war es still, dann sagte Shaugnessy mit schwerfällig klingender Stimme: »Bevor ich zulasse, dass du die Squaw eines verdammten Indianers wirst, schlage ich dich tot.«
Ben Drago trat an eine der Fensterluken und blickte in das Innere des Handelsladens. Der Raum war leer bis auf zwei Menschen. Shaugnessy, der Ire, stand mit geballten Händen vor der Theke. Ihm gegenüber stand Gwyneth, das schöne dunkelhaarige Mädchen. Sie hielt eine Winchester im Hüftanschlag, und ihr Finger lag so hart am Abzug, dass ein winziger Ruck genügt hätte, um den Schuss zu lösen.
»Ich werde dich verlassen, noch heute Nacht«, sagte das Mädchen. »Versuche nicht, mich aufzuhalten.«
Shaugnessy wollte einen Schritt auf Gwyneth zu tun, doch die Winchestermündung hielt ihn zurück.
»Wohin willst du gehen?«, fragte er rau.
»Zu meinem eigentlichen Volk, zu den Comanchen«, erwiderte sie. »Denn zu ihnen gehöre ich.«
»Du bist wie deine Mutter«, murmelte der Händler. »Auch sie hat sich immer nach dem Leben bei den Indianern zurückgesehnt. Sie hat es mir nie gesagt, aber ein Mann spürt so etwas.«
Gwyneth öffnete die Tür, indem sie mit einer Hand hinter sich griff, ohne die Winchestermündung zu senken, trat rücklings über die Schwelle und lief auf den Stall zu, ohne Ben Drago zu bemerken, der nur wenige Schritte von ihr entfernt stand. Shaugnessy wollte hinter ihr her, doch dann schien er sich eines Besseren zu besinnen. Er kehrte zur Theke zurück, griff nach einer Whiskeyflasche, setzte sie an den Mund und trank sie in einem Zug zur Hälfte leer.
*
Ein Trompetensignal riss ihn aus dem Schlaf. Wie immer war Ben Drago beim ersten Anzeichen von Gefahr sofort hellwach. Während er sich auf seinem Lager aufrichtete, dröhnte draußen ein Kanonenschuss, der die Garnison von Fort Sill alarmierte. Durch die einzige, kleine Fensterluke der Kammer drang roter Feuerschein herein. Mit einem gemurmelten Fluch schlüpfte Ben Drago in Hemd und Mokassins, griff nach dem Revolvergürtel und schnallte ihn im Hinauslaufen um.
Der Nachthimmel über Fort Sill war blutrot erhellt. Lodernde Flammen schlugen aus einem Pferdestall westlich des Paradeplatzes. Der Wind wirbelte grauen Rauch in Dragos Richtung. Dunkle Gestalten liefen vor dem Hintergrund des Feuers hin und her. Soldaten drangen in den brennenden Stall ein, um die Kavalleriepferde aus den Flammen zu retten. Gleich darauf galoppierten die ersten Here wiehernd, schnaubend und keilend aus dem rauchverhüllten Stalltor.
Eine Kette von Männern bildete sich zwischen dem Brunnen und dem Stall. Wassereimer wanderten von Hand zu Hand. Doch der Brand war schon zu weit fortgeschritten, als dass er noch einzudämmen gewesen wäre.
Ben Drago wusste, wie leicht Feuer in einem Stall ausbrechen konnte, bei all dem Heu, Stroh und trockenem Holz, das sich darin befand. Eine umgestürzte Laterne reichte aus, um solch ein Gebäude im Nu in Flammen aufgehen zu lassen. Aber Ben Drago glaubte nicht an einen zufälligen Unglücksfall – nicht hier und jetzt.
Er drängte sich zwischen den Soldaten hindurch, die aus allen Richtungen zusammenströmten, und lief auf das Wachhaus zu. Plötzlich sah er im flackernden Feuerschein Gwyneth Shaugnessy neben einem Schuppen. Sie saß zu Pferde und hielt ein zweites Tier am Zügel. Das Pferd war gesattelt, eine Winchester steckte im Scabbard, am Sattelhorn hingen ein Revolvergurt mit leerem Halfter, zwei weitere Patronengürtel und ein aus Ziegenleder gefertigter Comanchen-Wassersack. Die Aufmerksamkeit des Mädchens richtete sich auf das Wachhaus, das nur etwa hundert Schritte entfernt lag.
Im selben Augenblick hörte Ben Drago von dort eine Reihe dicht aufeinanderfolgender Schüsse, denen ein Schrei folgte. Nur Sekunden später tauchte eine Gestalt aus der Dunkelheit auf. Metall blinkte silbrig. Es war ein Comanche, der einen alten, spanischen Brustpanzer trug – der Schwarze Falke. Er hielt einen rauchenden Colt in der Rechten. Dann entdeckte er Ben Drago und schoss sofort auf ihn. Drago hörte die Kugel eine Handbreit neben seinem Gesicht vorbei pfeifen.
Noch während er sich zu Boden fallen ließ, fuhr seine Hand zum Griff des Armeecolts. Die Waffe zuckte aus dem Halfter und spie eine rote Flammenzunge aus. Die Kugel traf. Es klang, als hätte Drago auf eine Glocke geschossen. Die Kugel prallte am Brustpanzer ab. Der Comanche wurde um seine Achse gewirbelt und stürzte in den Staub. In diesem Moment galoppierten Pferde, die gerade aus dem brennenden Stall ausgebrochen waren, zwischen den beiden Männern hindurch.
Ben Drago sprang auf, doch als sich der Staub, den die Pferdehufe aufgewirbelt hatten, legte, sah Drago nur noch zwei Reiter in wildem Galopp in der Dunkelheit verschwinden.
Er ging zum Wachhaus hinüber. Eine der Zellentüren, die alle direkt ins Freie führten, stand offen. Schloss und Riegel waren durch Schüsse aus der Zelle heraus aufgesprengt. Vor der Tür lag ein Wachposten, ein Kugelloch in der Brust, ein zweites in der Stirn. Die übrigen Gefangenen befanden sich noch in ihren Zellen. Ben Drago konnte ihre Gesichter hinter den vergitterten Luken sehen. Er schob den Colt ins Halfter, als mehrere Männer aus der Dunkelheit auftauchten. Es waren Lieutenant Parke Stobo und ein halbes Dutzend Kavalleristen. Der Offizier warf einen Blick in die leere Zelle.
»Der Gefangene hat die durch den Brand entstandene Verwirrung benutzt, um auszubrechen. Was meinen Sie?«, fragte er Drago.
Der schüttelte den Kopf.
»Sie werden nie lernen, wie ein Indianer zu denken, Lieutenant«, antwortete er. »Das Feuer ist gelegt worden, um dem Schwarzen Falken die Flucht zu ermöglichen. Außerdem muss ihm jemand zuvor einen Colt zugesteckt haben, denn das Schloss der Zellentür ist von der Innenseite her zerschossen worden.«
»Wer könnte so etwas getan haben?«, fragte Stobo. »Doch nur einer von diesen verdammten Comanchen. Dabei hatte der Wachtposten Befehl, keinen Indianer an die Zellentüren heranzulassen.«
»Lieutenant, Sir«, sagte einer der Soldaten, »ich habe den Gefangenen fliehen sehen. Es war eine Frau bei ihm. Ich glaube, die Tochter von Shaugnessy erkannt zu haben.«
»Ist das wahr?«, fragte Stobo Ben Drago. »Sie waren dem Wachhaus am nächsten, als der Indianer ausbrach. Sie müssen doch gesehen haben, wer ihm half.«
»Lieutenant«, entgegnete Drago mit einem Achselzucken, »es ist Nacht, die Luft ist voll Staub und Rauch, überall galoppieren scheuende Pferde herum. Ich habe nicht allzu viel gesehen.«
Stobo maß ihn mit einem Blick, der deutlich zum Ausdruck brachte, dass er ihm nicht glaubte. Aber er musste hinnehmen, was Ben Drago behauptete. Auch wenn es ihm nicht gefiel.
In der Zwischenzeit hatten sich immer mehr Soldaten vor dem Wachhaus gesammelt. Ein Mann drängte sich durch ihre Reihen. Es war Shaugnessy, der Händler.
»Sind Sie sicher, dass meine Tochter es war, die Sie gesehen haben?«, fragte er den Kavalleristen, der mit Stobo gesprochen hatte. Der Soldat nickte.
»Ich war zwar ein ganzes Stück weit weg, aber es war Ihre Tochter, das kann ich beschwören.«
Shaugnessys Gesicht zuckte. Er ballte die Hände zu Fäusten, wandte sich ab, als wollte er gehen, blieb dann aber stehen, drehte sich noch einmal um und sagte mit mühsam beherrschter Stimme: »Wenn jemand bereit ist, mir das Mädchen zurückzubringen, zahle ich ihm tausend Dollar dafür.«
»Wenn Sie zweitausend bieten, bringe ich Ihnen Ihre Tochter wieder, Shaugnessy«, sagte da eine Männerstimme. Ben Drago wandte den Kopf und sah Siringo groß, schwarz und hager zwischen den Soldaten auftauchen. Sporenklirrend trat der Kopfgeldjäger näher und blieb vor dem Händler stehen, beide Hände auf die Elfenbeingriffe seiner tief geschnallten silbernen Colts gestützt. Seine gelben Wolfsaugen funkelten unheilvoll im flackernden Licht des fernen Brandes. Shaugnessy zögerte. Siringo, der düster und drohend wie der Tod wirkte, schien ihm Angst einzuflößen, doch dann nickte er.
»Ich bezahle Ihnen zweitausend Dollar, aber dafür will ich nicht nur das Mädchen, sondern auch den Skalp dieses verdammten Comanchen«, sagte er heiser und hasserfüllt.
Siringo lächelte wie ein Dämon aus den Tiefen der Hölle.
»Ich bringe Ihnen beides«, versprach er, »das Mädchen und den Skalp.«
Doch als er sich umdrehte, um wegzugehen, griff Ben Drago nach seinem Arm und hielt den Kopfgeldjäger fest.
»Tun Sie’ s nicht«, sagte er. »Sie sind ein Weißer. Und wenn ein Weißer den Schwarzen Falken tötet, wird es unter den Comanchen einen Aufstand geben, der das ganze Land verwüstet. Hunderte von Menschen werden sterben müssen. Dafür sind zweitausend Dollar ein erbärmlich geringer Lohn.«
»Warum haben Sie denn Shaugnessys Angebot nicht angenommen? Sie sind doch ein halber Kiowa. Wenn ein Indianer den anderen tötet, würde es bestimmt keine Rebellion unter den Comanchen geben«, erwiderte der Kopfgeldjäger kalt, löste sich von Drago und tauchte zwischen den umstehenden Soldaten unter.
»Shaugnessy, verdammt, widerrufen Sie Ihren Auftrag«, forderte Ben Drago von dem Händler, »Sie wissen genau, welches Unheil daraus entstehen wird, wenn Siringo den Schwarzen Falken erschießt. Außerdem hat er bestenfalls eine Chance von eins zu tausend, das Mädchen lebend zurückzubringen. Die Comanchen haben die Angewohnheit, ihre weißen Gefangenen zu töten, bevor sie befreit werden können.«
»Gwyneth ist überhaupt keine Gefangene«, gab Shaugnessy zurück, ohne Ben Drago dabei ins Gesicht zu sehen. »Sie ist freiwillig mit dem Indianer gegangen. Sie ist genauso verdorben, wie ihre Mutter es war. Die wäre mir auch davongelaufen und zu den Indianern zurückgekehrt, wenn ich sie nicht jede Nacht neben mir im Bett festgebunden hätte.«
Nach diesen Worten wandte der Händler Drago den Rücken zu und ging weg. Ben Drago kehrte in seine Kammer zurück, verschnürte seine Deckenrolle und packte seine wenigen Habseligkeiten in die Satteltaschen. Dann ging er in den Stall, sattelte den Pinto und befestigte die beiden Büffelfellbündel hinter dem Sattel, in denen er seine indianischen Waffen und die Kriegsfederhaube aufbewahrte. In der Kammer warf er einen Dollar auf den Boden – für das Nachtquartier. Er führte den Hengst aus dem Stall über den Paradeplatz und band ihn vor dem Hauptquartier an. Er trat ein, ohne anzuklopfen.