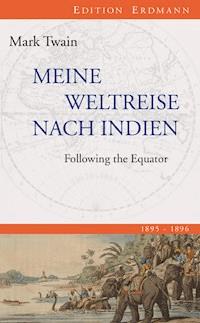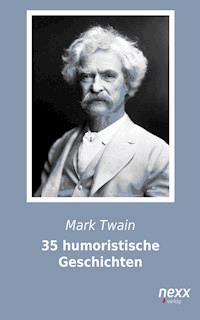
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NEXX
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Genießen Sie die Erzählkunst Mark Twains in 35 kurzweiligen Geschichten aus seinem Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mark Twain
35 humoristische Geschichten
Impressum
Covergestaltung: nexx verlag gmbh, 2017
ISBN/EAN: 9783958706248
2. Auflage
Rechtschreibung und Schreibweise des Originaltextes wurden behutsam angepasst.
www.nexx-verlag.de
Meine Uhr
Meine schöne neue Uhr ging nun schon anderthalb Jahre weder vor noch nach, sie war kein einziges Mal stehen geblieben und an dem Werk war nichts zerbrochen. Nunmehr galt mir ihr Urteil über die Tageszeit für völlig untrüglich, ihre Lebenskraft und ihr Knochenbau für unzerstörbar. Aber endlich ließ ich sie eines Abends doch ablaufen. Ich trauerte darüber, als sei dies Versehen ein Vorbote von kommendem Unheil und Missgeschick. Erst allmählich wurde meine Stimmung wieder heiterer, ich zog die Uhr auf, stellte sie nach Gutdünken und schlug mir alle abergläubigen Gedanken und trüben Ahnungen aus dem Sinn.
Am nächsten Morgen trat ich in den Laden des ersten Uhrmachers der Stadt, um meine Uhr genau nach richtiger Zeit zu stellen. Der Herr nahm sie mir aus der Hand, um dies Geschäft für mich zu besorgen.
»Sie geht vier Minuten nach,« sagte er dabei, »der Regulator muss vorgerückt werden.«
Ich versuchte ihn daran zu hindern, versuchte ihm begreiflich zu machen, dass der Gang der Uhr unübertrefflich sei. Vergebens – der Kohlkopf in Menschengestalt sah nur das eine: die Uhr ging vier Minuten nach und der Regulator musste vorgestellt werden. Ich bat und flehte, er solle es nicht tun, ich sprang in meiner Seelenpein um ihn herum, aber alles umsonst. Mit kaltblütiger Grausamkeit vollbrachte er die schändliche Tat.
Von da ab begann meine Uhr zu laufen – schneller und schneller, Tag für Tag. Innerhalb einer Woche geriet sie in ein wahres Fieber, ihr Puls stieg bis auf hundert und fünfzig Grad im Schatten. Noch ehe zwei Monate zu Ende waren, hatte sie alle Uhren der Stadt weit hinter sich gelassen und war dem Kalender vierzehneinhalb Tage voraus. Noch hing das bunte Oktoberlaub an den Bäumen und sie tummelte sich schon mitten im Novemberschnee. Die Zahltage für die Hausmiete, für alle fälligen Rechnungen und sonstigen Schulden kamen in so wahnsinniger Hast näher, dass ich mir schier kaum mehr zu helfen wusste. So brachte ich sie denn zum Uhrmacher, um sie regulieren zu lassen. Dieser fragte mich, ob sie schon jemals repariert worden sei. Als ich das mit dem Bemerken verneinte, es sei noch nicht nötig gewesen, glitt ein boshaftes Lächeln über seine Züge. Gierig öffnete er die Uhr, guckte hinein, klemmte sich ein Ding ins Auge, das aussah wie ein kleiner Würfelbecher und betrachtete das Räderwerk genau.
»Sie muss gereinigt und geölt werden,« sagte er, »und außerdem reguliert; – fragen Sie in einer Woche wieder nach.«
Gereinigt, geölt und reguliert war meine Uhr; aber nun ging sie schrecklich langsam, ihr Ticken klang wie Grabgeläute. Ich versäumte alle Eisenbahnzüge, hielt keine meiner Verabredungen ein und kam wegen Verspätung um mein Mittagessen. Allmählich machte meine Uhr aus drei Tagen vier; zuerst wurde es bei mir gestern, dann vorgestern, dann letzte Woche; ich geriet immer weiter ins Hintertreffen und konnte mich nicht mehr in die jetzige Welt finden.
Wieder begab ich mich zum Uhrmacher. Er nahm in meinem Beisein die Uhr ganz auseinander und sagte, der Zylinder sei »gequollen«, in drei Tagen könne er ihn aber wieder auf das richtige Maß bringen.
Hierauf ging die Uhr im Durchschnitt gut, aber auch nur im Durchschnitt. Den halben Tag lang raste sie wie im Donnerwetter unter fortwährendem Schnarren, Quieken, Schnauben und Schnaufen, so dass ich vor dem Lärm meine eigenen Gedanken nicht hören konnte. Keine Uhr im ganzen Land hätte vermocht sie einzuholen in ihrem tollen Lauf. Den Rest des Tages blieb sie allmählich immer mehr zurück und trödelte derart, dass sie ihren ganzen Vorsprung einbüßte und sämtliche Uhren ihr wieder nachkamen. Einmal in vierundzwanzig Stunden war sie aber ganz auf dem richtigen Fleck und gab die Zeit genau an. Dies hielt sie pünktlich ein und niemand hätte daher behaupten können, sie tue weniger als ihre Pflicht und Schuldigkeit, oder mehr.
An die Tugend einer Uhr stellt man jedoch höhere Ansprüche, als dass sie nur im Großen und Ganzen richtig geht. Ich trug sie daher abermals zum Uhrmacher. Er sagte, der Hauptzapfen wäre zerbrochen und ich sprach ihm meine Freude darüber aus, dass der Schaden nicht größer sei. Offen gestanden hatte ich noch nie etwas von einem Hauptzapfen gehört, aber ich wollte mich doch einem Fremden gegenüber nicht unwissend zeigen. Der Zapfen wurde ausgebessert, aber das half nur wenig. Die Uhr ging jetzt eine Weile und dann blieb sie wieder eine Weile stehen, ganz nach ihrem Belieben. Jedes Mal, wenn sie losging, tat sie einen Rückschlag wie eine Muskete. Ein paar Tage lang wattierte ich mir die Brusttasche aus, schließlich trug ich die Uhr aber zu einem andern Uhrmacher. Der zerpflückte sie in lauter einzelne Stücke, drehte die Trümmer vor seinem Vergrößerungsglas hin und her und meinte, es müsse an der Hemmung etwas nicht in Ordnung sein. Das besserte er aus und setzte die Uhr wieder zusammen. Nun ging sie gut – nur alle zehn Minuten schlossen sich die Zeiger wie eine Schere und machten die Runde gemeinsam weiter.
Der Weiseste unter den Menschenkindern würde von solcher Uhr nicht herauskriegen können was die Glocke geschlagen hat. Ich ging also wieder hin, um dem Übelstand abhelfen zu lassen. Jetzt meinte der Mensch, der Kristall sei verbogen und die Spiralfeder krumm, auch müsse ein Teil des Werkes neu gefüttert werden. Alle diese Schäden beseitigte er und meine Uhr ließ nun nichts zu wünschen übrig, nur dann und wann, nachdem sie etwa acht Stunden regelmäßig gegangen war, geriet bei ihr inwendig alles in Bewegung, so dass sie zu summen begann wie eine Biene und die Zeiger sich stracks so flink im Kreise drehten, dass man sie nicht mehr unterscheiden konnte, sie sahen aus wie ein zartes Spinngewebe auf dem Zifferblatt. In sechs oder sieben Minuten hatte sie die ganzen nächsten vierundzwanzig Stunden durchwirbelt, dann gab es einen Krach und sie stand still. Mit schwerem Herzen ging ich wieder zu einem andern Uhrmacher und sah wie er das Werk auseinander nahm. Dabei rüstete ich mich, ein Kreuzverhör mit ihm anzustellen, denn das Ding war mir jetzt über den Spaß. Ursprünglich hatte die Uhr zweihundert Dollar gekostet und ich musste jetzt für Reparaturen zweitausend bis dreitausend ausgegeben haben. Während ich so dastand und dem Mann zusah, kam er mir plötzlich bekannt vor. Nein, ich irrte mich nicht – der Uhrmacher war ein früherer Dampfbootmaschinist und zwar nicht einmal ein guter. Er betrachtete alle Teile sorgfältig, gerade wie die andern Uhrmacher auch und fällte dann seinen Urteilsspruch mit derselben Zuversicht.
Er sagte: »Sie macht zu viel Dampf – wir müssen den stellbaren Schraubenschlüssel an das Sicherheitsventil hängen!«
Ich schlug ihm auf der Stelle den Schädel ein und ließ ihn auf meine Kosten beerdigen.
Mein Onkel William (Gott hab' ihn selig!) pflegte zu sagen, ein gutes Pferd sei ein gutes Pferd, bis es einmal durchgegangen wäre, und eine gute Uhr eine gute Uhr, bis sie den Reparierern in die Hände fiele. Er zerbrach sich oftmals den Kopf, was denn eigentlich aus allen verdorbenen Kesselflickern, Büchsenmachern, Schustern, Grobschmieden und Maschinisten in der Welt schließlich würde – aber niemand konnte ihm je Auskunft geben.
Einiges über Barbiere
Alle Dinge sind dem Wechsel unterworfen, ausgenommen die Barbiere, die Gewohnheiten der Barbiere und die Umgebungen der Barbiere. Diese ändern sich nie. Was man erlebt und erfährt, wenn man zum ersten Mal eine Barbierstube betritt, das erlebt und erfährt man später in allen andern Barbierstuben, bis an das Ende seiner Tage.
Heute Morgen ließ ich mich wie gewöhnlich rasieren. Ein Mann kam von der Jones Street auf die Tür zu, als ich auf der Hauptstraße herankam – so trifft sich das stets. Ich beschleunigte meine Schritte, aber umsonst; er war mir um eine Sekunde voraus, ich folgte ihm auf den Fersen und sah, wie er den einzigen unbesetzten Stuhl einnahm, wo der erste Barbier sein Amt versah. Das trifft sich immer so. Ich setzte mich mit der stillen Hoffnung nieder, Erbe des Stuhles zu werden, welcher dem besseren von den zwei übrigen Barbiergehilfen gehörte, denn dieser hatte schon angefangen seinem Kunden das Haar zu kämmen, während sein Kamerad noch damit beschäftigt war, dem seinigen die Locken einzuölen und einzureiben. In großer Spannung beobachtete ich, was für Aussichten sich mir boten. Als ich sah, dass Nr. 2 drohte Nr. 1 einzuholen, verwandelte sich meine Spannung in Besorgnis. Als Nr. 1 einen Augenblick innehielt, um einem neuen Ankömmling, der ein Badeticket verlangte, Geld herauszugeben und dabei im Wettlauf zurückblieb, wurde meine Besorgnis zur Angst. Als Nr. 1 das Versäumte wieder nachholte und gleichzeitig mit seinem Kameraden, dem Kunden das Handtuch abnahm und das Pulver aus dem Gesicht wischte, so dass sich unmöglich voraussehen ließ, welcher von beiden zuerst: »Der nächste!« rufen würde – stockte mir der Atem vor banger Erwartung. Als ich nun aber sah, wie sich Nr. 1 im entscheidenden Moment noch damit aufhielt, seinem Kunden ein paarmal mit dem Kamm durch die Augenbrauen zu fahren, da wusste ich, dass er den Wettlauf um dieses einzigen Augenblicks willen verloren habe. Entrüstet stand ich auf und verließ den Laden, um nicht Nr. 2 in die Hände zu fallen; denn, jene beneidenswerte Festigkeit besitze ich nicht, die den Menschen in den Stand setzt, einem dienstbereiten Barbiergehilfen ruhig ins Angesicht zu sehen und ihm zu sagen, man wolle auf den Stuhl seines Kollegen warten.
Etwa fünfzehn Minuten blieb ich draußen und kam dann wieder zurück, in der Hoffnung, es werde mir besser glücken. Natürlich waren jetzt alle Stühle besetzt und vier Männer warteten schweigend, ungesellig, zerstreut und mit gelangweilten Mienen, wie das immer der Fall ist, wenn Leute in einer Barbierstube darauf passen, dass die Reihe an sie kommt.
Ich ließ mich auf einem steinharten alten Sofa nieder und vertrieb mir eine Weile die Zeit damit, die eingerahmten Anzeigen verschiedener Quacksalber zu lesen, die ihre Haarfärbemittel anpriesen. Dann las ich die fettigen Namen auf den Branntweinflaschen, welche einzelnen Kunden angehörten und las auch die Namen und Zahlen auf den Barbierbecken, die als Privateigentum in den offenen Fächern des Schrankes standen, studierte die beschmutzten und schadhaften wohlfeilen Bilder an den Wänden, welche Schlachten darstellten, ehemalige Präsidenten, wollüstig zurückgelehnte Sultaninnen und das langweilige, ewig wiederkehrende Mädchen, das des Großvaters Brille aufsetzt. Auch verfluchte ich in meinem Herzen den lustigen Kanarienvogel und den unausstehlichen Papagei, die selten in einer Barbierstube fehlen. Zuletzt suchte ich mir aus den vorjährigen illustrierten Zeitungen, welche auf dem schmutzigen Mitteltisch herumlagen, die am wenigsten zerlesene heraus und starrte die unerhört falschen Abbildungen alter, vergessener Ereignisse an, die sie enthielt.
Endlich kam ich an die Reihe. Eine Stimme rief: »Der nächste!« und ich geriet natürlich in die Hände von – Nr. 2. So geht es immer. Ich äußerte schüchtern, dass ich Eile habe, was ihm einen gerade so tiefen Eindruck machte, als hätte er es nie gehört. Er schob mir nun den Kopf in die Höhe und legte mir eine Serviette unters Kinn. Er fuhr mir mit den Fingern in den Halskragen und stopfte ein Handtuch hinein. Er grub seine Klauen in mein Haar und sagte, es müsse beschnitten werden. Ich erwiderte, ich wolle es nicht schneiden lassen. Nun wühlte er wieder darin und meinte, es sei für die jetzige Mode ziemlich lang, besonders hinten; es müsse durchaus unter die Schere. Ich sagte, es wäre erst vor einer Woche geschnitten worden. Darauf sann er einen Augenblick gedankenvoll nach und fragte dann mit verächtlicher Miene, wer es besorgt habe. »Sie!« antwortete ich schnell. Da war er in der Falle.
Nun fing er an den Seifenschaum zu rühren und sich dabei im Spiegel zu besehen; von Zeit zu Zeit hielt er inne und trat näher herzu um sein Kinn in Augenschein zu nehmen und einen kleinen Pickel zu besichtigen. Dann seifte er mir eine Seite des Gesichts gründlich ein und wollte eben die andere in Angriff nehmen, als zwei sich beißende Hunde seine Aufmerksamkeit fesselten. Er lief ans Fenster, blieb da stehen bis der Kampf vorbei war und verlor beim Wetten über den Ausgang zwei Schillinge an die andern Barbiergehilfen, was mir große Befriedigung gewährte. Nun strich er mir die Seife vollends mit dem Pinsel auf und begann sie mit der Hand einzureiben.
Dann schärfte er sein Rasiermesser auf einem alten Hosenträger, wobei ihn ein lebhaftes Gespräch über den öffentlichen Maskenball sehr aufhielt, bei dem er am Abend zuvor in rotem Kattun und falschem Hermelin eine Art König dargestellt hatte. Dass seine Kameraden ihn mit einem Dämchen aufzogen, welches er durch seine Reize erobert haben sollte, schmeichelte ihm sehr und er trachtete die Unterhaltung auf jede Weise fortzusetzen, indem er sich stellte, als ärgere ihn die Neckerei. Dies trieb ihn auch zu einer abermaligen genauen Betrachtung seiner Person im Spiegel; er legte das Rasiermesser hin, bürstete sich das Haar mit großer Umständlichkeit, klebte sich eine kühne Locke vorn im Bogen auf die Stirn, machte sich hinten einen wundervollen Scheitel und strich sich beide Seitenflügel mit genauster Sorgfalt über die Ohren. Inzwischen trocknete mir der Seifenschaum im Gesicht und zehrte mir förmlich am Leben.
Nunmehr begann er mich zu rasieren. Er drückte mir mit den Fingern im Gesicht herum, um die Haut auszudehnen und warf meinen Kopf hin und her, wie es ihm beim Barbieren bequem war. Solange er nur die weniger empfindlichen Stellen berührte, litt ich keine Schmerzen, als er aber an meinem Kinn herum zu kratzen, zu scharren und zu schaben anfing, kam mir das Wasser in die Augen. Nun brauchte er meine Nase als Anfasser, um die Winkel meiner Oberlippe besser rasieren zu können. Bei diesem Anlass machte ich die Entdeckung, dass es zu seinen Obliegenheiten im Laden gehörte, die Petroleumlampen zu reinigen. Ich hatte mich oft schon aus Langeweile gefragt, ob das wohl der Geschäftsinhaber selber besorge, oder die Barbiergehilfen.
Indessen vergnügte ich mich damit mir auszudenken, wo er mich heute wohl schneiden werde; ich hatte es jedoch hierüber noch zu keiner Entscheidung gebracht, als er mir zuvorkam und mir das Kinn aufritzte. Sogleich begann er sein Messer zu schärfen – das hätte er vorher tun sollen. Ich mag nicht zu dicht an der Haut rasiert sein, daher wollte ich ihn nicht zum zweiten Mal an mich kommen lassen und versuchte ihn zu überreden, das Rasiermesser fortzulegen, aus Angst, er möchte an die Seite meines Kinns geraten, wo meine allerempfindlichste Stelle ist, die kein Messer zum zweiten Mal berühren darf ohne Schaden anzurichten. Er sagte, er müsse nur noch einige Rauheiten glätten, aber ehe ich mich's versah, fuhr er schon über den verbotenen Grund und Boden hin und das gefürchtete Brennen und Prickeln meiner Haut begann sich, wie gerufen, bemerklich zu machen. Nun tauchte er das Handtuch in Lorbeerbranntwein und klatschte mir damit ins Gesicht, bald hier bald da – ein widerliches Gefühl! Hat sich wohl je ein menschliches Wesen auf solche Weise gewaschen? Dann nahm er das trockene Ende des Handtuchs und schlug mir auch dieses ins Gesicht, als ob ein Menschenkind sich jemals so abtrocknete! Aber ein Barbier reibt einen nur selten ordentlich ab wie ein Christenmensch. Dann goss er mir Branntwein auf die wunde Stelle, verklebte sie mit Stärkemehl, feuchtete sie wieder mit Branntwein an und würde gewiss in alle Ewigkeit mit Kleben und Anfeuchten fortgefahren haben, wenn ich mich nicht dagegen aufgelehnt und ihn ersucht hätte, es bleiben zu lassen.
Er puderte mir nun das ganze Gesicht ein, richtete mich in die Höhe, wühlte nachdenklich mit den Händen in meinem Haar und schlug vor, mir die Kopfhaut gründlich zu waschen, das sei ganz notwendig, ganz notwendig! Ich entgegnete, dass ich mir erst gestern im Bad das Haar tüchtig gereinigt hätte. Da war er wieder in der Falle.
Hierauf empfahl er mir »Smiths Haarverschönerungstinktur« und bot mir eine Flasche zum Kauf an. Das schlug ich aus. Nun pries er mir »Jones' Wonne des Toilettentisches« und wollte mir von diesem neuen Wohlgeruch ein Gläschen verkaufen. Aber ich ging nicht darauf ein. Er drang endlich in mich, ein grässliches Mundwasser seiner eigenen Erfindung mitzunehmen.
Nachdem auch dieser letzte Versuch fehlgeschlagen war, ging er wieder an sein Geschäft, bestreute mich über und über mit Puder, mit Einschluss der Beine, fettete mir die Haare ein, obgleich ich Einsprache dagegen erhob, zog und riss mir dabei eine Menge mit der Wurzel aus, kämmte und bürstete dann den Rest, teilte mir hinten einen Scheitel ab und klebte mir die unvermeidliche, bogenförmige Haarlocke auf die Stirn. Während er mir dann meine dünnen Augenbrauen auskämmte und mit Pomade beschmierte, erging er sich über die Leistungen eines ihm gehörigen schwarz und braun gefleckten Dachshundes bis ich das Pfeifen des Mittagszuges hörte und wusste, dass ich zu demselben fünf Minuten zu spät ankommen würde. Nun nahm er mir das Handtuch ab, wischte mir damit noch einmal über das Gesicht, fuhr mir wieder mit dem Kamm durch die Augenbrauen und rief munter: »Der Nächste!«
Wie ein Schnupfen kuriert wird
Es ist zwar etwas Gutes für die Unterhaltung des Publikums zu schreiben, aber etwas noch weit Höheres und Edleres ist es, wenn man zur Belehrung, zum Nutzen, zum wahren Wohl seiner Mitmenschen schreibt – und das ist der einzige Zweck der folgenden Abhandlung. Wenn es mir gelänge, dadurch auch nur einem Leidenden wieder zur Gesundheit zu verhelfen, das Feuer der Hoffnung und Freude in seinem matten Blick aufs Neue zu entzünden und seinem erstorbenen Herzen den raschen, fröhlichen Pulsschlag vergangener Tage zurückzugeben, so wäre mir alle Mühe reichlich vergolten und jene heilige Wonne würde meine Seele durchströmen, welche der Christ fühlt, wenn er eine gute, selbstlose Tat vollbracht hat.
Da ich stets ein untadeliges Leben geführt habe, bin ich berechtigt zu glauben, dass niemand, der mich kennt, aus Furcht, ich hätte die Absicht ihn zu täuschen, meine Ratschläge zurückweisen wird. Möge das Publikum sich die Ehre antun, meine hier niedergelegten Erfahrungen bei Behandlung eines Schnupfens zu lesen – und dann meinem Beispiel folgen.
Als das Weiße Haus in Virginia City abbrannte, verlor ich meine Häuslichkeit, meine Behaglichkeit, meine Gesundheit und meinen Koffer. Der Verlust der beiden erstgenannten Artikel war leicht zu verschmerzen; denn eine Häuslichkeit ohne eine Mutter, eine Schwester oder eine entfernte junge Verwandte, welche uns die schmutzige Wäsche wegräumt, unsere Stiefel vom Kaminsims herunternimmt und uns so daran erinnert, dass jemand an uns denkt und für uns sorgt, ist nicht schwer zu finden. Und was meine Behaglichkeit betrifft, so war ich ja kein Dichter und brauchte der Schwermut über ihren Verlust nicht lange nachzuhängen. Aber eine gute Gesundheit zu verlieren und einen noch besseren Koffer, das waren ernstliche Unglücksfälle. Am Tage der Feuersbrunst zog ich mir nämlich infolge der übergroßen Anstrengung, mit welcher ich mich anschickte etwas zu tun, eine starke Erkältung zu.
Als ich das erste Mal zu niesen begann, riet mir ein Freund ein warmes Fußbad zu nehmen und dann zu Bett zu gehen. Das tat ich. Gleich darauf meinte ein zweiter, ich solle aufstehen und ein kaltes Sturzbad nehmen. Eine Stunde später versicherte mir ein dritter, man müsse einen »Schnupfen füttern und ein Fieber aushungern.« Ich litt an beiden und hielt es daher für das beste, mich des Schnupfens wegen voll und satt zu essen, dann Hausarrest zu nehmen und das Fieber eine Weile hungern zu lassen.
Bei halben Maßregeln lasse ich es in solchem Fall nie bewenden. Ich aß also nach Herzenslust und wendete meine Kundschaft einem Fremden zu, der an jenem Morgen gerade sein Speisehaus eröffnet hatte. Er stand in ehrerbietigem Schweigen dabei, bis ich meinen Schnupfen genug gefüttert hatte und fragte dann, ob die Leute in Virginia City häufig vom Schnupfen befallen würden. Als ich erwiderte das könne wohl möglich sein, ging er hinaus und nahm sein Wirtshausschild ab.
Ich begab mich nun ins Büro und begegnete unterwegs abermals einem vertrauten Freunde, der mir sagte, dass es auf der Welt nichts Wirksameres gäbe, um sich vom Schnupfen zu kurieren, als wenn man ein Quart warmes Salzwasser tränke. Ich zweifelte stark, dass ich noch Platz dafür haben könne, aber versuchen wollte ich es jedenfalls. Der Erfolg war überraschend. Mir war als hätte ich meine unsterbliche Seele von mir gegeben.
Da ich meine Erfahrungen nur zum Nutzen derjenigen niederschreibe, welche von demselben Übel befallen sind wie ich, halte ich es für angemessen, sie vor den Mitteln zu warnen, die sich bei mir als unwirksam erwiesen haben. Aus vollster Überzeugung muss ich ihnen daher raten, sich vor warmem Salzwasser zu hüten. Wenn ich wieder den Schnupfen hätte und mir nur die Wahl bliebe, meine Zuflucht zu einem Erdbeben oder einem Quart Salzwasser zu nehmen, so würde ich mein Heil mit dem Erdbeben versuchen.
Nachdem der Sturm, der in meinem Innern wütete, sich etwas gelegt hatte und da zufällig kein guter Samariter mehr bei der Hand war, borgte ich mir wieder Taschentücher und zerschneuzte sie zu Atomen, wie ich es in den ersten Stadien meines Schnupfens getan hatte. Dies trieb ich solange, bis ich einer Dame begegnete, die eben von jenseits der Prairie herkam. Sie hatte in einer Gegend gelebt, wo Mangel an Ärzten war und sagte, die Not habe sie gelehrt, einfache Alltagskrankheiten mit vielem Geschick zu behandeln. Ich war überzeugt, dass sie eine lange Erfahrung hinter sich haben müsse, denn sie sah aus, als sei sie hundertfünfzig Jahre alt.
Sie mischte einen Trank aus Sirup, Scheidewasser, Terpentin und allerlei Kräutern zusammen und gab mir die Anweisung, alle Viertelstunde ein Weinglas voll davon zu nehmen. Ich ließ es jedoch bei der ersten Dosis bewenden; sie reichte hin um mich aller moralischen Grundsätze zu berauben und die unwürdigsten Triebe in mir wach zu rufen. Unter ihrem bösartigen Einfluss wälzte ich in meinem Hirn die ungeheuerlichsten und niederträchtigsten Pläne und Entwürfe, aber meine Hand war damals zu schwach, sie auszuführen. Hätten nicht die unfehlbaren Heilmittel für den Schnupfen durch wiederholte Angriffe meine Kräfte völlig erschöpft, ich wäre wahrlich imstande gewesen auf Leichenraub auszugehen.
Wie die meisten andern Leute habe ich zuweilen gemeine Regungen und handle danach; aber bis zu einem solchen Grade von unmenschlicher Ruchlosigkeit hatte ich es noch nie gebracht, bevor ich jene Arznei einnahm und obendrein war ich noch stolz darauf. Nach Verlauf von zwei Tagen war ich wieder soweit, aufs Neue an mir herumdoktern zu können. Ich wandte noch mehrere untrügliche Mittel an und trieb mir schließlich die Erkältung aus dem Kopf in die Lunge.
Nun bekam ich fortwährend Hustenanfälle und meine Stimme sank unter den Nullpunkt. Ich sprach mit den Leuten in einem grollenden Bass, zwei Oktaven unter meinem gewöhnlichen Tonfall. Eine regelmäßige Nachtruhe konnte ich nur dadurch erlangen, dass ich mich in einen Zustand gänzlicher Erschöpfung hineinhustete; sobald ich aber im Schlaf zu sprechen anfing, weckte mich der Misslaut meiner Stimme wieder auf.
Mein Fall verschlimmerte sich von Tag zu Tag. Man empfahl mir Wachholderschnaps. Den trank ich. Dann Schnaps mit Sirup. Ich trank auch den. Ferner Schnaps und Zwiebeln. Die tat ich dazu und schluckte alle drei zusammen, jedoch ohne besonderes Ergebnis.
Ich sah mich jetzt genötigt meiner Gesundheit durch Luftveränderung wieder aufzuhelfen und reiste mit meinem Kollegen, dem Zeitungsreporter Wilson, zum Bigler See. Nicht ohne eine gewisse Befriedigung denke ich daran, dass wir auf ganz vornehme Weise reisten, wir benutzten nämlich die Pionierpost und mein Freund nahm sein ganzes Gepäck mit, welches aus zwei prachtvollen seidenen Halstüchern und dem Daguerre-Bild seiner Großmutter bestand. Dort machten wir den Tag über Segelfahrten, gingen auf die Jagd, auf den Fischfang und zum Tanz und die Nacht hindurch kurierte ich meine Erkältung. Durch diese Einrichtung gelang es mir, jede von den vierundzwanzig Stunden nutzbringend zu verwenden. Aber mein Übel wurde nur immer schlimmer.
Man riet mir nun zu einer nassen Wickelung. Bisher hatte ich kein einziges Heilmittel zurückgewiesen und es schien Torheit, jetzt noch damit anzufangen. So beschloss ich denn die Wickelung zu versuchen, obwohl ich keine Ahnung hatte, was das eigentlich für eine Veranstaltung sei. Sie wurde um Mitternacht vorgenommen und das Wasser war brennend kalt. Ein Leintuch, das mindestens tausend Meter lang zu sein schien, wurde in Eiswasser getaucht und mir um Brust und Rücken gewickelt, bis ich aussah wie der Wischer für eine der neuen Riesenkanonen.
Es ist ein grausames Verfahren. Wenn der kalte Lappen das warme Fleisch berührt, fährt man vor Schrecken zusammen und schnappt nach Atem wie ein Mensch in der Todesnot. Mir erfror das Mark in den Knochen und mein Herzschlag schien stillzustehen. Ich glaubte, mein letztes Stündlein sei gekommen.
Ich warne hiermit jedermann vor kalten Wickelungen. Es gibt nichts Unbehaglicheres in der Welt – außer vielleicht einer Damenbekanntschaft zu begegnen, die aus Gründen, die sie selbst am besten weiß, unsereinen ansieht ohne ihn zu sehen und, wenn sie ihn wirklich sieht, ihn nicht kennt.
Aber, was ich noch sagen wollte – als mein Schnupfen nach der Wickelung nicht kuriert war, empfahl mir eine befreundete Dame, ein Senfpflaster auf die Brust zu legen. Das hätte mich, glaube ich, auch wirklich geheilt, wäre der junge Wilson nicht gewesen. Beim Zubettgehen legte ich mir das Senfpflaster, das ganz großartig war – es maß achtzehn Zoll im Viereck – bequem zur Hand, wo ich es erreichen konnte. Aber Wilson bekam in der Nacht Hunger und – den Rest kann sich der Leser selber denken.
Nach einem achttägigen Aufenthalt am Bigler See ging ich nach Steamboat Springs, wo ich Dampfbäder nahm und noch eine Masse der erbärmlichsten Arzneien zu schlucken bekam, die je zusammengebraut worden sind. Sie würden mich ganz hergestellt haben, aber ich musste nach Virginia City zurückkehren, wo ich es trotz der verschiedenartigsten Heilmittel, die ich jeden Tag verschlang, möglich machte, meine Krankheit durch Vernachlässigung und Ausgehen bei kalter Witterung sehr zu verschlimmern.
Endlich beschloss ich nach San Franzisco zu reisen. Am ersten Tag nach meiner Ankunft daselbst sagte mir eine Dame im Gasthaus, ich solle alle vierundzwanzig Stunden ein Quart Whisky trinken und ein Freund, der in der Stadt wohnte, gab mir denselben Rat. Das machte also zusammen zwei Quart oder eine halbe Gallone. Soviel trank ich und bin noch am Leben.
~ ~ ~
In obigem habe ich mit der allerbesten Absicht von der Welt das mannigfaltige Heilverfahren geschildert, welches ich kürzlich zur Kur meines Schnupfens durchzumachen hatte. Ich empfehle es besonders allen, die an der Schwindsucht leiden. Wenn sie einen Versuch damit anstellen und nicht gesund werden, so kann es sie höchstens umbringen.
Kinderkrankheiten
Diese Geschichte hat Mr. McWilliams, ein freundlicher Herr aus New York, dem Verfasser erzählt, der ihn zufällig auf einer Reise traf.
Sie können sich kaum vorstellen, Herr Mark Twain, wie schrecklich die unheilbare Krankheit, welche man die häutige Bräune nennt, in unserer Stadt gewütet hat. Ebenso schlimm als die Krankheit selbst war der Umstand, dass alle Mütter vor Angst und Schrecken fast den Verstand verloren. Hören Sie zu, was ich mit meiner Frau während jener Zeit erlebte. Eines Mittags kam ich nach Hause und machte meine Frau auf die kleine Penelope aufmerksam, indem ich bemerkte:
»Mein Herz, ich würde an deiner Stelle nicht erlauben, dass das Kind an dem Kienspan kaut.«
»Was in aller Welt soll denn das schaden?« entgegnete sie, schickte sich aber zugleich an, den Span fortzunehmen – ohne weitläufige Erörterung können Frauenzimmer nun einmal nicht den geringsten Rat befolgen, wenn dessen Weisheit auch noch so sehr auf der Hand liegt; d. h. verheiratete Frauen.
Ich erwiderte: »Herzchen, man weiß, dass keine Holzart so wenig Nährwert für ein Kind besitzt wie Tannenholz.«
Meine Frau zog die Hand zurück, mit der sie den Span ergreifen wollte und legte sie wieder in den Schoß.
»Du bist im Irrtum,« sagte sie merklich erregt; »alle Ärzte versichern, dass das Terpentin im Tannenholz für ein schwaches Rückgrat und für die Nieren sehr gut ist.«
»Ah so – ich bitte um Entschuldigung. Ich habe nicht gewusst, dass unser Kind an Rückenschwäche und an den Nieren leidet und dass der Hausarzt verordnet hat ...«
»Das Kind denkt gar nicht daran, an dergleichen zu leiden – wie kommst du darauf?«
»Aber liebe Frau, du hast doch angedeutet ...«
»Bewahre, so etwas ist mir nicht eingefallen.«
»Es ist ja kaum zwei Minuten her, mein Herz, dass du sagtest ...«
»Dummes Zeug! Ich mag gesagt haben was ich will – jedenfalls ist es kein Unglück, dass die Kleine an einem Stück Holz kaut, wenn sie Lust dazu hat; ich dächte, du könntest das auch einsehen. Ich verwehre es ihr nicht und damit ist's gut!«
»Ereifere dich nicht, mein Kind; ich sehe schon ein, dass du Recht hast und werde gleich ausgehen, um ein paar Klafter vom besten Tannenholz zu bestellen. Solange ich lebe, soll mein Kind ...«
»Oh bitte, geh' in dein Geschäft und lass mich einen Augenblick in Ruhe. Man kann auch nicht die geringste Bemerkung machen, du musst darüber streiten, streiten, streiten, bis du nicht mehr weißt, wovon du sprichst – wie immer.«
»Nun gut, du sollst deinen Willen haben. Aber in deiner letzten Bemerkung war ein Mangel an Logik, der ...«
(Ehe ich jedoch ausgeredet hatte, war sie zur Tür hinausgesegelt und hatte das Kind mitgenommen.)
~ ~ ~
Als ich am Abend desselben Tages zu Tisch nach Hause kam, trat sie mir mit kreideweißem Gesicht entgegen.
»Oh Mortimer, ein neuer Fall! Der kleine George vom Nachbar Gordon ist krank!«
»Häutige Bräune?«
»Häutige Bräune!«
»Hat der Arzt noch Hoffnung?«
»Nicht die geringste! Oh was soll aus uns werden!«
Kurz darauf brachte eine Wärterin die kleine Penelope herein, um uns gute Nacht zu sagen und das übliche Abendgebet auf der Mutter Schoß zu sprechen. Aber mitten in: »Jetzt leg' ich mich zu süßer Ruh',« hustete sie ein wenig. Meine Frau fuhr zurück als hätte sie der Schlag gerührt. Doch schon im nächsten Augenblick war sie auf den Füßen, der Schrecken spornte sie zu fieberhafter Tätigkeit.
Sie befahl, das Bett des Kindes aus der Kinderstube in unser Schlafzimmer zu bringen, und ging selbst mit, um die Ausführung des Befehls zu beaufsichtigen. Natürlich musste ich auch dabei sein, und wir brachten die Sache schnell in Ordnung. Für die Kinderfrau wurde ein Bett in dem Ankleidezimmer meiner Frau aufgeschlagen. Nun fiel ihr aber ein, dass wir zu weit von dem andern Kind entfernt seien, und wenn sich in der Nacht bei ihm Symptome zeigen sollten – mein armes Frauchen wurde wieder leichenblass.
Darauf schafften wir das Kinderbett und die Kinderfrau wieder in die Kinderstube und schlugen für uns beide ein Bett im Nebenzimmer auf. Plötzlich bekam meine Frau jedoch Angst, Penelope könne den Kleinen anstecken. Dieser Gedanke jagte ihr ein solches Entsetzen ein, dass ihre ganze Hilfsmannschaft das Bettchen nicht schnell genug wieder hinaustragen konnte. Meine Frau half in eigener Person und riss es beinahe in Stücken in ihrer verzweifelten Hast.
Wir zogen in den unteren Stock, aber da war nicht Platz genug, die Kinderfrau unterzubringen, und meine Frau meinte, ihre Erfahrung würde eine unschätzbare Hilfe sein. So kehrten wir denn mit Sack und Pack wieder in unser eigenes Schlafzimmer zurück und fühlten uns so glücklich, wie ein Paar vom Sturm verschlagene Vögel, die ihr warmes Nestchen wiederfinden.
Meine Frau eilte jetzt in die Kinderstube, um zu sehen, wie es dort stände. Im Nu war sie aber wieder da, von neuer Furcht ergriffen.
»Wie kann es nur kommen, dass der Kleine so fest schläft?«
»Aber mein Herz,« sagte ich, »der Kleine schläft ja immer so fest, dass er aussieht wie ein Bild.«
»Ich weiß, ich weiß; aber heute hat sein Schlaf etwas Unnatürliches. Er scheint – er scheint so regelmäßig zu atmen.«
»Aber, liebes Kind, er atmet immer regelmäßig.« »Oh, das weiß ich; aber heute macht es einen schrecklichen Eindruck. Seine Wärterin ist viel zu jung und unerfahren, Marie soll bei ihr bleiben, damit sie bei der Hand ist, wenn etwas passiert.«
»Das ist ein guter Gedanke; aber, wer wird dir helfen?«
»Du kannst mir alle Hilfe leisten, die ich brauche. Ich werde mich ja so wie so in dieser schrecklichen Zeit auf keinen Menschen verlassen, sondern alles selbst tun.«
Ich erwiderte, dass ich mich selbst verachten würde, wenn ich zu Bett gehen und schlafen wollte, während sie wachte und sich um unsere Kranke mühte, die lange, bange Nacht. Doch endlich ließ ich mich überreden. So begab sich also die alte Marie wieder zurück auf ihren Posten in der Kinderstube.
~ ~ ~
Penelope hustete ein- oder zweimal im Schlaf.
»Warum nur dieser Doktor nicht kommt. – Mortimer, es ist gewiss zu warm im Zimmer. Mach' den Schieber zu – schnell!«
Ich schloss die Luftheizung ab, sah nach dem Thermometer und fragte mich, ob denn 14° wirklich zu warm sei für ein krankes Kind.
Der Kutscher kam jetzt aus der Stadt mit der Nachricht, dass unser Hausarzt krank zu Bett liege. Meine Frau warf mir einen verlöschenden Blick zu und sagte mit sterbender Stimme:
»Es ist der Wille der Vorsehung. So war es vorher bestimmt. – Noch nie ist er krank gewesen, nie! Wir haben nicht so gelebt wie wir sollten, Mortimer. Immer und immer wieder habe ich es dir gesagt. Nun siehst du, wohin es führt. Unser Kind wird niemals wieder gesund werden. Danke Gott, wenn du es dir je verzeihen kannst – ich kann es mir nicht vergeben.«
Ich sagte, ohne die Worte genau zu wählen, aber durchaus nicht in der Absicht, sie zu kränken, es sei mir nicht bewusst, dass wir ein so gottloses Leben geführt hätten.
»Mortimer – willst du das Gericht Gottes auch über den Kleinen heraufbeschwören?«
Sie brach in Tränen aus – aber plötzlich rief sie:
»Der Doktor muss doch Arznei geschickt haben!«
»Gewiss,« versetzte ich; »hier ist sie. Ich habe nur auf den passenden Moment gewartet, es dir zu sagen.«
»So gib sie doch her; weißt du nicht, dass jetzt jeder Augenblick kostbar ist! Aber ach, wozu schickt er überhaupt Arznei, wenn er doch weiß, dass alles vergebens ist.«
Ich sagte, wo noch Leben wäre, sei auch noch Hoffnung.
»Hoffnung! – Mortimer, du weißt so wenig was du sprichst, wie ein neugeborenes Kind. Wenn du nur – Welcher Unsinn – die Anweisung sagt: alle Stunde einen Teelöffel! Einmal stündlich – als ob wir ein ganzes Jahr vor uns hätten, um das Kind zu retten! Mortimer, schnell, gib dem armen verschmachtenden Würmchen einen Esslöffel voll; nur diesmal beeile dich!«
»Aber, mein Herz, ein Esslöffel voll könnte ...«
»Mache mich nicht toll! ... Hier, mein Engelchen, mein süßes, nimm das hässliche bittere Zeug; es ist gut für Nelly, für Mamas süßen, kleinen Liebling und soll sie gesund machen. Da, da, da, lege dein Köpfchen an Mütterchens Brust und schlaf ein, damit du bald ... oh, ich weiß, sie wird den Morgen nicht erleben! – Mortimer, einen Esslöffel alle halbe Stunde! Aber das Kind sollte auch Belladonna nehmen und Akonit. Hol die Fläschchen, Mortimer. Bitte, tue was ich sage; du verstehst ja doch nichts davon.«
Wir stellten nun das Bett des Kindes dicht an das Kopfende meiner Frau, und legten uns nieder. Das viele Durcheinander hatte mich schrecklich müde gemacht, und in zwei Minuten war ich halb eingeschlafen.
Meine Frau weckte mich.
»Männchen, ist die Luftheizung offen?«
»Ich glaube nicht.«
»Das habe ich mir gedacht. Bitte, mache den Schieber gleich auf; das Zimmer ist kalt.«
Ich schob ihn auf und schlief wieder ein; da wurde ich nochmals geweckt.
»Bester Mann, du könntest doch so gut sein, das Bettchen an deine Seite zu stellen, es ist näher an der Heizung.«
Ich stellte das Bett an meine Seite, verwickelte mich aber in den Bettteppich und weckte das Kind. Wieder verfiel ich in Schlaf, während meine Frau die kleine Kranke beruhigte. Aber nicht lange, so kamen wie aus weiter Ferne durch den Nebel meiner Schlaftrunkenheit die Worte an mein Ohr:
»Mortimer, wenn wir nur etwas Gänsefett hätten – bitte, willst du klingeln.«
Ich kletterte im Halbschlaf heraus und trat auf die Katze, welche mit einem lauten Protest antwortete; ich wollte ihr dafür einen Fußtritt verabreichen, aber der Stuhl bekam ihn statt der Katze.
»Mortimer, was fällt dir ein? Warum drehst du den Gashahn auf? Willst du das Kind zum zweiten Mal wecken?«
»Ich will sehen, ob ich mir Schaden getan habe, Karoline.«
»Dann sieh nur auch den Stuhl an; ich bin überzeugt, er ist in Stücken. Die arme Katze; wenn du nun ...«
»Die Katze ist mir völlig gleichgültig. Das alles wäre nicht geschehen, wenn du Marie hier behalten hättest, um diese Pflichten zu übernehmen, die sie angehen, und nicht mich.«
»Du solltest dich schämen, Mortimer, eine solche Bemerkung zu machen. Wahrhaftig, wenn du die Kleinigkeiten, um die ich dich bitte, nicht einmal besorgen willst – da doch unser Kind ...«
»Schon gut, ich will ja alles tun. Aber kein Mensch hört auf mein Läuten. Sie sind wahrscheinlich alle zu Bett gegangen. – Wo steht das Gänsefett?«
»Auf dem Kamin im Kinderzimmer. Wenn du hingehen willst und mit Marie sprechen ...«
Ich holte das Gänsefett und schlief wieder ein. Abermals wurde ich gerufen: »Mortimer, es ist mir schrecklich, dich zu stören, aber das Zimmer ist noch immer zu kalt, wenn ich die Einreibung machen soll. Könntest du nicht das Feuer anzünden? Es ist alles zurechtgelegt, du brauchst nur ein Schwefelhölzchen hineinzustecken.«
Ich kroch aus dem Bett, machte das Feuer an, und setzte mich als Jammergestalt daneben.
»Mortimer, du erkältest dich zu Tode, wenn du da sitzen bleibst. Komm zu Bett!«
Ich wollte hineinsteigen, da sagte sie:
»Nur einen Augenblick! Bitte, gib' dem Kind noch etwas Arznei.« – Das tat ich, und meine Frau benutzte die Gelegenheit, da die Kleine doch einmal wach war, sie auszuziehen und über und über mit dem Gänsefett einzuschmieren. Bald schlief ich von neuem – aber nicht lange.
»Mortimer, es zieht irgendwo; ich fühle es ganz deutlich. Nichts ist verhängnisvoller bei solcher Krankheit, als Zugwind. Bitte, stelle das Kinderbett näher ans Feuer.« Das tat ich, und verwickelte mich wieder in den Bettteppich, den ich ins Feuer warf. Meine Frau sprang aus dem Bett und rettete ihn, wobei wir etwas an einander gerieten. Nun folgte wieder eine kleine Schlafpause, bis mir befohlen wurde, einen Umschlag von Leinsamen zu machen. Dieser wurde dem Kind auf die Brust gelegt, um dort seine heilende Wirkung zu üben.
Ein Holzfeuer hat nicht lange Bestand. Alle zwanzig Minuten stand ich auf, um das unsrige anzufachen und Holz nachzulegen; dadurch verkürzten sich auch die Zwischenräume beim Eingeben der Arznei um zehn Minuten, was meiner Frau eine große Erleichterung war. Dazwischen erneuerte ich die Umschläge und legte einen Senfteig oder andere Zugpflaster überall da auf, wo noch eine freie Stelle an dem Kind zu finden war. Endlich, gegen Morgen, war das Holz verbraucht, und meine Frau meinte, ich solle in den Keller gehen, um welches zu holen.
»Das ist eine schwere Arbeit, liebes Kind,« bemerkte ich. »Der Kleinen ist gewiss warm genug bei ihren vielen Umhüllungen. Wir können ihr ja auch noch eine Lage Brei auflegen und ...«
Ich kam nicht zu Ende, denn ich wurde unterbrochen. Eine Weile schleppte ich Holz herauf und kroch dann wieder in mein Bett. Bald schnarchte ich, wie nur ein Mensch schnarchen kann, der völlig abgemattet ist, an Körper und Geist, Bei Tagesanbruch fühlte ich ein Rütteln an meiner Schulter, was mich schnell zur Besinnung brachte. Meine Frau stand mit stierem Blick vor mir und rang nach Luft. Sobald sie sprechen konnte, sagte sie:
»Es ist alles aus – alles aus! – Das Kind schwitzt. Was fangen wir an?«
»Mein Gott, wie du mich erschreckt hast! Ich weiß nicht was ich dir raten soll. Vielleicht wenn wir alles abkratzten und Penelope wieder in den Zug brächten ...«
»Welcher Blödsinn! – Jetzt ist kein Augenblick zu verlieren! Hole den Doktor, schnell! Du musst selbst gehen. Bring' ihn her, tot oder lebendig.«
Ich zerrte den armen kranken Mann aus dem Bett und brachte ihn zu uns. Er sah das Kind an und sagte, es läge nicht im Sterben. Das war mir eine unaussprechliche Freude, aber meine Frau wurde so böse, als habe er sie persönlich beleidigt. Dann meinte er, der Husten des Kindes wäre nur durch einen kleinen Reiz in der Kehle verursacht. Wie er das sagte, fürchtete ich fast, meine Frau würde ihm die Tür weisen. Der Doktor wollte die Kleine nun stärker zum Husten bringen, um die Störung zu beseitigen. Er gab ihr etwas ein, sie hustete heftig, und heraus kam – ein kleiner Holzsplitter.
»Das Kind hat keine Bräune,« sagte der Arzt. »Es hat an einem Stück Tannenholz gekaut, und ein paar kleine Splitter in den Hals bekommen. Die werden ihm nichts schaden.«
»Nein,« sagte ich, »das glaube ich auch. Das Terpentin darin ist sogar sehr gut für einige Krankheiten, die bei Kindern vorkommen. Meine Frau kann Ihnen das sagen.«
Aber das tat sie nicht. Sie wendete sich empört von uns ab und verließ das Zimmer. Seit der Zeit ist in unserm ehelichen Leben eine Episode, die wir nie erwähnen. Im Übrigen fließt der Strom unserer Tage in ungetrübter Heiterkeit dahin.
Sehr wenig Ehemänner haben ähnliche Erfahrungen gemacht, wie Herr McWilliams; deshalb dachte der Verfasser dieses Buches, die Sache würde durch ihre Neuheit vielleicht in den Augen des Lesers ein flüchtiges Interesse erhalten.