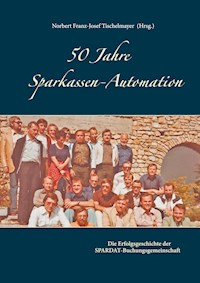
50 Jahre Sparkassen-Automation E-Book
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Im Jahre 2018 hat die SPARDAT ihr 50-jähriges Jubiläum gefeiert, denn die Gründung erfolgte mit der Unterzeichnung des Gesellschafts-Vertrages am 8. August 1968. Die Geschichte der SPARDAT ist untrennbar mit der Sparkassenautomation dieser 50 Jahre verbunden und hat diese maßgeblich beeinflusst. Die SPARDAT war - darüber sind sich sehr viele ehemalige Mitarbeiter einig - ein außergewöhnliches Unternehmen, was in diesem Buch durch viele Fakten, Bilder und Geschichten untermauert wird. Es wird erzählt, wie eine kleine Firma mit anfangs acht Mitarbeitern mit damals in Österreich neuen Methoden bezüglich Unternehmenskultur, Führungstechniken und Mitarbeiter-Motivation zu einem Unternehmen mit über tausend Mitarbeitern gewachsen ist. Das Buch ist für den Themenkomplex ein Zeitdokument.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Redaktion und Autoren: Franz „Angelo“ Gruber, Hans-Georg Schwarz, Norbert Tischelmayer
Weitere Autoren: Alois Aichbauer, Walter Auracher, Peter Benda, Peter Bezold,
Walter Domandl, Heinz Eberndorfer, Kurt Essler, Albert Feurstein, Helmut Gähr,
Johannes Größing, Reinhold Immler, Wilhelm Markom, Peter Pikisch, Helfried Plenk,
Guido Radschiner, Franz Redl, Walter Renner, Günter Royer, Gerhard Schellander,
Roland Schwandner, Walpurga Spitzer (Cartoons), Erwin Standl,
Egon Telecek, Walter Zdrazil, Konrad Ziegelwanger.
50 Jahre Sparkassen-Automation
Bei der 1979 erfolgten Klausur „SPARDAT-83“ im Berghotel Tulbingerkogel ging es um die zukünftige Ausrichtung der SPARDAT und Festlegung der dafür notwendigen Maßnahmen. Erwähnenswert ist, dass auf diesem Bild das Redaktionsteam bzw. insgesamt elf Autoren dieses Buches zu sehen sind.
Die Erfolgsgeschichte der SPARDAT Buchungsgemeinschaft
INDEX
Prolog
Das Unternehmen (Norbert Tischelmayer & Geschäftsführung)
2.1 Die Geschäftspolitik der SPARDAT
2.2 Organisationsstruktur
2.3 Erwin Standl und Peter Benda -1970 bis 1980
2.4 Peter Bezold, Peter Carniel, Friedrich Horak - 1980 bis 1983
2.5 Peter Bezold und Friedrich Horak - 1983 bis 1989
2.6 Peter Bezold und Gerhard Schellander – 1989 bis 1998
2.7 Peter Bezold, Johannes Höbinger, Walter Mangl - 1999 bis 2005
2.8 SARZ & iT-AUSTRIA - 1996 bis 2005
2.9 s IT Solutions Austria - 2005 bis 2018
2.10 Standorte
2.11 Mann der ersten Stunde - Erwin Standl
2.12 Mr. GRID - Dr. Peter Benda
2.13 Längst dienender Geschäftsführer - Dr. Peter Bezold
2.14 Mr. Internet – DI Gerhard Schellander
SPARDAT-Mitarbeiter berichten
3.1 Walter Domandl
3.2 Hans-Georg Schwarz
3.3 Walter Zdrazil
3.4 Franz „Angelo“ Gruber
3.5 Konrad Ziegelwanger
3.6 Norbert Tischelmayer
3.7 Roland Schwandner
3.8 Reinhold Immler
3.9 Franz Redl
3.10 Walter Renner
3.11 Egon Telecek
Chronik der Ereignisse (Hans Georg Schwarz)
4.1 Rahmenbedingungen
4.2 High-Lights 1968 bis 2018
Anwendungsentwicklung (Franz „Angelo“ Gruber)
5.1 Sparkassen 1970
5.2 Automationsunterstützung vor 50 Jahren
5.3 Meilensteine von 1970 bis 2002
5.4 Vertriebsstrategie der Bankenwelt (Peter Pikisch)
Technik (Norbert Tischelmayer & Egon Telecek)
6.1 IBM - Der Computergigant Big Blue
6.2 Hardware und Betriebssystem-Software
6.3 Speichermedien
6.4 Online-Betrieb
6.5 Outputverarbeitung
6.6 Programmierung / Entwicklung
Kunden & Eigentümer (Hans-Georg Schwarz & Kunden)
7.1 Kundenorientierung (Hans-Georg Schwarz)
7.2 Walter Auracher – Girozentrale
7.3 Alois Aichbauer – Sparkasse Dornbirn
7.4 Johann Roßmiller – Sparkasse Poysdorf
7.5 Helfried Plenk – Salzburger Sparkasse
7.6 Albert Feurstein – Sparkasse Dornbirn
7.7 Kurt Essler – Girozentrale
7.8 Heinz Eberndorfer – Kärntner Sparkasse
Anekdoten & Bonmots (verschiedene Zeitzeugen)
8.1 Der richtige Vorname (Norbert Tischelmayer)
8.2 Die „Infernogruppe“ (Wilhelm Markom)
8.3 Ich hole Dich am Bahnhof ab (Hans-Georg Schwarz & Guido Radschiner)
8.4 Der „SPARDAT-Geist“ in Agonie (Wilhelm Markom)
8.5 Die „schwarze Middle“ (Norbert Tischelmayer)
8.6 Dolmetscher für die IBM (Norbert Tischelmayer)
8.7 100% für die SPARDAT (Helmut Gähr)
8.8 Gefahrenzulage für RZ-Mitarbeiter (Roland Schwandner)
8.9 Die „eierlegende Wollmilchsau“ (Norbert Tischelmayer)
8.10 Zu viele Belege im Restfach (Egon Telecek)
8.11 Mannder s´isch Zeit (Norbert Tischelmayer)
8.12 Wo is da Koffa? (Guido Radschiner)
8.13 Overlap on unexpired File (Norbert Tischelmayer)
8.14 Die SPARDAT aus externer Sicht (Günter Royer)
8.15 ASSEMBLER versus COBOL (Franz Redl)
8.16 SPARDAT-Zitate (Johannes Größing)
Unternehmenskultur (Norbert Tischelmayer)
9.1 SPARDAT-Geist
9.2 Spitzenunternehmen
9.3 Führungstechnik
9.4 GRID
9.5 Beratungsgespräch/Mitarbeitergespräch
9.6 Unternehmensleitbild
9.7 Ausbildung & Schulung
9.8 Meeting-Kultur
9.9 Information
9.10 Dokumentation
9.11 Gehaltsphilosophie
9.12 Projekt-Management
9.13 SYS-Termine (Programmeinsätze)
9.14 SPARDAT-Namen
9.15 Externe Berater & Spezialisten
9.16 Hart arbeiten - Feste feiern
9.17 Facebook-Seite „Wir waren die SPARDAT“
In Memoriam
Epilog
11.1 Das Geheimnis der SPARDAT
11.2 Wünsche für die s IT Solutions
11.3 Sinnsprüche
11.4 Rezensionen / Feedbacks
1 Prolog
Im Jahre 2018 hat die SPARDAT ihr 50-jähriges Jubiläum gefeiert, denn die Gründung dieses Unternehmens erfolgte mit der Unterzeichnung des Gesellschafts-Vertrages am 8. August 1968. Als Firmenziel wurde im Vertrag die Errichtung einer Buchungsgemeinschaft definiert, die allen österreichischen Sparkassen EDV-Dienstleistungen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten anbieten sollte. Der Name SPARDAT ist heute nur mehr wenigen bekannt, denn durch in der Folge beschriebene Umstände, wie zum Beispiel Eigentümerwechsel, heißt die Nachfolgefirma s IT Solutions Austria. Diese fungiert als IT-Dienstleister der Erste Bank und Sparkassen und ist ein Tochterunternehmen der Erste Group. Der Name SPARDAT ist aber nach wie vor im Handelsregister eingetragen.
Einige ehemalige Mitarbeiter der SPARDAT, welche die Anfänge miterlebt haben, fassten einen Entschluss: Dieses Ereignis muss entsprechend gewürdigt und es soll in Form eines Druckwerkes darüber berichtet werden. Gemäß SPARDAT-Gepflogenheiten wurde professionell vorgegangen, ein Projekt aufgesetzt und von der Gruppe Norbert Tischelmayer als Projektleiter bestimmt. Nach Erarbeitung eines Konzeptes mit erforderlicher Zielsetzung, Aktivitäten und Terminen bzw. Zeitplan sowie auch den geschätzten Kosten wurde mit der Umsetzung begonnen.
Die Geschichte der SPARDAT ist untrennbar mit der Sparkassen-Automation dieser 50 Jahre verbunden und hat diese maßgeblich beeinflusst. Die SPARDAT war – darüber sind sich sehr viele ehemalige Mitarbeiter einig - ein außergewöhnliches Unternehmen, was in diesem Buch durch viele Fakten, Bilder und „Geschichten“ untermauert wird. Ich selbst war in der SPARDAT 25 Jahre und in den RZ-Betriebs-Nachfolgefirmen SARZ und iT-AUSTRIA 10 Jahre tätig. In diesem langen Zeitraum gab es nur relativ wenige Tage, an denen ich nicht gerne in die Firma gegangen bin.
Die Zielgruppe für dieses Buch sind die ehemaligen Mitarbeiter der SPARDAT und aller Nachfolgefirmen sowie ehemalige und aktive Mitarbeiter des Sparkassen-Sektors. Es wäre schön, wenn darüber hinaus auch Leser gewonnen werden können, die ein allgemeines Interesse an der Sparkassen-Automation und der Entwicklung der Computer-Technologie der letzten 50 Jahre haben. Außerdem kann man erfahren, wie ein kleines Unternehmen mit anfangs nur acht Mitarbeitern mit damals in Österreich neuen, ungewöhnlichen bzw. revolutionären Grundsätzen bezüglich Unternehmenskultur, Führungstechniken und Mitarbeiter-Motivation zu einem Unternehmen mit über tausend Mitarbeitern gewachsen ist. Das Buch ist für diese drei Bereiche ein Zeitdokument.
Es ist ein Gemeinschaftswerk vieler Autoren mit allen dadurch geprägten Stärken bezüglich Vielfalt, aber vielleicht auch Schwächen bezüglich der „Wahrheit“ und zum Teil auch inhaltlichen Überschneidungen. Jeder erzählt „seine Geschichte“ nach seinen persönlichen Erinnerungen, die ja zum Großteil sehr lange zurückliegen. In diesem Zusammenhang ist folgender Umstand bemerkenswert: obwohl bei den meisten seit ihrem Ausscheiden aus der SPARDAT viele Jahre (Jahrzehnte) vergangen sind, haben sich insgesamt 25 Personen bereit erklärt, einen Beitrag zu leisten. Das ist bei weitem nicht selbstverständlich.
Die Beiträge der SPARDAT-Autoren sind von positiven Erlebnissen an diese Zeit geprägt. Um die notwendige Objektivität zu gewährleisten, kommen deshalb auch Kunden und Externe zu Wort.
Alle Mitarbeiter haben zum Erfolg der SPARDAT-Buchungsgemeinschaft beigetragen. Wir möchten uns bei allen entschuldigen, die namentlich nicht genannt werden.
Norbert Franz-Josef Tischelmayer - Wien im Oktober 2020
PS: Inzwischen gab es zahlreiche zum überwiegenden Teil positive Rückmeldungen zu diesem Buch. Das waren u. a. Frau Patricia Neumann (Country General Manager IBM Austria) und Herr Helmut Vanek (Steiermärkische Sparkasse), deren Feedbacks in dieser 4. Auflage enthalten sind (siehe Kap. 11.4).
2 Das Unternehmen
Anfang der 1960er-Jahre wurden im österreichischen Kreditsektor die ersten damals noch nicht als Computer bezeichneten Geräte eingesetzt, das waren die Zentralsparkasse, die Erste österreichische SparCasse, die Girozentrale und die Salzburger Sparkasse. Als rein lochkartenorientierte Anwendungen wurden bei diesen Instituten anfangs die Buchung von Giro- und Sparkonten entwickelt. Im Jahre 1967 wurde vom Hauptverband der Sparkassen der damals beim Computerhersteller Remington Rand-UNIVAC tätige Erwin Standl beauftragt, die flächendeckende Computerisierung im Sparkassensektor auf Basis der Erfahrungen der bisherigen Anwender und die Gründung einer Buchungsgemeinschaft vorzubereiten.
Aus diesem Grund wurde am 19. Mai 1967 sozusagen als Vorgängerfirma der SPARDAT die STUSA (Studiengesellschaft für Sparkassen Automation) mit Beteiligung von Sparkassenverband, Girozentrale, Sparkassenverlag, der beiden Wiener Sparkassen sowie der Landeshauptstadt-Sparkassen gegründet und Erwin Standl als Geschäftsführer bestellt. Der Praxistest der STUSA war die Automatisierung der Kärntner Sparkasse von 1967 bis1968. Das positive Ergebnis führte dann 1968 zur Einführung der Datenverarbeitung in der Allgemeinen Sparkasse in Linz. Die STUSA war ab der ebenfalls in diesem Jahr erfolgten Gründung der SPARDAT ein inaktiver Teil davon. Sie wurde dann im Jahre 1970 unter der Führung von Hans Ambros als eigenständige Firma reaktiviert und beschäftigte sich mit langfristig ausgerichteter Grundlagenarbeit.
Am 8. August 1968 wurde mit der Unterzeichnung des Gesellschafts-Vertrages die SPARDAT ins Leben gerufen. Die Gründungsmitglieder waren Generalsekretär Dr. Walter Sadleder vom Sparkassen-Verband, Direktor Herbert Lugmayr von der Zentralsparkasse und Direktor Dr. Theoderich Mellich von der Girozentrale. Die Anteile hielten der Sparkassen-Verband mit 45%, die Girozentrale mit 45% und der SPV mit 10%. Am 23. September 1968 wurde die SPARDAT mit dem Eintrag in das Handelsregister als Ges.m.b.H. rechtswirksam; der erste Geschäftsführer war Erwin STANDL. Die SPARDAT bestand aus 8 Mitarbeitern.
Als Ziele werden u. a. definiert: Es wird eine Buchungsgemeinschaft errichtet, die allen österreichischen Sparkassen EDV-Dienstleistungen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten anbieten soll. Die finanzielle Gestionierung ist so zu gestalten, dass die SPARDAT insgesamt kostendeckend arbeiten kann. Die SPARDAT verpflichtet sich, dass für diese Dienstleistungen geeignete und ständig auf dem letzten Wissensstand befindliche Mitarbeiter sowie die technischen Einrichtungen zur Verfügung stehen. Bis 1975 sollen sämtliche Sparkassen an leistungsfähige EDV-Anlagen angeschlossen sein. (übrigens wurde dann bis zum Jahre 1975 dieses Ziel nahezu, mit Ausnahme von 7 Instituten, erreicht). Im Jahre 1968 gab es insgesamt 172 Sparkassen mit 506 Geschäftsstellen; nur 3 davon hatten eine eigene EDV, die damals noch lochkartenorientiert war (Zentralsparkasse, Erste Österreichische SparCasse und Salzburger Sparkasse).
2.1 Die Geschäftspolitik der SPARDAT
Im Frühjahr 1971 erschien die erste Nummer der Broschüre „SPARDAT-Info“. Für die redaktionelle Gestaltung war Hans-Georg Schwarz verantwortlich. In zeitlichen Abständen von ca. acht Wochen wurde Aktuelles über die SPARDAT, allgemein über die Computerbranche und vor allem über alle für die Sparkassen interessanten Neuerungen und Erweiterungen der SPARDAT-Dienstleistungen berichtet (siehe auch unter Kap. 9.9). Unter anderem war in der Nummer 1 die Geschäftspolitik der SPARDAT mit drei Prinzipien und fünf Zielen wie folgt formuliert:
2.2 Organisationsstruktur
Zu Beginn gab es in der SPARDAT eine flache Hierarchie mit anfangs drei Ebenen (GF, Abteilung, Referat) und später vier Ebenen (GF, Bereich, Abteilung, Team). Bei einer kleineren Mitarbeiteranzahl ist das zwangsläufig so (1970 rund 70). Nach einer Legende gab es beim Orden der Zisterzienser folgende Regel: Hatte ein Kloster eine Anzahl von etwa 60 bis 70 Mönchen erreicht, mussten die jüngsten 12 das Kloster verlassen und an einer anderen Stelle ein neues Kloster gründen. Diese Größe entspricht auch in etwa einer Horde in der Steinzeit. Jeder kennt jeden, jeder weiß um Stärken und Schwächen der anderen und niemand kann sich verstecken und schmarotzerhaft agieren, indem er sich nicht an den notwendigen Arbeiten in der Gruppe beteiligt. Das würde sofort entsprechende Maßregelungen nach sich ziehen.
Die gesamte SPARDAT-Zeit war geprägt von unzähligen Strukturänderungen. Trotz großer Bereitschaft der SPARDAT’aner zu Veränderungen war das zum Teil zwar sehr belastend aber auch von Vorteil, weil sich besonders für die karrierebewussten Kollegen ständig neue Chancen ergaben. Siegfried „Sigi“ Nowak hat sich die Mühe gemacht und von 1970 bis Anfang 2000 alle Strukturänderungen gesammelt. In diesen 31 Jahren waren es unglaubliche 86 (sechsundachtzig). Das bedeutet im Durchschnitt rund drei Änderungen jährlich oder anders ausgedrückt gab es alle vier Monate eine strukturelle Veränderung. Darüber gibt es auch eine der zahlreichen Anekdoten, wie sie dann im Kap. 8 erzählt werden.
Wieder einmal wurde in einer Middle (großer Besprechungskreis aller Führungskräfte) eine Strukturänderung vorgestellt. Wilhelm Markom meldete sich zu Wort und meinte, man möge in Hinkunft auf den neuen Organigrammen nicht nur das Datum, sondern auch die Uhrzeit vermerken. Vom Großteil der Runde wurde dies mit schallendem Gelächter belohnt, aber es gab nach Ohrenzeugenberichten auch einen hochrangigen Nichtgenannten, dem dies nicht gefallen hat (ja – es gab auch humorlose Leute in der SPARDAT).
In der Folge werden einige Organigramme gezeigt, und zwar von jenen Jahren, in denen ein Wechsel in der Geschäftsführung stattgefunden hat. Das hat selbstverständlich auch immer einen mehr oder weniger großen Wandel bedeutet, weil selbstredend jeder neue Geschäftsführer seine Vorstellungen und Ideen einbrachte, die sich auch in recht verschiedenen Führungsstilen äußerten.
Runde der ehemaligen SPARDAT-Geschäftsführer 22. Jänner 2004: Johannes Höbinger, Christian Gosch, Erwin Standl, Peter Bezold, Gerhard Schellander, Peter Benda und Walter Mangl.
2.3 Erwin Standl und Peter Benda - 1970 bis 1980
Im Zeitraum 1970 bis 1980 waren Erwin Standl und Peter Benda als Geschäftsführer verantwortlich. Diese zwei haben auf entscheidende und nachhaltige Art die SPARDAT-Kultur eingeführt und geprägt. Peter Benda wechselte 1975 in die GIROZENTRALE als Bereichsleiter Organisation, war aber nach wie vor als zweiter Geschäftsführer in der SPARDAT tätig. Erwin Standl wechselte dann Mitte 1980 in die ERSTE BANK. Das Organschafts-Verhältnis bzw. der bilanzmäßige Gewinn- und Verlustabsaugungs-Vertrag mit der GZ wurde 1974 beendet; die SPARDAT war aber nach wie vor eine 100%-ige GZ-Tochter.
Das Organigramm zeigt die Struktur im Juni 1974. Die SPARDAT beschäftigte 117 Mitarbeiter, die Umsatzerlöse betrugen 91,4 Mio ATS. Das Ereignis dieses Jahres war der Einsatz des neu entwickelten Datenerfassungs-System EDESYS am 11. November in der Sparkasse Stockerau. Im GIROZENTRALEHaupthaus 1010 Wien Schubertring wurde im März dieses Jahres das SPARDAT-RZ-Wien 2 in Betrieb genommen. Es diente ausschließlich für die Beleglesungs-Arbeiten der GZ-Abteilung 252.
2.4 Peter Bezold, Peter Carniel, Friedrich Horak - 1980 bis 1983
Im Jahre 1973 wurde von der GIROZENTRALE die Tochtergesellschaft LOGICA als Programmentwicklungs-GmbH gegründet. Rund 20 Leute verließen die SPARDAT und bildeten den Grundstock (u. a. Herbert „Alfi“ Schmid, Johann Hack, Jörg Reidlinger und Siegfried Nowak). Die LOGICA bezog ein Gebäude in 1020 Wien, Schreygasse und hatte die Aufgabe, speziell für die GIROZENTRALE und die s Bausparkasse EDVAnwendungs-Systeme zu entwickeln. Im Gegensatz zur SPARDAT, die auf die Programmiersprache COBOL setzte, war in der LOGICA der ASSEMBLER Standard. Es gab auch verschiedene Meinungen bezüglich Führungstechniken. Die SPARDAT setzte auf „GRID“, die LOGICA auf „Transaktionsanalyse“. Das Verhältnis der beiden Firmen war nicht konfliktfrei, es wurde aber in Projekten professionell zusammengearbeitet.
Die LOGICA wurde dann Ende 1980 wieder aufgelöst und deren Agenden und der Großteil der Mitarbeiter in die SPARDAT rückgeführt, was eine Änderung in der Geschäftsführung und große Strukturänderungen bewirkte. Die LOGICA brachte die für die GIROZENTRALE entwickelten Anwendungspakete ein (AZV, Depot, WPA). Nun gab es das Geschäftsführungs-Triumvirat Friedrich Horak (vorm. GF LOGICA, der schon von 1970 bis 1973 in der SPARDAT tätig gewesen war), Peter Carniel und Peter Bezold. Ein Teil der SPARDAT übersiedelte in die Schreygasse im 2. Wiener Bezirk – unter anderem auch die Geschäftsführung.
Das Organigramm zeigt die Struktur ab Anfang 1981. Die SPARDAT beschäftigte 192 Mitarbeiter, die Umsatzerlöse betrugen 264,6 Mio ATS. Das Ereignis des Jahres war der im Mai abgeschlossene Vertrag mit der Kärntner Sparkasse (Übernahme des ersten Eigenanwenders). Das Konzept sah eine Datenstation in Klagenfurt für die Input/Output-Verarbeitung vor, die mittels Standleitung mit der Gst. Graz verbunden war.
2.5 Peter Bezold und Friedrich Horak - 1983 bis 1989
Im November 1979 wurde im Wiener 1. Bezirk in der Pestalozzigasse 4 das neu errichtete SPARDAT-RZ der Geschäftsstelle GGB in Betrieb genommen und auch das im Girozentrale-Haupthaus angesiedelte RZ-WIEN 2 (Beleglese-RZ) in dieses neue RZ inkludiert. Einige Abteilungen der SPARDAT übersiedelten ebenfalls in das neu adaptierte Haus. Im November 1983 wurden Teile des neu erbauten Gebäudes der Firma MOBIL in 1010 Wien, Pestalozzigasse 6-8 von der SPARDAT besiedelt und damit auch alle Dependancen (1030 Hintere Zollamtsstraße 17 und 1020 Schreygasse 3) aufgelassen. Damit waren zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder alle Wiener SPARDAT-Stellen an einem Ort vereinigt. Im neuen Haus wurde am 3. Dezember mit einem „Tag der Offenen Tür“ der 15. Geburtstag der SPARDAT gefeiert. Peter Carniel verließ Ende 1983 die Firma. Er wurde nicht ersetzt, nun bildeten Friedrich Horak und Dr. Peter Bezold bis 1989 ein Duo. Dadurch ergaben sich natürlich neue Zuordnungen von Bereichen, Abteilungen und Projekten.
Das Organigramm zeigt die Struktur Anfang 1984. Die SPARDAT beschäftigte 214 Mitarbeiter, die Umsatzerlöse betrugen 365,5 Mio ATS. Das Ereignis des Jahres war der Einsatz der dezentralen Beleglesung in Graz und Wien für die NÖ-Sparkassen, sowie die Inbetriebnahme der neuen SIEMENSLaserdrucker-Systeme in Wien und Innsbruck (Projekt OCTOPUS, siehe Kap. 3.6.4).
2.6 Peter Bezold und Gerhard Schellander – 1989 bis 1998
Anfang 1989 wurden die beiden SPARDAT-Schwesterfirmen SVI (für s-Versicherung-Entwicklungen) und GZI (für GIROZENTRALE-Entwicklungen) gegründet. Der Vorstands-Direktor Herbert Lugmayr von der Bank Austria wurde zum Generaldirektor der GIROZENTRALE bestellt. In der Folge wurde Friedrich Horak durch den von der IBM gekommenen Gerhard Schellander ersetzt, der nun knapp zehn Jahre lang mit Peter Bezold die Geschäftsführung bildete.
In dieser Zeit erfolgten große Veränderungen in der Eigentümerstruktur. Im Jahre 1996 wurde die SARZ und zwei Jahre darauf die iT-AUSTRIA gegründet. In dieser Firma wurden nun die Rechenzentrumsagenden des Sparkassensektors, der ERSTE Bank und der Bank Austria inklusive der CAIT wahrgenommen. Das Organigramm zeigt die Struktur im Jahre 1993. Die SPARDAT AG beschäftigte damals 466 Mitarbeiter, die Umsatzerlöse betrugen 1.054,1 Mio ATS – also erstmals über eine Milliarde ATS.
In den 1990er-Jahren gab es durch Großprojekte, Standort- und Eigentümerwechsel große Veränderungen. Der Beginn erfolgte mit dem Projekt PHOENICS (RZ-Konzentration), das im Juni 1991 abgeschlossen wurde. Im Cartoon wird die Minitop gezeigt, die als Projektaufsicht fungierte: Peter Bezold (der sich über die erzielten Kosteneinsparungen freut), Walter Zdrazil, Walter Domandl, Johannes Größing, Gerhard Schellander und Hans-Georg Schwarz (der vergeblich nach Kundenreklamationen sucht).
Im August 1992 erfolgte der Spatenstich für das neue Gebäude der SPARDAT in 1110 Wien, Geiselbergstraße 21-25; im Herbst 1994 erfolgte dann die Besiedelung des neuen Standorts in Simmering.
2.7 Peter Bezold, Johannes Höbinger, Walter Mangl - 1999 bis 2005
Das Jahr 1999 war von der Übernahme der SPARDAT durch die Erste Bank geprägt, wodurch sich auch größere Änderungen in der Struktur ergaben. Die GF bestand zuerst aus Peter Bezold, Johannes Höbinger und Walter Mangl. In der Folge kam es aber zu zahlreichen weiteren Änderungen und Neubesetzungen in der Geschäftsführung. Im Jahre 2005 ging der längst dienende Geschäftsführer aller Zeiten Peter Bezold in den verdienten Ruhestand und wurde mit einer Abschiedsfete gebührend verabschiedet (Kap. 9.16.7).
2.8 SARZ & iT-AUSTRIA - 1996 bis 2005
Ab Anfang der 1990er-Jahre gab es umfangreiche Änderungen in der Bankenlandschaft mit zahlreichen Eigentümerwechseln. Diese bewirkten auch Änderungen in den EDV- bzw.- IT-Technologie-Bereichen der betreffenden Instiutute. Bei den Sparkassen, sowie den Banken Creditanstalt, Erste Bank und Bank Austria wurden diese Agenden in Tochtergesellschaften ausgelagert. Letztlich kam es zu einer besonderen Situation, als die Institute ihre EDV-Agenden in einer gemeinsamen Firma abwickeln ließen (zuerst SARZ, dann iT-AUSTRIA). Die komplizierte Entwicklung soll nun in der gebotenen Kürze dargestellt werden.
Aus der Fusion der Zentralsparkasse und der Länderbank ist 1991 die Bank Austria entstanden. Diese übernahm 1994 mehrheitlich die GiroCredit, die aber bereits 1997 an die Erste österreichische Spar-Casse Bank AG verkauft wurde, die damit zur Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG wurde. Durch diese Fusion wurden auch die System- und Infrastrukturteile der beiden Institute zusammengeführt und dafür die EB-IT (Erste Bank Informations-Technologie GmbH) geschaffen. Die EDV-Agenden der EB-IT erfolgten zu diesem Zeitpunkt über 4 UNISYS-CPU’s mit 142 MIPS und 1.408 MB Speicherkapazität, 720 GB Platten und 2 Bandrobotern an 2 Standorten sowie 400 Servern und 5.000 Clients.
Ebenfalls im Jahre 1997 wurde von der Bank Austria die Creditanstalt gekauft. Die EDV-Agenden erfolgten damals in der Tochtergesellschaft CA-IT über 4 IBM-CPU’s mit 1.740 MIPS.
2.8.1 Gründung der SARZ 1996
Wie oben erwähnt erwarb im Dezember 1994 die Bank Austria von der GiroCredit die Mehrheit an der SPARDAT-KG. Die Anteile an der neuen SPARDAT hielten nun die Bank Austria (51%), die GiroCredit- (19,8%), die Sparkassen (25%) und der Rest andere Sektor-Unternehmen. Es fiel die Entscheidung, die EDV-Agenden von Bank Austria und SPARDAT zusammenzuführen. Die prognostizierten Einparungen waren 355 Mio ATS bis 2002. Zu diesem Zweck wurde per 1. Jänner 1996 die SARZ (SPARDAT AUSTRIA Rechenzentrums GmbH) gegründet und das Projekt REBUS gestartet. Der Projektinhalt:
Übersiedlung von rund 100 SPARDAT-Mitarbeitern von 1110 Wien Geiselbergstraße in das Gebäude der Bank Austria in 1020 Wien Lassallestraße sowie 150 Mitarbeitern der Bank Austria innerhalb des Gebäudes Lassallestraße
Schaffung eines RZ-Verbundes mittels Lichtwellenleiter-Ring der drei RZ-Lokationen Geiselbergstraße (GB),. Vordere Zollamtsstraße (VZ) und Lassallestraße (LAS). Die CPU-Leistung betrug 2.117 MIPS, das Speicherungsvermögen 8,64 Terabytes
Gemeinsame Roboternutzung und gegenseitige Back-Up-Sicherung zwischen GB und LAS
Gemeinsames Bundesländernetzwerk für die 7 Landesdirektionen und 153 Bundesländer-Zweigstellen der Bank Austria mit dem s-Netz der SPARDAT
Servicierung der Bank Austria und GiroCredit-Filialen in Prag, London, Moskau, Hongkong und New York über internationalen Daten- und Sprachleitungsring und V-SAT-Satelliten
Verbesserte Hardware- und Softwareverträge
Das Bild zeigt den neuen Standort 1020 Wien, Lassallestraße 5. Für die Abwicklung des Zusammenführungs-Projektes wurde ein entsprechendes Projekt-Management und Controlling aufgesetzt. Im Projektauftrag wurden die einzelnen Projekt-Inhalte mit Terminen und Akteuren, die zu erwartenden Kosteneinsparungen, die Qualitätsverbesserungs-Kennziffern und der Investitionsrahmen definiert.
Das REBUS-Kernteam, stehend von links nach rechts: Johann Gartner, Karl-Heinz Duchek (GF ex SPARDAT), Walter Heinl, Gerhard Lentschik (GF ex Bank Austria), Harro D. Welzel (externer Berater); sitzend von links nach rechts Walter Renner, Norbert Tischelmayer (PL) und Wilfried Glanner.
2.8.2 Gründung der iT-AUSTRIA 1998
Am 31. Dezember 1997 wurde zwischen der Bank Austria und der Erste Bank ein Vertrag bezüglich der Zusammenführung aller EDV-Agenden der beiden Häuser und der Zukunft der Firmen SARZ, CA-IT, SPARDAT KG (Software SPARDAT) und EB-IT abgeschlossen. Die SARZ (370 MA), CA-IT (260 MA) und die EB-IT (40 MA) wurden zur iT-AUSTRIA (Informations-Technologie Austria GmbH). Dadurch entstand eines der größten IT-Unternehmen Österreichs.
Die iT-AUSTRIA servicierte damit die Kunden der Eigentümer-Großbanken solwie aller österreichischen Sparkassen mit allen EDV-technischen Anwendungen. 670 Mitarbeiter erarbeiteten ein Umsatzvolumen von 3 bis 3,5 Milliarden ATS. Durch die Zusammenführung ergaben sich folgende Kennzahlen (SPARDAT-KZ kurz vor Gründung der SARZ: 530 MIPS Rechnerleistung und 716 GB DASD; siehe Kap. 6.2 und 6.3):
10 Mainframes mit insgesamt 4.093 MIPS Rechnerleistung
22,5 Terabyte DASD im Mainframebereich
2 Terabyte DASD im Midrangebereich
44.000 über Netz und Satelliten angeschlosseneTerminals
65.000 Bandkassetten mit 180 Terabyte Speichervolumen
Für die Integration der vier Mitarbeitergruppen mit jeweils unterschiedlichen Unternehmenskulturen wurde ein Change-Management- und Integrations-Prozess mit Unterstützung durch externe Spezialisten aufgesetzt. Ziel war es, eine gemeinsame Firmen-Identät mit akzeptierten und gelebten Regeln zu schaffen.
Ich war für dieses Projekt verantwortlich. Das Bild zeigt die konstituierende Projekt-Klausur im Mai 1998 im Berghotel Tulbingerkogel mit dem Top-Management-Kreis (GF, BL, CRM, StL). Alle rund 25 Teilnehmer verpflichteten sich mit Unterschrift auf einem Flipchart, dass sie sich mit den Projektzielen identifizieren und konstruktiv zum Gelingen der Inegration beitragen werden (W. Haimböck, N. Tischelmayer, H. Weber).
Am
iT-AUSTRIA – Struktur ab 1. Jänner 1998. In den folgenden Jahren ergaben sich aber einige Änderungen:
Die Geschäftsführung wurde aus den vier Herkunftsfirmen gebildet: Roland Dippelreiter (CA-IT), Hannes Traxler (ERSTE BANK), Gerhard Lentschik (Bank-Austria) und Karl-Heinz Duchek (SPARDAT).
2.8.3 Trennung und Auflösung der iT-AUSTRIA
Im Jahre 2005 wurde die SPARDAT Teil des internationalen IT-Dienstleisternetzwerks der Erste Group und in s IT Solutions AT Spardat GmbH umbenannt. Im Jahre 2010 wurde die Zusammenarbeit zwischen Bank Austria (die in der Zwischenzeit von der italienischen Bank UniCredit übernommen wurde) und Erste Bank beendet und die iT-AUSTRIA in zwei Teilbetriebe aufgespaltet. Die rechtliche Trennung erfolgte rückwirkend per Dezember 2009. Die rund 600 Mitarbeiter der iT-AUSTRIA wurden auf die BAGIS (340) und s IT-Solutions (260) aufgeteilt. Die Rechenzentrums-Agenden wurden nun für die Erste Bank von der s IT-Solutions, für die Bank Austria von der BAGIS (Bank Austria Global Informations GmbH) wahrgenommen.
Ab Juni 2011 wurden operative Agenden der Softwareentwicklung, des Rechenzentrums-Betriebes und der Supportbereiche der Bank Austria an IBM Österreich und zwar an die Tochtergesellschaft BSC (IBM Banking Solution Center) auslagert. Die verbliebenen Restaktivitäten der BAGIS wurde in die aus der WAVE entstandene UGIS (Unicredit Global Information Services) integriert. Daraus ist 2012 die UBIS (UniCredit Business Integrated Solutions) entstanden, die 2018 in UniCredit Services umbenannt wurde. Das ist sozusagen der verbliebene Ur-Bank Austria-Teil der iT-AUSTRIA.
2.9 s IT Solutions Austria – 2005 bis 2018
Im Jahre 2005 wurde die SPARDAT Teil des internationalen IT-Dienstleisternetzwerks der Erste Group und in s IT Solutions AT Spardat GmbH umbenannt. Ab 2010 wurden von der iT-AUSTRIA auch die Rechenzentrumsaufgaben für die Erste Group übernommen. 2012 wurden die Mainframe Services an die IBM-Tochter BSC (IBM Banking Solution Center) ausgelagert. Bei der s IT Solutions verblieben Server, Arbeitsplatzsysteme, Netzwerk und Telefonie. Im November 2014 erfolgte die Auslagerung des Midrange Monitorings an HCL-Deutschland (indisches IT-Serviceunternehmen für Business Process Outsourcing).
Am 1. Juli 2016 spaltet sich das Unternehmen in die zwei Geschäftszweige EG IT (Erste Group IT International) und s IT (s IT Solutions Austria). Die EG IT betreut die IT-Lösungen der Erste Group, während s IT den Fokus auf den österreichischen Markt richtet und somit für Erste Bank und Sparkassen zum Generalunternehmer für lokale Lösungen im Inland wird. Sie ist für die Entwicklung, die Implementierung, den Support und das Service von Bank-IT-Lösungen zuständig. Zudem verantwortet s IT Solutions Austria den Rechenzentrums-Betrieb der Erste Group und das technische Service vor Ort in Österreich. Die Geschäftsführung wird von Dietmar Böckmann (CIO) und Thomas Kolarik (CTO) gebildet. Der CIO-Bereich umfasst den Großteil der Applikations-Landschaft für Endkunden und Bank-MitarbeiterInnen, der CTOBereich ist primär für die erforderliche Infrastruktur inklusive Rechenzentrumsbetrieb verantwortlich.
Die Output-Agenden (siehe Kap. 6.5) wurden zum Teil bereits ab 1989 und später in vollem Umfang von verschiedenen Sektorfirmen wahrgenommen. Das waren zuerst SBG Linz (1989), gefolgt von GZV Wien (1995) und ZVS Graz (2000). Diese drei wurden im Jahre 2002 zur sZV (Sparkassen Zahlungsverkehr) fusioniert und die Rest-SBG Linz abgespalten. Das Stammservice der Firma umfasste Zahlungsverkehr, Scan- und Druckservices, Post- und Botendienste und Transportlogistik. Ab dem Jahre 2009 wurde das Marktservice durch Übernahme der Marktserviceeinheiten an den Standorten Graz, Wien und Klagenfurt sowie ab dem Jahre 2010 das Finanzierungsservice durch die Übernahme der Abwicklungseinheiten großer Institute (Erste Bank Österreich, Kärntner Sparkasse, Tiroler Sparkasse etc.) aufgebaut. Seit dem Jahre 2012 firmiert das Unternehmen unter dem Namen sDG (Dienstleistungsgesellschaft von Erste Bank und Sparkassen). Die Zielgruppe der sDG sind die österreichische Sparkassengruppe inklusive Erste Group Bank AG (Österreich) sowie Kooperationspartner der Sparkassengruppe und des Erste Group-Konzerns.
2.10 Standorte
Bei den Standorten gab es in diesen 50 Jahren naturgemäß viele Veränderungen und Übersiedlungen. Diese konnten zumeist nur an einem Wochenende erfolgen, um ohne Unterbrechung einen reibungslosen RZBetrieb zu gewährleisten. Das hat vor allem die Mitarbeiter der Hausverwaltung sowie die Techniker der Hardware-Firmen sowie der Post bezüglich der damals erforderlichen Standleitungen (dauerhafte Verbindung) betroffen. Es gab bei den über 20 Übersiedlungs-Projekten kein einziges Mal negative Auswirkungen. Besonders in den Anfängen gab es in Wien aus Platzgründen eine Aufteilung auf mehrere Standorte, was die Kommunikation in Zeiten ohne Bildschirme am Arbeitsplatz erschwerte.
2.10.1 Wien
1968 bis 1972: 1030 Beatrixgasse 1-3 – Geschäftsführung, Verwaltung, Entwicklung
1970 bis 1972: 1030 Beatrixgasse 27 – RZ Wien (Haus des Sparkassenverlages)
1972 bis 1982: 1030 Hintere Zollamtsstraße 17 – RZ Wien, Geschäftsführung, Entwicklung
1973 bis 1983: 1020 Schreygasse 3 –LOGICA, dann SPARDAT GF und einzelne Abteilungen
1974 bis 1979: 1010 Schubertring 5 – RZ 2 (Beleglese-RZ) im Gebäude der Girozentrale
1979 bis 1994: 1010 Pestalozzigasse 4 – Geschäftsstelle GGB mit RZ
1983 bis 1994: 1010 Pestalozzigasse 6-8 – gemeinsamer Standort für gesamte Firma
1989 bis 1991: 1010 Hegelgasse – Projekträumlichkeiten (Franz Steinhauer)
1991 bis 1994: 1030 Traungasse – Projekträumlichkeiten
1991 bis 1994: 1040 Gußhausstraße 3 – einzelne Entwicklungsabteilungen
1994 bis 2021: 1110 Geiselbergstraße 21-25 – gemeinsamer Standort für gesamte Firma
1996 bis 2005: 1020 Lassallestraße 5 – SARZ, danach iT-AUSTRIA
2.10.2 Linz
1970 bis 1979: 4010 Sparkasse Promenade - Rechenzentrum
1979 bis 1999: 4040 ZVG Urfahr, Sparkassenplatz 2 – RZ und Gst und ab 1991 PZ und Gst
1983 bis 1989: 4010 Landstraße 12 – Gst.-Leitung und Beratung
1999 bis 2008: 4040 Wildbergstraße 32 - Beratung, Software-Support
2008 bis 2013: 4040 ZVG Urfahr, Sparkassenplatz 2 - Beratung, SW-Support
2013 bis 2020: 4020 Kraußstraße – Beratung
2.10.3 Graz
1971 bis 1984: Schmiedgasse 2 - RZ und Gst und ab 1991 PZ und Gst
1984 bis 2018: Grabenstraße 48 - Gst und ab 1991 PZ und Gst
2.10.4 Innsbruck
1971 bis 1999: Höttinger Au, Mitterweg 96 – Gst und PZ (heute Gst. der Tiroler Sparkasse)
1999 bis 2018: Eduard-Bodem-Gasse 2, PZ
2.11 Mann der 1. Stunde – Erwin Standl
Ich begann meine berufliche Laufbahn 1960 in der Erste Bank (damals Erste Österreichische SparCasse) in einer der Wiener Filialen. Nach zwei Jahren kam ich in das neu gegründete Team zur Vorbereitung der Computerisierung der Bank. Dort arbeitete ich bis 1966, bevor ich zum Computer-Lieferanten (Remington Rand-UNIVAC) ins Controlling wechselte. Im Jahre 1967 wurde ich vom Hauptverband der Sparkassen eingeladen, die Computerisierung im Sparkassensektor auf Basis der Erfahrungen der bisherigen Anwender flächendeckend vorzubereiten.
Der Praxistest der STUSA war die Automatisierung der Kärntner Sparkasse (1967/1968). Das positive Ergebnis führte zur Einführung der Datenverarbeitung in der Allgemeinen Sparkasse in Linz (1968). Die dadurch notwendige Kapitalisierung brachte die Gründung der SPARDAT, an der die Girozentrale maßgeblich (vor allem finanziell) beteiligt war und die Bestellung eines weiteren Geschäftsführers (Dr. Benda), der im Jahre 1975 hauptberuflich als Bereichsleiter in die Muttergesellschaft GIROZENTRALE wechselte.
Mitte 1980 wechselte ich von der SPARDAT in die Erste Bank. Hier war ich in verschiedenen Funktionen (Organisation, EDV, Personal, Bau, Rationalisierungs-Projekt) tätig. Im Jahre 1995 schied ich als Direktor mit Generalvollmacht aus. Die nächste Station war ein Vorstands-Mandat als Generaldirektor-Stellvertreter der Salzburger Sparkasse, wo ich den Verwaltungsbereich mit Schwerpunkt Umstellung auf das SPARDAT-System leitete. Im Jahre 1998 schied ich nach einer Herzerkrankung aus, blieb aber in verschiedenen SPARDAT- und Erste Bank-Gremien beratend bis 2000 tätig.
2.11.1 Der Beginn
Heute gibt es kaum ein Küchengerät von der Mikrowelle bis zum Kühlschrank, das ohne Chip auskommt. Zu dieser Zeit waren Chips ausschließlich aus Kartoffel. Als Rechenhilfen gab es in den 1960er-Jahren keinen PC, sondern mit Handkurbel betriebene mechanische Zahnradmaschinen. Und Netze wurden zum Fischen verwendet. Für die Internet-Generation ein unvorstellbares und zeitlich knapp nach der Steinzeit anzusiedelndes Szenario. Wenige Jahre vor 1960 hat ein IBM-internes Strategiepapier ein weltweites Marktpotential von 50 (in Worten: fünfzig) Computern, ausschließlich für den wissenschaftlichen bzw. militärischen Einsatz, vorhergesagt. Zum Glück für die Firma hat ein intuitives Management diese Prognose nicht ernst genommen. Es ist wichtig dieses Szenario vor Augen zu haben, um den Weitblick der damaligen Entscheidungsträger im Sparkassensektor richtig würdigen zu können.
2.11.2 Erster Computereinsatz bei österreichischen Sparkassen
Im österreichischen Bankenapparat – und hier einmal mehr durch die Sparkassen als Pioniere – hatten die ersten Tabelliermaschinen um 1960 Einzug gehalten. „Einzug gehalten“ ist eigentlich übertrieben. Im Versuchsbetrieb wurden bei den Computeranbietern IBM und BULL einfache Anwendungen (z.B. Erstellen von Zinsstaffeln) in Auftrag gegeben. Zwischen 1961 und 1964 wurden die ersten hauseigenen Computer angeschafft und die ersten Anwendungen programmiert (Buchung von Giro- und Sparkonten). Den Anfang machten die heutige Bank Austria (damals noch „Zentralsparkasse“), die Erste Bank (die „Erste österr. SparCasse“ 1962, 1964 die „Girozentrale“) und, belächelt von den anderen Regionalinstituten,1962 auch die Salzburger Sparkasse über Initiative von Fritz Rücker. Dieser leitete auch 1965 den Untersuchungs-Ausschuss „Buchungsgemeinschaften“ im Auftrag des Betriebswirtschaftlichen Ausschusses (BWA). Er sollte die Frage klären, ob durch Zusammenarbeit von mehreren Sparkassen die damals sehr hohen Kosten der Datenverarbeitung wirtschaftlich zu rechtfertigen wären.
Das Computersystem der Erste Bank kostete damals ca. 10 Millionen Schilling. Die Speicherkapazität bzw. der Hauptspeicher des Rechners betrug nach heutiger Definition gerade 20 KB, so wenig hat heute nicht einmal ein einfacher elektronischer Kalender um wenige hundert Schilling.
2.11.3 Gründung der STUSA
Der eigentliche Initiator der Entwicklung, die dann zur Gründung der STUSA und später der SPARDAT geführt hat, war Herbert Lugmayr. Er hat Dr. Sadleder, den ursprünglich gegenüber der EDV sehr reservierten damaligen Generalsekretär des SPK-Verbandes davon überzeugt, dass im Einsatz von Computern im Sparkassensektor die Zukunft liegt. Wenn dieser von einer Sache überzeugt war, dann hat er sich ihrer konsequent und mit vollem persönlichem Einsatz angenommen. Das war auch notwendig. Damals wie heute war es noch relativ einfach Zustimmung zu Ideen zu bekommen. Doch was sind Ideen ohne finanzielle Basis? Und hier haperte es zu allen Zeiten. Sadleders ursprüngliche Idee, sofort eine Buchungsgemeinschaft als Kapitalgesellschaft zu gründen, scheiterte daran. Der Kompromiss war die Einrichtung und Finanzierung einer Studiengesellschaft (als Verein), die die Möglichkeit und finanzielle Auswirkung eines Rechenzentrums für alle österreichischen Sparkassen prüfen sollte.
Die STUSA (Studiengesellschaft für Sparkassen Automation) wurde am 19. Mai 1967 gegründet und durch Sparkassenverband, Girozentrale, Sparkassenverlag, die beiden Wiener Sparkassen sowie die Landeshauptstadtsparkassen finanziert. Sie nahm am 1. August 1967 ihre Tätigkeit auf. Die personelle Besetzung bestand aus einem Geschäftsführer und einer Sekretärin. Die Unterbringung erfolgte im Haus der Sparkassen, wodurch es vom Start weg eine vernünftige Büroinfrastruktur gab.
2.11.4 Die STUSA im Jahre 1
Der Aufgabenschwerpunkt der STUSA im ersten Jahr war zweigeteilt. Intern galt es die Errichtung einer Buchungsgemeinschaft vorzubereiten: Aufnahme und Ausbildung der ersten Mitarbeiter (z. B. Konrad Ziegelwanger), Ablauforganisation bei Einsatz von EDV in Sparkassen, Abklären logistischer Fragen (vor allem Buchungsschnitt, Transport der Unterlagen zwischen Sparkassen und Rechenzentrum), Gesellschafts-Konstruktion, Finanzierung, Preispolitik, Beobachtung des EDV-Marktes etc.
Extern ging es darum, die Sparkassen vom Nutzen der Datenverarbeitung und der Sinnhaftigkeit einer Gemeinschaftslösung zu überzeugen. Sadleder war dabei der unermüdliche Motor. Er absolvierte unzählige Sitzungen, Besprechungen, Kontakte mit den Landeshauptstadtsparkassen und den Landesverbänden. Starke Unterstützung bekam er von der GZ (zuerst Dr. Mellich, später auch durch Dr. Taus, der den Einsatz der Datenverarbeitung als strategischen Faktor klar erkannte) und vielen anderen Mitgliedern des damaligen STUSA-Ausschusses. So sehr die Entscheidung der Kärntner für ein eigenes Rechenzentrum eine Belastung für die sektorale EDV-Strategie war (oder jedenfalls als solche gesehen wurde), so sehr war sie für die praktische Arbeit in der STUSA hilfreich. Die Kärntner hatten den Willen und das Geld für ein eigenes Rechenzentrum, die STUSA hatte das Know-how und die Leute für die programmtechnische Umsetzung.
Es war ein klassisches Joint Venture zu beiderseitigem Nutzen. Die Sparkasse kam rasch in den Genuss anwendbarer Programme, die STUSA konnte beweisen, dass sie professionell arbeitet. Das Rechenzentrum der Kärntner Sparkasse wurde 1968 in Betrieb genommen. Die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern der Kärntner, allen voran dem Organisationschef Helmuth Brandl, und der STUSA war hervorragend
Das, die Hartnäckigkeit der STUSA Repräsentanten und die „Oberösterreich Connection“ Sadleders führten letztlich dazu, dass die Allgemeine Sparkasse Linz (dank DDr. Richard Büche und Dr. Hansjörg Rigele) im Jahr 1968 als erste Sparkasse der Buchungsgemeinschaft beitrat. Damit war die Initialaufgabe der STUSA eigentlich erfüllt. Die Realisierung der Buchungsgemeinschaft wurde der am 8. August 1968 neu gegründeten SPARDAT (Handelsregistereintragung 23. September 1968) übertragen. Die STUSA blieb als Mantel erhalten, wurde in Personalunion mit der SPARDAT geführt und stellte ihre Mitarbeiter voll für die Programmierarbeiten für das Rechenzentrum in Linz ab.
2.11.5 Wiederauferstehung der STUSA
Mit der Inbetriebnahme des ersten SPARDAT RZ’s im Jahr 1970 war die Buchungsgemeinschaftsidee endgültig etabliert. Nun ging es darum die Basis möglichst rasch zu verbreitern, weitere Sparkassen als Kunden zu gewinnen, Rechenzentren in anderen Bundesländern zu errichten. Das notwendige Kapital wurde von der Girozentrale zur Verfügung gestellt, die im Gegenzug die SPARDAT zu 100 % übernahm. Am Wochenende 7./8. März 1970 wurde der Giroverkehr der Allgemeinen Sparkasse auf Datenverarbeitung umgestellt. Kongenialer Partner bei Umstellung und Vorbereitung waren Dkfm. Siegfried Seirl und sein Team.
Damit wurde auch die Frage des weiteren Bestehens der STUSA, die zu diesem Zeitpunkt ein inaktiver Teil der SPARDAT war, akut. Es war einmal mehr Sadleder, der die Weichen stellte. Seine Meinung, dass es neben einer operativen Gesellschaft (SPARDAT), auch eine mit langfristig ausgerichteter Grundlagenarbeit betraute EDV-Gesellschaft geben sollte, setzte sich durch. Damit ging auch die Geschäftsführung von Erwin Standl auf Hans Ambros über, der die weitere Entwicklung der STUSA markant, wenn auch nicht immer konfliktfrei geprägt hat. Diese neue Ausrichtung wurde, wenngleich erst viel später, durch die Ersetzung des Wortes AUTOMATION durch INNOVATION im alten Namen STUSA dokumentiert.
2.11.6 Eine Buchungsgemeinschaft für alle Sparkassen?
Um der Wahrheit die Ehre zu geben: die Idee der Sparkassen-Buchungsgemeinschaft wurde nicht in Österreich geboren, das wäre der Durchsetzung der Idee möglicherweise auch gar nicht förderlich gewesen, siehe „Prophet im eigenen Land“. Vorbilder waren Einrichtungen in Schweden und in Bayern, die beide 1964 gegründet worden waren. Der erste Entwurf eines „Gesellschaftsvertrages über die Errichtung der Sparkassen-Buchungsgemeinschaft“ aus dem Jahr 1965 sah fast folgerichtig eine Geschäftsführung durch den BSGV (Bayerischer Sparkassen- und Giroverband) vor, der die bayerische Buchungsgemeinschaft betrieb. So viel Internationalität kam, abgesehen davon, dass der Meinungsbildungsprozess in Österreich noch nicht so weit gediehen war, in der Vor-EU-Zeit dann doch nicht in Frage. Die weiteren Überlegungen gingen von einer rein österreichischen Lösung aus. Neben der Frage: „wer zahlt?“ und vor allem „wer zahlt wie viel?“ war, damals wie heute, die Angst vor Verlust von Selbstständigkeit, Einflussmöglichkeit und Prestige sowie vor dem „Wiener Zentralismus“ ein Haupthemmnis, um zügig voran zu kommen.
Den PRO-Exponenten (vor allem Dr. Sadleder und Dr. Mellich seitens der GZ), standen die Vertreter der großen Regionalinstitute skeptisch und abwartend gegenüber. Die GZ hat durch den von der Z in die Bausparkasse geholten Rudolf Peter die Idee von Buchungsarbeiten für kleine Sparkassen aufgegriffen und bei der damals in ihrem Einfluss stehenden Sparkasse Tulln im Jahr 1965 erstmalig realisiert. Die kleinen Institute waren überhaupt der Meinung, dass sie das nichts anginge und nie etwas angehen wird. Das war nicht ganz unverständlich. Denn Ende 1967 gab es insgesamt 172 Sparkassen, 4% davon verwalteten 70% aller Einlagen und hatten 60% aller Buchungsposten. Der Rest an Einlagen und Posten entfiel auf die restlichen 96% der Sparkassen, eine Maßzahl für die Größe (besser Kleinheit) der Institute.
Die Vertreter der „beati possidentes“ (Glücklich die Besitzenden) wie Erste, Z und Salzburg standen der Buchungsgemeinschaftsidee wohlwollend gegenüber, gaben Ratschläge und wirkten in den Gremien konstruktiv mit. Ein Mittun kam für sie nicht in Frage. Das hat vor allem hinsichtlich Salzburgs die Gespräche mit den anderen Landeshauptstadt-Sparkassen erschwert. Das zögerliche Vorgehen im Sektor hatte noch eine Nebenwirkung: die Kärntner Sparkasse, offensichtlich schon damals für Neuerungen sehr aufgeschlossen, wollte auf die Realisierung einer Buchungsgemeinschaft nicht länger warten und entschloss sich Anfang 1967 zum Ankauf eines eigenen Rechners. Das war ein Alarmsignal: wenn es nicht bald zu einer Gemeinschaftslösung kommt, dann würde der teure Weg von ausschließlich Einzelanwendern nicht zu verhindern sein. So lieferte Klagenfurt den letzten Anstoß für die Gründung der STUSA.
2.11.7 Die Missionierung der Sparkassen
Nach dem Motto „Klotzen, nicht kleckern!“ stellte Sadleder die komplette Sparkassentagung 1968 unter das Generalthema AUTOMATION. Neben den vielen, unermüdlich geführten Einzelgesprächen sollte damit die Idee der Buchungsgemeinschaft in ganzer sektoraler Breite diskutiert und das Bewusstsein für Notwendigkeit und Unumkehrbarkeit dieser Entwicklung geschaffen werden:
DDr. Büche/Linz betonte die Notwendigkeit der EDV unter Wettbewerbs- und Rentabilitäts-Gesichtspunkten
Standl/STUSA versuchte durch Entmystifizierung der EDV das Thema SPK-verträglich zu machen
Lugmayr/Z beleuchtete den Einsatz der EDV vor dem Hintergrund geschäftlicher Zielsetzungen und berührte dabei eine Reihe „moderner“ Themen wie Organisationsstraffung, Geschäftsstellencontrolling, Reduktion von Personalkosten, Verbesserung des Kundendienstes
Dr. Leitgeb/Erste behandelte Mitarbeiterfragen rund um die EDV
DVw Plenk/Salzburg und Hoffmann/STUSA behandelten Fragen und Zukunftsentwicklungen rund um Dateneingabe und Datenausgabe (inkl. maschineller Beleglesung, Online Verarbeitung, Datenträgeraustausch)
Dr. Mellich/GZ erklärte das geplante operative Vorgehen zur Errichtung einer Buchungsgemeinschaft und verwies auf vorbildhafte ausländische Beispiele
Dr. Sadleder/HV spannte den Bogen bis zur strategischen Ausrichtung der Sparkassen mit Hilfe der EDV („von der Improvisation zur wissenschaftlichen Unternehmensführung“), wobei ihm
Schöttler/Düsseldorf starke Schützenhilfe leistete und auf die guten Erfahrungen in der BRD mit den EDV-Gemeinschaftseinrichtungen verwies
Wie wichtig das Thema AUTOMATON bei dieser Tagung war, lässt sich daran ermessen, was alles nicht Thema war, sondern nur in einem zweiten Schlussreferat von Sadleder kursorisch gestreift wurde:
Standort- und Zinsliberalisierung in der österreichischen Kreditwirtschaft
die aus betriebswirtschaftlicher Sicht notwendige Fusion von Sparkassen
Sparkassenrechtsreform
Jedes dieser Themen hätte in anderen Jahren ein eigenständiges Generalthema hergegeben.
2.11.8 Rückblick
Ende der 1960-er Jahre war kaum zu hoffen, dass es einmal zu einer gesamtsektoralen Rechenzentrums-Lösung kommen würde. Die zentrifugalen Kräfte schienen zu stark. Der Weg zurück vom Eigenanwender zu schwierig. Die Partikularinteressen zu stark.
Umso mehr überrascht die Situation des Jahres 2000 und der Weg dorthin:
Die kleine Buchungsgemeinschaft der GZ wurde 1970 in die SPARDAT integriert
1980 erfolgte die Wiedereingliederung der LOGICA, der Softwareentwicklungsfirma der GZ
1981 entschloss sich die Kärntner Sparkasse zur SPARDAT zu kommen
1989 war es die Sparkasse Krems – ebenfalls ein Computerpionier der ersten Tage
1996 die Salzburger Sparkasse - irgendwie schließt sich der Kreis: jenes Institut, unter dessen Fittichen die ersten Überlegungen zur Buchungsgemeinschaft stattfanden, stößt nun wirklich dazu
1998 wird die iT-AUSTRIA, das gemeinsame Rechenzentrum für Sparkassen und dem Bank Austria Konzern gegründet
1999 entschließt sich die Erste Bank ihre EDV-Aktivitäten in die SPARDAT einzubringen
35 Jahre später ist die strategische Vision einer gemeinsamen sektoralen Datenverarbeitung doch noch umgesetzt worden. Was lernen wir daraus? Man soll die Hoffnung nie aufgeben! Aber - vielleicht geht es beim nächsten Thema etwas rascher? Es wäre unserem Sektor zu wünschen.
Eröffnung des RZ-Wien 1030 Wien Hintere Zollamtsstraße im April 1972. Vlnr: Peter Benda, Erwin Standl, Michael Reisenauer, Alfred Schmauss (Girozentrale) und Peter Carniel Jahre Sparkassen-Automation 27 von 228
2.12 Mr. GRID - Dr. Peter Benda
All glory comes from daring to begin (Aller Ruhm kommt vom Wagemut, anzufangen); das Zitat soll von Shakespeare stammen. Anlässlich eines GRID-Seminars hat eine der Teilnehmerinnen eine Zeichnung angefertigt. Sie zeigt eine Raupe und darüber einen schönen Schmetterling. Wer kann das wohl gewesen sein? Kann sich wer daran erinnern? Bis heute geistert diese Metapher in meinem Gehirn herum. Die s iT Solutions des Jahres 2019 ist der schöne, große bunte Schmetterling. Wir - die SPARDAT - waren 1970 die kleine borstige Raupe, umgeben von vielen Fressfeinden, die durchaus nichts dagegen gehabt hätten, wären wir gescheitert. Wieso haben wir uns damals auf das Wagnis eingelassen? Wie haben wir es trotz der Probleme geschafft?
Im Jahre 1970 war ich 38 Jahre, damals seit zehn Jahren in der IBM tätig, unter anderem Verkaufsleiter für Banken und Versicherungen, Leiter der IBM Service Centers und fest verankert (das heißt praktisch unkündbar dank Leistung!). Eines Tages ersuchte mich der Vorstand der GIROZENTRALE ein Kurzseminar über Datenverarbeitung zu halten. Ich war positiv erstaunt, denn das Interesse für EDV (so hieß damals die IT) war – ausgenommen bei Dr. Mellich - vornehm ausgedrückt kaum vorhanden. Bald stellte sich heraus: Das Interesse war ein Fake (auf Deutsch: gar nicht wahr). In Wirklichkeit war es ein Assessment, das heißt ein Prüfgespräch, ob ich wohl für eine akute Problemsituation eine geeignete Person wäre.
Problemsituation
Erstes Problem: Im Jahre 1970 gab es ja schon die SPARDAT als zarte Frühgeburt STUSA (siehe Kap. 2.11). Erwin und sein hochmotiviertes Kernteam (Helga Dreiseitel, Hermann Fürdös, Peter Hoffmann, Klinger, Maria Reschenhofer, Schwarzinger, Herbert Suntych, Svoboda, Konrad Ziegelwanger) waren kurz davor, in Linz das erste Rechenzentrum zu installieren. Unabhängig davon hatte die GIROZENTRALE hobbymäßig begonnen, auf ihrer EDV-Anlage den Sparverkehr für die Sparkasse Tulln zu automatisieren.
Zweites Problem: Wer lässt das Geld für die SPARDAT springen? Der Sparkassen-Hauptverband war dazu satzungsmäßig nicht in der Lage, große Sparkassen hatten ihre eigenen Anlagen, also kein Interesse an einer Buchungsgemeinschaft (ist was für die „Kleinen“). Und die Kleinen (?) hatten ihre Buchungsautomaten, ihr langjährig bewährtes Kontoblatt und mit der EDV nichts am Hut (von ganz Wenigen abgesehen z. B. Tulln). Woher also die Erstfinanzierung (ca. 60 Mio ATS von uns damals errechnet) kriegen? Ein Kredit ohne die leiseste Sicherheit!
Drittes Problem: Es war das große Verdienst der GIROZENTRALE in den Personen von Dr. Taus (Bild bei der Eröffnung vom RZ-Wien 1972) sowie Dr. Mellich, dass sie als einziges Institut die Finanzierung durchgesetzt haben und übernahmen. Taus als risikofreudiger Visionär, Mellich als EDV-Begeisterter. Eine Finanzierung ohne Sicherheiten. Wo lag also das Problem? Die GZ wollte Erwin Standl wenigstens einen zweiten Geschäftsführer zu Seite stellen, der aus der GZ stammte. Und das war das Problem. Es gab schwerwiegende Auffassungs-Unterschiede zwischen den geplanten Personen.
Viertes Problem: Abgesehen davon gab es auch ein manifestes Sachproblem: Die Erstinstallation in Linz war auf einer Bull-Anlage vorgesehen, die Programme so gut wie fertig, die Anlage bestellt, Datenerfassung über Lochstreifen. Die GZ benützte für ihre Anwendungen (Bausparkasse) eine IBM-Anlage, Datenerfassung über Lochkarten. Erstere lief mit COBOL-, letztere mit ASSEMBLER-Programmen. Ein Grundsatzstreit entbrannte, der damals in Software-Kreisen fast ein Glaubenskrieg war. SPARDAT-Standort war Wien und alles sollte auf einer Anlage laufen.
Erfolgsfaktoren
Und da kam ich ins Spiel. Die Idee war: Ein unbelasteter Mensch/Mann (Frauen waren damals in der EDV kaum vertreten) von außen könnte die verfahrene Situation retten. Die Faktoren unseres Erfolges:
Faktor 1 - Sponsoren und Fürsprecher
(OE - Organisationsentwicklung: Der Mensch liebt den Fortschritt, aber er hasst jede Veränderung: Ohne Sponsoren, Schutzpatrone scheitert jeder OE-Prozess. Habe ich selbst erlebt).
Die SPARDAT hatte mächtige Sponsoren wie Dr. Walter Sadleder, Chef vom Hauptverband der Sparkassen, überzeugt von der Idee Buchungsgemeinschaft, Generaldirektor Dr. Josef Taus und Dr. Theoderich Mellich vom Vorstand der GIROZENTRALE sowie Fürsprecher wie Generaldirektor Herbert Lugmayr (damals noch Direktor der Zentralsparkasse) und Direktor Rückert von der Salzburger Sparkasse.
Faktor 2 - Die 1970er Jahre selbst
Die Elektronische Datenverarbeitung erlebte den ersten Aufschwung. Für viele Menschen war das ein neues interessantes Tätigkeitsfeld. Aus allen möglichen Arbeitsgebieten, oft sehr einfachen Berufen mit monotonen Abläufen, oft nur neugierig und risikofreudig bewarben sich viele Menschen. Wir waren in der Lage, sozusagen handverlesen, MitarbeiterInnen in persönlichen Gesprächen zu gewinnen. Sogar die Mundpropaganda (Facebook, LinkedIn, Instagram etc. gab’s noch nicht) Motto: „da entsteht eine interessante Firma“. Die meisten kamen auf eigene Initiative, waren in durchaus festen Anstellungs-Verhältnissen, oft mit der Zusage des Definitivums. Ich musste einige Male heilige Eide schwören, dass ich die Bewerbung ja nicht verrate (Helmut Gähr, erinnerst Du Dich?). Er hat mir vertraut und wie ich glaube, es bis heute nicht bereut.
Faktor 3 - Erwin Standl und das vorhandene Team
Es gelang uns innerhalb kürzester Zeit, eine Vertrauensbasis herzustellen. Wir waren uns einig, dass wir sehr, sehr rasch handeln mussten, denn es gab einige brennende Fragen:
Auf welcher Anlage sollte gearbeitet werden? Die Frage wurde von den Software-Spezialisten rasch beantwortet. Wir können die Assembler-Programme nicht auf der Bull-Anlage laufen lassen, Zeit für Umprogrammierung gab es nicht, COBOL lief allerdings auch auf IBM. Also Entscheidung pro IBM. Erwin musste sich damals große Vorwürfe von GD Denk (Bull CEO) anhören, von mir „hatte er sich ja nichts anderes erwartet“. Unglaublich, wie emotional damals der Computer-Markt umkämpft war.
Wir haben als nächstes - wirklich innerhalb von wenigen Tagen - ein Budget und einen Investitionsplan erstellt, basierend auf folgenden Vorgaben der Sparkassen und GZ:
72 Groschen/Buchung und in 5 Jahren die schwarze Null
Der Buchungsposten-Preis beträgt 72 Groschen angelehnt an die 10 Pfennig (Kurs 7:1) der deutschen Buchungsgemeinschaften, die damals schon ein Mengen-Aufkommen jenseits von unseren Startlöchern hatten. Und die GZ gab uns eine Frist von fünf Jahren, um eine ausgeglichene Bilanz vorlegen zu können. Ob sich damals jemand bei diesen Vorgaben wohl die Hände gerieben hat?
Unsere Zielgruppe als Marktpotential waren 170 Sparkassen verstreut über neun Bundesländer
Rückblickend glaube ich heute, dass wir damals wohl ein wenig verrückt waren. Aber, wir hatten Feuer gefangen. In wirklich wenigen Tagen hatten wir ein Budget. Es waren, glaube ich, ca. 60 Mio. öS und wir ersuchten um Genehmigung seitens des GZ-Vorstands binnen 14 Tagen. Die Antwort: gelähmtes Schweigen. Auf meine Urgenz erklärte mir ein Insider: „Man kann dem GZ-Vorstand doch keinen Termin setzen“. Zur Ehrenrettung des Vorstands muss ich einräumen, dass ja der Vorstand nicht beurteilen konnte, wie seriös unser Investitionsplan war und kein Fachwissen zur Überprüfung unserer Vorstellungen existierte. Es kam also zu einer für mich denkwürdigen Vorstandssitzung mit dem GZ-Vorstand, in der man uns ein wenig ratlos fragte, wie man diese 60 Mio wohl genehmigen könne?
Unsere Antwort war einfach: „Sie werden uns wohl oder übel vertrauen müssen!“
Das war für Juristen im Vorstand eine unmögliche Bedingung. Und wieder muss ich dem damaligen Vorstand hohes Lob aussprechen. Er erkannte die Notwendigkeit unserer Eile und schuf einen lustigen neuen Begriff: Grundsätzlich genehmigt! Das hieß eigentlich nicht genehmigt, sondern wir schauen uns im Nachhinein an, ob wir richtig gehandelt hatten! De facto fand diese Überprüfung nie statt, denn wir schafften es, mit den 72 Groschen pro Buchungszeile die schwarze Null nach drei Jahren zu erreichen.
Apropos 72 Groschen: Diese vollkommen irrationale Preisfestsetzung ärgerte mich und wir bestanden in mehreren Verhandlungen auf einer Indexierung des Preises. Die wurde uns zugestanden. Intern lautete unser Credo: Wir werden diese Klausel tunlichst nicht anwenden, um damit auch in den Folgejahren unsere Wirtschaftlichkeit zu beweisen.
Faktor 4 - Firmengrundsätze
Hier möchte ich nur die anführen, die meines Erachtens nachhaltig für unseren Erfolg in den 1970ern waren.
Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser: Diese Maxime hat mich in meinem ganzen Berufsleben begleitet. Vertrauen ist ein Geschenk, es kann nicht erkauft, nicht erzwungen werden. Dieses Geschenk hat eine große Kraft: Der Beschenkte fühlt sich verpflichtet, ein Gegengeschenk zu machen: und das heißt ebenso Vertrauen zurück zu schenken. Ich glaube, dieses Vertrauensgitter hat uns in der SPARDAT so stark, leistungsfreudig und auch menschlich zufrieden gemacht.
Ursprünglich lautete diese Maxime nämlich genau umgekehrt und wird auch heute noch gerne von modernen Managern angewendet. Was die meisten „modernen“ nicht wissen: Dieser Grundsatz stammt von Dzierżyński, Gründer der Tscheka (russische Geheimpolizei), 1917 Genosse von Lenin, der auch als Autor zitiert wird. Gründer der Gulags vulgo KZs. Man kann natürlich eine Firma auch als Gulag führen! Geht eine Zeit lang ganz gut. Das Scheitern ist aber vorprogrammiert. Beispiele?
kompromisslos Konsens-orientiert
Ich bitte um Nachsicht, wenn ich jetzt kurz auf meinem Steckenpferd GRID reite, dem ich so viel verdanke und das mich bis heute auch privat unterstützt in meinem Verhalten. Tagtäglich ärgere ich mich, wenn in Politik, Demokratie und Alltag behauptet wird, dass alle Entscheidungen im Grund nur über Kompromisse erreichbar sind. Alle, die GRID erlebt haben, erinnern sich (hoffentlich), dass wir den Kompromiss (5,5) als KOMPROMIES angeprangert haben. Das heißt, zwei Menschen einigen sich scheinbar, gehen aber in der Meinung auseinander, dass ihre ursprüngliche Auffassung die richtige war. Das Ergebnis: beide gehen unzufrieden auseinander, jeder sagt, ich hätte nicht nachgeben sollen, das nächste Mal muss ich recht haben. Meistens stellt sich ja nachher heraus, dass einer recht hatte. Das züchtet Revanchegefühle, Vorurteile, die sich steigern bis zu echten Gräben, die zu neurotischen Vorurteilen, ja Hass führen können. Musterbeispiel der Abgesang auf die so lange und nach 1945 auch notwendige Koalition Schwarz-Rot.
Konsens hingegen bedeutet, dass unterschiedliche Meinungen ein Indiz dafür sind, dass Jeder Fakten mitbringt, die der andere nicht hat oder übersehen hat oder vielleicht nicht sehen will. Die aber zusammengeführt werden müssen, um die richtige Entscheidung zu finden.
Für uns in der SPARDAT immer ein Hinweis, dass diese individuellen Fakten, Meinungen erörtert und geklärt werden müssen, weil bei komplexen Fragen keiner allein im Besitz der ganzen Wahrheit ist. Dann kam im Regelfall eine Entscheidung zustande, die alle tragen und jedermann gegenüber vertreten konnte. Eine Willensübereinstimmung, ein KONSENS wurde gefunden (9,9 für Insider). Voraussetzung: Respekt, Vertrauen, Kollegialität etc. Ich bin überzeugt, dass dieses Streben nach Konsens uns stark gemacht hat. Es hieß auch oft: Die SPARDAT-Führung kann man nicht auseinanderdividieren.
Fehlertoleranz, menschlich betrachtet
Wir waren rasch, wir haben oft bis über die Grenzen unserer Kräfte gearbeitet. Da haben wir auch Fehler gemacht. Die waren manchmal unangenehm. Ich denke da zum Beispiel an die Vorlauf-Datumskarte beim Jahresabschluss, der ja oft genug unter enormen Zeitdruck stand. Also eine lächerliche kleine Lochung, ein falsches Datum oder sonst was. Oder einmal ein internes Memo, in dem eine unpassende Bemerkung über einen lästigen GZ Funktionär im elektronischen Verteiler prompt diesen aus dem Bildschirm ansprang. Soweit ich mich erinnern kann, hat das keinen in der SPARDAT den Kopf gekostet. Na ja, zornig war ich vielleicht. Aber für mich war das in erster Linie eine Lernchance. Ich kann mich jedenfalls an keinen zweiten Fall einer falschen Datumskarte erinnern (Erstaunlich, was einem mit 87 aus dem Langzeitgedächtnis anspringt).
Faktor 5 - Die Geschäftsführung





























