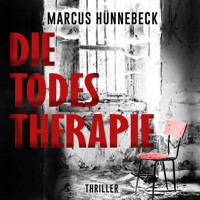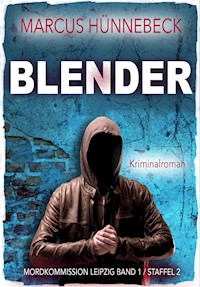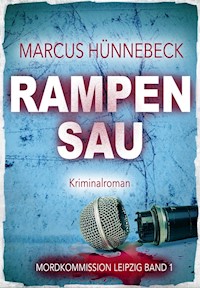3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Fast 300 Seiten Gute-Laune-Lesespaß Als der Kinderbuchautor Sven Frost an einem Herzinfarkt stirbt, werden ihm 595 zusätzliche Stunden unter den Lebenden eingeräumt. Anfangs weiß er allerdings nicht, wie er die Zeit sinnvoll nutzen soll. Doch nach einem Wochenende, das er mit einer atemberaubenden Escort-Dame verbringt, hat Sven eine Idee. Plötzlich überschlagen sich die Ereignisse, was nicht nur an seiner bezaubernden Nachbarin Katharina liegt … Stimmen zum Roman: "In dem Buch "595 Stunden Nachspielzeit" sind es die Ereignisse und die Wendungen, die immer wieder überraschen und von einer grundsätzlichen Heiterkeit geprägt sind, die sich direkt auf den Leser überträgt und so ein Gesamtwerk erschaffen, das bis zur letzten Seite vollkommen zu Recht als 'humorvoll' bezeichnet werden kann." (eBookmeter.info - Das Online Magazin für eBooks & Co.) "Das ist eine heitere Komödie im "Chik-Lit" Stil – aber wendet sich durchaus an Männer, denn Sven liebt Poker und Escort-Damen. Liest sich gut und ist professionell geschrieben!" (xtme.de) "Humorvoller, spannender und herzerwärmender Roman ..." (Maria) "Sehr humorvoll und erfrischend geschrieben." (Ina) "Des Öfteren ertappte ich mich beim laut vor mich hin lachen und einem Dauergrinsen im Gesicht. Danke für diese Geschichte." (Diana E-W) "Ich musste eigentlich das ganze Buch durch immer wieder lachen, absolute Kaufempfehlung!" (simone h) "Eine schöne, leicht geschriebene Geschichte, die Seiten fliegen so davon." (der Bremer) "Ein herrlich erfrischendes Buch, manchmal nicht ganz jugendfrei, aber auf jeden Fall flüssig, unterhaltsam, lesens- und empfehlenswert. Bitte mehr davon." (Vielleser) "Das war doch mal ein locker flockiges Buch mit toll formulierter Handlung... ich hab es gern gelesen." (KJSM-T) "Ich gestehe, ich habe mich köstlich amüsiert... Danke für dieses Buch!" (Elayne) "Es ist durchgehend witzig und flott geschrieben und am Ende fand ich es schade, dass ich nicht mehr davon lesen durfte. Absolute Empfehlung!" (B. René) "Ein großartiges Gute-Laune-Buch und noch viel mehr als das! Absolut lesenswert!" (Sabine Brockhaus)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Jo C. Parker/Marcus Hünnebeck
595 Stunden Nachspielzeit
Humorvoller Roman
Das Buch
Als der Kinderbuchautor Sven Frost an einem Herzinfarkt stirbt, verhandelt er aus prinzipiellen Erwägungen mit seinem persönlichen Jenseitsbegleiter über eine Rückkehr auf die Erde. Tatsächlich gewährt ihm dieser 595 zusätzliche Stunden und rät ihm, in der Nachspielzeit positives Karma zu sammeln. Zurück unter den Lebenden hat Sven allerdings keine Ahnung, wie er das anstellen soll. Doch nach einem Wochenende, das er mit der atemberaubenden Escort-Dame Arabella verbringt, schmiedet er einen Plan. Plötzlich überschlagen sich die Ereignisse, was nicht nur an Svens bezaubernder Nachbarin Katharina liegt …
Prolog
Schlaftrunken öffne ich die Augen. Durch die Ritzen des Rollladens dringt Licht, ich höre das Zuschlagen einer Autotür, kurz darauf das Starten eines Motors. Als ich mich umdrehe, vernehme ich einen Morgengruß. Gähnend werfe ich einen Blick auf den Wecker. Vermutlich lohnt es sich nicht mehr, wieder einzuschlafen. Die blinkende, rote Anzeige signalisiert mir, dass es zehn Minuten nach zwei ist.
Also lohnt es sich ja doch.
Bevor ich einnicke, wundere ich mich wegen der Helligkeit im Zimmer. Um diese Uhrzeit müsste es stockdunkel sein. Dann erinnere ich mich an die morgendliche Begrüßung. Welcher Spinner ruft um zehn nach zwei nachts ›Guten Morgen‹?
Und außerdem: Warum blinkt mein Radiowecker?
Die Informationen verdichten sich in meinem Gehirn zu einem unangenehmen Resultat.
»Verdammt!«
Mit einem Mal hellwach schlage ich die Bettdecke beiseite und stehe hektisch auf. Ich sprinte ins Badezimmer, wo eine batteriebetriebene Uhr an der Wand hängt. Schonungslos offenbart sie mir die wahre Zeit: 7.59.
»Verfluchter Mist!«
Um neun habe ich einen Lesetermin in einer Schule. Für den Weg dorthin bräuchte man normalerweise eine Dreiviertelstunde, wenn er nicht über mehrere stauanfällige Autobahnen führen würde. Um diese Uhrzeit benötige ich bestimmt doppelt so lange und müsste bereits seit einer halben Stunde im Auto sitzen.
Ich entledige mich des Schlafanzugoberteils, verreibe Wasser unter die Achselhöhlen und wische mit einem Handtuch drüber. Die mangelhafte Körperpflege kompensiere ich mit überdurchschnittlichem Deoeinsatz. Danach renne ich in die Küche, in der die ebenfalls blinkende Mikrowellenuhr meine Mutmaßung bezüglich eines nächtlichen Stromausfalls bestätigt. Weil sich mein Kopf bei Koffeinentzug rasch in ein dumpf pochendes Folterinstrument verwandelt, starte ich den Kaffeeautomaten. Während die Maschine vorheizt, eile ich ins Schlafzimmer und ziehe mich an. Zurück im Bad beseitige ich mit der Zahnbürste den schalen Geschmack im Mund. Zuletzt begebe ich mich noch einmal in die Küche, stelle eine Kaffeetasse bereit, drücke den Startknopf und nutze die folgenden vierundzwanzig Sekunden, um dem Kühlschrank die Toastpackung zu entnehmen. Ich hole einen einzelnen Toast heraus, den ich trocken hinunterwürge. Hauptsächlich dürstet es mich ohnehin nach Kaffee. Hastig blase ich in die Tasse, trotzdem verbrenne ich mir beim ersten Schluck die Zunge.
»Autsch!«
Weiteres Pusten, der nächste Zug ist erträglich. Kurz darauf spüre ich den Koffeinschub. Achtlos stelle ich das Porzellangefäß in die Spüle, das Brot bleibt auf dem Tisch liegen.
Um zehn nach acht öffne ich die Wohnungstür. Glücklicherweise habe ich gestern Abend die Bücherboxen im Wagen gelassen und muss mich nun nicht mit ihnen abplagen.
Ausgerechnet jetzt läuft die Wagner die Treppe hinunter, nachdem wir erst am Vortag wegen ihres Kindes aneinandergeraten sind.
»Morgen!«, brummt sie mürrisch.
Hektisch drängle ich mich an ihr vorbei.
»Hey«, beschwert sie sich, als ich sie versehentlich anremple.
»Hab’s eilig!«, verteidige ich mich und verlasse das Haus, ohne ihr die Tür aufzuhalten.
»Was für ein Gentleman!«, ruft sie mir hinterher. »Aber meinen Sohn verhaltensgestört nennen.«
Ich sprinte zu meinem Pkw, der immerhin sofort anspringt. Für die Strecke stehen mir achtundvierzig Minuten zur Verfügung.
»Sei bitte auf meiner Seite«, flehe ich das Schicksal an und ignoriere die stechenden Brustschmerzen ebenso wie die Kurzatmigkeit.
Eine Viertelstunde später lande ich bei der Zufahrt zur zweiten Autobahn im Stau.
»Das kann nicht wahr sein!«, fluche ich. Die anderen Verkehrsteilnehmer zeichnen sich zu allem Überfluss durch besondere Unfähigkeit aus; meinem Vordermann reicht ein drei Wagenlängen großer Raum nicht zum Einfädeln aus. Dass er einen altmodischen Hut trägt, erklärt seinen Fahrstil. Statt seiner nutze ich die Gelegenheit, was der Hintermann mit einem Hupton quittiert.
»Schnauze!«, brülle ich.
Der Verkehr kommt fast vollständig zum Erliegen. Am zügigsten geht es auf der linken Spur voran, allerdings muss ich demnächst erneut die Autobahn wechseln.
Nun zwängt sich der Hutträger doch noch vor mich, ich steige in die Bremsen und hupe meinerseits. Schwarze Flecken tanzen wie ein Mückenschwarm vor meinen Augen. Ich blinzle, ohne dass sie verschwinden.
Da man auch in der Mitte schneller vorankommt, ziehe ich rüber. Als ich mich kurz darauf wieder rechts einordnen will, fährt ein Spasti die Lücke zu. Ich blicke ihn wütend an, er grinst hämisch zurück. Zornig zeige ich ihm den ausgestreckten Mittelfinger. Daraufhin spitzt er seine Lippen zum höhnischen Kuss.
Plötzlich fällt mir das Atmen unsagbar schwer. Ich kriege keine Luft mehr. Als hätte sich ein Elefant auf meinen Brustkorb gesetzt. Schweißperlen rinnen mir das Gesicht hinab. Ein unerträglicher Schmerz durchzuckt mich. Ich höre leiser werdende Hupgeräusche, ehe ich das Bewusstsein verliere.
Ein Körperfunktionscheck signalisiert die Wiederherstellung in allen Bereichen: Atmung normal, Schmerzen verblasst, Sehstörung beseitigt. Jedoch sitze ich nicht in meinem Auto, sondern stehe allein in einem Tunnel. An dessen Ende entdecke ich ein zügig näher kommendes Licht, in dem sich eine Gestalt befindet. Sie trägt ein helles Gewand, ihre langen, blonden Haare fallen ihr bis über die Schultern. Anhand der Gesichtszüge erkenne ich nicht, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Stattdessen bemerke ich auf dem Rücken zwei weiße Flügel aus Federn.
Oh nein! Bitte nicht!
Oder fängt die Karnevalssession dieses Jahr extrem früh an?
»Willkommen!«, werde ich freundlich begrüßt. Selbst die Stimme bietet keinerlei Anhaltspunkte für die Geschlechtsbestimmung.
»Wer bist du?«, frage ich.
»Sascha, dein persönlicher Jenseitsbegleiter.«
Sascha!
Klar. Warum nicht Jens oder Jasmin? Dann wäre wenigstens ein Punkt geklärt. Doch ausgerechnet mein Begleiter trägt einen Namen, den es für Männer und Frauen gibt.
Moment!
Die Gestalt hat sich als Jenseitsbegleiter vorgestellt. Wäre sie weiblichen Geschlechts, hätte sie sich als Begleiterin bezeichnen müssen.
Andererseits: Wer garantiert mir, dass im Himmel auf solche sprachlichen Feinheiten Wert gelegt wird?
Also gelange ich zu der Auffassung, in dieser Hinsicht keine endgültigen Schlüsse ziehen zu können, ehe mir bewusst wird, gestorben zu sein.
Was unmöglich sein kann! Ich bin siebenunddreißig!
»Das ist ein Irrtum«, informiere ich Sascha, ohne ihm die Schuld an diesem Schlamassel zu geben. Soll er es halt in Ordnung bringen.
»Was ist ein Irrtum?«, fragt er begriffsstutzig. Ich habe für mich entschieden, dass es ein Er ist.
»Ich bin nicht tot!«
»Bist du wohl!«
»Unmöglich!«
»Weshalb bist du dann hier?«
»Weshalb bist du dann hier?«, äffe ich seine affektierte Sprachmelodie nach, die mir allmählich auf den Sack geht.
So gekünstelt hat zuletzt der Priester bei der Beichte vor der Erstkommunion mit mir gesprochen.
»Natürlich war es falsch, Isabel so feste an den Haaren zu reißen, dass sie geweint hat. Falls du es ehrlich bereust, verzeiht dir Gott.«
Sascha blickt mich erwartungsvoll an.
»Meine Zeit ist noch nicht gekommen«, kläre ich ihn auf.
»Wir irren uns nie«, beharrt Sascha.
»Ich bin erst siebenunddreißig!«, teile ich ihm triumphierend mit. Damit ist ja wohl alles gesagt.
»Du warst ein siebenunddreißigjähriger Mann mit stark erhöhtem Blutdruck und schwachem Nervenkostüm, der sich zu wenig bewegt hat«, kontert er.
»Stark erhöhtem Blutdruck? Du übertreibst!«, wende ich ein. »Bei der letzten Untersuchung hatte ich einen Blutdruck von einhundertfünfundvierzig zu neunzig.«
»Das waren deine Werte vor zwölf Monaten. Seitdem hast du deinen Arzt nicht mehr aufgesucht«, tadelt er mich. »Als dir gestern schwindelig wurde und du dich in der Diele hinsetzen musstest, lagen sie bei einhundertneunzig zu einhundertzehn.«
Stehen dem Himmel drahtlose, unsichtbare Messgeräte zur Verfügung? Wie werden die Daten wohl übermittelt? Über W-LAN, dem UMTS-Netz oder dem Wolkenbreitbandnetz?
»Ich hatte noch so viel vor«, beschwere ich mich. »Heute Abend wollte ich beispielsweise mit einem Kinderroman anfangen. Deinem Boss gefällt es bestimmt, wenn Kinder lesen.«
»Die Idee für den Roman hattest du bereits vor einem Vierteljahr. Bist du dir sicher, dass du ausgerechnet heute Abend mit dem Schreiben begonnen hättest?«
Seine unerbittliche Art, mit der er die Einwände pariert, nervt. Ich erinnere mich an meine letzten Lebensminuten, die ich im Stau verbracht habe. Was für ein unwürdiger Abgang!
»Was ist mit der Zeit, die mir auf Erden gestohlen worden ist?«, frage ich ihn.
Zum ersten Mal wirkt er leicht unsicher. »An welche Zeit denkst du?«
»Wie oft habe ich in meinem Leben im Stau gestanden? Wenn ich das zusammenzähle, komme ich wahrscheinlich auf zwei Jahre.«
Neben Sascha taucht unvermittelt ein aus Wolken geformter Aktenschrank auf. Der Jenseitsbegleiter öffnet eine Schublade und holt etwas heraus, das wie ein Wolken-iPad aussieht.
Verehrte Engelschar, Steve Jobs präsentiert euch das iPad der neuesten Generation. So leichtes Material wurde nie zuvor für ein modernes Elektronikgerät verwendet.
»Hm«, murmelt Sascha. »Für dein Alter hast du wirklich schon zahlreiche Stunden durch Verkehrsbehinderungen verloren.«
»Genau! Richtig behindert war das!«, bestätige ich ihm. »Deswegen habe ich den Job als Transporteur an den Nagel gehängt.«
»Vierundzwanzig Tage, neunzehn Stunden, achtzehn Minuten und dreißig Sekunden«, stellt Sascha fest.
»Rechne das nach!«, fordere ich ihn auf. »Gefühlt waren es mindestens zwei Jahre.«
»Vierundzwanzig Tage, neunzehn Stunden, achtzehn Minuten und dreißig Sekunden«, wiederholt Sascha.
Besserwisserischer Korinthenkacker!
»Was würde der Boss wohl dazu sagen, wenn ich dir quasi eine Nachspielzeit gewähre? Lustige Vorstellung! Bringt ein wenig Pfeffer in den Alltag! Ist eh alles so eingefahren hier. Aber eigentlich entspricht es nicht den Regeln.«
Seine nachdenklich geäußerten Worte wecken Hoffnung in mir, jedoch finde ich vierundzwanzig Tage zu wenig.
»Moment!«, wende ich mit erwachender Selbstsicherheit ein. »Wir sollten über alle gestohlenen Jahre reden! Die ganze Schulzeit beispielsweise.«
Sascha sieht mich kopfschüttelnd an. »In der Schule lernt ihr Menschen fürs Leben.«
»Nicht bei den langweiligen Lehrern. Von denen hatte ich einige.«
»Auch bei diesen hast du gelernt.«
»Meine Beziehung mit Simone!«, fällt mir ein. Simone war die zweite Freundin, die ich ins Bett bekommen hatte. Zu meinem Verdruss dauerte es acht Monate, sie zu überreden, und dann floppte der Sex gewaltig. Da die Wiederholung keinen Deut besser war, trennte ich mich anschließend von ihr.
»Niemand hat dich gezwungen, Zeit mit ihr zu verbringen.«
»Na ja«, widerspreche ich. »Ich bin kein Experte bezüglich des Sexualtriebs von Engeln, doch junge Männer werden von den Hormonen zu so manchen Sinnlosigkeiten angestiftet.«
In seinen Augen erkenne ich, dass er dieses Argument nicht gelten lässt. Hektisch suche ich nach weiteren Zeitverschwendungen.
»Familienfeste!«, rufe ich. »Was habe ich mich dort gelangweilt!«
»Familienfeste dienen dem Wachsen der Seele«, klärt er mich auf.
»Die Anfänge des Internets!«
»Was?«
»Weißt du, wie langsam früher eine Modemverbindung war?«
Er schüttelt den Kopf.
»Schlechte Kinofilme! Mieses Fernsehprogramm! Niederlagen meines Fußballvereins!«
»Mein Entschluss steht fest«, teilt er mir mit. Der Aktenschrank und das Wolken-iPad lösen sich in Luft auf. »Du hast unangemessen viel Erdenzeit durch Verkehrsbehinderungen eingebüßt. Daher biete ich dir an, diese auf der Erde nachzuholen. Weil ich in Spendierlaune bin, bekommst du sie sogar komplett erstattet, obwohl fast jeder Mensch in den Industrienationen etwas Zeit im Stau verliert. Von jetzt an stehen dir noch fünfhundertfünfundneunzig Stunden, achtzehn Minuten und dreißig Sekunden zur Verfügung. Allerdings muss ich dich warnen. Dein Karmapunktekonto war nur knapp im positiven Bereich; gerade in den letzten Jahren hast du reichlich Negativpunkte gesammelt. Bei unverändertem Verhalten läufst du in der Nachspielzeit Gefahr, die Zutrittsberechtigung zum Himmelsreich einzubüßen. Deswegen lautet mein Rat, auf eine Rückkehr in deine menschliche Hülle zu verzichten und mir diskussionslos zu folgen.«
Tatsächlich denke ich kurz über die Alternativen nach. Was bringen mir knapp fünfundzwanzig Tage? Eine prinzipielle Erwägung gibt den Ausschlag: Ich will nicht mitten im Berufsverkehr sterben.
»Die Nachspielzeit wird angenommen«, kläre ich ihn auf.
Im gleichen Moment verschwindet Sascha und alles um mich herum wird schwarz.
Tags zuvor
Etwa vierundzwanzig Stunden vor meiner denkwürdigen Begegnung mit Sascha verdiente ich auf für mich alltägliche Weise Geld: Eine Grundschule hatte mich für zwei Lesungen gebucht.
Ich saß in einem stickigen Raum, mein Vortrag näherte sich einem Spannungshöhepunkt, mit einem Cliffhanger beendete ich diesen Teil der Veranstaltung und schlug effektheischend das Buch zu. Der Knall schien eine der Lehrerinnen aus ihrem Halbschlaf zu reißen, denn sie zuckte zusammen und blinzelte wie ein Autofahrer, den der Sekundenschlaf übermannt hatte.
»Ob es Tamara gelingt, die Kobolde aus der Gefangenschaft der hässlichen Warzenhexen zu befreien, erfahrt ihr in meinem Roman. Ich danke euch fürs Zuhören.«
Wie eine Trophäe hielt ich das Hardcover in die Höhe, um das Verlangen zu wecken, dieses Meisterwerk im Anschluss käuflich zu erwerben. Die beiden anwesenden Lehrerinnen klatschten und animierten die vierundfünfzig Schüler, ihrem Beispiel zu folgen. Der Applaus endete rasch, was ich als schlechtes Omen für den späteren Buchverkauf wertete.
Die Pädagogin, die beinahe eingedöst war, erhob sich von ihrem Stuhl. »Jetzt hat uns der Herr Frost nicht nur so wundervoll vorgelesen«, sagte sie mit pathetischer Stimme, »sondern sich auch bereit erklärt, eure Fragen zu beantworten. Was wollt ihr also von einem echten Autor wissen?«
Schüchtern hoben die ersten Kinder ihre Arme in die Höhe.
Ich wählte ein Mädchen in der zweiten Reihe aus, das ein gelbes T-Shirt trug. Auf diesem schlug ein Comicgirl einen Strichmännchenjungen mit der rechten Faust nieder. ›Frauenpower‹ stand unter dem Bild. Vor meinem geistigen Auge sah ich ihre Eltern Eva und Judith beim Vorgespräch für die künstliche Befruchtung.
»Wollten Sie schon immer Bücher schreiben?«, erkundigte sie sich.
»Nein«, antwortete ich. »Als ich in eurem Alter war, hasste ich Aufsätze.«
Die Pädagogin sah mich tadelnd an. Von Wahrheitsliebe hielt sie wohl nicht viel.
»Warum sind Sie denn dann Schriftsteller geworden?«, rief ein Schüler, der hinten saß.
»Vor etwa zehn Jahren fing ich an, mir Geschichten für einen Jungen auszudenken. Weil ihm meine Ideen gefielen, schrieb ich sie irgendwann auf und schickte sie an Verlage. Einer dieser Verlage hatte Interesse und knapp zwölf Monate später erschien mein erster Roman. Das war ein tolles Gefühl!« Die zwanzig Standardabsagen, die ich vorher erhalten hatte, erwähnte ich nicht.
»Wie heißt Ihr Sohn?«, fragte ein Mädchen mit zum Zopf geflochtenen, blonden Haaren und einem roten Brillengestell auf der Nase.
»Ich habe keine Kinder.«
»Wer war dann dieser Junge?«, bohrte sie nach.
»Der Sohn meiner damaligen Lebensgefährtin.«
»Wie alt sind Sie?«
»Siebenunddreißig.«
»Was hast du gemacht, bevor du Autor geworden bist?«
»Ich besaß ein Transportunternehmen und fuhr mit einem kleinen Lkw Pakete von einem Ort zum anderen.«
»Cool!«, sagte ein Junge. »Warum machst du das heute nicht mehr?«
»Bücher schreiben und sie netten Kindern wie euch vorzulesen, ist viel schöner«, schleimte ich mich ein. »Außerdem hat es mich genervt, die Hälfte meiner Arbeitszeit im Stau zu stehen.« Und die Verdienstmöglichkeiten waren mit jeder Gesetzesänderung geschrumpft. Doch vor allem hatten mir irgendwann meine Kniegelenke Schwierigkeiten bereitet. Das ständige Kuppeln, Bremsen, Gas geben war Gift für sie gewesen.
»Sind Sie reich?«, fragte ein Mädchen.
Die Lehrerinnen und zahlreiche Schüler kicherten.
»Leider nicht«, erwiderte ich wahrheitsgemäß.
Ein Mädchen in einer weißen Bluse hob schüchtern ihre Hand. Aufmunternd nickte ich ihr zu. Sie gehörte bei der Lesung zu denjenigen, die mir positiv aufgefallen waren, weil sie die ganze Zeit aufmerksam zugehört und am Ende frenetisch applaudiert hatte.
»Ich finde Sie voll toll«, sagte sie zuckersüß. »Und das Buch war so spannend. Meine Eltern lesen mir nie vor.«
»Schade«, entgegnete ich mit einem tröstenden Lächeln. Wenn die Mehrzahl der jungen Zuhörer wie sie wäre, würden mir diese Schulveranstaltungen mehr Spaß bereiten.
Zehn Minuten später beendete ich die Fragerunde. Auf dem Tisch lag eine Plastikbox mit Postkarten, die meine aktuellsten vier Romane bewarben. Ich hielt eine der gelben Karten in die Höhe. »Hierauf findet ihr ein paar Hinweise, die euch bei einer Bestellung in der Buchhandlung oder im Internet helfen. Wer Geld mitgebracht hat, kann Tamara und der Fluch der hässlichen Warzenhexen jetzt bei mir kaufen, ich schreibe gerne eine Widmung hinein. Außerdem freue ich mich über Gästebucheinträge auf meiner Homepage; die Adresse ist ebenfalls auf der Postkarte vermerkt.«
Eine Schülerin schnippte aufgeregt mit ihren Fingern. »Was kosten die Karten?«
»Nichts.«
Die Kinder jubelten laut. Ehe ich sie bitten konnte, sich anständig in einer Reihe anzustellen, drängelten sie sich um mich herum. Im Kampf um die besten Plätze schubsten sie sich gegenseitig weg und streckten mir ihre Hände entgegen. In meiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt, fiel es mir anfangs schwer, meinen Namenszug auf die Postkarten zu setzen. Manchmal rempelte mich jemand an und die Unterschrift wurde krakelig. Ich spürte eine seltsame Beklemmung in der Brustgegend, als litte ich unter spontaner Klaustrophobie. Doch je kürzer die Schlange wurde, desto mehr entspannte ich mich.
Zur Pause nahm mich eine der Pädagoginnen mit ins Lehrerzimmer. In der Mitte des Raumes standen sich zwei längliche, mit Papieren übersäte Tische gegenüber und ich zählte insgesamt vierzehn Stühle, von denen vier bereits besetzt waren.
»Ich hoffe, es frustriert Sie nicht, nur drei Bücher verkauft zu haben.«
»Nein«, täuschte ich Gelassenheit vor. »Nach Lesungen zieht oft der Buchverkauf in Buchhandlungen an.«
Sie deutete auf eine Sitzgelegenheit. »Die Kollegin ist seit ein paar Wochen im Mutterschutz. Setzen Sie sich. Möchten Sie einen Kaffee?«
»Gerne.«
Meine Ansprechpartnerin ging zu einer Kaffeepadmaschine. Unterdessen betraten weitere Lehrerinnen den Raum, von denen mir manche zunickten und einige sich erkundigten, ob ich der Autor sei, der heute hier vorlas.
Auf das Getränk wartend, musterte ich die Lehrkörper. Sie bildeten einen Durchschnitt der Fachkräfte, die ich regelmäßig an Grundschulen antraf. Zwei Frauen sprangen mir jedoch durch ihre Attraktivität ins Auge. Die erste war ziemlich groß und hatte braune, bis zu den Hüften reichende Haare. Ihre Kleidung erinnerte mich an die wilden Sechziger; besonders auffällig waren die zehn Ringe, die sie an den Fingern trug. Außerdem hatte sie ihre Fingernägel schwarz lackiert. Die andere war optisch ihr komplettes Gegenteil: kleiner, zierlicher, zu einem Dutt gewundenes blondes Haar, eine weiße Bluse und einen grauen Rock tragend. Ihr Gesicht wies Ähnlichkeiten mit Meg Ryan auf. In einem völlig unpassenden Moment – allein unter Frauen im Lehrerzimmer einer Schule – wurde mir schmerzhaft bewusst, wie lange ich inzwischen Single war. Eigentlich wollte ich mir keine Hoffnungen machen, dass eine der beiden Lehrerinnen Interesse an mir zeigen könnte, aber entstand Liebe nicht manchmal bei den seltsamsten Gelegenheiten? Warum also nicht in einer Pause nach einer Lesung?
Die Zimmertür öffnete sich schwungvoll und ein Mann kam herein.
»Gibt’s ja gar nicht«, rief er laut. »Wer stiehlt mir den Platz als Hahn im Korb?« Er trat auf mich zu und begrüßte mich mit übertrieben festem Händedruck.
»Sven Frost«, stellte ich mich vor. »Ich bin der Autor.«
»Alexander Siebert. Dann lesen Sie gleich bei uns. Ich bin der Klassenlehrer der Drei a.«
Ich taxierte ihn, während er den freien Stuhl zwischen den hübschen Lehrerinnen ansteuerte. Er war ein gut aussehender Endzwanziger. Bestimmt äußerst beliebt bei seinen Kolleginnen.
Ich sah meine Vermutung bestätigt, als ihm das Hippiemädchen eine Keksdose reichte.
»Die habe ich gestern Abend gebacken. Hoffentlich schmecken sie dir.«
»Hier ist das versprochene Cocktailrezept«, sagte die blonde Lehrerin und schob ihm einen Zettel zu. Es hätte mich nicht gewundert, ein rotes Herzchen darauf zu entdecken.
Der Lehrer fing meinen Blick auf und zwinkerte mir zu. Ob er wohl ahnte, wie sehr ich ihn beneidete?
***
Am frühen Nachmittag steckte ich auf dem Weg zu einer weiteren Lesung in einer Light-Version der Hölle: auf einer Autobahn in Richtung der alten Heimat.
Wochen zuvor hatte ich in gefühlsduseliger Stimmung meiner ehemaligen Grundschule per E-Mail angeboten, honorarfrei bei ihnen zu lesen. Wahrscheinlich hatte ich unterbewusst geahnt, etwas für mein Karma tun zu müssen. Oder ich hatte gehofft, mich in das Kind zurückzuversetzen, das neugierig auf seine Zukunft war.
Honorarfrei!
Gibt es ein schrecklicheres Wort für einen Schriftsteller, der es gerade eben schafft, von der Kombination aus Tantiemen, Bücherverkäufen bei Veranstaltungen und Lesungsvergütungen zu leben? Deswegen hatte ich die Nachricht schnell bereut und auf ausbleibende Resonanz gesetzt.
Fünf Tage später hatte die Direktorin jedoch geantwortet, um auf meinen Vorschlag einzugehen und mich um zwei Lesungen im Rahmen des jährlichen Sommerfestes zu bitten. Statt mich damit herauszureden, dass mein E-Mail-Account von Hackern gekapert worden sei, und auf meinen üblichen Honorarsatz zu verweisen, hatte ich zugesagt. Daher befand ich mich nun auf dem Weg in die Stadt, in der ich meine ersten einundzwanzig Lebensjahre verbracht hatte.
Auf der Autobahn behinderten wie immer zahlreiche Baustellen den fließenden Verkehr. Beim Einsetzen leichten Nieselregens leuchteten reflexartig rote Bremslichter auf.
»Leute! Leute! Leute!«, fluchte ich nach einem Blick auf die Uhr. »Es sind bloß ein paar Tropfen Wasser. Ihr müsst nicht für jeden einzelnen in die Bremsen steigen!«
Meine Belehrungsversuche brachten nichts. Es bildete sich ein Stau, der mich zum Anhalten zwang.
»Verdammter Mist!« Wütend schlug ich aufs Lenkrad. Ich hatte nur noch sechzig Minuten Zeit bis zum Beginn des Schulfestes.
Vor mir stand ein blaues Fahrschulauto. Als sich die Blechkarawane wieder in Bewegung setzte, würgte der Fahrschüler den Motor ab. Das Auto blieb ruckelnd stehen.
»Das darf nicht wahr sein!«, brüllte ich. »Wie kann man so einen blutigen Anfänger auf die Bahn lassen?«
Der Schüler schaffte es, den Motor anzulassen und ihn beim Anfahren erneut abzuwürgen.
»Flasche!«
Hinter mir hupte jemand. Um meine Solidarität kundzutun, drückte ich ebenfalls fest auf die Hupe. Genervt blickte der Fahrlehrer über die Schulter. Mit seinem Zeigefinger gab er mir zu verstehen, was er von so viel Ungeduld hielt.
»Was willst du von mir?« Ich gestikulierte mit meinen Armen, um darauf hinzuweisen, dass die Blechlawine inzwischen gut dreihundert Meter vorwärtsgekommen war. Während dieser dezenten Informationsvermittlung spürte ich einen heftigen Stich in der Brustgegend.
»Puh«, stöhnte ich gepeinigt auf und massierte meinen Brustkorb.
Das Fahrzeug rollte endlich los und der Lehrer hatte ein Einsehen mit den staugeplagten Menschen. Der Blinker leuchtete auf, kurz danach verließ der Pkw die Autobahn. Im Nu fand ich Anschluss an die anderen Wagen.
Mit vierzig Stundenkilometern quälte ich mich durch die Baustelle und wählte unterdessen mittels der Freisprecheinrichtung die Telefonnummer meiner Mutter an.
»Frost«, meldete sich eine erkältet klingende Stimme.
»Bist du krank?«, fragte ich ohne Umschweife.
»Hallo, mein Sohn. Ich war letzte Woche krank. Jetzt geht es einigermaßen. Du solltest öfter anrufen, falls dich mein Gesundheitszustand interessiert.«
»Du kannst dich ja auch melden. Oder gilt deine Flatrate ausschließlich für ankommende Gespräche?«
»Als du noch mit Melanie zusammen warst, haben wir uns häufiger gesehen.«
»Melanie ist seit zwei Jahren Geschichte«, erinnerte ich sie.
»Wird Zeit für eine neue Frau. Das Alleinsein tut dir nicht gut.«
Warum bloß bohrte sie in dieser Wunde? Ich wusste selbst, dass ich nicht fürs Alleinsein geschaffen war. Andererseits gehörte eine Menge Glück dazu, die richtige Partnerin zu finden und sie nicht wieder zu verlieren.
»Bist du gleich da?«, erkundigte sie sich.
»Ich schaffe es nicht, dich abzuholen. Ich stehe im Stau.«
»Wie soll ich dann zur Schule kommen?«
»Indem du fünf Minuten läufst!« Nach dem Tod meines Vaters war meine Mutter in der alten Wohnung geblieben, in der sie seit nunmehr zweiundvierzig Jahren lebte.
»Ich fühle mich heute nicht so gut«, stöhnte sie.
»Ein kurzer Spaziergang wird dir nicht schaden.« Ihre Wehleidigkeit war äußerst anstrengend. Als ich ein kleiner Junge war, hatte sie mir regelmäßig Angst eingejagt, weil sie in jedem stärkeren Kopfschmerz die Symptome eines Gehirntumors zu erkennen glaubte. Zumindest war es mir in der Pubertät gelungen, mich davon nicht mehr tangieren zu lassen. Meine Abneigung gegen Vorsorgeuntersuchungen hing bestimmt mit ihrer überproportionalen Inanspruchnahme dieser Leistung zusammen.
»Wenn du mich nicht abholst, muss ich wohl zu Fuß gehen.«
»Ich habe mir den Stau nicht ausgesucht. Die Lesung fängt um Viertel nach drei an. Sei ausnahmsweise pünktlich!«
Ohne ein weiteres Wort legte sie auf.
Erneut massierte ich mir meine Brust und versuchte, meine verkrampfte linke Schulter zu lockern. Wunderte sie sich wirklich über unseren seltenen Kontakt? Stets sprach sie mich darauf an, dass zu Melanies Zeiten alles schöner gewesen war. Als würde ich das nicht selbst wissen.
Wenigstens löste sich die Autoschlange endlich auf. Ich wechselte die Spur und gab Gas.
Eine halbe Stunde später tauchte das dreigeschossige, rote Backsteingebäude vor mir auf. Die Direktorin hatte mir in der E-Mail-Konversation die Erlaubnis gegeben, den auf dem Schulgelände befindlichen Parkplatz zu benutzen. Also rollte ich vorsichtig durch das geöffnete Tor und überfuhr dabei fast einen übergewichtigen Mann, der sich mir überraschend behände in den Weg stellte. Mit einer Handbewegung im Stil eines Verkehrspolizisten forderte er mich zum Halten auf. Abrupt bremste ich, da ich mir nicht sicher war, ob mein Wagen einen Zusammenprall mit seinem Fettairbag schadlos überstanden hätte.
Er rief etwas, das ich wegen der geschlossenen Seitenscheibe nicht verstand. Gereizt kurbelte ich das Fenster hinunter. »Warum versperren Sie die Zufahrt?«
»Das ist ein Lehrerparkplatz. Sie sind kein Lehrer!«, klärte er mich dankenswerterweise auf.
»Ich bin der Autor, der beim Schulfest liest. Frau Schreiters hat mir erlaubt, hier zu parken.«
»Welcher Autor? Welche Lesung?«
»Wer sind Sie überhaupt?«
»Frank Fischer. Der Schulhausmeister. Ich bin auf diesem Gelände für Recht und Ordnung zuständig. Wie lautet Ihr Name?«
»Sven Frost.«
»Sven Frost? Nie gehört!«
Super! Für meinen Auftritt schien ja reichlich Werbung gemacht worden zu sein. Ich kramte in meiner Tasche nach dem Ausdruck der E-Mail. Wortlos drückte ich dem Hausmeisternazi das Papier in die Finger. Er überflog es und trat enttäuscht beiseite.
»Das wird ja dann seine Richtigkeit haben«, murmelte er. »Vorausgesetzt, Sie haben das nicht gefälscht.«
Ich fühlte mich ertappt, denn natürlich fälschte ich solche Nachrichten, um stundenweise exklusive Parkmöglichkeiten in Anspruch nehmen zu können.
»Passen Sie ja auf, dass Sie keine Macken in die Lehrerautos fahren!«
»Jawohl, mein Führer!« Ich salutierte mit der rechten Hand und ließ den Wagen anrollen. Grimmig schaute er mir hinterher.
***
Erinnerungen an die Grundschulzeit tauchten aus den Tiefen meines Gedächtnisses auf, während ich mich dem Eingang näherte: Auf dem Platz links von mir hatten meine Freunde und ich in den großen Pausen mit einem Tennisball Fußball gespielt. Meistens hatte meine Mannschaft gewonnen, oft dank meiner Tore. Zur Eingangstür führte eine Treppe mit insgesamt zwölf steinernen Stufen. Ich entsann mich an die zittrigen Beine, mit denen ich diese bei der Einschulung erklommen hatte, unsicher darüber, was für Erfahrungen dieser Lebensabschnitt bereithalten würde.
Hinter mir liefen ein paar Kinder leichtfüßig den Aufgang hoch. Unterdessen zog ich erfolglos an der geschlossenen Holztür.
»Wird erst um drei aufgemacht«, klärte mich ein blondes Mädchen in einem bunten Blumenkleid auf.
»Und wie komme ich jetzt hinein?«, fragte ich.
Sie sah mich an, als sei ich vom Himmel gefallen. »Sie müssen einfach klingeln.«
Die hochbegabte Schülerin übernahm das für mich. Wenige Sekunden später öffnete uns eine ältere Frau, die ein graues Kostüm und farblich abgestimmte Schuhe trug. Ihre grauweißen Haare waren kurz geschnitten.
»Herr Frost!«, begrüßte sie mich mit einem Lächeln und einem unangenehm schlaffen Händedruck. »Schön, Sie zu sehen! Ich dachte schon, Sie hätten es sich anders überlegt.«
»Auf der Autobahn war ein kilometerlanger Stau«, rechtfertigte ich mich. Warum fühlte ich mich getadelt wie ein einfältiger Junge?
»Ich zeige Ihnen den für Sie vorbereiteten Raum.«
Beim Betreten des Gebäudes kam mir das schwarz-weiß-karierte Bodenfliesenmuster ungemein vertraut vor. Uns unterhaltend liefen wir die Stufen bis zum Dachgeschoss hinauf. Selbst an das Treppenhaus konnte ich mich deutlich erinnern. Die Grundschulzeit hatte sich unauslöschlich eingeprägt. Allerdings hatte mir früher das Treppensteigen nicht den Atem geraubt. Schließlich erreichten wir den obersten Absatz und betraten ein geräumiges Zimmer, in dem die Tische an den Rand gestellt und circa dreißig Kinderstühle in einem Halbkreis aufgebaut waren. Für mich hatte man einen Erwachsenenstuhl und einen hölzernen Tisch vorgesehen.
»Ich organisiere Ihnen Mineralwasser. Wenn Sie ein Stück Kuchen möchten, sagen Sie einfach am Kuchenstand Bescheid. Als unser Ehrengast benötigen Sie keine Wertmarken. Gleich erfolgt übrigens der Startschuss in der Turnhalle. Darf ich Sie dort begrüßen?«
»Wird ziemlich knapp. Ich muss meine Tasche und die Bücher aus dem Auto holen. Wahrscheinlich muss ich sogar zweimal gehen.«
»Dann viel Glück! Plaudern wir nach Ihren Lesungen.«
Der Grund, warum ich mich letztlich auf die honorarfreien Auftritte bei diesem Schulfest eingelassen hatte, war die Anwesenheit der Eltern mit hoffentlich prall gefüllten Geldbörsen. Gewiss würden sie ihren kleinen Lieblingen das Werk eines Autors kaufen, der diese Schule besucht hatte und damit den lebenden Beweis antrat, dass sich Schulbildung lohnte.
In meinem Wagen befanden sich zwei große Plastikboxen mit Konstantin-Klever-Romanen. Ich brauchte fünf Minuten, um sie nacheinander die Etagen in den Vorleseraum zu tragen. Als das erledigt war, setzte ich mich nach Luft ringend auf den Stuhl. Möglicherweise sollte ich doch regelmäßig Sport treiben, was mir mein Hausarzt bei einem Termin im letzten Jahr im Hinblick auf erhöhte Blutdruckwerte empfohlen hatte.
Nach einer kurzen Verschnaufpause holte ich die Bücher aus den Kisten und stapelte sie ordentlich auf einem Beistelltisch.
Kurz vor dem geplanten Lesungsbeginn war ich noch immer allein in dem Klassenzimmer. Wo blieb eigentlich meine Mutter?
»Hereinspaziert«, forderte ich schließlich die ersten Kinder auf, die ihre Köpfe durch den Türspalt reinsteckten.
»Was findet denn hier statt?«, fragte ein Mädchen.
»Eine coole Bücherlesung.«
»Langweilig«, sagte der ungefähr zwölf Jahre alte Junge, der sie begleitete. »Lass uns weiter!« Er zog an ihrem Ärmel, woraufhin sie ihm unwillig folgte.
Um zwanzig nach drei hielten sich fünf Kinder und drei Erwachsene bei mir auf, meine Mutter gehörte nicht zu ihnen. Ich versuchte, den Start etwas hinauszuzögern. Würden sich die Besucher etwa auf die zweite Veranstaltung stürzen?
Als um halb vier die Tür aufging, hatte ich mich sowie den Roman vorgestellt und die erste Seite rezitiert. Meine Mutter trug einen fliederfarbenen Blazer kombiniert mit einer schwarzen Hose. Sie lächelte mir zu, während sie eintrat, mein Gesicht hingegen entsprach einer eingefrorenen Maske. Ich konzentrierte mich wieder auf den Text. Kaum hatte ich den nächsten Satz gelesen, stöhnte ein Junge schmerzerfüllt auf. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen quetschte sich meine Mutter ausgerechnet in die Reihe, in der bereits drei Leute saßen, obwohl zwei Stuhlreihen völlig leer waren. Zu allem Überfluss trat sie dabei einem Schüler auf den Fuß.
»Oh weh«, bedauerte sie ihn in nicht unerheblicher Lautstärke. »Ist es sehr schlimm?«