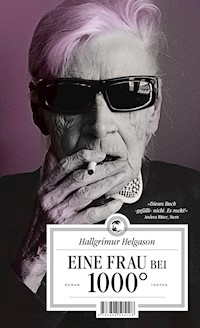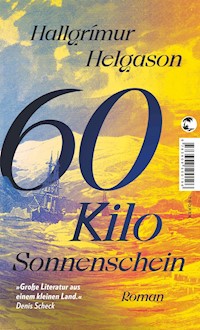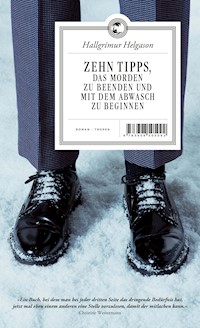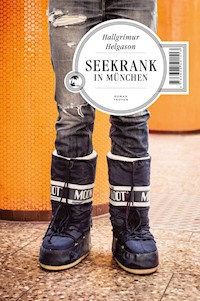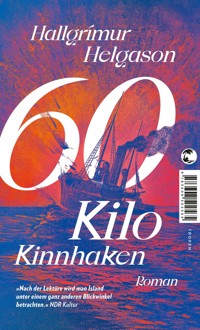
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tropen
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das größte Abenteuer der isländischen Geschichte Segulfjörður erlebt Sonnenschein satt. 1906, nach der vierten Heringssaison, säumen bunte Holzhäuser den Fjord, überall winkt die Chance auf schnell verdientes Geld. Doch dann holt das Schicksal zu einem fiesen Kinnhaken aus, der dem Treiben am Fjord ein jähes Ende setzt. Bildstark erzählt Hallgrímur Helgason vom abenteuerlichen Weg Islands in die Moderne. Nach seinem Bestseller 60 Kilo Sonnenschein schreibt Hallgrímur Helgason die Reise seines Landes in die moderne Welt fort: Der junge Waise Gestur ist mittlerweile volljährig und stürzt sich übermütig in den munteren Tanz auf den Heringsplattformen. Dort treffen ausländische Fischer auf einheimische Frauen, in der Luft liegen die Verführungen des Lebens. Und in Segulfjörður beginnt die spektakuläre Reise aus den dunklen Torftunneln in hell erleuchtete Wohnzimmer mit Plüschsesseln und Blumentapeten. Doch dann holt das Schicksal zu einem fiesen Kinnhaken aus. Ein imposantes, vor Originalität sprühendes Werk, das einmal mehr zeigt, warum Helgason zu den ganz großen Schriftstellern seines Landes zählt. »Ein unterhaltsamer Schmöker bar jeder Romantik und Nostalgie.« Frankfurter Allgemeine Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 854
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Hallgrímur Helgason
60 Kilo Kinnhaken
Aus dem Isländischen von Karl-Ludwig Wetzig
Tropen
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Tropen
www.tropen.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Sextíu kíló af kjaftshöggum« im Verlag JPV Útgáfa, Reykjavík
© 2021 by Hallgrímur Helgason
Published by agreement with Forlagið, www.forlagid.is
Für die deutsche Ausgabe
© 2023, 2024 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: Zero-Media.net, München
unter Verwendung der Illustration »Germany’s Menace to Neutrals: A Trawler Blown Up«, Illustration auf der Titelseite von The Graphic, 5. September 1914, gezeichnet von Donald Maxwell (1877–1936) nach Skizzen von Bergur Pálsson (1874–1967)
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von Druckerei C.H.Beck, Nördlingen
ISBN 978-3-608-50256-5
E-Book ISBN 978-3-608-12208-4
4. Buch
Gestur in Strönd
Kapitel 1
Dunkelheit zwischen den Bänden
Zwischen den Bänden herrscht Dunkelheit. Eine rabenschwarze und saukalte isländische Dunkelheit. Doch keine ganz stille, denn Wind pfeift hindurch, Nordwind mit nassen Böen, sie prasseln auf die kleine arktische Ortschaft ein, die wir uns im ersten Band aufgebaut haben.
Der Wind vom Eismeer fällt ungehindert in den Fjord ein und klatscht mit seinem Nassschnee auf die Dächer und gegen die Fenster, gegen Masten und Rahen, sodass kein Schiff ruhig vor Anker liegt. Der Herbststurm fegt auch jeden Bücherwurm um Kirchturm und Kirchenschiff, wo er gern im Dunkel herumlungert, denn der Leser fühlt sich in Druckerschwärze am wohlsten. In einem Fenster erblickt er allerdings ein Licht und fragt sich und den Autor, wer wohl dort noch wach sein mag.
Der Autor, immer eine Eule im eigenen Werk (selten gesehen, aber alles sehend), hockt mit großen Augen auf der Friedhofsmauer und antwortet, dort im Obergeschoss des Madamenhauses liege die alte Pfarrersfrau, die Königin des Fjords. Sie hat die gesamte Geschichte durchlebt, ist inzwischen einhundertzwei Jahre alt und feiert jeden Tag Weihnachten: Nachts lässt sie ihr Licht brennen.
Davon abgesehen ist der Ort in dieser finsteren Septembernacht lichtlos. Und unser Held Gestur liegt in der einem Erdhügel gleichenden Tagelöhnerkate Strönd am Nordufer der Halbinsel Eyri, die mithin die erste Hauswand darstellt, auf die der Nordwind prallt. Gestur schläft im Dunkeln, den Kopf voller Dunkelheit, und in dieser dreht sich das Traumrad und knarrt verhalten. An diesem großen Mühlrad hängt sein Vater Eilífur und schnappt nach Luft, taucht aus dem Meer auf und verschwindet wieder und wieder und wieder. Die See geht mächtig hoch.
Diesen Traum hat der Junge schon oft geträumt, und jedes Mal wacht er mit derselben Frage auf den Lippen auf: Wo ist mein Vater? Manchmal wandelt sich die Frage ab zu: Wer ist mein Vater?
Der Leser reibt seine Nase an der Scheibe im Grasdach über Gestur, denn seine Neugier ist erwacht, er möchte die Hauptperson gern sehen, wissen, wie sie drei Jahre nach dem ersten Band aussieht. Der Tag beginnt wie ein in Tinte getauchtes Blatt. Es steigt papierweiß aus der Druckerschwärze, und das Dunkle läuft von ihm ab, doch einige Tropfen bleiben zurück, sprenkeln die Seite, bis sie ein Muster bilden. Jede Schrift ist Dunkelheit, jedes Blatt Papier Licht. So wirken sie zusammen. Keine Nacht ohne Träume, kein Traum ohne Gespenster.
Kapitel 2
Menschenerwachen
Heulend regt sich der Tag, und wir sehen, wie die Menschen erwachen. Man kann in das Haus aus Grassoden nicht leicht hineinsehen, aber der Erzähler kommt dem Leser entgegen, wischt mit seinem Eulenflügel den Matsch vom Fenster und verschwindet dann im Schneegestöber. Zu dem Zeitpunkt der Geschichte besteht die Scheibe schon aus Glas, nicht mehr aus der Fruchtblase eines Kalbs. Obwohl der größte Teil der Bevölkerung noch immer in Erdlöchern haust, ermöglicht das zwanzigste Jahrhundert eine gute Sicht. Wir richten unser Leselicht nun auf die Bettgestelle und sehen, dass der Morgen mit einem Auge beginnt. Der kleine Olgeir, der Junge in Gesturs Bett, öffnet das seine.
»Es iss Mor’n!«
Er ist wie der Himmel: ein Auge auf, das andere zu, sie werden bestimmt Sonne und Mond genannt. Jetzt ist das eine im Haus aufgegangen, das andere zugekniffen.
»Es iss Mor’n!«
Der Kleine ist drei Jahre alt, trägt ein pipigelbes Wollunterhemd und eine zerrissene, kurze Hose und verkündet den Mitschläfern in der Baðstofa den Anbruch des Tages. Er erkennt ihn an dem grauen Lichtschimmer über dem Dach. Mehrmals hat er nun schon bis zum Anbruch der Dämmerung geschlafen. Selbst das Kind hat gelernt, dass die Fischfangsaison vorbei ist und die Menschen schlafen wollen, solange es dunkel ist. Doch jetzt weicht das Dunkel. Gestur rührt sich und schiebt Olgeir mit dem nackten Arm über der heugefüllten Decke von sich. Sein Gesicht ist nicht mehr so rundlich wie früher, schon markanter geschnitten, die Züge ausgeprägter; er ist jetzt achtzehn Jahre alt. Neben ihm ist der kleine Einäugige bereits putzmunter und voller Energie, er möchte alle wecken und sich unterhalten.
»Gettur, Mor’n iss. Schiffe fahren!«
»Ja, ich weiß, sag das deinem Papa«, gibt Gestur zurück und dreht sich von dem Jungen weg auf die Seite. Keine Spur von Stimmbruch mehr in seiner Stimme.
Auf der anderen Seite des Mittelgangs schnarchte Snjólka in ihrem Bett, weiter hinten schliefen die Alten, Lási auf Gesturs Gangseite und Grandvör ihm gegenüber. Zwischen ihnen konnte man durch das Fenster in der Giebelwand den Segulfjörður sehen. Da das Ufer nicht im Blickfeld lag, sondern nur das Wasser, konnte man sich in dieser Baðstofa wie auf einem Schiff fühlen, zumal bei heftigem Nordwind wie diesem, auf einem Schiff, das aus dem Fjord ausläuft. Wie oft hatte sich Gestur vorgestellt, sie führen zu unbekannten Meeren und Ländern und unterwegs ginge der Großteil der Mannschaft über Bord. Denn trotz spürbarer Fortschritte auf allen Gebieten hatte Gestur es ordentlich satt, in dieser Hütte festzusitzen, mit diesen Menschen, die mit ihm noch immer so wenig blutsverwandt waren wie an dem Tag, an dem sie ihn bei sich aufgenommen hatten, als er mit zwölf, verdüstert von seinem Sturz aus der Welt der Holzhäuser in die der Torfkotten, bei ihnen gelandet war.
»Papa! Papa!«, rief Olgeir laut, bis der Gerufene auf vier Pfoten schwanzwedelnd angedackelt kam. Papa war eine Promenadenmischung norwegischer Herkunft mit hellem Schnurrbart. Im Zwielicht waren seine Augen kaum mehr als glänzende Punkte, als er seine feucht schimmernde, kalte Schnauze über das Bettbrett schob. Der Junge tippte ihm mit dem Zeigefinger auf die Nase. Er hatte gelernt, das Tier nicht zu kraulen und nicht zu streicheln.
»Alter Papa, nasse Schnauze. Willst du in Bett?«
»Nein, er kommt nicht ins Bett«, verbot Gestur und schob den Hund weg. »Das ist ein räudiges Vieh voller Flöhe.«
»Aber er ist mein Papa!«
»Er ist ein Schäferhund und nicht dein Papa. Aber du kannst ihn meinetwegen so nennen, wenn du willst.«
»Aber er ist mein Papa!«
»Nein. Du hast keine vier Beine und keinen Schwanz.«
»Aber ich habe ein Auge.«
Diese Feststellung brachte Gestur zum Schmelzen, er drückte den Jungen an sich und presste ihm Pupslaute auf die Haut, bis er ein Lachen zustande brachte. Ohne den Kleinen wäre das Haus wahrscheinlich längst versunken, sein eines Auge war die Sonne, die es in seinem Inneren hell werden ließ. Gestur verstand inzwischen das alte, übellaunige Sprichwort, das Snjólka manchmal fallen ließ: »Fad ist ein kinderfreies Haus.« Ihr Leben war lange verfinstert gewesen, nachdem sie am Ende des ersten Bandes ihre beiden Kinder und auch ihre Mutter verloren hatte, in jener Lawine, die ihr altes Haus verschüttet und sie hierhergewirbelt hatte. Monatelang brannten ihre Augen von der Sinnlosigkeit des Lebens.
Olgeirs leiblicher Vater, der Bauer und Handwerker Lási, war alt geworden und hatte alle Lebensfreude verloren; er redete fast nicht mehr und reimte sich nur noch fluchend in Rage. Die Lawine schien ihm jeglichen Humor ausgetrieben zu haben. Einem kleinen Jungen hatte er wenig zu geben, auch wenn er sein eigener Sohn war. Olgeir nannte ihn Opa. Gestur war der im Alltag diensttuende Vater und hatte sich nur mit großer Mühe diesen Titel verbitten können.
»Mama, ich will Tei und Pulla! Tei und Pulla!«, krähte Olgeir über den Gang zu Snjólka. Meist schlief er bei ihr und bekam morgens ein Bröckchen Teig zur Morgenmilch, die Gestur von Mjólkurbær holte. Anschließend erhielt er seine Pulla, einen Löffel Haferbrei, der zusammen mit etwas geriebenem Trockenfisch in ein altes Tuch gewickelt wurde, an dessen Zipfel er dann bis zum Aufstehen nuckeln konnte.
Snjólka erhob sich wie ein Automat, verrichtete die letzten Schnarcher im Stehen und sah das Kind gar nicht an, war aber fast aufgewacht, als sie die Küche betrat und die Wärme des Herdfeuers spürte. Über ihr pfiff der Nordwind, denn um das Reinregnen durch den Rauchabzug zu verringern, hatte Lási eine leere Flasche ohne Boden hineingestopft, und dieser gläserne Schornstein war im ganzen Ort bekannt. Der Wind blies sein minimalistisches Morgenlied auf dem grünen Flaschenhals, während das Tageslicht aus der Tiefe heraufstieg.
Ein weiterer Tag fiel in den Segulfjörður ein.
Kapitel 3
Fernseeblick
Strönd bestand aus kaum mehr als einer Baðstofa am Wasser, den Nordgiebel gegen den Wind gestemmt, den anderen nach Süden weisend; ein äußerst kurzer Gang und eine angebaute Küche trugen das Ihre dazu bei, den Grassodenbuckel ein Haus nennen zu dürfen. Es war nicht die übelste Behausung auf der Eyri-Halbinsel, aber auch nicht die beste. Den größten Nachteil stellte die Nähe des Meeres dar, dessen Brandung dem neuen Leben seinen Rhythmus vorgab, sie war die Uhr, die jede Minute einläutete. Selbst an den windstillsten Tagen konnte eine unsichtbare Welle mit solchem Krachen am Ufer brechen, dass die alte Grandvör auf ihrem hohen Kissen zusammenschrak, weil sie es für das Donnern einer Lawine hielt.
Regelmäßig überspülte die Flut das Ufer, und das Haus verwandelte sich in das Schiff, von dem Gestur träumte. Aus den Betten traten sie in knöchelhohes Eiswasser. Das Ufer war voll Seetang, langhalsiger Rhizoide. Zwar hatten die Isländer ihr Land von jeglichem Wald gesäubert, doch das Meer schien zwischen Grund und Ufer dicht damit bewachsen zu sein und tat alles, um so viel wie möglich davon an Land zu werfen. Ständig hingen Vögel in der Luft, Möwen und Raben, die ohne Flügelschlag wie Drachen über dem Strand schwebten und nach etwas Essbarem in den Tanghaufen Ausschau hielten. Am schlimmsten aber war es, wenn die Brecher gegen das Haus krachten. Dreimal schon hatte die Brandung die Fensterscheibe in der Nordwand zerschmettert, und einmal schleuderte sie sogar einen mannsschweren Treibholzstamm aufs Dach der Baðstofa, sodass ein Sparren brach.
Lási schnitzte eine pfiffige Sitzbank aus dem Stamm, die dann vor dem Haus aufgestellt wurde. Erst im Nachhinein kam ihm der Gedanke, es könne angeraten sein, der Familie für die Nachtruhe Stahlhelme zu besorgen. Aber noch hatte er sich nicht aufraffen können, der dänischen Armee zu schreiben.
Gestur hatte sich angewöhnt, vor dem Haus oder auf dem Strandwall zu stehen und zur Fjordmündung hinauszuschauen. Er konnte dort halbe Stunden lang stehen, erst recht nach dem Ende der Fangzeit. Die Mündung war wie ein Fenster aus dem bergigen Zimmer, das der Fjord bildete. Nur dort sah man den Horizont, die kurze Linie von Segulnes im Osten zum Landsendabjarg am westlichen Ufer des Fjords. Und obwohl er genau wusste, dass hinter dieser Linie auch nichts anderes lag als noch mehr Meer und der Nordpol, aber keine Länder, keine Städte, wies der Himmel über der See doch immer einen träumerischen Zauber auf. Die Wolken, die dort schwebten, das Licht, das dort verweilte und zuweilen den letzten Rest des Sonnenuntergangs hinter den Bergen im Westen bildete, waren Verheißungen von Abenteuern und anderen Welten. Daher schaute er immer wieder fasziniert zum Fjord hinaus, so wie Menschen später auf ihre Bildschirme. Selbst im alltäglichsten Regenschauer, der wie ein dunkelgrauer Vorhang über den Horizont wanderte, schienen ihm wunderbare Begebenheiten, eine spannende Geschichte, die Gesänge fremder Völker, Auseinandersetzungen jenseits des Urals, Schiffshavarien im Bosporus zu stecken. Die Fjordmündung war sein Fernseher. Sein Fernseer.
An diesem Tag sah er zu, wie sich der Sommer aus dem Fjord kämpfte. »Schiffe fahren!«
Es ging auf Abend zu, der steife Nordwind ließ nach, und zwei norwegische Segler kreuzten gegen ihn an, ein dritter wurde von einem Motorboot geschleppt. Gestur sah, wie die weißen Segel im heftigen Wind flatterten, als wären sie ausgelesene Seiten in einem anderen Buch. Die vierte Heringsfangzeit in Segulfjörður war offiziell zu Ende. Reeder dieser Schiffe war der Risikospieler Rune Vetlesen, der als Letzter heimfuhr. Es war schon die zweite Septemberhälfte, und es musste mit jeder Art von Wetter gerechnet werden. Noch immer galt die Regel, dass die Flotte vor dem Sturmtag, dem 6. September, das Land verließ, aber da noch über dieses Datum hinaus Hering gefangen wurde, waren die wagemutigsten Fischer das Risiko eingegangen. Vetlesen war einer von ihnen, ein tollkühner Newcomer in der Branche, und natürlich nannten die Spottdrosseln ihn nicht Vetlesen, sondern Vitleysi, Verrückter. Er hatte den Sommer über gut verdient, im September noch besser. Er würde als schwerreicher Mann nach Hause zurückkehren, oder als Wasserleiche.
Gott sei ihnen gnädig, dachte Gestur wie so manch anderer. Die drei Schiffe hatten den ganzen Tag darauf gewartet, dass sich der Wind legte, und nun schienen sie es gerade noch vor dem Dunkelwerden zu schaffen, sich aus dem Fjord zu stehlen. Gestur begleitete die Fahrzeuge mit den Augen bis Segulnes, wo sie hinter Núpur seinem Blick entschwanden. Praktisch im gleichen Moment schlief der Wind ein, und Stille erfüllte den Fjord. Die Wellen rollten glatt aus wie weiße Laken nach einer turbulenten Wäsche und glichen sich dem Weiß in der Höhe an: Der morgendliche Matsch, der von den Steinen getaut war, lag oben auf den Bergen als Schnee.
Bald wurde die Stille vom Tuckern des Motorboots unterbrochen, das eines der Schiffe aufs offene Meer geschleppt hatte, und das Tageslicht schwand zusehends. Gestur ging mit den Händen in den Taschen zum Strand und kickte ein paar Steine weg. Dieser neue Zeitvertreib war ihm möglich, seit er norwegische Stiefel trug. Am Ufer blieb er eine Weile stehen und bedachte seine Lage. Im ersten Heringssommer war er konfirmiert worden, eigentlich ein Jahr zu spät, weil es keine Kirche gegeben hatte, danach war er im selben Takt wie das Heringsgeschäft gewachsen. Das winzige Fischerdorf war zu einer Ortschaft mit fünfhundert Einwohnern, einigen zweigeschossigen Häusern und drei Geschäften geworden, dennoch ließ sich die neue Zeit für Gesturs Geschmack zu viel Zeit. Und er selbst steckte noch in der alten fest. Alles, was er besaß, stand in Tonis Büchern im Krónufélag, nur so bekam er bessere Konditionen. Im Herbst zahlte er seinen Lohn des Sommers ein und konnte dafür den Winter über Waren entnehmen.
Plötzlich hörte er ein Geräusch hinter sich und fuhr blitzschnell herum (eine Reaktion, die einem die Lawinen beibrachten), aber es war bloß ihr heller Bello mit dem Schnauzbart. »Pap, alter Schäffi!«
Fast hätte er den Hund Papa genannt wie der kleine Einäugige, gerade noch konnte er es sich verkneifen, vermutlich aus schlechtem Gewissen, denn natürlich hätte eigentlich er, Gestur, und nicht der Hund von Olgeir Papa genannt werden müssen. Froh, aus seinen bedrückenden Gedanken gerissen worden zu sein, beugte er sich zu dem Hund und kraulte ihn hinter den Ohren, was er nicht hätte tun sollen, und redete ihm gut zu, wie er es einmal im Sommer bei einem Ausländer gesehen hatte. Isländer hingegen kannten nichts anderes, als ihre Hunde mit Beschimpfungen anzubrüllen, und berührten sie aus Angst vor Läusen und Flöhen niemals, außer um ihnen einen saftigen Tritt zu verpassen. Die Nation stand noch auf der Stufenleiter der Unterdrückung, deren Hierarchie von oben nach unten folgendermaßen verlief: Kirche, Kramladen, Holzhaus, Torfkate, Hund, Katze, Maus, Laus.
Gesturs Sommerlohn war geringer ausgefallen als im Vorjahr. Die Fangmenge lag unter der der ersten drei märchenhaften Sommer, und als der Nachzüglerschwarm kam, hatte er bei den Septembermännern keine Heuer bekommen. Das Heringsgeld würde den Winter über wohl kaum reichen für den Fünf-Personen-Haushalt, der auf seinen Schultern ruhte.
Herr und Hund betrachteten den Fernseebildschirm, auf dem ihn die Abenteuer des Lebens riefen: »Besorge dir einen Platz auf den Wolken, auf einem Schiff …« Warum versuchte er nicht sein Glück, warum fuhr er nicht mit Vetlesen und seinen Männern übers Meer und versuchte es in einem anderen Haus? Vielleicht erwartete ihn da eine Ja-willige Jente, die ihm die Hand über den Tisch reicht, die liebreizend lächelt und ihn nimmt, wie er ist.
Hier gab es nur wenige Mädchen in seinem Alter, nur seine Konfirmationsschwester Sunna, inzwischen zweifache Mutter in Selber, Anna in Mjölkot, die von ihrer Mutter an einen sechzigjährigen Haifischer verschachert worden war, und die berühmten Drillinge in Kvíðagerði, Sóley, Signý und Sjöfn, die er nie auseinanderhalten konnte, so schlaksig und niedergedrückt, wie sie waren. Ihr Vater Sæmundur hatte ihnen ewig vorgehalten, die Familie würde noch als Gemeindearme enden. »Hat schon jemals jemand ein solches Unglück erlebt? Sich auf einen zusätzlichen Fresser gefasst zu machen und dann drei auf einen Schlag zu kriegen? Und alle drei überleben auch noch!« Das war ein berechtigter Vorwurf, sie waren die einzigen Drillinge in dreihundert Jahren, die in Island am Leben blieben. Jetzt waren sie im heiratsfähigen Alter, lagen ihrem Vater aber noch immer auf der Tasche, weswegen der sie weiterhin verfluchte.
Auch Gestur war jetzt »heiratsfähig«, wandelte allerdings noch nicht auf Freiersfüßen. Er hatte bei der einen oder anderen Saisonarbeiterin mal einen Blick übers Heringsfass riskiert, aber keinen weiteren Schritt unternommen, und allmählich plagte ihn seine Schüchternheit und dass sich auf dem Gebiet nichts tat. Es kam sogar vor, dass er abends auf dem Kopfkissen liegend Lási stille Vorwürfe machte, dass er ihm keine Braut besorgte. War das nicht die Aufgabe von Vätern? Aber nein, anstatt sich für Gestur nach einer guten Partie umzusehen, beschäftigte er sich mit seinem lästerlichen Reimeschmieden und stahl sich zwischendurch aus dem Haus, um in der Nachbarschaft einer Magd ein Kind zu machen! Einmal hatte der Alte immerhin erwähnt, er kenne in Flóðin einen guten Bauern, der eine stattliche Tochter habe. Dann stellte sich heraus, dass die auf die fünfzig zuging.
In der Welt der Holzhäuser gab es wohl ein paar Gleichaltrige, aber die lebten eben in einer anderen Welt. Södals Töchter waren durchaus ansehnlich, auch wenn sie etwas Maskulines an sich hatten; Kaufmann Tonis Schwester Kristjana hielt sich kerzengerade und sah gut aus, hatte aber bei den seltenen Gelegenheiten, bei denen sie sich begegneten, nichts als ein herablassendes Grinsen für ihn, den Proleten aus dem Torfkotten, übrig. Es verletzte ihn jedes Mal. Einmal hatte er das Pech, dass sie ihn im Krónufélag bediente und das große Rechnungsbuch mit seinem Kontostand aufschlug. Dieses hämische Grinsen verfolgte ihn den ganzen Winter lang.
Armut bestand nicht bloß aus Kälte, Hunger und nassen Füßen. Die Einzige, die ihn in seiner Unbeweibtheit aufbaute, war die, die in seiner Vorstellung lebte, die einzige und wahre Súsanna, die Olgeir in seiner Schicksalsstunde gepflegt und Gestur gestattet hatte, sich an ihrer Brust auszuweinen. Er dachte noch an ihre Hochzeit und hatte sie in seinen Phantasien oft etwas verändert: Die Braut schritt durch die Kirche, hob ihren Schleier, beugte sich zu ihm (mit Konfirmationsschleife und offenem Hosenstall) herab und küsste ihn leidenschaftlich. Wobei sich das Bild in den letzten drei Jahren etwas gewandelt hatte: Neuerdings war die Kirche leer und die Braut nackt, wenn auch mit Schleier.
Aber ja, warum hatte er sich nicht mit einem von Vetlesens Schiffen davongemacht? In Norwegen würde er als einer von vielen an Land gehen, da wäre ihm die Torfkate nicht gleich anzusehen. Die Möglichkeit, nach Norwegen zu fahren und dort als Mann ohne Vergangenheit ein neues Leben zu beginnen, hatte er ernsthaft erwogen. Aber als Junge hatte er sich schon einmal an Bord eines Schiffes geschlichen, mit schrecklichen Folgen, das wagte er kein zweites Mal. Außerdem war für ihn klar, wenn er die Menschen in Strönd sich selbst überließe, müsste er ihnen vorher die Kehle durchschneiden. Vier hungrige Mäuler lässt man nicht im Stich. Ihm blieben also nur zwei Möglichkeiten, entweder zum Mörder zu werden oder weiter als Sklave auf der Galeere Segló zu schuften. Zusammen mit einem Hund und einem Strandläufer stand er vor dem Haus am Ufer und schaute mit sehnsüchtigen Augen zum Fjord hinaus.
Kapitel 4
Elison
»Hallo, Gestur! Gestur! Das ist doch Gestur, oder täusche ich mich?«, rief es nahe dem Ufer.
Gestur kam zu sich und erblickte einen großen, weißhaarigen Mann in einem kleinen Motorboot im flimmernden Abendlicht lautlos das Ufer entlangtreiben. Woher war er gekommen?
»Könnten Sie mir behilflich sein? Ich komme mit dieser Maschine nicht zurecht.«
»Wie bitte?«
»Sie wissen doch, wie man mit so etwas umgeht, nicht wahr?« Gestur gab keine Antwort, sondern ging zur Strandlinie und watete ins Wasser. Es reichte ihm fast bis zur Hüfte, als er das Dollbord des Boots erreichte. Der Weißhaarige, Kristmundur auf Hvammur, reichte ihm eine Hand, packte mit der anderen das Dollbord und rutschte auf die andere Seite der Ruderbank, damit das Boot nicht kenterte, wenn Gestur sich hineinschwang.
»Ich wollte mich etwas auf dem Fjord vergnügen, wo ich mir nun schon ein Motorboot zugelegt habe wie die anderen auch. Ich weiß aber nicht, was es hat. Die Burschen sind die ganze Woche damit herumgefahren.«
Gestur öffnete die Motorabdeckung, tupfte ein wenig Benzin in den Vergaser und drückte den Starter. Der Motor hustete kurz, sprang an, und das Boot schoss zu Kristmundurs Erstaunen und Freude los. An Land bellte Papa, als wolle er unbedingt mitfahren. »Oh ja, Sie verstehen … du verstehst dich auf solche Dinge, Gestur Eilífsson!«, rief der alte Honoratior durch den Motorenlärm und siezte Gestur nicht länger.
»Elison«, rief Gestur zurück.
»Was?«
»Ich bin jetzt Elison.«
»Wie das?«
»Ja, ich heiße jetzt Gestur Elison.«
Er hatte diese Schreibung einmal auf Södals Lohnliste gesehen, und sie hatte ihm gefallen. Mit ihr war er den altmodischen, albernen Eilífurnamen los, ein neuer Name für neue Zeiten, und norwegisch hörte er sich auch noch an. Nun brauchte er sich nicht länger für seine Verwandtschaft mit dem Schwierigkeiten machenden Waldieb und Pfarrermörder zu schämen, der diese schweren Anschuldigungen ungebüßt mit in sein nasses Grab genommen hatte. Hans und Baldvin, die bekannten Schandmäuler von Eyri, hatten sich natürlich heftig über die Namensänderung lustig gemacht, und selbst sein Spätvater Lási hatte eine Strophe darüber gedichtet, die einzige, nachdem die Lawine ihm Haus und Frau, dreißig Schafe und zwei Enkelkinder genommen hatte.
Bin ich etwa Kaufmannssohn?
Oder eines andern Sohn?
Meine größte Hoffnung wäre schon,
ich wäre Gestur Allersohn.
Aber das focht Gestur nicht an. Wenn der neue Name ihn fast zu einem Norweger machte, dann sollten die Kleingeister ihren Spaß haben.
Kristmundur auf Hvammur war ein alter Mann geworden. Den schlohweißen Schopf hatte er zwar noch und auch den Tonnenbauch, aber die ehemals speckige Gesichtshaut war wie von Messern eingeritzt, aus den Nasenlöchern wucherten Haare, die blaurote Nase war mit Äderchen überzogen, und die Augen tränten fortwährend vor Verlangen nach Leben.
»Lass uns nach Segulnes rausfahren!«, rief der Großbauer und sah behaglich zu, wie Gestur das Ruder auf den richtigen Kurs brachte. Hatte der Mann getrunken?
Der Abend war kühl und Gestur nass bis zur Brust, aber die Kälte, die er spürte, wich bald der Freude, den hehren Kristmundur von Eyri durch den ganzen Fjord nach Segulnes fahren zu dürfen. Er hatte noch nie ein Motorboot gesteuert. Das Gefühl war unvergleichlich, das Boot rauschte geradeaus, hielt von selbst den Kurs, und seine Ladung war einer der Schirmherren des Fjords, ein Mann, von dem Gestur wusste, dass er der Eigentümer seiner Eltern gewesen war. Bislang hatte sein Leben aus leerem Geklapper und ziellosen Bittwegen durch ein kleines Eyri bestanden, doch jetzt genoss er es, die Wellen eines ganzen Fjords zu zerteilen. Was könnte nicht alles aus ihm werden? Wieso fuhren sie nicht nach Norwegen? Er witterte all die Möglichkeiten, die das Leben bot, und ihm war vielleicht kalt, aber er machte vor nichts halt!
Doch erst musste er noch eine Kleinigkeit zu Ende bringen, das verlangte das Leben an seinem breiten Eingangsportal von ihm.
Kapitel 5
Trockenlegen
Kristmundur hatte mit dem Bauern auf Segulnes etwas Geschäftliches zu regeln, er wollte ihm zwei alte Haifangklepper andrehen, die er nicht mehr brauchte. Ja, inzwischen war sogar der weißhaarige alte Lokalpatriot im norwegischen Zeitalter angekommen. Bis zu einem gewissen Grad. Noch hatte er den Haifang nicht ganz aufgegeben, aber eines seiner Boote war im Sommer bereits dem Hering nachgejagt, und nun führte er eine Revision seiner Bestände durch.
»Aber ihr hier auf Nes haltet noch die alten Tugenden hoch! Von Fanneyri kann man das nicht mehr sagen. Segló nennen sie es neuerdings. Segló! Alles versinkt in einem norwegischen Kauderwelsch. Man schläft in einem Zeitalter ein und wacht in einem anderen auf. So schnelllebig ist alles geworden. Es lässt einen an Geschichten denken, die man aus diesem … Amerika hört.«
So bramarbasierte der Hvammurbauer und wollte die von Segulnes dafür loben, dass sie sich nicht vereinnahmen ließen und den alten Sitten treu blieben. Aber in dem, was er sagte, lag ein hohler Ton, er hatte die alte Leier zu oft abgespult und glaubte nicht einmal selbst mehr an sie. Wie alle anderen auch, sah er, dass die Neuerungen aus Norwegen gesiegt hatten. Nun war dieses Amerika, dieses große Weib, an dessen Namen er sich nicht einmal genau erinnerte, das Neuste vom Neuen. Es kursierten Meinungen im Land, die besagten, Chancen für tüchtige Isländer gebe es entweder in Amerika oder in Segulfjörður. Gestur stand pitschnass im Dämmerlicht auf dem Hofplatz und erinnerte sich an das, was ihm einmal gesagt worden war: Dass er und sein Vater einst nach Amerika gewollt hatten. Stattdessen war es zu ihm gekommen.
Obwohl Kristmundur wegen eines bescheidenen Geschäfts nach Segulnes gekommen war, nicht viel anders als ein Hausierer im Grunde, war er in einem doch der Alte geblieben: Er ließ sich gern und überall mit allem Tamtam empfangen. Das erreichte er allein durch sein Auftreten, seinen Gang, seine Art, Menschen anzusehen. Dass hier der Kaiser Einzug hielt, blieb weder Hausherr noch Gesinde verborgen, und binnen kürzester Zeit war eine Tafel aufgebaut, wurden die besten Stühle herbeigeschafft, Schüsseln mit Skyr gefüllt und Teller mit leckeren Innereien, kam feines Schmalzgebäck auf den Tisch samt irgendwelchem exotischem Backwerk und Schnaps in geschliffenen Gläsern. Auch Gestur kam in den Genuss all dessen, denn der Hvammurbauer nannte ihn seinen Jungen. Zuerst solle man ihn aber mal nach nebenan bringen.
»Mein Junge ist nass bis unter die Achseln, und hinter den Ohren auch. Hoho! Tut mir den Gefallen und lasst ihn von eurem Mädchen trockenlegen.«
Dabei handelte es sich um einen alten Brauch. Wenn Männer, entkräftet von einem langen Fußmarsch, völlig durchnässt, bis in den Schritt schlammverkrustet oder gar in gefrorenen Kleidern, auf einem Hof eintrafen, wurden sie in ein Gästezimmer oder einen Vorratsraum geführt, wo sie von der jüngsten Magd »trockengelegt« werden sollten, das heißt, sie sollte ihnen die Schaflederschuhe und die Kleider ausziehen, was oft nicht ganz einfach war. Das war der einzige Luxus, der Männern in der Zeit der Grassodenhäuser geboten wurde. Dem Brauch haftete mitunter etwas Erotisches an, denn wenn die Männer Glück hatten, konnte das Trockenlegen schon mal ein Happy End haben. Die Frauen hingegen beschwerten sich fast durchweg über diese Pflicht, die nicht selten zu Unannehmlichkeiten führte, und manche Mägde unternahmen alles, um dieser Aufgabe zu entgehen, besonders wenn die Ankömmlinge schwerbetrunken oder bekannte Flegel waren. Man kann sagen, damit habe sich die isländische Sklavenhaltergesellschaft eine Art Entsprechung zu den japanischen Geishas geschaffen, und tatsächlich soll ein unschönes isländisches Wort für ficken von diesem »Trockenlegen« abgeleitet sein.
Wie alle hatte auch Gestur schon von dieser Sitte gehört, aber da er nirgends hinreiste, war er noch nie in ihren Genuss gekommen. Gleichwohl hatten Schilderungen davon ihm nicht wenige Male Anlass zum Onanieren gegeben.
Das Mädchen, das ihn nun trockenlegen sollte, hieß Sigrún. Gestur hatte es noch nie gesehen, es war untersetzt, hatte aber ein ungewöhnlich hübsches Gesicht für Leute aus Segulnes, die gewöhnlich für ein plumpes Äußeres und ein mürrisches Wesen bekannt waren. Wahrscheinlich stammte es aus einer anderen Gegend. Krummbeinig und mit schiefen Schultern schlurfte das Mädchen vor ihm aus der Baðstofa und wies ihn wortlos ins Gästezimmer, dessen Fußboden und Decke mit Holz verkleidet waren, wie vieles auf Segulnes, wo es nie an Treibholz mangelte. Draußen war es inzwischen dunkel, trotzdem zog die Magd einen Vorhang vor dem kleinen Fenster in der Vorderwand zu und dann ein Stück Leder aus Fischhaut unter dem Bett hervor. Sie legte es aufs Bett und bedeutete Gestur, sich mit seinem nassen Heck daraufzusetzen. Dann verschwand sie mit einer gediegenen Tranlampe aus Zinn, die es von irgendeinem Schiff in dieses Haus verschlagen haben musste, erschien gleich darauf wieder, nun mit brennender Lampe, schloss die Tür und legte den Riegel vor. All das erledigte sie flüssig und ohne Zögern.
Gestur legte sich aufs Bett, ließ aber auf Geheiß der Magd die Füße über das Fußende nahe dem Fenster hängen. Sie hatte Mühe, ihm die groben Stiefel auszuziehen. Das Leder war vom Salzwasser hart geworden, und die Stiefel saßen eng an den Füßen. Endlich gelang es, und da gingen die Wollstrümpfe gleich mit ab. Darauf folgten die Hose und der Pullover. Länger dauerte es, das am Leib klebende Hemd und die Ärmel auszuziehen. Den Unterwäsche-Einteiler streifte sie ihm ab wie die Pelle von der Wurst. Gestur hatte noch nie fremde Hände an den Beinen gefühlt. Sie wrang die Sachen schnell, aber ohne großen Erfolg aus und brachte sie dann irgendwo hin, wo ein Feuer brannte. Der nahezu unbekleidete Gestur blieb frierend und zitternd liegen, bis die wangenschöne Sigrún mit einem Wolltuch zurückkam. Im Licht der Lampe suchte er ihren Blick, erreichte ihn aber nicht, ihr Gesicht blieb ernst und ausdruckslos. Gestur war für sie wie ein Stück Vieh, um das sie sich zu kümmern hatte.
Mit einer einfachen Bewegung streifte sie ihm das Unterhemd ab, legte ihm das Wolltuch auf und rubbelte ihm dessen Wärme in den kalten Leib. Zwischen ihren Haaren hindurch sah sie ihm mit einem Sekundenblick in die Augen, bevor sie seine Unterhose packte, das letzte Kleidungsstück, das noch übrig war. Ehe er sichs versah, lag er komplett gehäutet auf dem Bett und guckte mit großen Augen an sich hinab, wie ein Dorschkopf, der seinen soeben aufgeschlitzten Bauch betrachtet. Sie bearbeitete ihn mit Wolle und bloßen Händen, wo sie hinfasste, sang und jaulte es in seinem Fleisch, der Geist drängte in die Haut, er hatte vorher nie gelebt. Er erschrak allerdings etwas vor ihrer Miene, die nichts als reine Pflichterfüllung ausdrückte, er war die Kuh, sie die Melkerin. Es war nicht gelogen, was man sich über die Menschen auf Segulnes erzählte, sie hielten aus belastbarer Sklavenmentalität an den alten Sitten und Gebräuchen fest. Als Nächstes raffte die isländische Geisha zwei Überröcke hoch, streifte zwei Unterhosen ab und bestieg das Bett und das darin aufgerichtete Stöckchen, dass es in dem gut durchgetrockneten Treibholz für eine Weile nur so knackte. Eine viel zu kurze Weile.
Kapitel 6
Die Lage in Strönd
Sie übernachteten in Segulnes. Gestur dachte wieder und wieder an das, was ihm am Abend widerfahren war, und schwebte noch immer auf Wolke sieben. Er war in eine Frau hineingekommen! Er hatte gelebt! Auch wenn es nur für ein paar Minuten war und seine Gespielin nichts davon gehabt hatte. Er sah noch einmal vor sich, wie die Magd Sigrún nach vollbrachtem Gehopse mit den zielgerichteten Bewegungen einer Reiterin abgestiegen war, die ungesattelt auf den Hof reitet und anderen das Pferd übergibt. Hatte es denn ihrerseits keinerlei Verlangen und Lust gegeben? Hatte sie es nur ihrem Hausherrn zuliebe getan? Oder um dem Brauch Genüge zu tun? War das ein Teil der Kultur auf Segulnes? Dieser achtzehn Jahre alte Familienvater und Ernährer war also seine Unschuld losgeworden. In Gedanken schickte er eine Botschaft nach Hause: Macht euch keine Sorgen, ich komme morgen wieder.
Nachdem die Lawine ihre Existenz auf Ytri-Skriða vernichtet hatte, waren Gestur und seine seltsame Familie, Lási und seine Schwiegermutter Grandvör, die geistig zurückgebliebene Tochter Snjólka und der einäugige Sohn Olgeir, wie gesagt in dem Kotten Strönd untergekommen. Sein voriger Bewohner, jener Þórður, der gegen das Oberkörperentblößen der norwegischen Zimmerleute protestiert hatte, war mit Frau und Töchtern aus dem ungesitteten Fjord geflohen, und daher konnte sich die Familie von Skriða dort unter der niedrigen Tür durchbücken. Von Leihgabe oder Miete war keine Rede, denn auch für diese landlose Behausung galt wie für andere auf Eyri, dass keiner wusste, wessen Eigentum sie war. Sie standen einfach da, als Wartehäuschen verschiedener Lebenswege. Wenn einer auszog, zog ein anderer ein.
Strönd war die einfache Ausgabe eines Grassodenhauses, eine Baðstofa mit sechs abgeteilten Bettstätten, ein sogenannter Sechsschläfer, von dem kleinere Gänge abzweigten, Küche und Vorratsraum. Bemerkenswert waren allein die beiden hölzernen Giebelwände. Die nördliche hatte Lási allerdings mit Grassoden verkleidet, weil ihm bei Nordwind die Zugluft abends die Seiten umgeblättert hatte; manchmal stob der Schnee bis über den First wie im Sturm die Schneefahnen über eine Gletscherkuppe. Die südliche Giebelwand bestand noch ganz aus Holz und wies ein kleines Fenster auf. Mit diesem Spitzgiebel sah die Kate aus wie eine alte Torfkirche ohne Kreuz.
Es handelte sich allerdings nicht um einen Hof, sondern lediglich um eine Häusler- oder Kätnerstelle ohne eigenes Land und Vieh. Daher hingen all ihre Bewohner von Gestur ab, er trug die gesamte Last auf seinen Schultern. In den ersten Jahren hatte das, was er im Sommer verdiente, auch für den Winter gereicht, für Mehl und geräuchertes Bauchfleisch, aber jetzt sah es nicht gut aus. Gestur hatte vorgeschlagen, sie könnten doch Untermieter aufnehmen, da ja zwei Betten frei wären, aber davon wollte Lási nichts hören, er wolle keine Landstreicher unter seinem Dach haben, außerdem diente ihm eine der beiden Bettstellen als Werkstatt und Bibliothek. Deren Bestand war angewachsen, als Gestur ihm in einem Anfall von Wohltätigkeit eine ganze Kiste voll gebundener Schätze gekauft hatte, die die Besatzung eines Heringsfängers aus den Ostfjorden hatte loswerden wollen. Inzwischen verwünschte er die alten Schwarten jedes Mal, wenn er an ihnen vorbeikam. Da lagen mausetote Schinken, die nie ein Auge aufschlugen, in einem Bett, in dem lebende Menschen hätten schlafen können, die ihm für jede Nacht eine Krone hinlegten.
Die alte Grandvör war von der Lawine schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Sie fand an nichts mehr Vergnügen, nicht einmal ihre Stricknadeln hielten sie mehr beschäftigt. In den ersten Wochen hatte sie nur mit dem Gesicht zur Wand im Bett gelegen, inzwischen verbrachte sie ganze Tage auf der Bettkante, starrte ins Halbdunkel und murmelte vor sich hin, als würde sie die todbringenden Lawinen zählen, die sie überlebt hatte. Snjólka wiederum hatte ihre Mutter und ihre beiden geliebten Kinder verloren und sprach ganze zwei Jahre lang kein einziges Wort. Erst nach und nach hatte sie sich mit der Existenz des kleinen Olgeir, ihres »Bruders«, abgefunden, und mittlerweile hatten sich die Vorzeichen vollständig in ihr Gegenteil verkehrt, und dem anfangs verhassten Olgeir galt jetzt ihre ganze Liebe. Das wackere Kerlchen hing zwar völlig an Gestur, pinkelte sogar wie er, durfte aber nie außer »Mama Sokkas« Sichtweite sein; sie nannte ihn ihren Augenstern.
»Olli, pass auf Auge auf! Du hast nur eins.«
Olgeir trug keine Augenklappe. Sein linkes Auge sah aus, als wäre es ständig zugekniffen, und entsprechend war seine linke Gesichtshälfte etwas verzerrt. Er war ein kluges Kerlchen und nannte Snjólka Mama, Gestur aber Gettur. Der hatte sich schließlich auch mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass der Kleine ihn Papa rief. Als Olgeir zu plappern begann, war Gestur sechzehn Jahre alt, und die Leute sollten auf keinen Fall denken, er hätte der Snjólka, diesem pferdezähnigen Ausbund, ein Kind gemacht. Auch wenn sie eine seltsam zusammengesetzte Familie bildeten, gab es doch Grenzen des Zumutbaren.
Die Dreckschleudern Hans und Baldvin verbreiteten gleichwohl überall, die »Geschwister« hätten das Kind ihres Vaters angenommen.
Die Rolle der beiden Kumpane in der kleinen Gemeinschaft war unverändert: Sie erhielten Lohn vom Krónufélag, obwohl kaum jemand wusste, wofür eigentlich, denn sie waren beileibe keine guten Arbeiter, dafür aber umso flinker mit dem Mundwerk. Manche behaupteten, ihre einzige Aufgabe bestehe darin, die Konkurrenz schlechtzumachen, sie seien so etwas wie Marketing- oder Public-Relations-Beauftragte (Jahrzehnte bevor diese Bezeichnungen entstanden). Ihre Hauptzielscheibe waren indes die ärmeren Leute, von ihrem finanziell gut gepolsterten Hochsitz aus schossen sie genüsslich auf praktisch jeden, der ärmer war als sie.
Lási war inzwischen zum Vollzeitsargschreiner geworden, hatte in einer Ecke bei Södal eine kleine Werkstatt eingerichtet und zimmerte dort für den Tod und dichtete für den Teufel. Anfangs hatte er einiges für den norwegischen Herrn bauen dürfen, doch nach und nach waren die Aufträge weniger geworden. Bald konnte er nicht mehr genug für seinen Lebensunterhalt verdienen und beschränkte sich fortan auf das Schreinern von Särgen. Gestur hatte den Hammer übernommen, und seine Gelegenheitsarbeiten waren die einzigen Einkünfte im Winter, neben dem Heringssegen des Sommers und den Särgen. Die nette Emma in Mjólkurbær trat ihnen eine Zitze der Kuh in der nördlichsten Stallbox ab, genauer bezeichnet die Nordostzitze, und Gestur trabte jeden Morgen mit einem Eimer in der Hand zu ihr. So sah das Leben aus.
Zweimal hatte Gestur sich bei Kopp um Arbeit bemüht, der in der südwestlichen Ecke der Hafenbucht eine ganze Fangstation mit eigener Pier und mehreren Schiffen betrieb, der erste Isländer, der vom Haifang auf Hering umgesattelt hatte. Beim ersten Mal war Gestur dem Hochbehüteten auf der Norwegerbrücke begegnet, aber die Augen des Kaufmanns und Reeders hatten nicht bis zu ihm hinaufgereicht (Kopp war plötzlich einen Kopf kleiner als Gestur), und der Weg an dem Bittsteller vorbei war zu einfach gewesen. Beim zweiten Mal hatte er sich die Treppe zu seinem Kontor hinaufgewagt und war, die Mütze zwischen den Fingern, vor Eðvald Kopps Schreibtisch getreten, hinter dem dieser mit Papieren in der einen und einem Zigarrenstummel in der anderen Hand thronte. Der Großhändler sah durch ihn hindurch bis nach Fagureyri, jedoch ohne die Tränen, die er einmal mit diesem männlichen Wesen auf dem Schoß vergossen hatte.
»Du … du weißt, wer ich bin … wer ich einmal war?«
»Sind wir per Du? Seit wann duzen wir uns?«, fragte Kopp mit großen Augen, antwortete dann aber: »Hier wird nicht nach dem gefragt, was einmal war, sondern nach dem, was wird. Das Morgen ist mein Gott.«
»Ich war einmal … ich habe mal bei …«
»Hör mal, Junge, hier haben die Menschen Arbeit zu erledigen. Sigga!«, rief er unter dem Schnauzbart hervor, der ebenso grau geworden war wie der Haarwuchs um die Ohren; dazwischen glänzte ein alkoholikerroter Schädel.
Gestur beeilte sich, das Kontor zu verlassen. Auf der Treppe kam ihm eine junge Frau entgegen. Einen Moment sahen sie sich in die Augen, die Frau war gut gekleidet, trug einen Rock mit Seidenstruktur, und ihr blondes Haar war so sorgfältig um ihren Kopf frisiert, dass Gestur sie erstaunt anstarrte. Ganz kurz schien sie sich zu erinnern, wie sie einmal in der Kindheit auf dem Weg ins Büro ihres Vaters laut gerufen hatte, dass der zweijährige Rotzlöffel Vaters Kaffee getrunken hätte. Sie wollte ihn wohl ansprechen, aber Kopp funkte dazwischen. »Sigga!«, schrie er wieder gellend aus seinem Kontor.
Als Gestur das Haus hinter sich gelassen hatte, drehte er sich noch einmal um und sah auf der hölzernen Giebelwand in roten Lettern stehen: KOPP. Jeder Buchstabe mannshoch. Schon sah er den Namen ELISON in ebenso großen Buchstaben vor sich, doch dann entdeckte er einen um die Hausecke lugenden Frauenkopf und musterte ihn genauer. Für einen Moment sahen sie sich an, ehe der Kopf verschwand.
So war die Lage in Strönd. Ihr einziger Besitz waren Lásis schlafende Bücher und sein Werkzeug, das aber auch nur selten aufstand. Ach ja, und das Land von Ytri-Skriða. Aber das war in etwa so viel wert wie ein Schiff auf dem Meeresgrund.
Am nächsten Morgen erwachte Gestur in Segulnes wie ein vollkommen freier Mann, der im nächsten Hafen gleich eine Neue hat und sich nicht um Alltagsgejammer schert. Ein ganz anderer Mensch. Er hielt überall nach Sigrún Ausschau, dem netten Abenteuer, wollte sich mit dem gebotenen Anstand von ihr verabschieden, sah sie aber nirgends. Kristmundur betrachtete ihn wie ein Vater, der seinen Sohn triumphierend am Eingang zu einem Freudenhaus erwartet, wo dieser völlig fertig die Treppe runterkommt. Ja er tat so, als habe er alles exakt so eingefädelt. Sie nahmen ein einfaches Frühstück aus Trockenfisch, Milch und Hákarl nach Art des Hauses zu sich und verabschiedeten sich anschließend vom Bauern und seiner Frau, die überhaupt nicht wussten, wie man sich ordentlich verabschiedet. »Ich lasse euch die Boote von den Jungen bringen. Wir sehen uns beim Weihnachtsgottesdienst von Séra Árni«, rief Kristmundur munter. Er hatte gerade den Verkauf seiner Haifangboote per Handschlag besiegelt. Gestur sah derweil ein heimliches Schäferstündchen im engen Turm der Fanneyri-Kirche vor sich. Er und Sigrún würden sich während des Gottesdienstes die steile Stiege hinaufstehlen und unter dem Glockenstuhl in zehn Minuten zehn Kinder zeugen, und sie würde ihre Glocken bloßlegen.
Wo steckte sie eigentlich? Er traute sich nicht zu fragen. Draußen herrschte das übliche Septembermatschwetter, und sie nahmen mit dem Motorboot geraden Kurs in den Fjord, fuhren an Eyri vorbei und durch die Hafenbucht, wo sie bei Hvammur anlegten. Von dort musste Gestur zu Fuß nach Hause gehen, nur im Pullover, doch die neue Erfahrung wärmte ihn. Ebenso wie das, was Kristmundur ihm zum Abschied gesagt hatte:
»Ich habe dir eine verantwortliche Position auf Hvammur zugedacht. Nächstes Jahr bauen wir eine Pier und steigen groß in die Heringsfischerei ein. Darin kennst du dich ja bestens aus. Oh ja, mein Sohn, ich habe dich im Auge gehabt.«
Kapitel 7
Ortsvorsteher ohne Ort
Die Pfarrersfamilie wohnte nicht mehr im Madamenhaus, sondern in einem prächtigen, nagelneuen Pfarrhaus, das ein Stück den Hang hinauf über der planlosen Häuseransammlung auf Eyri thronte. Die Spaßvögel hatten es Upphæðir genannt, ein doppelsinniger Name, der sowohl auf die erhöhte Lage als auch auf die Höhe der Baukosten hinwies. Das gefiel Séra Árni ganz und gar nicht, er wollte schlicht in Fanneyri wohnen, aber es gibt nun mal kaum etwas, das sich schneller festsetzt als ein knackiger Spitzname, und inzwischen hatte die Familie die offizielle Postanschrift: Upphæðir, Segulfjörður.
Der Grundbesitz der Kirche hatte so viel Pacht vonseiten der norwegischen und isländischen Heringsfänger eingebracht, dass mit dem Geld etwas unternommen werden musste. So waren von Séra Árnis Prachtbau aus im Sommer neun Anleger zu sehen, und jeden Monat gingen Anträge zur Errichtung weiterer ein. Für die Musik hatte der Pfarrer keine Zeit mehr, aber seine Sammlung von Volksliedern war immerhin vollendet, umfasste auf neunhundertneunzehn Seiten sechshundertsechsunddreißig Lieder und wartete in einem imposanten Schrank in Kopenhagen auf ihre Veröffentlichung. Den halben Winter hatte Séra Árni dort verbracht und versucht, sein Œuvre bei der ehrwürdigen Isländischen Literaturgesellschaft unterzubringen, doch in deren Vorstand saßen strengbrauige und arbeitsscheue Neider, die jegliche verlegerische Tätigkeit verächtlich fanden. Große Taten machen große Männer größer und kleine kleiner. Inzwischen richteten sich die Hoffnungen Séra Árnis ganz auf das Gutachten eines dänischen Musikprofessors namens Hammer und eine eventuelle Förderung durch den mächtigen Carlsberg-Fonds. In diesem Fall musste also auf die Dänen vertraut werden, um diesen Schatz der Isländer zu retten. Letztere waren nämlich schon damals viel zu sehr von all den technischen Neuerungen fasziniert – Motorboote, Wasserklosetts, Autos, elektrisches Licht, Fernschreiber –, um noch eine Neigung zu verspüren, die Vorzeit singen zu hören.
Drei Kinder erfüllten Upphæðir mit Fröhlichkeit und Geschrei. Kristin, fünf Jahre, Birgir, drei Jahre, und der einjährige Aðalsteinn. Außerdem gab es zwei Knechte und zwei Mägde sowie das lebhafte, sommersprossige Kindermädchen Lotta aus Ísafjörður. Im Stall nördlich des Wohnhauses muhten vier Kühe in ihren Ständen. Magnús Mannlos, die gute, kräftige rechte Hand des Pastors, hatte den Pfarrersleuten die Treue gehalten und wohnte in einem kleinen Häuschen südlich des Haupthauses, in Rufweite jenseits des Gemüsegartens wie der Jagdaufseher des Königs von Versailles. Besagte Spaßvögel nannten sein Häuschen Limbo, weil es auf halber Strecke zwischen Upphæðir und der »Hölle« lag, dem Stall für die Schafböcke, der etwas weiter unten am Hang klebte. In Limbo wohnte Magnús zusammen mit einer deprimierten Norwegerin, einer gewissen Stenette, im Fjord stets Steinhetta, Steinkapuze, genannt, die er bei Norskabryggja aus dem Wasser gefischt hatte. Insofern waren beide Treibgut des Meeres, wobei Magnús hartnäckig bestritt, dass sie mehr sei als seine Haushälterin.
Die beiden alten Madamen, Guðlaug und Sigurlaug, waren im Madamenhaus wohnen geblieben, und Erstgenannte war dort in der Weihnachtsnacht des Vorjahrs verstorben. Beerdigt wurde sie allerdings erst Monate später, denn am Weihnachtstag war ein Schneesturm ausgebrochen, der sechs Wochen anhielt. Ihr Leichnam wurde so lange im Turm der Kirche aufbewahrt, weil sich der Krónufélag entschieden weigerte, eine verwesende Madam in seinem Lebensmitteldepot zwischenzulagern. So etwas sei ein Überbleibsel aus alten Zeiten, verkündete Toni, der Sohn des Kaufmanns, der nunmehr dessen Nachfolge angetreten hatte, weil sein Vater Kristján an Typhus gestorben und folglich auf der Karriereleiter der Firma nicht höher gestiegen war. Zum anderen war der Mann aus Fagureyri, den sie als Nachfolger geschickt hatte, unterwegs ertrunken, als sein Boot bei den Útdalabjargar scheiterte. Obendrein war auch der vom Félag Entsandte, der die Nachricht überbringen sollte, ums Leben gekommen, in einem Unwetter oben auf dem Pass von Skeifuskarð.
In diesen Jahren wurde reichlich gestorben.
Die Pfarrerswitwe Guðlaug wurde nach ihrem Ableben also nicht auf die ehrfurchtsvolle Art ihres Mannes, des seligen Séra Jón, aufgebahrt, stattdessen quetschte man sie durch die Bodenluke des Dachreiters und legte sie auf der kleinen Plattform unter dem Glockenstuhl ab. So wenig Aufmerksamkeit erregte ihr Tod, dass selbst die amtierende Pfarrersfrau, die gewissenhafte Madam Vigdís, ihn vergaß, und das sagt einiges über die Flut von Ereignissen jener Tage und was an ihnen alles zu erledigen war. Es ging schon auf Ostern zu, als sich Magnús Mannlos endlich daran erinnerte, dass er die kleine Frau die Stiege hinaufbugsiert hatte. Daraufhin schritt man sofort zur Tat und begrub sie noch am selben Tag in Anwesenheit weniger Trauergäste: Pfarrer und Organist, Leichenträger Magnús (er nahm den zierlichen Sarg nach der Aussegnung auf die Schulter und trug ihn zum Grab), das Gemeindevorsteherpaar Hafsteinn und Mildiríður sowie die Haushälterin im Madamenhaus.
Die vollbusige Halldóra war nicht mit den Pfarrersleuten in das Haus mit Aussicht gezogen, sondern im Madamenhaus geblieben, wo sie eine kleine Kneipe und eine Armenspeisung betrieb. Im Keller beherbergte sie Bedürftige, und im Erdgeschoss empfing sie Kostgänger, gutbehütete Männer, von denen sich, wie es hieß, einer nach dem Essen manchmal nach oben stahl. Die älteste Pfarrersmadam, Sigurlaug, bewahrte sie im Obergeschoss auf, ließ ihr Essen nach oben bringen und auch den gesamten Kerzenvorrat, denn Ihre Majestät ließ jede Nacht Kerzen brennen, als ob Weihnachten wäre. Sigurlaug Sveinsdóttir war, wie schon erwähnt, über hundert Jahre alt, am Krönungstag Kaiser Napoleons geboren, und somit die älteste damals lebende Isländerin. Ein so hohes Alter erreichten nur wenige in diesem harten Land; zweihundert Jahre lag es bereits zurück, dass ein Pfarrer im nahen Dulvíkurdal das gleiche Alter erreicht hatte. Nur Menschen, die in geheizten Räumen lebten, hielten so lange durch: Pfarrer und Madamen. Die Alte trug ihre Kleider nicht mehr auf, sondern lag im Bett und vertrieb sich die Zeit, indem sie in ihrem Internet mit Gott, ihrem verstorbenen Mann und ihren im Land verstreut lebenden Enkelkindern kommunizierte.
Abends stand immer die alte Metta aus Mjölkot, die Mutter des Großmauls Baldvin, vor dem Küchenfenster des Madamenhauses, nicht mehr hoffnungsvoll, sondern hoffnungsgewiss, denn seitdem Halldóra im Haus allein das Sagen hatte und Leute beschäftigte sowie für die im Keller Wohnenden finanzielle Unterstützung von der Gemeinde erhielt, konnte die schmale Kittelträgerin sicher sein, dass man ihr etwas in ihren Kübel tat. Doch nie wollte sie zur Vorderseite des Hauses kommen, was der Köchin einige Umstände bereitete, denn am Küchenfenster ließ sich nur die obere, kleine Unterteilung öffnen, und es bedurfte schon einiger Geschicklichkeit, da hindurch Kartoffeln, Kuchenstücke oder gefüllten Schafsmagen zu reichen. Darum hatte sich Halldóra eine Angel gebastelt, mit der sie ihre Gaben langsam an der Hauswand abseilte. Dann sah man Metta immer buchstäblich an den Haken gehen, was jedes Mal ein rührender Anblick war.
Eigentlich war der krummbeinige Bartträger Hafsteinn Gemeindevorsteher, doch fungierte längst Séra Árni als eine Art geschäftsführender Bürgermeister, obwohl dieses Amt offiziell gar nicht existierte. Es gab derart viel zu tun, dass noch niemand die Zeit gefunden hatte, die Stadtrechte zu beantragen; dabei würde es kaum Schwierigkeiten geben, sie zu bekommen, denn im Lauf der Zeit war Segulfjörður zum zweitgrößten Ort des Nordlands geworden und mit Abstand der größte Fischereihafen. In den letzten Jahren war die Bevölkerung jährlich um hundert Einwohner gewachsen, und in den Sommern hatte sich ihre Zahl jeweils verdoppelt und gar verfünffacht, wenn die ganze norwegische Flotte im Hafen lag. (Im vergangenen Sommer war ein neuer Rekord aufgestellt worden. Der Gemeindevorsteher hatte einen Jungen auf den Berg geschickt, um die Schiffe auf dem Pollur zu zählen. Ergebnis: einhundertachtundfünfzig.) Kaum zu glauben, aus dem armseligen Kaff war ein Ort von zweitausend Einwohnern geworden! Die Massen füllten die Hauswiesen und Gassen von Eyri wie bei einem Open-Air-Festival unserer Tage. Ganz gleich, wie viele Häuser auch gebaut wurden, es mangelte immer an Schlafplätzen. Im Frühjahr hatten Gestur und einige andere auf dem Schlafboden von Södals Laden weitere dreißig Kojen eingerichtet, doch als die Heringssaison losging, hatten sie in einer Notunterkunft trotzdem noch zwanzig Betten mehr aufstellen müssen. Man erzählte sich gar von einem Tagelöhner, der in jeder Heringssaison sein Haus räumte, mit seiner Familie in einem alten Boot am Ufer unterkam und dann den Winter über von den Mieteinnahmen lebte.
Deswegen haderte Gestur mit der Entscheidung seines Vaters Lási, der seit der Schneekatastrophe einer der verbissensten Konservativen des Fjords geworden war. Menschen einen Schlafplatz zu vermieten, nannte er Traumwucherei.
»Ich verkaufe Menschen nicht ihre eigenen Träume.«
»Wir können sie ja umsonst bei uns wohnen lassen«, erwiderte Gestur.
Der alte Mann drehte sich im Mittelgang der Baðstofa schnell um, und seine Augen wurden feucht, während er knurrte: »Ich habe einen ganzen Berg in mein Bett bekommen und wünsche keine weiteren Besuche. Ich will nur, dass man mich in Ruhe lässt.«
»Und in Armut«, schnappte Gestur zurück.
Lási legte eine kurze Denkpause ein; dann sagte er:
»Wer mit den Augen isst, ist immer satt.«
Dazu nickte er in Richtung seines Büchergestells.
Séra Árni war von morgens bis abends damit beschäftigt, Dinge zu erlauben, Genehmigungen zu erteilen oder etwas zu untersagen, Grundstücke aufzumessen und zu verpachten, mit Menschen und Norwegern zu verhandeln. Buchhaltung war seine starke Seite nicht, Papiere verteilten sich wie von allein über seinen Schreibtisch, landeten zuweilen auf dem falschen Haufen oder in der verkehrten Schublade, und Geldbeträge wurden unverbucht in die Kasse gesteckt. Böse Zungen behaupteten, die isländische Staatskirche, die Eigentümerin des Lands von Fanneyri, bekomme nicht alles, was ihr zustehe, von jeder Krone würden einige Öre für das Pfarrhaus, die Verbesserung des Zugangswegs, Teppiche, ein neues Klavier oder schönere Bücherregale abgezweigt. Tatsächlich ging es sogar noch sehr viel weiter, denn laut Gesetz standen alle Einkünfte aus kirchlichem Grundbesitz den dortigen Pfarrern zu. Sämtliche Pachtgelder flossen somit in vollem Umfang Séra Árni zu. Ausgerechnet ihm, der sich anfangs über die armselige Pfarrstelle beschwert hatte, die ihm zugeteilt worden war; seine Frau hatte Ströme von Tränen über ihr schweres Schicksal vergossen. Dieser gottserbärmliche Krähwinkel hatte sich dann aber als der große Lottogewinn entpuppt, der jeden Sommer ausgezahlt wurde, und jedes Mal fiel die Summe höher aus als im Jahr davor.
Auf Séra Árnis Schreibtisch lagen zwei Schreiben seines Vorgesetzten, des Bischofs, in denen er eine genauere Darlegung der Vorgänge im Norden, Abschriften von Verträgen und Rechnungen sowie eine Auflistung der Einkünfte und Ausgaben forderte. Der Pastor hatte noch nicht die Kraft gefunden, der Aufforderung nachzukommen.
Das Pfarrerehepaar residierte mittlerweile ähnlich Aristokraten im Ausland in der besten Lage, mit Butler, Gesinde und Bediensteten, hochglanzpolierten Kommoden und Plüschsesseln in jeder Ecke, die Räume mit Blumenmustern tapeziert, silbergerahmte Bilder und Spiegel an den Wänden. Es gab sogar sechs Zimmerpflanzen. Das Außergewöhnlichste für Außenstehende war jedoch, dass die Familienmitglieder in sogenannten Nachthemden schliefen. Derartige Kleidungsstücke allein für die Nacht waren völlig unbekannt in einem Land, in dem die meisten Menschen keine Wechselwäsche besaßen und daher nackt unter heugefüllten Bettdecken auf Grassodenmatratzen schliefen, damit sie ihre einzigen Kleidungsstücke nicht im Schlaf verschlissen. An den Waschtagen blieben die Männer im Bett, während die Magd die Sachen wusch, und oft mussten sie zwei Tage liegen bleiben, weil feuchtes Wetter die Wäsche nur langsam trocknen ließ.
Der Pastor ging niemals anders als mit Hut, Stock, Krawatte, dreiteiligem Anzug und spiegelblank geputzten Schuhen aus dem Haus. Man hatte es weit gebracht seit dem Lotterleben in Keflavík. Séra Árni hatte festgestellt, dass die erfolgreichste Art, mit Großhändlern umzugehen, darin bestand, besser als sie gekleidet zu sein, und auch die Norweger traten neuerdings selbstbewusster auf, seit sie sich im vorigen Jahr aus der Union mit Schweden gelöst hatten. Ihr berühmtester Landsmann, Henrik Ibsen, war im Frühjahr verstorben, auf dem Gipfel seines Ruhms als bedeutendster Dramatiker der Welt. Zurzeit konnte Norwegen also mit Weltmeistern in allen drei Disziplinen der Kunst und Kultur aufwarten: Literatur, Malerei und Musik. Und obwohl die waschechten Seebären kaum davon wussten, war doch etwas vom Bewusstsein dieser kulturellen Blüte zu ihnen durchgesickert. Diese Jahre gehörten den Norwegern, die um die gleiche Zeit zum Nord- und zum Südpol vorstießen. Das spürte auch der Pfarrer, der einmal ein Foto von Ibsen gesehen hatte, und beschloss, ihnen in Großmannskleidung entgegenzutreten. Irgendwer musste in dem ganzen Unrat doch Klasse beweisen und einen Stützpfeiler in diesem Chaos bilden, zu dem Eyri geworden war.
Hier gab es so vieles zu planen. Es musste eine Straße in den Fjord gebaut werden, ebenso mussten Brücken über die Stundará, die Fanná und den Aulalækur geschlagen werden. Letztgenannter war außerdem zu säubern, und man musste die Menschen dazu bringen, den Inhalt ihrer Senkgruben nicht länger in den Bach zu kippen, sondern ihn nur noch am Nordufer zu entsorgen. Private Müll- und Misthaufen gehörten verboten, ebenso das ungehinderte Herumstreunen von Rindern. Erst neulich hatte der Bulle von Mjólkurbær die Hauswand von Hákarl-Jóis Hütte eingerannt, und es hatte nicht viel gefehlt, dass der arme Mann unter den Trümmern gelandet wäre.
Es gab endlos Dinge, um die man sich kümmern musste. Die sechsköpfige Familie aus dem Hagafjörður etwa, die sich hier niederlassen wollte, aber kein Führungszeugnis ihrer Heimatgemeinde vorweisen konnte. (Das erinnerte einen daran, sich nach dem Hintergrund der dunkelbrauigen Brüder aus Bárðardalur zu erkundigen, die neulich sternhagelvoll zu Pferd in den Ort gekommen waren.) Ein norwegischer Böttcher wollte sich ein Haus aus »Beton« bauen. (Informationen einholen, um was für ein Material es sich dabei handelt.) Drei Kaufleute aus Reykjavík beantragten eine Handelslizenz für den nächsten Sommer, und ein junger Haarstutzer aus dem Osten wollte eine »Rasurgenehmigung«. Und zu guter Letzt ersuchte eine Frau aus dem Eyrarfjörður um eine Ausschanklizenz für Schokolade in Tassen! (Das alles war ihm allein an diesem einen Tag auf den Tisch geflattert.)
Über all das hinaus war Séra Árni vorübergehend auch Rektor der Grundschule, Vorstand der Sparkasse, Vertreter dreier Versicherungsgesellschaften, dänischer Konsul, Leiter des Theatervereins, Kassenwart der Armenfürsorge sowie natürlich, ganz nebenbei, auch noch Pfarrer, Haushaltsvorstand und Musikförderer. Zusätzlich hatte er die leiblichen Freuden wiederentdeckt und war zu einem der tüchtigsten Trinker in Eyri geworden. Wo auch immer eine Flasche geöffnet wurde, schob er sein eigentliches Anliegen beiseite und ließ sich nieder. Zuhause trank er dagegen nie, und er wollte auch nicht betrunken zu seiner Frau zurückkehren, weswegen er seinen Rausch stets am Ort des Besäufnisses ausschlief. Dort stand er dann immer als Erster auf und schlich im Morgengrauen nach Hause, setzte sich unrasiert und nach Alkohol stinkend an den Tisch und las die Zeitung, als ob nichts gewesen wäre. Das sorgte für Stress in der Ehe. Irgendwann glaubte Vigdís den Versicherungen ihres Mannes nicht mehr, er sei »in Sigfús’ Kontor eingeschlafen« oder hätte »mit den Norwegern nach Segulnes fahren« müssen. Sie hatte offensichtlich einen Mann, der nicht ins Glas schauen konnte, ohne hinterher in einem fremden Bett zu landen.
Trotz seiner vielen Tätigkeiten und Beschäftigungen nahm sich Séra Árni jeden Abend Zeit, die Geschehnisse des Tages aufzuschreiben. Früher hatten Geistliche die berühmten isländischen Annalen verfasst und darin die Ereignisse jedes Jahres festgehalten, doch jetzt geschah an einem Tag mehr als damals in einem ganzen Jahr, und darum musste alles sofort notiert werden, bevor die nächste Lawine hereinbrach.
Wenn die Tagesmühen es gestatteten, musste der Pfarrer jedoch vor allem anderen an das große Ganze denken. Es ging einfach nicht mehr, dass Häuser nach Belieben und Gutdünken hier und da hingebaut wurden. Hier war ein größerer Ort im Entstehen begriffen, und entsprechend brauchte es Straßen und Planung. Manchmal erinnerte sich der Pfarrer an jenen Augenblick vor zehn Jahren, als er in der Nacht der Sommersonnenwende oben im Bergsattel über Fanneyri gestanden und die schnurgerade Linie von der Sonne über die Kirche zum Anleger entdeckt hatte. Der Stütze des Orts kam es zu, die Hauptachse der Stadt zu entwickeln, und eines Sonntagmorgens kam ihm im Halbschlaf die rettende Eingebung: Die Planung von Segulfjörður sollte sich an den vier Himmelsrichtungen orientieren. Alle Straßen sollten von Nord nach Süd und von Ost nach West verlaufen und so ein überschaubares, einfaches Raster bilden. Der Plan von Eyri würde aussehen wie ein kariertes Rechenblatt. Die erste Straße sollte von seinem Haus hoch am Hang hinunter zur Spitze der Landzunge im Osten führen, wo sie an Södals Landungsbrücke ein würdiges Ende finden würde. Er würde sich einen guten Namen für diese Straße einfallen lassen müssen.
Kapitel 8
Hoffnungsschiffe, Hoffnungsbrüche
An einem dunklen Oktobertag ging eine schwarzgekleidete Gestalt von Bord des Küstenfahrzeugs Vesta, holte bei Einheimischen Erkundigungen ein und ging dann in Mantel mit Kapuze und bis auf die Schuhe reichendem Rock ohne Gepäck Richtung Upphæðir. Der Regen fiel in Böen schräg über ihren Weg.
Vigdís war nicht zuhause, aber Lotta bat die Besucherin herein, servierte ihr einen heißen Kakao und stellte ihr die Kinder vor. Die Besucherin lächelte, ohne die Mundwinkel zu heben. Dann wurde ihr ein Gästezimmer zugewiesen. Darin stand sie den ganzen Tag am Fenster, und anschließend lag sie eine Woche zu Bett. Súsanna war aus Norwegen heimgekehrt.
Alles war anders. Sie war verändert, der Ort war verändert. Vigdís war verändert, ebenso Árni, die kleine Kristin, Magnús Mannlos … Das fröhliche Gedränge im Madamenhaus war vom großen und prächtigen Upphæðir abgelöst worden. Die hinzugewonnenen Quadratmeter schienen aber lediglich die Distanz zwischen den Eheleuten vergrößert zu haben, und auch wenn das Haus mit Dienstpersonal aufgefüllt worden war, war dessen Unterwürfigkeit zu groß, waren die Räumlichkeiten zu vornehm, um einem ein Lachen in den Sinn kommen zu lassen. Die Isländer waren erst dabei, zu lernen, wie das Glück mit der Geräumigkeit schwindet. Allein die Kinder, allen voran die jüngsten, konnten auf den Lippen der Erwachsenen ein Lächeln hervorrufen, oder allenfalls die zerstreuten Missgeschicke des Kindermädchens Lotta, wie das eine Mal, als sie einem norwegischen Kapitän die Muttermilch der Magd Elsa, die auch als Amme der Pfarrersleute fungierte, in den Kaffee schüttete.
Erst nach drei Wochen schafften es die alten Freundinnen aus Reykjavík, die vor zehn Jahren gemeinsam in ein raues Haifängernest gekommen waren, bei einer Abendmahlzeit einen Anflug von Fröhlichkeit in sich zu entdecken. Sie wurde aber gleich wieder von Wehmut getrübt, denn in ihren Erinnerungen erschien alles, was sich damals im Madamenhaus zugetragen hatte, auf einmal in einem unbekümmerten Licht, als wären enttäuschte Hoffnungen schöner als erfüllte. Da saßen zwei Frauen, deren Liebe erwidert worden war und die sich trotzdem nur über die zartesten Anfänge ihrer Märchen freuen konnten. War Glück eine Verderben bringende Kraft des Lebens? Als Séra Árni in ihre Unterhaltung eintrat und an das erste Heringsboot, die Marsey, erinnerte, verstummten die Frauen schlagartig. Súsanna musste mühsam schlucken und sah dann eine ganze Weile aus dem Fenster; eine dicke Wolkendecke hing tief über der nassen Halbinsel, und auf der gegenüberliegenden Seite des Fjords waren nur die untersten Uferfelsen zu sehen, dort, wo einmal der Hof Ytri-Skriða gestanden hatte. An Súsannas Hals traten Adern und Sehnen hervor, er sah ergreifend verlassen aus, wie ein Treibholzstamm an einem einsamen Strand, der meilenweit von seinem letzten Laub entfernt war.
Vigdís fragte nichts und verstand alles. Sie sah ihren Mann an, mit Vollbart und buschigen Brauen, den Kopf voller Quadratmeter und Beträge, und sie überlegte, wann sie das letzte Mal zusammen gelacht hatten und auf wem er wohl bei seiner letzten Tour gelandet war. Ob viele von seinen Eskapaden wussten und was sie tun würde, wenn man ihm den Talar nahm. Sie fühlte, wie ihre Verletztheit dabei war, sich in tiefe Verachtung zu verwandeln. Sie begleitete Súsanna nach oben und saß dann neben ihrer heulenden Freundin auf der Bettkante. Sie stellte ihr die gleichen Fragen, die sie sich auch selbst stellte:
»Liebt er dich noch?«
»Das sagt er, aber … ich glaube … er kann gar nicht lieben.«
»Wieso sagst du das?«