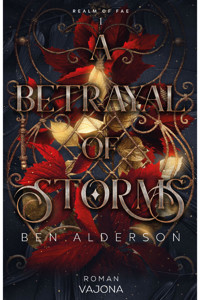
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: VAJONA
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
"Halbfae Robin Vale ist unter Menschen aufgewachsen, doch das rettet ihn nicht davor, von Jägern entführt zu werden." Als er von einer Faeprinzessin gerettet wird, öffnet sich für ihn der Weg nach Wychwood, dem Reich der Fae, in dem sich alle auf einen Krieg gegen die Menschen vorbereiten. Robin versteht nicht, wie er in diese Pläne hineinpasst, bis ihm eröffnet wird, dass er der verlorene Erbe des Icethorn-Hofs ist, dessen unbeanspruchte Macht den Krieg beginnen soll. Während Robin in einer Welt aus Verrat, Mord und Lügen den Thron besteigen und einen Krieg verhindern will, kommt er seinem Leibwächter Erix näher. Die Anziehung zwischen ihnen ist deutlich zu spüren, doch irgendetwas hält Erix zurück.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ben Alderson
A Betrayal of Storms
Realm of Fae
(Band 1)
Übersetzt von Michelle Markau
A BETRAYAL OF STORMS
(Band 1)
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel
»A Betrayal of Storms: Realm of Fey«
A BETRAYAL OF STORMS Copyright © 2024 by Ben Alderson
All rights reserved.
The moral rights of the author have been asserted.
Published by Arrangement with Taryn Fagerness Agency,
4810 Pt Fosdick Dr PMB 34 Gig Harbor WA 98335 U.S.A
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Agence Hoffman GmbH,
Bechsteinstr. 2, 80804 München
Alle Rechte der deutschsprachigen Ausgabe © 2025
A Betrayal of Storms
by VAJONA Verlag GmbH
Übersetzung: Michelle Markau
Korrektorat: Aileen Dawe und Susann Chemnitzer
Satz: VAJONA Verlag GmbH
Umschlaggestaltung: Stefanie Saw
VAJONA Verlag GmbH
Carl-Wilhelm-Koch-Str. 3
08606 Oelsnitz
Für meinen Mann, meinen Wächter, meine Liebe,
meine Aufgabe und mein Vergnügen.
Harry, das ist für dich und unsere Zukunft.
Ich wurde durch einen Dolch an meiner Kehle geweckt. Ich musste ihn nicht sehen, um mir sicher zu sein. Nicht, wenn ich den mir bereits so vertrauten Druck spüren oder den Geruch einer rostigen Klinge wahrnehmen konnte. Es war seltsam. Ich hätte nie gedacht, dass ein Dolch nach etwas riechen könnte, aber ich nahm an, dass eine so unmittelbare Nähe auch die kleinsten Geheimnisse lüften würde.
»Hast du ihn?«, fragte eine raue Stimme, doch die Frage war nicht an mich gerichtet.
»Halt die Klappe, du Idiot!«, antwortete eine andere, etwas tiefere Stimme. »Lass den Bastard entkommen und du wirst dein eigenes Leben geben.«
Ich öffnete meine Augen, die einzige Bewegung, die nicht damit enden würde, dass mein Blut über mein Nachthemd und die Bettlaken vergossen werden würde. Es war fast unmöglich, klar zu denken, aber ich musste es. Es gab keinen Grund zur Eile, nicht, wenn mein mögliches Ende nur einen Klingenschnitt entfernt war.
Es war noch dunkel. Durch die Fenster fiel kein Licht. Es musste also noch mitten in der Nacht sein. Mein Zimmer war in eine Decke aus Schatten gehüllt. Der Mond gab gerade genügend Licht, um die Umrisse der Gestalten über mir zu erkennen.
Anscheinend versucht der Verstand, in lebensbedrohlichen Situationen möglichst viel aufzunehmen. Und meiner glich in diesem Moment einem Wirbelsturm, während er versuchte, zu erfassen, was passiert war.
Der erste Mann hatte eine vom jahrelangen Pfeife-Rauchen raue Stimme und breite Schultern. Wenn es noch Nacht war, bedeutete es, dass Vater schon seit Stunden in der King's Head Taverne in der Stadt arbeitete. Er würde erst nach Sonnenaufgang zurückkehren, und das konnte noch ewig dauern.
Ich war also auf mich gestellt.
Mein Hund, Winston, hatte bei ihrer Ankunft nicht gebellt. Also war er entweder tot oder einfach zu faul. Ich hoffte wirklich auf Letzteres.
Bei der zweiten Person handelte es sich ebenfalls um einen Mann, aber seine Stimme war heller, als hätte ihm jemand einen Tritt in die Eier verpasst und sie hätten sich nie wieder gesenkt. Er war derjenige, der meine Beine an den Knöcheln festhielt, als ob ich es wagen würde, auszubrechen. Ich würde es nicht tun, zumindest noch nicht.
»Ich glaube, er sieht mich an«, sagte der erste Typ, mit einem leichten Anflug von Panik in seiner Stimme. Er drückte wieder auf die Klinge, sie biss fester in meine Haut. »Ich will nicht, dass er mich ansieht!«
Die Hände des zweiten Mannes fummelten an meinen Knöcheln herum, bevor sie losgelassen wurden. Doch der Druck ließ nicht nach. Im Gegenteil. Er hatte meine Beine gefesselt. Ich beobachtete, wie er sich zu seinem Komplizen an meiner Seite stellte, und sah das Seil, das er in seinen Händen drehte.
»Dann zieh ihm den Sack über den Kopf.«
Zu der rostigen Klinge gesellte sich ein weiterer Geruch. Ein scharfer, der mir nur allzu vertraut war. Es roch nach Vater, zumindest nach dem, was an seiner abgetragenen Kleidung haftete, wenn ich ihn morgens nach einer langen Schicht in der Taverne schlafend auf dem Sessel vorfand.
Ein Gemisch aus Gewürzen und verglühter Kohle. Der unverwechselbare Geruch von Whiskey. Aber er haftete nicht an den Kleidern der Eindringlinge, sondern stach mir bei jedem ihrer Atemzüge entgegen.
Ich hätte den Kopf von ihnen weggedreht, nur um den elenden Geruch nicht einzuatmen, aber ich blieb still, bedacht, wegen der Klinge an meiner Kehle.
»Ach, es ist egal, ob er es sieht. Soll er doch. Seine Erinnerung an uns wird ihm nicht helfen können.«
Sie lachten beide. Ein tiefes, schnaubendes Grunzen wie bei Schweinen.
»Solange ich die versprochene Belohnung bekomme«, sagte der erste Mann und beugte sich über mich. Ich spürte den Hauch einer Berührung an meiner Schulter. Bevor ich die Augen zusammenkniff, sah ich, dass es sein praller, dicker Bauch war. »Hast du etwas zu deiner Verteidigung zu sagen … Robin Vale?«
Ich versuchte, der Stimme ein Gesicht zuzuordnen. Seine stämmige, breite Gestalt und sein heiserer, rauchiger Tonfall passten zu James Campbell. Denn wenn er meinen Namen kannte, war die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich auch seinen kannte. »James«, sagte ich, die Stimme heiser vom Schlaf. »Wem verdanke ich das Vergnügen deines … nächtlichen Besuchs?«
»Scheiße«, zischte der zweite Typ und trat vom Bett zurück.
Ich verzog den Mund und schob die Brauen zusammen, als die Klinge für meinen Geschmack etwas zu sehr verrutschte. »Normalerweise ist es dein Sohn, der mir zu so später Stunde Gesellschaft leistet. Wolltest du dich etwa selbst von meinen Fähigkeiten überzeugen?«
Als er sich zu mir hinunterbeugte, konnte ich sein Gesicht jetzt ganz deutlich erkennen. Es war aufgedunsen vom ständigen Alkohol, den er im King's Head zu sich genommen hatte. Selbst jetzt verriet mir der Gestank von Whiskey und getrocknetem Schweinefleisch, dass er die Taverne wahrscheinlich erst kürzlich verlassen hatte.
»Rede nicht über ihn, du Dreckskerl«, zischte er und ließ seine vergilbten Zähne aufblitzen. »Ich schlage vor, du überlegst dir gut, was du als Nächstes sagst, oder es könnte das Letzte sein, was du von dir gibst.«
»Das glaube ich nicht. Wenn du mich hättest verletzen wollen, hättest du es bereits getan, als ich noch geschlafen habe«, erwiderte ich, auch, wenn ich nicht mit Sicherheit sagen konnte, ob ich tatsächlich recht hatte. »Sonst wäre deine stumpfe, kleine Klinge bereits mit Blut verschmiert.« »Stülp ihm den Sack über den Kopf!«, rief der zweite Mann. Ich konnte seine Stimme keinem Gesicht zuordnen, aber das war egal. Was zählte, war, warum sie beide hier waren.
»Halt die Klappe«, antwortete James schnippisch. Seine schwielige, aufgedunsene Hand packte mich an der Schulter und drückte zu. Ich versuchte, mir mein Unbehagen nicht anmerken zu lassen. »Ein kleiner Kratzer wird nichts an dem Preis ändern, der uns versprochen wurde.«
Meine anfängliche Vermutung, dass Münzen der Grund des Einbruchs sein könnten, hatte sich gerade bestätigt. Das haben sie mehr als einmal deutlich gemacht. Ich wusste, dass es diejenigen, die verzweifelt genug waren, zu interessanten Taten verleitete, aber das … das war ein Schritt zu weit. Ein sehr großer und falscher Schritt.
Gerade als ich ihnen etwas entgegnen wollte, verschwand die Hand von meiner Schulter und legte sich über meinen Mund.
»Du kleiner Mistkerl hältst dich sogar jetzt noch für was Besseres. Selbst mit meiner stumpfen, kleinen Klinge an deiner Kehle.« Er machte sich über mich lustig, indem er mich nachahmte. »Das Kopfgeld für Leute wie dich ist gestiegen, Junge. Ich wäre ein Narr, es nicht zu versuchen. Das wäre jeder. Also wirst du jetzt genau zuhören, wenn du nicht noch mehr von deinem Blut verlieren willst.«
»Ja«, sagte der andere, der sich noch immer in den Schatten versteckte.
James drückte sein Gewicht auf mich, sodass das Bett ächzte. »Wenn wir das schnell hinter uns bringen, können wir noch in die Taverne zurückkehren und von deinem Vater mit den Münzen, die wir für dich bekommen, noch mehr Whiskey kaufen. Verdammt, es wird genug sein, um jedem in dieser Taverne einen auszugeben. Den gesamten Winter lang.«
Ich blinzelte nicht, als ich in die weit aufgerissenen Augen des Mannes sah. Selbst in dem düsteren Raum konnte ich den wilden Funken erkennen, der sich dort abzeichnete, als ob er am Verhungern wäre und auf einen großen Haufen Fleisch hinabblickte.
Es war ein Wunder, dass er nicht anfing, zu sabbern.
Mit der Hand auf meinem Mund konnte ich nicht laut lachen, aber in meinem Kopf war dieses Geräusch alles, was ich hören konnte. Wenn es einen Moment gab, sich zu wehren, dann jetzt.
Ich biss hart in seine Hand, bis er einen Schrei ausstieß. Warmes Blut füllte meinen Mund und ließ Kupfer auf meiner Zunge explodieren. Der Geschmack war widerlich, aber es hatte den erhofften Effekt. James ließ mich los und ich konnte meine Stirn gegen seine stoßen. Es ertönte ein lautes Knacken.
Der Klang war wunderschön. Schmerzhaft und entzückend zugleich. Er erfüllte den Raum, als ob die dünnen Scheiben meiner Fenster zerbrochen wären. Mein Kopf pochte kaum. Vater hatte mich gut gelehrt und dafür gesorgt, dass ich wusste, wie ich anderen möglichst großen Schaden zufügen konnte, während ich selbst beinahe unverletzt blieb.
Der Druck des Dolches an meiner Kehle ließ nach, als James mit seiner Hand vor dem Gesicht rückwärts stolperte. Ich wartete nicht darauf, dass die Klinge zurückkehrte, sondern griff nach dem Seil an meinen Knöcheln und zog daran.
Der Knoten öffnete sich. Eine schlampige Arbeit. Passend, wenn man bedenkt, wie das alles bisher gelaufen war. James hatte eindeutig zu viel getrunken, denn er schwankte wie ein Rehkitz auf Eis. Ich sprang vom Bett, bevor die beiden Männer die Chance hatten, ihre Fassung wiederzuerlangen.
»Und was jetzt?«, fragte ich und schüttelte meine Hände an den Seiten, bevor ich sie zu Fäusten ballte. Ich war noch nie in meinem Leben so bereit gewesen, jemanden zu schlagen. Zuerst weckten sie mich aus einem traumlosen Schlaf – was bei mir sowieso selten vorkam. Dann waren sie in mein Haus eingebrochen. Allein diese Tatsache schürte die Glut in mir. »Vielleicht solltet ihr eure Pläne für heute Abend überdenken, bevor ich euch, nun ja, fertigmache.«
»Fertigmachen? Du?«, fragte die leisere Stimme verwirrt. Hätte ich seine Gesichtszüge erkennen können, hätte ich wahrscheinlich eine hochgezogene Stirn gesehen. James trat vor, sein dicker Körper verdeckte den größten Teil des Mondlichts hinter ihm. »Wir sind nicht so weit gekommen, damit du uns einen Strich durch die Rechnung machst, Junge. Du kannst entweder lebend mit uns kommen oder wir riskieren, unseren Gewinn zu verlieren, indem wir dich töten. Du hast die Wahl.«
Oh, was werde ich wohl wählen.
Das wäre wahrscheinlich der richtige Moment gewesen, um nachzufragen, wer ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt hatte. Aber dafür blieb keine Zeit, denn James hob den Dolch und richtete die Spitze direkt auf mich.
»Hat dir niemand beigebracht, dass man mit spitzen Gegenständen nicht spielen soll?« Ich stemmte die Hände auf meine Hüfte. Meine Stimme triefte vor Sarkasmus, etwas, das ich von Vater übernommen hatte. »Schon gar nicht in einem so … intimen Beisammensein.«
Mein Zimmer war klein. Es war das einzige Zimmer in unserem heruntergekommenen Haus, das eine eigene Tür hatte. Oben im Dachboden gab es kaum Platz zum Laufen, geschweige denn, um zwei betrunkene, dumme Männer zurechtzuweisen. Aber ich nahm an, dass ich es in solch einer Situation schaffen würde.
»Ich habe genug von euch.«
»Ich habe dir gesagt, du sollst den Sack benutzen!«, sagte James, bevor er mich aus hasserfüllten Augen musterte. »Wenn du unbedingt willst, dann lass uns spielen.«
Ich lächelte zuversichtlich, auch wenn ich mich nicht so fühlte. »Wenn ich ehrlich bin, habe ich noch nie gern gespielt.«
»Gut«, murmelte James. »Ich auch nicht.«
Ich machte einen Schritt zur Seite, als James mit ausgestrecktem Dolch ungeschickt auf mich zustürzte. Ich drehte mich und trat um ihn herum, bis ich direkt hinter ihm stand. Mit aller Kraft trat ich ihm in den unteren Rücken, bis er nach vorn taumelte und mit umherwirbelnden Armen versuchte, das Gleichgewicht zu halten.
Eine Hand packte mich an der Schulter und lenkte meine Aufmerksamkeit auf sich, bevor James auf das Bett fiel. Sein Schrei verschaffte mir trotzdem Genugtuung, bevor ich den Holzrahmen unter seinem Gewicht mit einem Knacken zerbrechen hörte.
»Hübsches Armband«, sagte der andere. »Dort, wo du hingehst, wirst du es nicht brauchen. Ich werde für dich darauf aufpassen, versprochen.«
Lange, schlanke Finger griffen nach meinem Handgelenk. Ich geriet in Panik, warf meinen Arm zurück und versuchte, etwas Abstand zwischen mich und den Mann zu bringen. Auch aus der Nähe betrachtet, konnte ich sein Gesicht noch immer nicht einordnen. Aber sein Auftreten war deutlich gefasster und gepflegter als das von James. Ich bemerkte die dünnen, blonden Haarsträhnen, die sein schmales Gesicht umrahmten, und versuchte, die Details zu einem Bild zusammenzufügen, das ich wiedererkennen würde. Er stand aufrecht und seine weichen Hände verrieten mir, dass er kein Kämpfer war.
»Hände weg«, knurrte ich. Das Armband mit den Eisenschlaufen war schlicht und würde wahrscheinlich nichts einbringen, aber für mich war es das Wertvollste, das ich besaß. Und niemand, nicht einmal dieser Mann, würde es mir nehmen.
»Aber, aber. Ich verspreche, es nicht aus den Augen zu lassen. Das heißt, bis ich dem nächsten Händler über den Weg laufe.«
Ich schlug zu und meine Fingerknöchel trafen die weiche Haut seines entblößten Halses. Die Augen des Mannes weiteten sich und der Mund stand offen, als er nach Luft schnappte. Ich verschwendete keinen weiteren Moment und schlug erneut zu, dieses Mal in die Eingeweide. Das genügte und er kippte nach vorn. Ich nutzte den Moment und ließ mein Knie mit seinem Gesicht kollidieren.
Er ging zu Boden, wie ein Sack Scheiße.
Ich wartete nicht, ob er wieder aufstehen würde. Denn mich überkam der starke Drang, sofort zu fliehen. Doch gerade als ich den ersten Schritt Richtung Tür machte …
»Noch einen Schritt weiter, Junge, und ich schneide dich auf wie einen verdammten Fisch!« James stand bereits vor mir, sein dicker Körper versperrte mir den einzigen Weg nach draußen. Sein Schrei ließ die Fenster beben. Und als es plötzlich gespenstisch ruhig wurde, hörte ich ein anderes Geräusch. Das leise Knirschen von Füßen auf dem Kies hinter der Eingangstür.
Jemand war dort draußen.
Vater.
Ich hätte um Hilfe geschrien, doch mein Ego verbot es mir. Wenn ich mit zwei verrückten Betrunkenen nicht allein fertig würde, würde ich nur Enttäuschung im Gesicht von Vater sehen.
Also änderte ich meinen Plan und beugte meine Knie, die bei der Bewegung knackten. Ich spannte die wenigen Muskeln in meinem Bauch und meinen Armen an und konzentrierte mich auf den Mann vor mir. Er wackelte leicht und schwang den Dolch, als wäre er ein zehnmal so langes Schwert. Hinter ihm war die offene Tür und dahinter die schmale Treppe, die ins Erdgeschoss führte. Ich betete zu einem Gott, welcher mir auch immer gerade zuhören mochte, dass Winston noch schlief. Und er somit noch am Leben wäre. Nutzlos, aber am Leben.
Ich ließ meinen Kopf von links nach rechts knacken und richtete meinen Blick auf James. »Leider sieht es so aus, als würdet ihr euer Bier diesen Winter selbst zahlen müssen. Das tut mir sehr leid.«
James öffnete den Mund und ich konnte den Speichel tropfen sehen. Doch bevor er ein Wort sagen konnte, rannte ich los.
Ich rammte meine Schulter in seinen geblähten Bauch und verlor das Gleichgewicht zuerst. Wie Dominosteine gingen wir beide zu Boden. Ich hatte Glück, dass er so groß war und den Sturz abfederte. Als wir stürzten, verlor ich die Orientierung. Als ich die Augen schloss, hörte ich nur noch seine gequälten Schreie, während wir die dunkle Treppe hinunterfielen. Es war schmerzhaft. Als mein Körper gegen die engen Wände und die scharfen Kanten der Stufen prallte, konnte ich nur hoffen, dass der schwere Mann unter mir den größten Teil des Aufpralls abfing.
Es dauerte Sekunden, lange, unerträgliche Sekunden, bis ich merkte, dass wir zum Stillstand gekommen waren. In meinem Kopf drehte sich alles. Ich öffnete meine Augen und konnte mich kaum konzentrieren. Schmerz pochte über meiner Augenbraue. Ich berührte die empfindliche Stelle mit einem Finger und stellte fest, dass er feucht wurde. Blut.
»Au … Scheiße«, zischte ich, und meine Arme schrien, als ich mich vom Boden abstieß.
»James!«, rief der zweite Mann von oberhalb der Treppe. Ich blickte zu ihm auf und sah doppelt. »Bist du in Ordnung?«
»Schnapp … ihn«, stöhnte James, während er sich neben mir auf dem Boden wand. Die donnernden Schritte des zweiten Mannes, der die Treppe hinunterrannte, erinnerten mich an meinen Plan. Ich tastete mich mit den Händen in Richtung Eingangstür und konnte mich kaum auf meinen Halt konzentrieren, sondern nur darauf, dass ich nach draußen musste.
Wer immer da war – Vater, ein Nachbar oder ein unglücklicher Fußgänger – würde mir helfen.
Ich begann, doppelt zu sehen, als ich vorwärts stapfte. Meine Schulter stieß gegen die Wand des Flurs und riss ein Bild von seinem Haken. Meine nackten Füße schrammten über zerbrochenes Glas, aber ich kämpfte weiter.
Geh weiter. Du musst hier raus.
Blut ergoss sich über mein Auge und nahm mir die Sicht. Ich wischte es weg, machte es dadurch aber nur noch schlimmer.
»Lass mich los, du Idiot! Schnapp ihn dir!«
»Mach dir keine Sorgen. Er wird nicht weit kommen.«
Ich warf einen Blick über meine Schulter und sah, wie die beiden Männer aneinander herumzerrten. Der dünnere Mann versuchte, James vom Boden hochzuziehen, aber der wehrte sich. Es war fast komisch, wenn man von meinem Blut absehen würde. Aber selbst in meinem benebelten Zustand fragte ich mich, warum sie mir nicht folgten.
Doch der Schmerz setzte erneut ein und ich konnte nicht begreifen, wie seltsam das Bild war.
Als ich endlich die Tür erreichte und nach der Klinke griff, wurde alles wieder scharf. Und noch immer verfolgten sie mich nicht. Ich drehte den Knauf, drückte mein Gewicht gegen die Tür und stieß sie auf. Ich zuckte zusammen, als sie gegen die Außenwand knallte, und erwartete halb einen schimpfenden Schrei von Vater. Selbst mit meinen vierundzwanzig Jahren hatte er noch immer die Kontrolle über meine Ängste.
Eine kühle Brise strich über mich und kühlte den Schnitt an meiner Stirn. Der Winter war nicht mehr fern, denn die Herbstnächte hatten nichts mehr von ihrer einstigen Wärme behalten.
Ich stolperte hinaus in die Dunkelheit, bereit, meine Beine zum Laufen zu zwingen. Wenn ich die Tür offen ließ, würde Winston mir sicher folgen. Und das King's Head war nicht weit entfernt.
James hatte recht. Ich war nicht weit gekommen.
Ich prallte gegen einen Körper aus Dunkelheit. In der Dunkelheit war es unmöglich, zu erkennen, wo die harte Masse begann und endete. Ich stolperte rückwärts und wurde von einem Arm gestoppt, der aus dem Schatten kam und mich packte.
»Was haben wir denn hier?«, ertönte eine Stimme.
Mit zusammengekniffenen Augen versuchte ich, zu begreifen, was geschah. Dann bewegte sich Stoff, eine Kapuze senkte sich und ein Gesicht starrte mich mit stechend grünen Augen an.
Der Unterschied zwischen diesem Mann und den beiden anderen war so groß wie Tag und Nacht. Er löste mit einem einzigen Blick Angst in mir aus. Es bedurfte keines Dolches, um mich innehalten zu lassen.
Es waren nicht die Schatten selbst, die er trug, sondern eine Rüstung, die aus dem schwärzesten Leder und Baumwolle gewebt war. Sein Mantel wehte im späten Herbstwind, als wolle er die silbernen Fäden und die komplizierten Details zur Schau stellen – eine Mode, von der wir Dorfbewohner nicht zu träumen wagten.
Das Aufblitzen von Metall an seiner Taille lenkte mich ab.
Hinter mir lachten James und sein Gehilfe – schallend.
Nun ergab es einen Sinn, warum sie mir nicht gefolgt waren. Es war nicht notwendig. Und das Geräusch, das ich gehört hatte, war nicht die Ankunft von Vater, sondern die der geheimnisvollen Gestalt, die mich in ihrem eisernen Griff hielt.
Ich versuchte, mich loszureißen, mich zu wehren, aber sein Griff wurde nur noch fester. Dann sprach er wieder, Kontrolle schwang in seiner Stimme mit. Er sprach so ruhig, dass ich für einen Moment dachte, ich sei sicher. »Warum haben wir es denn so eilig? Hast du noch etwas vor, Fae-Abschaum?«
Ein Schaudern überkam mich und Unbehagen breitete sich unter meiner Haut aus, als eine schwarz-behandschuhte Faust wie aus dem Nichts auftauchte und mir ins Gesicht schlug. Bevor sie mich traf, kniff ich die Augen zusammen, als ob das helfen würde. Ein Lichtblitz explodierte hinter meinen Lidern und riss mich augenblicklich von den Füßen. Die letzten beiden Worte hallten in meinem Kopf wider, als ich in die schmerzlose Dunkelheit fiel.
Fae-Abschaum.
Im Wachzustand erinnerte ich mich kaum an meine Mutter. Aber es schien, als würde ihre gesichtslose Figur öfter als sonst meine Träume heimsuchen.
Das Haar war so schwarz, dass es in einem subtilen blauen Glanz schimmerte. Dicht und wild, und trotzdem schienen sie immer im Wind zu tanzen. Ihre Stimme war sanft, so sanft, dass sie wahrscheinlich auch das lauteste Kind in den Schlaf wiegen würde.
Und ihre Ohren, zwei Spitzen auf beiden Seiten ihres verschwommenen Gesichts. Lang und stolz, nie versteckt, immer sichtbar trotz ihrer Haare.
Das war alles. Alles, was ich sehen konnte, wenn ich von ihr träumte.
Ich nahm an, dass sich mein Verstand an diese Details klammerte, weil es das war, woran Vater mich immer erinnerte. Dieselben Züge, die ich von meiner Mutter übernommen hatte: obsidianfarbenes Haar, Augen so schwarz wie eine Winternacht und eine sanft klingende Stimme. Und meine Ohren, die zwar nicht so lang waren wie ihre, aber dennoch daran erinnerten, dass sie nicht aus dem Reich der Menschen stammten.
Die Träume von meiner Mutter hielten nie lange an und verwandelten sich schnell in Albträume, weil ich mich so sehr danach sehnte, ihre Augen zu sehen. Ich wünschte, ich könnte mich daran erinnern, ob sich ihre Lippen trennten, wenn sie lächelte, oder ob ihre Wangen Grübchen zeigten, wenn sie über etwas lachte. Kleine Details, die für andere keine Rolle spielen würden. Aber für mich … Nun, ich würde die Welt dafür geben, wenn ich es nur wüsste. Nur um sie zu sehen. Um mich an ihre Augen zu erinnern oder an den Schwung ihres Mundes. Alle anderen Details, die mir vorenthalten wurden, waren Geheimnisse. Ich sehnte mich nach ihnen. Mehr als nach den Geheimnissen dieser Welt.
Aber diese Geheimnisse würden nie gelüftet werden. Denn sie hatte mich verlassen. Oft hatte ich darüber nachgedacht, warum sie nicht zu mir zurückgekehrt war. Die Götter wissen, dass Vater sie auch vermisste. Ich konnte es in den stillen Momenten sehen, wenn er in Gedanken versunken war, wenn sein Blick an einer unwichtigen Stelle klebte und er in Erinnerungen schwelgte.
Ich wagte nicht, ihn nach meiner Mutter zu fragen. Es war Jahre her, seit wir das letzte, unangenehm angespannte Gespräch über ihr Verschwinden geführt hatten. Ganz gleich, ob ich sie in einem Traum sah oder im Wirrwarr meines Bewusstseins, ich griff immer nach dem Eisenarmband an meinem Handgelenk.
Es war das Letzte, was sie mir geschenkt hatte. Und das machte es zu meinem wertvollsten Besitz.
Ich wachte durch Schreie auf. Entfernte Schreie und Rufe, die sich anhörten, als würden Katzen in den Straßen von Grove kämpfen. Ich öffnete meine Augen ein wenig, um sie dann im grellen Tageslicht wieder zu schließen. Als ich eine Hand hob, um meine Augen vor dem Sonnenlicht abzuschirmen, stellte ich fest, dass meine Handgelenke mit grob geknoteten Seilen zusammengebunden waren.
Und damit kamen die Ereignisse der letzten Nacht zurück. Alles, was geschehen war, kein Detail konnte ich vergessen. James, der schwarz gekleidete Wachmann und seine starke Faust. Ich hob eine Hand an meine Stirn, spürte die empfindliche Haut und das getrocknete Blut. Ich riss die Augen auf und blinzelte den Lichtschock weg, um meine Umgebung wahrzunehmen.
Ich war in einem Käfig. Einem, der sich bewegte. Die Räder quietschten unter mir, als ich das wagenähnliche Gefährt registrierte, das heftig über einen Feldweg schaukelte. Um mich herum waren hohe Gitterstäbe aus obsidianfarbenem Metall, die im Licht schimmerten. Ich reckte den Hals nach oben und betrachtete die Abdeckung aus demselben Material, die von einer Seite des Käfigs zur anderen führte.
Trotz der warmen Sonne, die auf mich herab schien, konnte ich ein Frösteln nicht unterdrücken. Der kalte Wind, typisch für den Spätherbst, wehte mir um die Nase und bedeckte meine entblößten Arme.
Ich schaute an mir herunter und schluckte, als ich die weite Hose und die einst weiße Tunika sah, die ich letzte Nacht getragen hatte. Meine nackten Füße waren mit Dreck beschmutzt und zierten eine Handvoll Schnitte, die vom Laufen über den zerbrochenen Bilderrahmen übrig geblieben waren.
Aus dem vorderen Teil des Wagens vernahm ich eine gemurmelte Unterhaltung. So leise wie möglich blickte ich hinüber und entdeckte die Rücken zweier Wachen, die beide in die bekannten dunklen, fleckigen Lederkleider gehüllt waren.
»Hallo!«, rief ich und zerrte an meinen Handgelenken. Mein Kiefer schmerzte und in meinem Kopf pochte ein nachhallender Schmerz, eine verbliebene Erinnerung an den Schlag, der mich bewusstlos werden ließ. »Ich glaube, hier liegt ein Irrtum vor. Was auch immer ihr glaubt, das ich getan haben soll, ich kann euch garantieren, dass ich es nicht war. Ihr habt die falsche Person erwischt.«
Einer der Wachmänner drehte den Kopf, nur ganz leicht, und konzentrierte sich dann wieder auf die Straße. »Gib mir die zehn Münzen«, sagte er und stupste dem anderen Mann in die Seite. »Sieht so aus, als würde ich die Wette gewinnen.«
Der zweite Wächter antwortete und schnalzte mit der Zunge, um den Pferden ein Zeichen zu geben. »Du hättest nur gewonnen, wenn er nicht aufgewacht wäre, bevor wir das Lager erreicht hätten … und wir fahren noch, oder nicht? Also habe ich die Wette gewonnen und du schuldest mir die Münzen!«
Mein Inneres brannte, während die Männer über mich sprachen, als wäre ich nicht hier. Was würde ich nur dafür geben, diesen ahnungslosen Idioten eine – oder zwei – meiner Fäuste ins Gesicht zu schlagen. Aber das war nicht der einzige Grund für meine Wut. Es war die Tatsache, dass ich mich überhaupt in dieser Situation befand. Meine Gedanken wurden von ›hätte‹ und ›könnte‹ überfüllt. Ich hätte härter kämpfen sollen. Ich hätte mehr Lärm machen sollen, einen Nachbarn oder jemand anderen alarmieren sollen. Irgendjemanden. Andererseits … wären sie gekommen, um zu helfen?
»James Campbell«, riss ich den Namen des Arschlochs aus den Tiefen meiner Gedanken. »Wenn er … was auch immer er getan oder euch erzählt hat, es sind alles Lügen … Ich schwöre, ich bin wertlos. Ich würde nicht einmal fünf Münzen auf mich setzen, geschweige denn zehn.«
»Wenn du noch weiterredest, werden wir dich knebeln«, sagte der Wachmann. Durch meine Panik hindurch registrierte ich seine Stimme als diejenige, die mich niedergeschlagen hatte. Wie viel Zeit war vergangen, seit ich bewusstlos geschlagen worden war? Das Tageslicht strahlte jetzt auf uns herab. Es müssen also mehrere Stunden gewesen sein.
»Sag mir einfach, was du von mir willst«, rief ich. Meine Stimme war hoch, sehr hoch, als ob meine Eier sich noch nicht gesenkt hätten. Ich versuchte einen Moment lang, aufzustehen, bevor der Wagen wie ein Schiff auf heftigen Wellen schwankte und ich wieder hinfiel.
»Halt die Klappe, Junge! Tu dir selbst einen Gefallen und sei einfach still. Glaub mir, wir haben das alles schon gehört. Und noch viel mehr.«
Es war klar, dass diese Männer aus reichem Hause stammten. Oder dass sie zumindest an einige Münzen gekommen sind. Niemand in Grove oder in einem der umliegenden Dörfer trug so gut genähte Kleidung, hatte Karren aus Metall oder besaß Pferde mit einem solch glänzenden Fell.
»Ich bin unschuldig …«
»Deine Ohren lassen etwas anderes vermuten.«
Die Spitzen meiner Ohren erhitzten sich, nicht gerade ein neues Gefühl.
»Commander Rackley hat verlauten lassen, dass wir bei Sonnenuntergang in die Hauptstadt ziehen werden. Ein paar weitere wurden gefangen genommen. Wir kassieren die Kopfgelder ein und dann feiern wir.«
Einer der Männer klopfte dem anderen auf den Rücken, woraufhin sich der Mantel um seine Schultern für einen Moment glättete. Ein aus Silberfäden gefertigtes Symbol zeichnete sich auf seinem Rücken ab. Es nahm den größten Teil des Stoffes ein, faltete sich aber wieder zusammen, als er erneut an den Zügeln zog.
Einen Moment lang sah es aus wie der Umriss einer Hand. Die geschwungenen Linien des Fadens hoben sich deutlich von dem tiefschwarzen Stoff ab, den sie zierten.
Ich öffnete wieder den Mund, um zu sehen, wie weit ich mein Glück herausfordern konnte, als mich ein leises Geräusch stoppte. Es klang wie … Weinen. Das Weinen von Kindern und die flehenden Schreie von älteren Menschen.
Ein Schwarm Krähen kreiste im Himmel, aufgeschreckt durch den Lärm, der die blaue, wolkenlose Leere erfüllte.
Ich reckte den Hals und sah über die dicken Gitterstäbe des Käfigs hinweg, als der Wagen sich drehte. Dann schlug mir der Geruch entgegen. Kupfer. Reines, intensives Kupfer, das mich angewidert die Nase rümpfen ließ. Blut. Der Ursprung war nicht schwer zu finden.
Auf einem offenen Feld, umrandet von meterhohen Bäumen, befand sich ein Lager. Auf den ersten Blick erinnerte es mich an eine Gruppe von Künstlern, die einst durch Grove zogen und drei Nächte lang ein Schauspiel und Unterhaltung boten. Aber das hier war nichts dergleichen.
Käfige, wie der, in dem ich saß, reihten sich im ganzen Lager aneinander. Unzählige Körper füllten sie, die Arme herausgestreckt, als ob sie um Hilfe flehen würden. Je näher wir kamen, desto mehr konnte ich erkennen. Es gab so viele andere Wachen, alle in den gleichen schwarzen Rüstungen gekleidet wie die, die meinen Wagen steuerten. Umhänge wehten und zeigten das gleiche Handsymbol, das sich auf dem Rücken der Wache abbildete.
Einige Wachen streiften durch das Lager, schlugen mit den scharfen Kanten ihrer Schwerter auf die Käfige und schrien, um die Gefangenen zum Schweigen zu bringen. Andere schoben sie vor sich her, mit Ketten an den Handgelenken und Füßen, die mit einem dicken Metallband um ihre Kehlen verbunden waren.
Aber egal, welches Grauen ich erlebte, es konnte mich nicht von dem stechenden, ekelerregenden Geruch des Blutes ablenken.
Wir fuhren weiter in das Lager rein, bis die Pferde langsam zum Stehen kamen. Bevor die Männer absteigen konnten, griffen andere Wachen nach der Rückseite des Käfigs und öffneten die Tür.
»Raus!«
Ich konnte nicht sprechen. Die Angst lähmte meine Zunge und ließ meine Kehle austrocknen. Ich krabbelte rückwärts, bis ich in der Ecke des Käfigs war, die am weitesten von ihnen entfernt war. Ich bereitete mich darauf vor, zuzutreten, wenn sie nach mir greifen würden.
»Temperamentvoll …«, sagte einer von ihnen, aber ich konnte nicht ausmachen, wer.
»Die Halbgeborenen sind es immer«, antwortete ein anderer mit dem gleichen pompösen Akzent wie der andere. Sie stammten aus einer Stadt, wahrscheinlich aus Lockinge. Die Hauptstadt, die der Wächter vor nicht allzu langer Zeit erwähnt hatte, als er über Commander Rackleys Befehle sprach.
Ich konnte nicht sagen, warum, aber der Name kam mir bekannt, sogar wichtig, vor. »Willst du uns etwa beißen, Halbgeborener? Dann müssen wir dir wohl dein Maul stopfen, was?«
Halbgeboren. Kein schönes Wort. Es schlug mir auf die Seele, als mich unzählige Augen von jenseits des Käfigs anstarrten.
»Du siehst aus, als würde dir das gefallen.« Ich stieß einen lauten Atemzug aus. »Pass bloß auf«, hörte ich die vertraute Stimme meines Entführers.
»Der hat bereits einiges angerichtet. Du hättest die beiden sehen sollen, die ihn verraten haben. Einer wird sicher noch tagelang nicht richtig laufen können.«
»Das Kopfgeld wird ihn seine Beschwerden vergessen lassen. Das tut es immer.« Sie sprachen von James und seinem Komplizen. Ich freute mich über ihren Schmerz. Doch meine Freude wurde durch behandschuhte Hände, die nach meinen Knöcheln griffen und mich nach vorn zerrten, ausgelöscht. Mein Hinterkopf schlug auf dem Boden auf. Mit jedem Blinzeln sah ich Sterne, zu viele, um sie zu zählen. Ein Pochen in meinem Schädel gesellte sich zu den restlichen Schmerzen, als die Hände mich über den Käfigboden in Richtung Ausgang zogen.
»Wo bringen wir ihn unter?«
»Er wurde bereits getestet und zeigte keine Reaktion. Bringt ihn zu den anderen, zum nutzlosen Pack«, antwortete mein Entführer.
Jemand trällerte. »Schade, diese Partie war nicht so ergiebig, wie ich gehofft hatte. Wenn wir mit wenig Vorrat zurückkommen, wird das bei der Hand nicht gut ankommen.«
Ich versuchte, mich auf das zu konzentrieren, was die anderen als Nächstes sagten, aber es war fast unmöglich. Raue Hände zerrten an mir und wir entfernten uns von den Wachen.
»Nimm deine verdammten Finger von mir.« Ich merkte, wie erbärmlich ich klang, aber das interessierte mich gerade wenig.
Sie ignorierten mich und kümmerten sich nicht darum. Stattdessen zerrten sie mich in die Reihe der größeren Käfige. Der erste war genauso voll mit jammernden und schreienden Personen wie die anderen. Wir kamen an einem sehr überfüllten Käfig vorbei. Die Körper waren zusammengepfercht, kaum ein Zentimeter Platz zwischen ihnen. Sie schrien und brüllten.
Ich sah Kinder, die sich zwischen den Beinen von Frauen und Männern versteckten. Die meisten weinten, aber einige rüttelten so heftig an den dunklen Gitterstäben des Käfigs, dass ich mich wunderte, dass die Stäbe nicht nachgaben.
»Bleibt zurück!« Mein Entführer brauchte die Warnung nur zu rufen und alle im Käfig erstarrten vor Angst.
Die patrouillierenden Wachen stießen die Spitzen ihrer Schwerter zwischen die Gitterstäbe. Die Gefangenen im Käfig wichen zurück. Die Wachen entriegelten das Tor und öffneten es. Und ich landete erneut in einem Käfig.
In einem Moment hielten sie mich noch fest umklammert, im nächsten kniete ich bereits im Käfig. Meine Handflächen schmerzten vom Sturz. Das Seil, das mich noch immer fesselte, rieb die Haut an meinen Handgelenken auf.
Metall knallte auf Metall und der Käfig wurde wieder geschlossen. Mit mir darin.
Diesmal waren es weiche Hände, die mich berührten und mir vom Boden hochhalfen, während ein Echo besorgter Fragen über mich hinwegfuhr.
Ich blinzelte, unfähig, meine rasenden Gedanken zu beruhigen. Besorgte und gleichermaßen erschrockene Gesichter blickten mich an. Und in jedem Gesicht, das ich wahrnahm, fiel mir etwas Merkwürdiges auf. Ein Detail, das ich nur in meinem eigenen Spiegelbild oder in der nebligen Erinnerung meiner Mutter gesehen hatte.
Spitze Ohren.
Diese Menschen waren Fae. Ob groß oder klein, ob jung oder alt: Sie alle besaßen spitze Ohren.
Ich kannte sie nur von meinem Spiegelbild oder der wiederkehrenden Vision meiner Mutter. Anderen Fae war ich noch nie begegnet. Weder Halb-Fae, wie mich, noch Vollblüter. Und sie jetzt alle vor mir zu sehen, beruhigte mich keinesfalls.
»Geht es dir gut?«, fragte eine Frau. Sie hatte kurzgeschnittenes, blondes Haar und leuchtende, kobaltblaue Augen. Ihr Gesicht und ihr Hals waren mit Schmutz und Dreck beschmiert. Rote Flecken zeugten von einem Kampf. Im Gegensatz zu meiner Nachtwäsche trug sie edle Kleider. Aber ihre waren genauso zerrissen und schmutzig. Als hätte sie mit einem Dornenbusch gerungen und kläglich verloren.
»Wer … wer sind die?«, fragte ich und schaute mich in der überwältigenden Anzahl von Gesichtern um. »Diese Wachen, warum tun sie das?« Die Menge grummelte und ein kleiner Schrei ertönte. Als ich nach unten blickte, entdeckte ich das runde Gesicht eines Kindes, das zwischen den Beinen der Frau hervorlugte und ähnliche große, blaue Augen hatte, auch von Angst erfüllt, wie die aller anderen.
»Jäger.« Sie nahm meine Hände in die ihren und verzog ihre Brauen zu einem Stirnrunzeln. »Von unserer Art.«
Fae. Sie meinte Fae. Ich öffnete meinen Mund, bereit, ihr zu sagen, dass ich kein Fae war, sondern etwas anderes. Irgendetwas dazwischen. Das hatte ich so lange behauptet, wie ich mich erinnern konnte.
Ich entschied mich, mitzuspielen, in der Hoffnung, die Antworten zu finden, die ich brauchte, um aus diesem Schlamassel herauszukommen, und stellte eine weitere Frage. »Und was wollen sie von … uns?«
»Blut.« Die Antwort war schlicht und einfach. »Aber du musst dir keine Sorgen machen. Wir sind machtlos – nutzlos. Ich hoffe, sie lassen uns gehen, bevor ihnen etwas Neues einfällt.«
Das glaubte ich nicht.
Ich wollte mich von ihr lösen, tat es aber nicht. Ihre Berührung hatte etwas Beruhigendes an sich. Sie sah zu ihrem Kind hinunter und wandte ihre Aufmerksamkeit mit einem Kopfschütteln wieder mir zu. Es war klar, dass sie alles, was sie sagen wollte, wegen des Kindes für sich behielt.
»Die sind nicht mehr nötig.« Sie begann, an meinen Fesseln zu zerren und ließ dabei abgebrochene Nägel und blutverschmierte Knöchel aufblitzen. »Lass mich dir da heraushelfen.«
Niemand sonst hier schien gefesselt zu sein. Der Boden des Käfigs war von weggeworfenen Seilen übersät oder was davon übrig war.
»Danke«, sagte ich und zuckte zusammen, als sie mit zitternden Händen zu zerren begann. Ich zischte zwischen zusammengebissenen Zähnen, als sich das Seil löste und rote Haut zum Vorschein kam.
Ich hatte so viele Fragen. Aber im Lager herrschte Chaos, was es unmöglich machte, auch nur das kleinste Wort zu sagen, ohne zu schreien.
Ich wollte die freundliche Fremde noch einmal befragen, aber ein Schrei durchschnitt den Tag. Wir blickten nach links und sahen, wie eine Handvoll Wachen eine Frau durch das Lager zerrte. Sie zogen sie an den Haaren, Schlamm bedeckte ihre nackten Beine. Sie wehrte sich gegen die Hände und Arme und grub ihre Nägel in den Stoff, der sie bedeckte. Aber sie zogen sie weiter.
Während ich zusah, spürte ich ein seltsames Gefühl in meiner Brust. Es war, als ob ein Vogel verzweifelt mit den Flügeln schlug und versuchte, zu fliegen, doch es gelang ihm nicht. Ich drückte meine freie Hand auf mein Brustbein und versuchte, das Gefühl zu beruhigen.
Die Wachen warfen die Fae schließlich in der Nähe eines alten Holzstumpfes zu Boden. Selbst aus der Ferne konnte ich Narben auf dem Holz sehen, gezackte Linien, die sich tief in die Oberfläche gruben.
Sie kämpfte wie ein Schmetterling unter Nadeln und warf alles, was sie finden konnte, auf die Wachen. Sie zwangen ihren Körper, sich unnatürlich zu krümmen, bis ihr Kopf auf der Seite über dem Stumpf ruhte. Es waren drei von ihnen nötig, um sie festzuhalten, denn sie kämpfte, als ob ihr Leben davon abhinge.
Und ich erkannte, dass es das tat.
»Altar, nimm ihren Schmerz«, sagte die Fae an meiner Seite und griff nach ihrer Tochter, die leise zu weinen begann. Ich schaute sie an und riss meine Aufmerksamkeit von der Szene los, um zu beobachten, wie die Frau eine Hand auf die Augen des jungen Mädchens legte. »Zähle bis zehn, meine Kleine. Zähle bis zehn, für Mama.«
Es war dasselbe, was Vater mich immer machen ließ, wenn ich Angst hatte. Eine Ablenkungstechnik. Ein Weg, um den Geist auf etwas anderes zu konzentrieren.
»Eins.« Ihre kleine Stimme brach unter einem Schrei.
Ich blickte zurück auf die Szene. Das gesamte Lager war verstummt.
»Zwei.«
Ein riesiger, breitschultriger Mann ging auf die Frau am Baumstumpf zu. Er trug dieselbe Uniform, die auch die übrigen Jäger trugen. Um eine Taille hatte er eine fleckige, zerrissene Schürze. In seinen dicken, behandschuhten Händen trug er eine Axt. Er brauchte beide Hände, um sie hochzuhalten. Der Griff war mit elfenbeinfarbenem Material umwickelt und die Klinge war schwarz. Vertrocknetes Blut.
»Drei.«
Noch bevor er die Frau erreichte, wusste ich, was passieren würde. Jeder, der zusah, wusste es.
»Vier.«
Mein Blick wanderte zu einem Schatten, der sich im Gras um den Baumstumpf herum ausbreitete. Aber er wurde weder von der Fae-Frau noch von dem Jäger, der über ihr stand, entdeckt. Ihre Hände stemmten sich gegen den Boden, unfähig, etwas anderes zu tun.
»Fünf.«
Um den Baumstumpf herum troff das Blut und tränkte das zertretene Gras und den Schlamm.
»Sechs.«
Mein Herz donnerte in meiner Brust. Meine Hand zitterte, als ich sie auf mein Herz drückte, als könnte ich es daran hindern, aus meiner Brust zu springen.
»Sieben.«
Die Frau auf dem Stumpf schrie nicht mehr. Mit weit aufgerissenen Augen gab sie ihren Kampf auf. Die Jäger, die sie festhielten, öffneten ihren Zopf. Ihr rotes Haar wurde von ihren Schultern gestrichen und legten ihren blassen Hals frei.
»Acht.«
Ich hatte das Bedürfnis, zu schreien. Etwas zu tun, irgendetwas, als der Jäger über der Frau stand und seine Statur einen Schatten auf sie warf.
»Neun.«
Der Tod stand unmittelbar bevor. Das ganze Lager schwieg, als sie auf ihn warteten.
»Mach weiter, mein Mädchen, mach weiter.«
Ich griff nach meinem Handgelenk, wollte die feste, sichere Umarmung des Armbands meiner Mutter spüren. Aber meine Finger trafen auf nackte Haut. Atemlos blickte ich nach unten und sah nur die roten Male, die meine Fesseln hinterlassen hatten.
Das Armband war weg.
Gerade als ich mich wieder der Szene vor mir zuwandte, ging mir etwas durch den Kopf, was James´ Partner gesagt hatte.
Ich werde für dich darauf aufpassen, versprochen.
Mit beiden Händen schwang der Henker die Axt über seinen Kopf. Sonnenstrahlen trafen auf die Schneide und erschufen die Illusion eines Lichtblitzes. Dann durchschnitt die Klinge die Luft. Ich konnte den Wind schreien hören, als sie durch den bleichen Hals glitt.
»Zehn.«
Dann gab es einen Aufprall. Es verschlug mir den Atem, aber ich weigerte mich, wegzusehen. Die Axt steckte im Baumstumpf, zwischen dem Kopf und dem Körper der Frau. Es dauerte einen Moment, bis das Leben aus den Augen der Frau wich. Dann fiel ihr Kopf auf den Boden, wo er in kleinen Kreisen zu rollen schien, bevor er schließlich vor den gestiefelten Füßen des Henkers zum Liegen kam.
In diesem Moment begann das Geschrei erneut. Ich blieb still. Mein Blut gefror. Die Kälte breitete sich von meinem Herzen aus und schlich sich in meine Arme, dann meine Beine.
Ich erwartete, jeden Moment zu zerbrechen. Unter der Sonne zu schmelzen.
Die Jäger schoben den leblosen Körper vom Baumstumpf und ließen ihn achtlos daneben liegen.
»Schau weg …« Eine zarte Stimme sprach zu mir. Dann schlich sich eine kleine, zarte Hand in meine und umfasste sie. »Wir können gemeinsam bis zehn zählen.«
Es war das junge Fae-Kind. Ich sah in ihr Gesicht. Es strahlte Unschuld und Vertrauen aus. Sie war eine Fremde und gleichermaßen der Anker, der mich in die Realität holte, während sich der eben erlebte Horror in meinem Kopf wiederholte.
»Eins«, drängte sie leise. »Zwei …«
Ich stimmte mit ein, während ich gegen den Drang kämpfte, mich umzudrehen und zuzusehen, wie die enthauptete Fae weggebracht wurde. Die hellen Augen des Kindes hielten meinen Blick gefangen und verdrängten das Grauen, während ich mich auf sie konzentrierte. Die Panik in meiner Brust verging so weit, dass ich mich konzentrieren konnte. Ihre Stimme konnte meinen inneren Sturm besänftigen.
»Acht, neun und zehn.«
Am späten Nachmittag wurde ein Scheiterhaufen angezündet, um die Überreste der Frau zu verbrennen. Ich atmete seitdem durch den Mund, um den widerlichen Geruch von brennender Haut nicht sofort wahrzunehmen. Doch es dauerte nicht lange, bis er in der Luft hing. Trotz des Chaos im Lager war ich mir sicher, dass ich das Knacken und Knistern der Knochen hören konnte, als sich das Feuer durch Fleisch und Muskeln fraß.
Ihre Verbrennung klang beinahe … banal. Wie Zweige in einem Feuer. Als ob eine solch schreckliche Tat einfach dahinschmelzen könnte. Ihr Körper wurde zu Asche, als wäre er dazu bestimmt gewesen.
Ein Stechen in meinem Magen tat sein Übriges, um den Schmerz in meiner Brust zu vertreiben. Vom hektischen Flügelschlag eines großen Vogels ging er in etwas Ruhigeres über. In ein leises Flattern eines Insekts. Ich unterdrückte den Drang, mich zu übergeben. Einige andere im Käfig leerten ihren Magen auf dem Boden aus. Erbrochenes spritzte ungehindert gegen sie und auf ihre nackten Füße, was auch meinen Würgereiz am Ende auslöste. Die neuen Pfützen gesellten sich zu den bereits getrockneten und erzählten mir, was sie bereits erlebt hatten.
Es wurde klar, was aus den nutzlosen Fae werden würde.
Sie würden sterben.
Meine Gedanken drehten sich um Flucht. Wychwood war so nah. Es galt nur, die Bäume und die dahinterliegenden Schatten zu überwinden. Wenn ich mich irgendwie befreien und fliehen könnte, dann würde ich Hilfe finden. Doch die Hoffnung wurde schon bald zunichtegemacht. Es kamen immer mehr Jäger ins Lager. Unzählige Pferde zogen schwarze Metallkäfige und luden ihren Inhalt ab, so wie sie es bei mir getan hatten. Was immer diese Männer und Frauen auch geplant hatten, führten sie präzise aus. Konvois von Jägern kamen an, luden Käfige ab und füllten sie wieder mit anderen. Aber die Fae, die sie in die Käfige auf Rädern verfrachteten, hatten alle ein Metallband um den Hals. Es war klar, dass diese für die Jäger von besonderem Interesse waren. Kayia, die Mutter des kleinen Mädchens, sagte, es habe mit ihrem Blut zu tun, aber was war daran so anders?
Sie räusperte sich und deutete auf einen Pferdewagen, der gleich das Lager verlassen würde. Beladen mit Metallband-tragenden Fae. »Sie machen das immer wieder. Nehmen einige mit und lassen andere zurück. Diese Fae, sie –« Kayia hielt inne, atmete zittrig ein und nahm ihr Kind in den Arm, das sich an ihr festhielt, als ob es um ihr Leben ginge. Was es wohl auch tat. »Was sie der Frau angetan haben, werden sie auch uns antun. Ich weiß es.«
»Du hast von Blut geredet?«, hakte ich nach, umklammerte die kalten, schwarzen Gitterstäbe und blinzelte, um etwas zu sehen. Irgendetwas, was die weggebrachten Fae von uns unterscheiden würde.
»Es gibt Stimmen, die behaupten, dass die Menschen auf unsere Art Jagd machen. Sie wollen diejenigen, die Macht besitzen. Magie. Ich dachte, es seien nur Gerüchte, um uns von dieser Seite Wychwoods fernzuhalten. Aber es waren nicht bloß Gerüchte. Hast du sie nicht gehört?«
Ich schüttelte den Kopf. Ich war noch nicht bereit, ihr von meiner Herkunft zu berichten. »Als ich aufwachte, sagten sie etwas von einem Test.«
»Den haben sie auch bei Lia und mir gemacht. Aber wir scheinen nichts Besonderes zu sein. Genau wie du.«
Obwohl ich nicht viel über meine Mutter wusste, war mir meine Herkunft bekannt. Ich wusste von den vier Höfen und ihrer Geschichte. Kannte diejenigen, die über sie herrschten und wusste, was es bedeutete, ein Fae zu sein. Wusste über ihre Macht. Vor vielen hundert Jahren wurde das Wychwood-Abkommen von den vier Höfen der Fae und dem ersten König der Menschen unterzeichnet. Seitdem hatten sich die Fae weitgehend in ihr Reich zurückgezogen und die Menschen in das ihre.
Bis jetzt, nahm ich an.
Ich kämpfte gegen den Drang, meine Ohren zu berühren. Bisher hatten sie mich von den Menschen in meiner Umgebung unterschieden. Doch hier, in diesem Käfig, gab es zwischen uns keine Unterschiede mehr.
Ich gehörte zu ihnen.
»Wurde an eurem … Hof darüber berichtet, was mit denjenigen passiert, die … Magie besitzen?«, fragte ich und zwang mich zu einem Lächeln, um das kleine Mädchen, das sich zwischen uns drängte, nicht zu beunruhigen. Ich war vorsichtig, denn trotz ihres Alters wollte ich sie nicht unterschätzen. Ich war mir sicher, dass sie wusste, dass ich keine der mir gestellten Fragen beantworten würde.
»Das weiß niemand.« Kayias blasse Brauen zogen sich zu einem Stirnrunzeln zusammen. »Die Menschen wollen seit jeher mehr Macht. Wenn es das Abkommen nicht gäbe, hätten sie sich schon längst geholt, was sie begehren.«
Einer meiner Lehrer hat einst etwas Ähnliches gesagt. Damals dachte ich, dass die Menschen das Abkommen unterzeichnet hätten, um ihre Art vor den mächtigen Fae zu schützen. Doch jetzt wurde mir die Wahrheit schmerzhaft bewusst. Die Fae hatten das Abkommen aus denselben Gründen akzeptiert.
Ich hatte noch viele Fragen, doch meine Kehle war wie zugeschnürt. Selbst jetzt, eingesperrt wie ein Tier, mit dem Geruch nach verbranntem Fleisch in der Nase, wollte ich Antworten auf diese Fragen. Ich war noch nie bei jemandem wie ihr gewesen. Jemandem wie mir. Bisher haben die Fae Wychwood und somit den Schutz ihrer Höfe noch nie verlassen. Zumindest habe ich noch nie davon gehört. All meine Fragen beantwortet zu bekommen, schien also bislang unmöglich.
»Wir müssen hier verschwinden«, flüsterte ich, als zwei Wachen an unserem Käfig vorbeigingen. »Sie sind nur wenige. Wir könnten hier rauskommen, wenn wir zusammenarbeiten und uns freikämpfen.«
Kayia schnaubte amüsiert. »Ich bewundere deine Moral, aber ich glaube, du hast zu viel Fantasie. Es ist das Risiko nicht wert. Was sie mit ihr gemacht haben, werden sie auch mit uns machen.«
Ich sah mich im Käfig um. Entmutigte Gesichter blickten mir entgegen. Ich sah von den Älteren zu den Kindern, die eingequetscht zwischen ihnen saßen und deren Augen vom Weinen geschwollen, die Wangen rot und rau waren.
»Sie werden auch uns umbringen. Ob wir nun etwas dagegen tun oder nicht, wir werden ihr Schicksal teilen. Und ich würde lieber in dem Wissen sterben, dass ich versucht habe, meines zu ändern. Kayia«, ich griff nach ihren kalten, steifen Händen, »wir müssen es versuchen.«
»Ich habe dir bereits gesagt …« Tränen schimmerten in ihren Augen, ihre Lippen waren zusammengepresst. Sie kniete sich nieder und drückte ihr Kind eng an sich, ließ ihren Blick jedoch nicht von mir ab. »Es ist das Risiko nicht wert. Wir haben den Schutz Wychwoods verlassen. Wir werden es nicht zurückschaffen, bevor sie uns einen nach dem anderen einen Pfeil in den Rücken geschossen haben. Alles, was wir tun können, ist warten und hoffen, dass unsere Königin Hilfe schickt.«
Als ich auf das Kind blickte, konnte ich Kayias Sorge verstehen. Und tief im Inneren wusste ich, dass sie recht hatte. Sie würden es nicht schaffen. Als ich meinen Blick hob, konnte ich die Bäume von Wychwood erkennen, die wie Wächter aus Rinde und dickem Laub in der Ferne standen und mich verhöhnten.
»Was dann?«, fragte ich und dachte an Vater. Ich hatte mich bemüht, ihn aus meinen Gedanken fernzuhalten.
Aber diese Frau zu sehen, die ihr Kind im Arm hielt, rief ihn in mein Gedächtnis.
Er wird nach Hause gekommen sein und ich war nicht da gewesen. Vielleicht hätte er aber auch gar nicht nach mir gesehen und darauf vertraut, dass ich bereits schlief, weshalb er mich nicht wecken wollte. Oft schlief er in seinem Sessel ein, in dem Wissen, ich würde ihn am nächsten Morgen wecken. Doch nicht heute. Heute würde er länger schlafen.
»Wir warten und beten, dass sie jemanden schickt, der uns rettet.« Kayias Blick huschte in Richtung des Waldes und ich wusste, wen sie meinte. Ihre Königin. Irgendeine Adelige von einem der vier Höfe.
Laute Stimmen und Rufe unterbrachen uns. Sie waren anders als die, die das Lager bisher erfüllten. Denn sie klangen entschlossen und wütend.
Eine junge Frau, nicht älter als ich, rannte vor einer Schar Wachen davon. Sie schlängelte sich um die Käfige, sprang über Schutthaufen und ließ ihr feuerrotes Haar hinter sich herfliegen. Doch ihre Hast war sinnlos, denn die Wachen verfolgten sie nicht. Das brauchten sie auch nicht. Von ihrem Metallband um ihren Hals ging eine Kette ab, die in den Händen eines Jägers endete.
Wie ein Hund war sie angeleint. Das hielt sie jedoch nicht vom Versuch ab, sich zu befreien.
Ein leises Keuchen entwich mir, als der Jäger an der Kette zog. Ich spürte fast, wie ihr die Luft aus der Lunge wich, als sie nach hinten flog und mit dem Rücken auf dem Boden aufschlug.
Das ganze Lager schaute gebannt zu. Doch diesmal war es anders als bei der Hinrichtung. Die Fae blieben nicht stumm. Nein. Sie begannen, zu schreien, und riefen den Jägern Drohungen zu.
Lia murmelte einen Namen.
»Althea.«
Ich schaute nicht zu ihr, sondern sah, wie sich diese Althea vom Boden erhob und den Jägern entgegenstellte. Mohnrote Locken flossen in sanften Wellen ihren Rücken hinunter. Sie war groß. Selbst aus der Ferne wusste ich, dass sie etwas größer war als ich. Und ihr Körper war breit und stark. Die Muskeln in ihren Armen spannten sich unter dem braunen Stoff ihres Hemdes an, das Leder ihrer Reithose bauschte sich, als sie sich in Kampfstellung begab, die Knie gebeugt und die Fäuste vor ihrem Gesicht erhoben.
Sie sprach zu den Wachen, doch ich konnte sie nicht verstehen. Sie waren zu weit weg. Aber was auch immer sie sagte, es brachte sie zum Stocken. Dann warfen sie ihre Köpfe zurück und lachten.
Die Fae um mich herum wurden wieder lauter. Einige knurrten, andere zischten. Und ich hörte ihren Namen erneut, diesmal lauter.
»Althea.«
Eine der Wachen wurde von den anderen nach vorn geschubst. Er trat vor Althea und hob seine Fäuste. Dann liefen sie aufeinander zu, wobei Althea ihm in Kraft, Geschwindigkeit und Präzision deutlich voraus war.
Mit so wenig Anmut wie ein neugeborenes Kalb machte der Jäger einen weiten Schritt und wurde in Sekundenschnelle besiegt. Es war unmöglich zu sehen, was geschah, denn mit einem Wimpernschlag lag er auf dem Rücken, während Althea sich auf den nächsten Jäger stürzte.
Sie sprang über ihre Kette und versetzte einem anderen einen Tritt. Ein Schauer durchfuhr mich bei dem Geräusch, das ihr Fuß machte, als er auf den Knochen traf. Jeder Fae hörte das Knacken und jubelte ihr zu. Althea kämpfte nun noch verbissener.
Als sie den dritten Jäger erreichte, lachte niemand mehr. Weitere Jäger rannten aus den Zelten und von den Wagen auf sie zu.
Althea bewegte sich wie ein Blatt im Wind, ihr Körper wich den Fäusten und ausgestreckten Beinen aus. Einer der Jäger zog ein Schwert aus dem Gürtel an seiner Hüfte und stieß es nach vorn. Ich war mir sicher, dass es sie treffen würde, aber sie wirbelte im letzten Moment herum, die Klinge verfehlte sie nur um wenige Zentimeter. Althea tanzte um das ausgestreckte Schwert herum, nahm die schlaffe Kette unter sich und wickelte sie um seinen Hals. Er ließ das Schwert fallen und griff nach ihr, als sie kräftig daran zog. Seine Augen weiteten sich und ein gurgelnder Laut brach aus seiner Kehle, während er versuchte, sich zu befreien.
Aber Althea hatte ihn wie eine Spinne in ihrem Netz gefangen. »Sie ist gekommen, um uns zu retten«, stotterte Kayia neben mir. Sie klammerte sich an mich und zerrte an meinem Arm. »Ich habe es dir gesagt. Ich habe dir gesagt, dass sie kommen werden.«
»Wer ist das?«, fragte ich und sah, wie das Fae-Mädchen die Jäger um sie herum anschrie. Sie hielt den erwürgten Jäger mit dem Rücken an ihre Brust und zog kräftig an der Kette. Sie verhandelte eindeutig mit ihnen, ihre Lippen bewegten sich schnell, während sie sprach. Aber die Jäger reagierten nicht. Stattdessen schlichen sie langsam auf sie zu und begannen, sie einzukreisen.
»Althea Cedarfall.«
Irgendetwas an ihrem Namen kam mir bekannt vor, aber ich konnte es nicht greifen. Ich blickte zurück zu Althea, unsicher, wie sie uns befreien konnte. Sie war kurz davor, selbst wieder gefangen genommen zu werden. Sie knurrte, ihr Gesicht verzerrte sich zu einer Maske aus Wut, das Gesicht des Jägers dagegen lief blau an, weil ihm die Luft ausging.
Doch schon bald wendete sich das Schicksal gegen sie und sie verlor ihren Vorteil. In Sekundenschnelle wurde sie von zahllosen Jägern angegriffen. Einer nach dem anderen kam auf sie zu, bis sie Althea überwältigen konnten. Es brauchte fünf Jäger, um sie unter Kontrolle zu bringen.
Immer mehr Jäger traten auf sie zu, bis sie in einem Meer aus schwarz gekleideten Männern nicht mehr zu sehen war. Nur das Schlagen von Fäusten und Treten von Stiefeln war noch zu hören.
Ich klammerte mich so fest an die Gitterstäbe, dass meine Knöchel weiß wurden. Das Flattern in meiner Brust verstärkte sich noch einmal. Ich schrie und stimmte in die Schreie der anderen Fae mit ein. Niemand blieb mehr still.
»Feiglinge. Lasst sie frei. Lasst sie verdammt noch mal gehen!«, schrie ich zusammen mit denen um mich herum. Sogar Lia schrie und rief Althea, Althea, Althea, als wäre es das einzige Wort, das sie kannte.
Ich war mir sicher, dass der Käfig wackelte, als sich die Körper gegen die Streben warfen. Althea Cedarfall bedeutete den Fae etwas. Sogar sehr viel, denn auch Kayia schrie nun mit ihnen. Sie war nicht kleinzukriegen, denn jetzt stand sie mit der Haltung einer Kriegerin da. So wie alle.
»Bastarde, ihr Bastarde! Ihr wagt es, das Kind von Cedarfall anzurühren.«
»Lasst sie gehen.«
»Mich, nehmt mich! Lass sie gehen!«
Ich konnte einen Schrei nicht von einem anderen unterscheiden. Und sie wurden nicht weniger. Der Himmel war erfüllt von den Schreien unzähliger Fae. Und die Schreie bewirkten etwas, denn die Gruppe der Jäger löste sich auf, und nur zwei blieben übrig, die über einem sehr stillen und sehr ruhigen Körper standen, der in sich selbst zusammengerollt war.
Die Jäger bewegten sich schnell auf unsere Käfige zu und stießen mit ihren Schwertern zwischen die Gitterstäbe, um das Chaos in Schach zu halten. Sie versuchten, mit Gewalt für Ordnung zu sorgen, aber der Aufstand, der von den Fae um mich herum ausging, war durch nichts zu beruhigen.
Es war berauschend.
Ich registrierte den jungen Jäger nicht, der auf unseren Käfig zukam. Doch Kayia beobachtete und wartete. Als er sich dem Käfig näherte, schob sie zwei spindeldürre Arme aus dem Käfig und schlang sie um seinen Nacken. Mit einem kräftigen Ruck zog sie ihn nach vorn und presste sein Gesicht zwischen zwei Gitterstäbe.
»Hilfe!«, war alles, was er zu stammeln vermochte, als ihre Nägel über seine sonnengegerbte Haut fuhren und ihm Fleischfetzen aus dem Gesicht rissen. Weitere Fae kamen zu ihr, jeder versuchte, ihm Schmerzen zuzufügen, so wie Kayia es tat. Eine Wand aus Körpern bildete sich zwischen mir und dem Wächter und drängte mich nach hinten.
Lia kreischte vor Angst und ich griff nach ihr, als der massige Körper eines Fae-Mannes sie fast zertrampelte.
»Ist schon okay«, sagte ich und zog sie in meine Arme. »Ich habe dich.«
»Nein.« Eine Stimme setzte sich über den Lärm hinweg. »Ich habe sie.« Eben noch war Lia in meinen Armen gewesen, im nächsten Moment war sie es nicht mehr. Sie wurde von den behandschuhten Händen eines Jägers von mir gerissen, der den Tumult genutzt und die Käfigtür geöffnet hatte.
Ihr Schrei sorgte augenblicklich für Ruhe. Sogar Kayia stoppte ihren Angriff. In ihren Augen blitzte Erkenntnis auf.
»Nein«, keuchte sie und versuchte, Lia zu erreichen. »Meine Tochter, nein!«
Lia trat um sich, als sie aus dem Käfig gezogen wurde. Ich sprang vor und griff nach ihrem Knöchel, bevor ein anderer Jäger die Tür zuschlagen konnte.
»Lass sie los.« Speichel flog aus meinem Mund, als ich mich in meiner Wut verlor.
»Noch immer so angriffslustig?«, entgegnete der Jäger und ein vertrautes Grinsen umspielte seine dünnen, blassen Lippen. »Hast du deine Lektion beim letzten Mal noch nicht gelernt, Fae-Abschaum?«
Irgendwo hinter mir schrie Kayia, aber ich wagte nicht, mich umzudrehen. Nein. Ich konzentrierte mich auf Lia und darauf, sie nicht loszulassen.
»Du kannst sie nicht haben«, zischte ich mit zusammengebissenem Kiefer.
Lia verzog den Mund zu einem stummen Schrei, Angst und Schmerz verzerrten ihr unschuldiges Kindergesicht. Schmerz, den ich ihr zufügte. Aber ich konnte sie nicht loslassen. Ganz gleich, welche Spuren meine Finger an ihrem kleinen, zarten Knöchel hinterließen. Wenigstens wäre sie noch am Leben. Wenigstens wäre ihr Kopf noch auf ihren Schultern. Wenigstens würde sie nicht auf einem Scheiterhaufen verbrennen.
»Wenn wir sie nicht haben können –« Er lockerte seinen Griff, sodass ich kräftig ziehen konnte. Wie Butter über einer Flamme löste sie sich aus seinem Griff und fiel auf mich. Wir stürzten auf den Boden und die Luft wurde mir aus der Lunge gedrückt. »Dann nehmen wir eben dich. Jemand sollte sie daran erinnern, was passiert, wenn man nicht gehorcht. Und ich denke, du hast es verdient, dieser Jemand zu sein.«
Seine behandschuhten Hände legten sich um meine Arme und rissen mich aus dem Käfig.
Niemand hielt ihn davon ab. Niemand kämpfte um mich. Nicht so, wie ich es für Lia getan hatte.
Niemand rief meinen Namen.
Ich konnte mich nicht wehren, denn die Qualen in meiner Brust waren unerträglich. Das Flattern war jetzt ein Schwarm Vögel, die mit heftigen Flügelschlägen versuchten, sich aus dem Käfig tief in meiner Brust zu befreien. Mein Atem ging stoßweise, als ich über den Boden geschleift wurde. Meine Arme hingen nutzlos an mir herab und wurden durch den Dreck geschleift.
Über mir lächelte der Jäger. Die Sonne brannte hinter seinem Kopf und verdeckte seine Gesichtszüge. »Mach dir keine Sorgen, Junge, sie werden dein Schicksal teilen. Ich verrate dir ein kleines Geheimnis. Wenn wir haben, was wir brauchen, und das nutzlose Pack nicht mehr gebraucht wird, enden sie alle als Futter für die Krähen und Wölfe. Mehr sind sie nicht wert.«
Wir kamen zum Stehen und ich nahm erneut den Geruch von Kupfer wahr. Nur deutlich stärker. Als ich nach unten gedrückt wurde, erkannte ich das Blut der Fae-Frau. Und nun wartete der Baumstumpf auf mich. Tiefe, ungleichmäßige Linien durchzogen seine Oberfläche. Altes und neues Blut bedeckte ihn und färbte ihn in verschiedenen Rottönen.





























